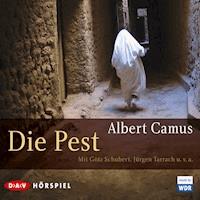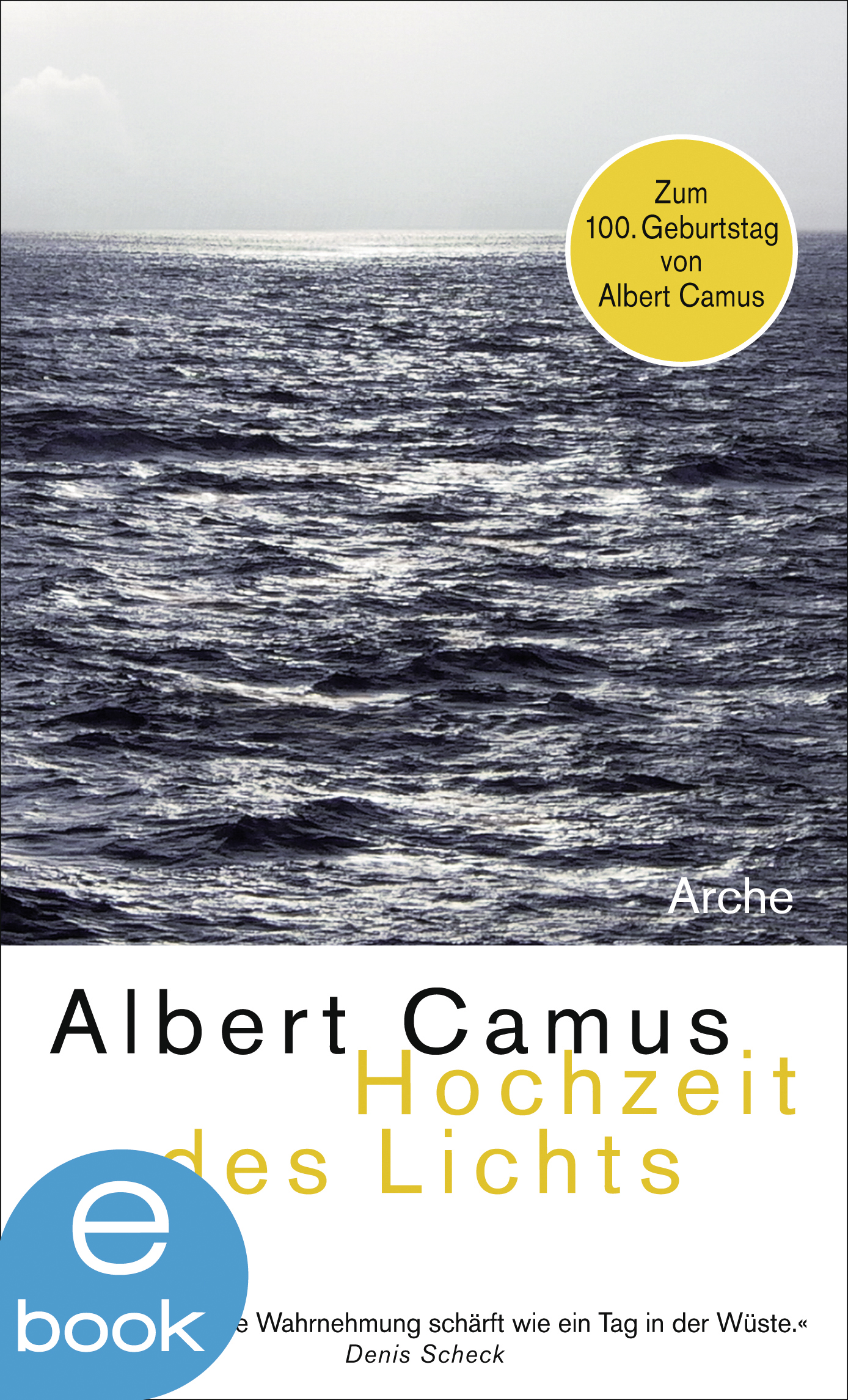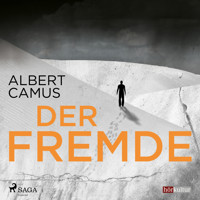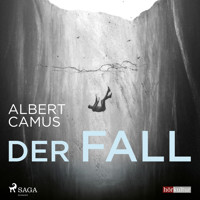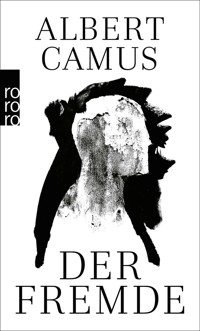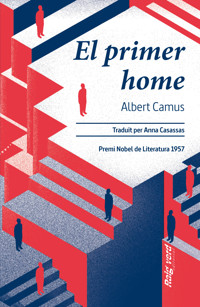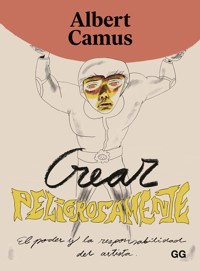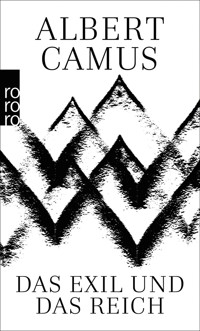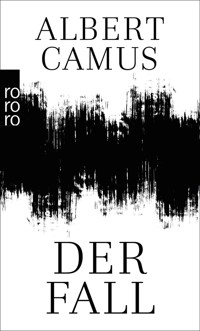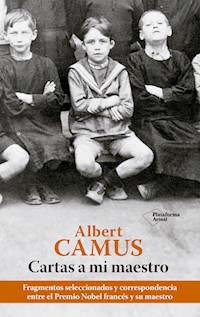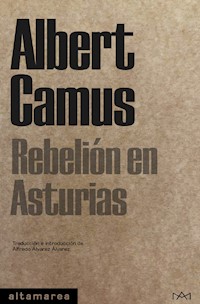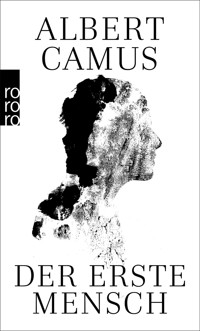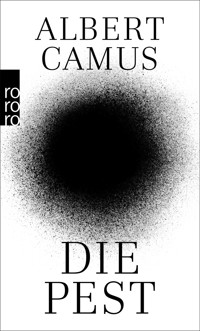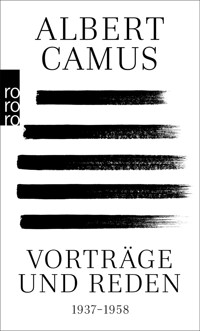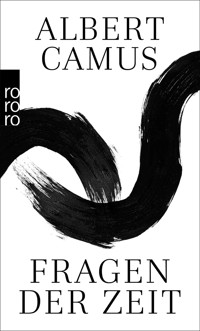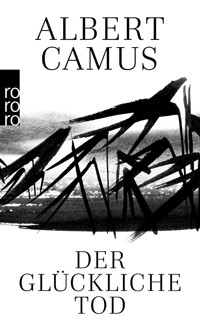
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Und ein Stein zwischen Steinen, ging er in der Freude seines Herzens wieder in die Wahrheit der unbeweglichen Welten ein.» Camus' erster, postum veröffentlichter Roman: In einer beherrschten sinnlichen Prosa beschreibt der Autor die geliebte algerische Landschaft, die mediterrane Sonne, den tiefblauen Himmel, die glühende Erde, die erlösende See, aber auch das Gefühl der Entfremdung und das vertraute Verhältnis zum Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Albert Camus
Der glückliche Tod
Cahiers Albert Camus I
Roman
Übersetzt von Eva Rechel-Mertens und Gertrude Harlass
Über dieses Buch
«Und ein Stein zwischen Steinen, ging er in der Freude seines Herzens wieder in die Wahrheit der unbeweglichen Welten ein.» In einer beherrschten sinnlichen Prosa beschreibt Camus die geliebte algerische Landschaft, die mediterrane Sonne, den tiefblauen Himmel, die glühende Erde, die erlösende See, aber auch das Gefühl der Entfremdung und das vertraute Verhältnis zum Tod.
Vita
Albert Camus, geboren am 7. November 1913 als Sohn einer Spanierin und eines Elsässers in Mondovi (Algerien), studierte von 1933 bis 1936 an der Universität Algier Philosophie. 1934 trat er der Kommunistischen Partei Algeriens bei, brach jedoch drei Jahre später mit der KP. 1940 zog er nach Paris, 1957 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Er starb am 4. Januar 1960 bei einem Autounfall.
Das Gesamtwerk von Albert Camus liegt im Rowohlt Verlag vor.
Weitere Veröffentlichungen:
Der Fall
Die Pest
Der Fremde
Jonas oder Der Künstler bei der Arbeit
Der Mythos des Sisyphos
Der Mensch in der Revolte
Tagebücher 1935–1951
Tagebücher 1951–1959
Reisetagebücher
Unter dem Zeichen der Freiheit
Verteidigung der Freiheit
Der erste Mensch
Mit der Herausgabe der Cahiers Albert Camus folgen Familie und Verlag des Autors dem Wunsch vieler Universitätslehrer und Studenten und all der Leser, die sich für Camus’ Werk und Denken interessieren.
Die Veröffentlichung dieser Werkhefte geschieht nicht ohne Bedenken. Albert Camus war sehr selbstkritisch, er entschloss sich nicht leicht, eine Arbeit zu publizieren. Warum, so könnte man fragen, werden dann jetzt ein von ihm zurückgestellter Roman, Vorträge und Aufsätze, die er nicht in die Sammelbände Actuelles aufgenommen hat, und sogar Arbeitsunterlagen und Rohentwürfe veröffentlicht?
Aus einem einfachen Grund: Wer einen Schriftsteller liebt oder über sein Werk arbeitet, möchte meist alles von ihm kennenlernen. Diejenigen, die die ungedruckten Texte des Autors verwahren, sind der Meinung, es wäre unrecht, diesem Wunsch nicht nachzukommen und all denen, die Wert darauf legen, nicht die Lektüre beispielsweise des Romans Der glückliche Tod oder der Reisetagebücher zu ermöglichen.
Die Wissenschaftler, die für ihre Untersuchungen und Analysen, teils noch zu Lebzeiten Camus’, die wenig bekannten oder noch unveröffentlichten frühen Schriften oder späteren Texte konsultiert haben, sind der Ansicht, dass durch die Lektüre dieser Arbeiten das Bild des Autors nur ausdrucksvoller und reicher werden kann.
Als Herausgeber für die Cahiers Albert Camus zeichnen Jean-Claude Brisville, Roger Grenier, Roger Quilliot und Paul Viallaneix.
Die Cahiers werden sich nicht auf die Veröffentlichung ungedruckter oder gegenwärtig schwer zugänglicher Texte beschränken, sondern auch ein Forum für Arbeiten sein, die geeignet sind, ein neues Licht auf Albert Camus’ Werk zu werfen.
Die Herausgeber
Erster TeilDer natürliche Tod
I
Es war zehn Uhr morgens, und Patrice Mersault ging mit gleichmäßigen Schritten auf Zagreus’ Villa zu. Um diese Zeit war die Wärterin auf dem Markt und niemand im Hause. Es war April, ein schöner funkelnder kalter Frühlingsmorgen mit einem reinen eisigen Himmel, in dem eine große Sonne stand, strahlend, aber ohne Wärme. Zwischen den Pinien an den Hängen in der Nähe der Villa rann ein reines Licht an den Stämmen entlang. Die Straße lag verlassen da. Sie stieg ein wenig an. Mersault trug einen Koffer, und in der Glorie dieser Erdenfrühe ging er dahin, begleitet von dem harten Geräusch seiner Schritte auf der kalten Straße und dem taktmäßig wiederkehrenden Knarren des Koffergriffs.
Kurz vor der Villa mündete die Straße in einen kleinen Platz mit Bänken und Grünanlagen. Frühe rote Geranien zwischen grauer Aloe, das Blau des Himmels, das Weiß der Umfassungsmauern – das alles wirkte so frisch und so jung, dass Mersault einen Moment den Schritt verhielt, bevor er den Weg einschlug, der von dem Platz zu Zagreus’ Villa hinunterführte. Vor der Schwelle des Hauses blieb er stehen und zog seine Handschuhe an. Er öffnete die Tür, die der Krüppel stets unverschlossen hielt, und machte sie ganz natürlich hinter sich wieder zu. Er ging durch den Flur bis zur dritten Tür links, klopfte an und trat ein. Zagreus war selbstverständlich da, er saß, mit einem Plaid über den Stümpfen seiner Beine, in einem Sessel dicht am Kamin, genau an dem Platz, den Mersault zwei Tage zuvor eingenommen hatte. Er las, und das Buch lag auf seiner Decke, während er Mersault, der neben der wieder geschlossenen Tür stehen geblieben war, aus seinen runden Augen ansah, in denen keinerlei Verwunderung lag. Die Fenstervorhänge waren zugezogen, und auf dem Boden, auf den Möbeln und an den Kanten der Gegenstände spielten Sonnenflecke. Hinter den Fensterscheiben strahlte der Morgen auf die vergoldete, kalte Erde herab. Freude, eine große eisige Heiterkeit, schrille, heisere Vogelschreie, die Flut von unbarmherzigem Licht verliehen der Vormittagsstunde einen Anschein von Unschuld und Wahrheit. Mersault war stehen geblieben, an der Kehle und an den Ohren von der erstickenden Hitze in dem Zimmer gepackt. Trotz der veränderten Witterung hatte Zagreus ein mächtiges Feuer entfacht. Und Mersault spürte, wie ihm das Blut in die Schläfen stieg und in den Rändern seiner Ohren pochte. Immer noch schweigend folgte der andere ihm mit dem Blick. Patrice ging zu der Truhe auf der anderen Seite des Kamins und stellte seinen Koffer auf den Tisch. Dort angekommen, verspürte er eine kaum merkliche Schwäche in den Fußgelenken. Er hielt inne und steckte sich eine Zigarette in den Mund, die er wegen seiner behandschuhten Hände ungeschickt anzündete. Hinter ihm ließ sich ein schwaches Geräusch vernehmen. Mit der Zigarette im Mund drehte er sich um. Zagreus schaute ihn noch immer an, hatte jedoch sein Buch zugeklappt. Während Mersault die Hitze fast schmerzhaft an seine Knie dringen fühlte, las er verkehrt herum den Titel: Kunst der Weltklugheit von Baltasar Graciàn. Ohne zu zögern, beugte er sich zu der Truhe hinunter und hob den Deckel hoch. Schwarz auf weiß glänzte dort der Revolver an allen seinen Rundungen wie eine gepflegte Katze. Er lag noch immer auf Zagreus’ Brief. Mersault nahm diesen in die linke Hand und den Revolver in die rechte. Nach kurzem Zaudern schob er die Waffe unter seinen linken Arm und öffnete das Kuvert. Es enthielt ein einziges großformatiges Blatt Papier, das mit einigen wenigen Zeilen in Zagreus’ großer, eckiger Schrift bedeckt war:
«Ich lösche nur einen halben Menschen aus. Man halte mir das zugute. In meiner kleinen Truhe wird man weit mehr finden, als nötig ist, um diejenigen schadlos zu halten, die mir bislang gedient haben. Was das Übrige betrifft, so habe ich den Wunsch, dass es für die Verbesserung des Loses der zum Tode Verurteilten verwendet wird. Doch bin ich mir bewusst, dass das viel verlangt ist.»
Mit unbewegtem Gesicht faltete Mersault den Brief wieder zusammen, und in diesem Augenblick reizte der Rauch seiner Zigarette seine Augen, während etwas Asche auf den Umschlag fiel. Er schüttelte das Papier, legte es deutlich sichtbar auf den Tisch und wendete sich Zagreus zu. Dieser schaute jetzt auf den Briefumschlag, und seine kurzen kräftigen Hände hielten weiter das Buch umschlossen. Mersault bückte sich, drehte den Schlüssel der Kassette, entnahm ihr die Bündel, von denen man durch die Umhüllung aus Zeitungspapier nur den Schnitt erkennen konnte. Seine Waffe unter dem Arm, füllte er mit der einen Hand in aller Ruhe seinen Koffer. Es waren weniger als zwanzig Bündel zu hundert Scheinen vorhanden, und Mersault stellte fest, dass er einen zu großen Koffer mitgenommen hatte. Ein Bündel von hundert Scheinen ließ er in der Kassette. Nachdem er den Koffer geschlossen hatte, warf er seine halb aufgerauchte Zigarette ins Kaminfeuer, nahm den Revolver in die rechte Hand und näherte sich dem Krüppel.
Zagreus sah jetzt zum Fenster hinaus. Man hörte ein Auto mit einem mahlenden Geräusch langsam an der Haustür vorüberfahren. Regungslos schien Zagreus die ganze unmenschliche Schönheit dieses Aprilmorgens in sich aufzunehmen. Als er den Revolverlauf an seiner rechten Schläfe fühlte, wendete er nicht einmal den Blick. Doch Patrice, der ihn anschaute, sah, dass seine Augen sich mit Tränen füllten. Er selbst schloss darauf die seinen. Er trat einen Schritt zurück und schoss. Einen Moment lang lehnte er sich mit immer noch geschlossenen Lidern an die Wand, er fühlte wieder das Blut in seinen Ohren rauschen. Dann schaute er hin. Der Kopf war auf die rechte Schulter gesunken, der Körper hatte kaum seine Stellung verändert, sodass man nicht mehr Zagreus sah, sondern nur eine riesige Wunde in einem Gewirr von Hirn, Knochen und Blut. Mersault begann zu zittern. Er ging auf die andere Seite des Sessels, tastete nach Zagreus’ rechter Hand, schloss sie fest um den Revolver, hob sie bis zur Höhe der Schläfe und ließ sie wieder sinken. Der Revolver fiel auf die Lehne des Sessels und von da auf Zagreus’ Knie. Bei dieser Bewegung sah Mersault Mund und Kinn des Krüppels. Er zeigte noch den gleichen ernsten, traurigen Ausdruck wie zuvor, als er aus dem Fenster geblickt hatte. In diesem Moment ertönte ein schriller Trompetenstoß vor der Tür. Ein zweites Mal erklang das unwirkliche Signal. Mersault stand noch immer über den Sessel gebeugt, ohne sich zu rühren. Wagenrollen kündete die Weiterfahrt des Metzgers an. Mersault ergriff seinen Koffer, öffnete die Tür, deren Klinke unter einem Sonnenstrahl blitzte, und verließ mit einem Pochen in den Schläfen und trockener Zunge den Raum. Er schritt durch die Haustür und enteilte mit großen Schritten. Niemand war zu sehen außer einer Gruppe von Kindern am anderen Ende des kleinen Platzes. Er entfernte sich. Auf dem Platz angekommen, wurde er sich plötzlich der Kälte bewusst und fröstelte unter seinem leichten Rock. Zweimal musste er niesen, und das Tal warf ein helles, höhnisches Echo zurück, das die kristallklare Luft höher und höher trug. Wiewohl etwas schwankend, blieb er stehen und atmete kräftig durch. Von dem blauen Himmel senkten sich Millionen kleiner lächelnder Lichter herab. Sie spielten auf den noch regennassen Blättern, auf dem feuchten Tuff der Alleen, flatterten zu den Häusern mit den Dachziegeln von der Farbe frisch vergossenen Blutes hinüber und schwangen sich wieder zu den Reservoirs von Luft und Sonne empor, aus denen sie kurz zuvor sich ergossen hatten. Ein sanftes Surren kam von einem winzigen Flugzeug, das dort oben schwebte. Bei diesem Überschwang der Luft und dieser Fülle des Himmels schien den Menschen einzig die Aufgabe zugedacht, zu leben und glücklich zu sein. In Mersault wurde alles still. Ein drittes Niesen schüttelte ihn, und er verspürte etwas wie einen Fieberschauer. Er eilte davon, ohne um sich zu blicken, begleitet nur von dem Knarren des Koffergriffs und dem Geräusch seiner Schritte. Zu Hause angekommen, legte er sich hin und schlief bis tief in den Nachmittag hinein.
II
Der Sommer füllte den Hafen mit Stimmenlärm und Sonne. Es war halb zwölf Uhr vormittags. Der Tag strömte sein Innerstes aus, um die Quais mit dem ganzen Gewicht seiner Hitze zu erdrücken. Vor den Lagerschuppen der Handelskammer von Algier nahmen ‹Schiaffinos› mit schwarzem Rumpf und rotem Schornstein Kornsäcke an Bord. Ihr feiner Staubduft vermischte sich mit den kompakten Teergerüchen, die eine heiße Sonne zur Entfaltung brachte. Vor einer kleinen Baracke, wo es nach Firnis und Anisette roch, saßen Männer und tranken, während arabische Akrobaten in roten Trikots vor dem sonnenblitzenden Meer auf den glühend heißen Steinplatten ihre Körper verrenkten. Ohne sie zu beachten, betraten die Säcke schleppenden Hafenarbeiter die beiden schwingenden Planken, die vom Quai auf das Deck der Frachtdampfer führten. Oben angekommen, hoben sie sich plötzlich vor dem Himmel über der Bucht, zwischen Winden und Masten, silhouettenhaft ab. Mit nach oben gewendetem Blick blieben sie eine Sekunde lang geblendet stehen, wobei ihre Augen in den mit einer weißlichen Schicht aus Schweiß und Staub überzogenen Gesichtern funkelten, bevor sie sich blindlings in den Laderaum stürzten, aus dem ein Geruch wie von warmem Blut aufstieg. In der glühenden Luft heulte beständig eine Sirene.
Auf der Planke machten die Männer plötzlich entgegen der Ordnung Halt. Einer von ihnen war zwischen die Bohlen gefallen, die nahe genug beieinanderlagen, um ihn festzuhalten. Doch sein Arm war hinter ihm eingeklemmt, zerquetscht durch das ungeheure Gewicht des Sackes, und er schrie vor Schmerz. In diesem Augenblick trat Patrice Mersault aus seinem Büro. Schon auf der Schwelle verschlug ihm die Sommerhitze den Atem. Er sog mit weit offenem Mund den Teergeruch ein, der ihn in der Kehle kratzte, und blieb bei den Hafenarbeitern stehen. Sie hatten den Verletzten befreit. Auf den Planken mitten im Staub hingestreckt, die Lippen bleich vor Schmerz, ließ er seinen gebrochenen Arm vom Ellbogen ab herunterhängen. Ein Knochensplitter war durch das Fleisch gedrungen, sodass eine hässliche Wunde entstand, aus der das Blut sickerte. Die Tropfen liefen am Arm entlang und fielen dann, einer nach dem andern, mit einem leichten Zischen auf die glühenden Steine, wo sie verdampften. Mersault starrte regungslos auf dieses Blut, als jemand seinen Arm ergriff. Es war Emmanuel, der ‹Kleine für die Botengänge›. Er wies auf einen Lastwagen, der mit lautem Kettengerassel und Geknatter auf sie zukam. «Wollen wir?» Patrice begann zu laufen. Der Lastwagen fuhr an ihnen vorbei. Und sogleich rannten sie ihm nach, verschlungen von Lärm und Staub, keuchend und blind, gerade noch klar genug, um zu fühlen, wie sie durch diese wilde Lauferei hineingerissen wurden in einen betäubenden Rhythmus von Trossen und Maschinen, begleitet vom Tanz der Masten am Horizont und dem Schlingern der leprösen Schiffsrümpfe, an denen sie vorüberjagten. Auf seine Kraft und Gelenkigkeit vertrauend, packte Mersault als Erster zu und schwang sich hinauf. Er half Emmanuel, bis auch er mit herunterhängenden Beinen auf dem Wagen saß, und in dem weißen, kreidigen Staub, dem gleißenden Dunst, der sich vom Himmel herabsenkte, der Sonne, der ungeheuren, phantastischen Dekoration des von Masten und schwarzen Kränen überquellenden Hafens brauste der Wagen in vollem Tempo dahin, über das holperige Pflaster des Quais, sodass Emmanuel und Mersault hin und her geschleudert wurden und in einem Taumel der Erregung lachten, bis ihnen die Luft ausging.
In Belcourt angekommen, sprang Mersault zusammen mit dem singenden Emmanuel ab. Er sang laut und falsch. «Du musst verstehen», sagte er immer zu Mersault, «es drängt einfach aus der Brust herauf. Wenn ich vergnügt bin. Wenn ich bade.» Das stimmte. Emmanuel sang, wenn er schwamm, und seine durch den Druck von außen her rau gewordene und auf dem Meer kaum hörbare Stimme bestimmte dann den Takt der Bewegungen seiner kurzen muskulösen Arme. Sie bogen in die Rue de Lyon ein. Mersault schritt kräftig aus, er war sehr groß und wiegte seine breiten sehnigen Schultern. An der Art, wie er den Fuß auf den Gehsteig setzte, den er entlangzuschreiten gedachte, wie er mit einer gleitenden Hüftbewegung der Menge auswich, die ihn zuweilen umgab, spürte man, dass sein Körper überraschend jung und kraftvoll und durchaus imstande war, seinen Besitzer bis an die äußersten Grenzen physischer Lust zu tragen. Wenn er sich nicht bewegte, ließ er ihn auf der einen Hüfte ruhen, mit einer leicht affektierten Geschmeidigkeit wie jemand, der durch Sport den richtigen Stil gelernt hat. Seine Augen blitzten unter den Bögen der etwas starken Brauen, und während er mit Emmanuel sprach, zog er unter einer zuckenden Bewegung seiner geschwungenen lebhaften Lippen an seinem Kragen, um seinen Hals freizumachen. Sie traten in ihr Restaurant. Sie setzten sich und nahmen schweigend ihre Mahlzeit ein. Im Schatten war es kühl. Man hörte Fliegen summen, Teller klirren und Gespräche. Der Wirt, Céleste, kam auf sie zu. Groß und mit einem Schnurrbart geschmückt, kratzte er sich den Bauch unter seiner Schürze, die er dann wieder fallen ließ. «Es geht», sagte Emmanuel. «Wie es alten Leuten so geht.» Sie redeten. Céleste und Emmanuel tauschten Anreden wie «Na, Kamerad!» und Schulterklopfen aus. «Die Alten, weißt du», meinte Céleste, «sind ja blöd im Kopf. Sie sagen, ein richtiger Mann ist einer von fünfzig Jahren. Das sagen sie aber nur, weil sie selber in den Fünfzigern sind. Ich habe da einen Kumpel gehabt, der nur mit seinem Sohn glücklich war. Sie gingen zusammen aus. Sie trieben es ziemlich bunt. Sie gingen ins Casino, und mein Kumpel sagte: ‹Warum soll ich mich mit all den Alten abgeben? Sie erzählen mir täglich, dass sie Abführmittel genommen haben, dass sie ihre Leber spüren. Da ist es besser, ich gehe mit meinem Jungen aus. Manchmal schnappt er sich eine kleine Hure, ich tue dann, als sehe ich nichts, und steige in die Tram. Auf Wiedersehen und danke. Ich bin sehr zufrieden.›» Emmanuel lachte. «Natürlich», erklärte Céleste, «wusste der auch nicht alles besser, aber ich mochte ihn gern.» Zu Mersault gewendet fuhr er fort: «Und außerdem ist mir so einer lieber als ein anderer Kumpel, den ich hatte. Als der es zu was gebracht hatte, winkte er mich nur noch mit dem Kopf heran oder gab mir kleine Zeichen. Inzwischen ist er nicht mehr so stolz, er hat alles verloren.»
«Geschieht ihm recht», meinte Mersault.
«Oh, man soll sich nicht kleinkriegen lassen im Leben. Er hat sich eine gute Zeit gemacht, und warum auch nicht. Neunhunderttausend Francs hat er gehabt … Ah, wenn ich das gewesen wäre!»
«Was würdest du tun?», fragte Emmanuel.
«Ich würde mir eine kleine Hütte kaufen, mir ein bisschen Vogelleim auf den Nabel schmieren und eine Fahne draufsetzen. Und dann würde ich warten und sehen, von welcher Seite der Wind kommt.»
Mersault verzehrte in Ruhe sein Mahl, bis Emmanuel auf den Gedanken kam, dem Wirt seine berühmte Geschichte von der Marneschlacht vorzusetzen.
«Uns, die Zuaven, haben sie als Tirailleurs eingesetzt …»
«Du ödest uns an», erklärte Mersault ruhig.
«Der Kommandeur befahl: ‹Angriff!› Und wir alle hinunter, es war da so eine mit Bäumen bestandene Schlucht. Er hatte uns gesagt, wir sollten angreifen, aber vor uns war kein Mensch. Wir sind also marschiert und immer weiter vorgegangen. Dann aber gab es auf einmal Maschinengewehrfeuer. Sie schossen mitten in uns hinein. Alles purzelte nur so übereinander. Es gab so viele Verwundete und Tote, und auf dem Grund der Schlucht war so viel Blut, dass man in einem Kanu hätte hinüberfahren können. Da waren welche, die schrien: ‹Mama!› Es war fürchterlich.»
Mersault stand auf und knüllte seine Serviette zusammen. Der Wirt ging und notierte sein Mittagessen mit Kreide hinten auf der Küchentür. Das war sein Rechnungsbuch. Wenn einer protestierte, hob er die Tür aus den Angeln und schleppte die Rechnung auf seinem Rücken herbei. In einer Ecke saß René, der Sohn des Wirtes, und aß ein weiches Ei. «Der Arme», sagte Emmanuel, «er geht an der Schwindsucht zugrunde.» Das stimmte. René war gewöhnlich still und ernst. Er war nicht allzu sehr abgemagert, doch seine Augen glänzten. Gerade war ein Gast dabei, ihm zu erklären, Tuberkulose sei heilbar, «wenn man abwartet und vorsichtig lebt». Er nickte und antwortete ernst zwischen zwei Bissen. Mersault stützte sich neben ihm mit den Ellbogen auf den Schanktisch, um noch einen Kaffee zu trinken. Der andere redete weiter: «Du hast wohl nicht Jean Pérez gekannt? Den von der Gasanstalt? Der ist gestorben. Er hatte eine kranke Lunge. Aber er wollte fort aus dem Spital und wieder nach Hause. Und da war seine Frau. Und seine Frau ist ein Pferd. Seine Krankheit hatte ihn so gemacht. Du verstehst schon, ständig war er auf seiner Frau. Sie wollte gar nicht. Er aber trieb es ganz schrecklich damit. Na ja, und zwei-, dreimal täglich, das bringt einen kranken Mann ja schließlich um.» René hatte zu essen aufgehört und starrte, noch ein Stück Brot zwischen den Zähnen, den anderen an. «Ja», meinte er schließlich, «die Krankheit kommt schnell, doch mit dem Gehen nimmt sie sich Zeit.» Mersault malte mit dem Finger seinen Namen auf die beschlagene Kaffeemaschine. Er blinzelte mit den Augen. Zwischen diesem friedlichen Lungenkranken und dem von Liedern überquellenden Emmanuel pendelte sein Dasein Tag für Tag im Geruch von Kaffee und von Teer hin und her, von ihm selbst und allem, was für ihn sinnvoll war, losgelöst, seinem Herzen und seiner Wahrheit entfremdet. Die gleichen Dinge, die ihn unter anderen Umständen leidenschaftlich bewegt haben würden, erzeugten bei ihm jetzt, da er sie selber erlebte, nur Schweigen, bis zu dem Augenblick, da er wieder in seinem Zimmer angelangt war und alle Kraft und Vorsicht darauf verwendete, die in ihm brennende Flamme des Lebens zum Verlöschen zu bringen.
«Sag mal, Mersault, du bist doch ein gebildeter Mann», sagte der Wirt.
«Ja, schon gut», sagte Patrice. «Ein andermal.»
«Du hast aber eine Saulaune heute Morgen.»
Mersault lächelte. Er verließ das Restaurant, überquerte die Straße und stieg die Treppe zu seinem Zimmer hinauf. Es lag über einer Rossschlächterei. Wenn er sich über das Balkongitter beugte, verspürte er den Geruch von Blut und konnte das Ladenschild lesen: ‹Zur edelsten Eroberung des Menschen›. Er legte sich auf sein Bett, rauchte noch eine Zigarette und schlief ein.
Er bewohnte das Zimmer, in dem seine Mutter gelebt hatte. Sie hatten lange in dieser kleinen Drei-Zimmer-Wohnung gehaust. Als er allein war, hatte Mersault zwei Zimmer an einen befreundeten Fassbinder vermietet, der mit seiner Schwester zusammenlebte, und das beste für sich selbst behalten. Seine Mutter war mit 56 Jahren gestorben. Da sie schön war, hatte sie gemeint, kokett auftreten, gut leben und brillieren zu können. Gegen die vierzig bekam sie eine furchtbare Krankheit. Sie musste auf Kleider und Schminke verzichten, Spitalkittel tragen, hatte ein durch grauenhafte Beulen verunstaltetes Gesicht und war wegen ihrer geschwollenen kraftlosen Beine fast zur Unbeweglichkeit verdammt. Schließlich wurde sie auch noch halb blind und tastete verzweifelt in einem farblosen Raum umher, den sie völlig verkommen ließ. Der Schlag war kurz und heftig. Es war eine nicht beachtete Zuckerkrankheit, die sie durch ihre unbedachte Lebensweise gefördert und verschlimmert hatte. Er hatte seine Studien aufgeben und Arbeit suchen müssen. Bis zum Tod seiner Mutter hatte er immer noch gelesen und nachgedacht. Und zehn Jahre lang ertrug die Kranke dieses Leben. Das Martyrium hatte so lange gedauert, dass man sich in ihrer Umgebung an ihre Krankheit gewöhnt hatte und vergaß, dass sie bei einer ernstlichen Verschlimmerung ihr erliegen könnte. Eines Tages starb sie. In der Nachbarschaft bemitleidete man Mersault. Man versprach sich viel von der Beerdigung im Gedanken an das tiefe Gefühl das Sohnes für seine Mutter. Man beschwor die entfernten Verwandten, nicht zu weinen, damit Patrice seinen Schmerz nicht noch stärker empfand. Man bat sie inständig, sich seiner anzunehmen und sich ihm zu widmen. Er indessen kleidete sich, so gut er nur irgend konnte, und schaute mit dem Hut in der Hand den Vorbereitungen zu. Er folgte dem Sarg, nahm an der kirchlichen Handlung teil, warf seine Handvoll Erde in das Grab und drückte alle Hände. Nur einmal äußerte er seine Verwunderung und Unzufriedenheit darüber, dass es so wenig Wagen für die Geladenen gab. Das war alles. Am nächsten Tage konnte man an einem der Fenster der Wohnung ein Schild sehen: ‹Zu vermieten.› Jetzt bewohnte er das Zimmer seiner Mutter. Früher hatte das ärmliche Leben zusammen mit seiner Mutter etwas Tröstliches gehabt. Wenn sie sich am Abend zusammenfanden und beim Licht der Petroleumlampe schweigend aßen, wohnte dieser Einfachheit und Zurückgezogenheit etwas inne, das wie ein heimliches Glück war. In ihrem Viertel ging es ruhig zu. Mersault betrachtete den schlaffen Mund seiner Mutter und lächelte. Sie lächelte ebenfalls. Er fing wieder zu essen an. Die Lampe blakte ein wenig. Mit der immer gleichen Bewegung schraubte seine Mutter den Docht herunter, sie streckte nur den rechten Arm aus und blieb zurückgelehnt sitzen. «Du hast offenbar keinen Hunger mehr», meinte sie etwas später. «Nein.» Er rauchte oder las. Im ersteren Fall pflegte seine Mutter zu sagen: «Schon wieder!» Im zweiten: «Rück doch näher an die Lampe heran, du verdirbst dir noch die Augen.» Jetzt dagegen empfand er das ärmliche Leben in der Einsamkeit als ein schreckliches Elend. Und wenn Mersault voll Trauer an die Entschwundene dachte, wendete er sein Mitleid in Wirklichkeit an sich selbst. Er hätte behaglicher wohnen können, aber er hing an dieser Behausung und ihrem Armeleutegeruch. Hier wenigstens spürte er noch einen Zusammenhang mit dem, was er gewesen war, und in einem Leben, dem er gern zu entrinnen suchte, erlaubte ihm diese trübselige, geduldig geübte Gegenüberstellung, sich in den Stunden der Traurigkeit und der Wehmut wieder auf sich selbst zu besinnen. Er hatte an der Tür ein am Rande zerschlissenes Stückchen graue Pappe hängen lassen, auf das seine Mutter mit Blaustift ihren Namen geschrieben hatte. Er hatte auch das alte Messingbett mit der Decke aus Baumwollsatin und das Porträt seines Großvaters mit seinem kleinen Bärtchen und seinen unbeweglichen hellen Augen behalten. Auf dem Kamin umgaben Schäfer und Schäferinnen eine alte Stutzuhr, die nicht mehr ging, und eine Petroleumlampe, die er fast nie anzündete. Die schäbige Einrichtung, die etwas eingesessenen Rohrstühle, der Schrank mit der gelb gewordenen Spiegeltür und der Waschtisch, an dem die eine Ecke fehlte, existierte für ihn nicht, denn die Gewohnheit hatte alles nivelliert. Er bewegte sich in einer schattenhaften Umgebung, die nicht die geringste Bemühung von ihm verlangte. In einem anderen Zimmer hätte er sich an Neues gewöhnen und damit erst wieder kämpfen müssen. Er hatte das Bedürfnis, die Angriffsfläche, die er der Umwelt bot, möglichst klein zu halten und zu schlafen, bis alles vollendet sein würde. Bei dieser Absicht war das Zimmer eine Hilfe für ihn. Es ging einerseits auf die Straße, andererseits auf eine Terrasse, auf der immer Wäsche hing. Und hinter der Terrasse sah man kleine, von hohen Mauern umschlossene Gärten mit Orangenbäumen. Zuweilen, in Sommernächten, machte er im Zimmer kein Licht und öffnete das Fenster, das auf die Terrasse und die dunklen Gärten ging. Von dem einen Dunkel zum andern stieg der sehr starke Orangenduft auf und umhüllte ihn mit seinem leichten Gewoge. Die ganze Sommernacht hindurch waren dann sein Zimmer und er selbst von diesem zugleich durchdringenden und schweren Duft erfüllt, und es war ihm, als öffne er nach langen Tagen des Gestorbenseins zum ersten Mal sein Fenster auf das Leben.
Er erwachte mit einem Mund, der noch von Schlaf erfüllt war, und schweißbedeckt. Es war sehr spät. Er kämmte sich, lief eilig hinunter und sprang in eine Tram. Um zwei Uhr fünf war er in seinem Büro. Er arbeitete in einem großen Raum, dessen vier Wände mit 414 Fächern bedeckt waren, in denen sich Akten häuften. Das Zimmer war weder schmutzig noch schäbig, machte aber zu jeder Tagesstunde den Eindruck einer Urnenhalle, in der die toten Stunden verwesten. Mersault überprüfte Seefrachtbriefe, übersetzte die Proviantlisten englischer Schiffe und empfing von drei bis vier Uhr Kunden, die Stückgut versenden wollten. Er hatte sich um diese Arbeit bemüht, obwohl sie eigentlich nicht zu ihm passte. Doch anfangs hatte er darin etwas wie einen Zugang zum Leben gesehen. Hier gab es lebendige Gesichter, Kunden, Abwechslung und einen frischen Luftzug, in dem er endlich sein Herz schlagen fühlte. Auf diese Weise entrann er den Gesichtern der drei Stenotypistinnen und dem Bürochef, Monsieur Langlois. Die eine der Stenotypistinnen war ganz hübsch und seit kurzem verheiratet. Die andere lebte bei ihrer Mutter, und die dritte war eine energische, würdevolle alte Dame, deren blumenreiche Sprache und deren Zurückhaltung in Bezug auf «ihre Schicksalsschläge», wie Langlois es nannte, Mersault schätzte. Langlois hatte zuweilen mit ihr scharfe Auseinandersetzungen, bei denen jedoch stets die alte Madame Herbillon die Oberhand behielt. Sie verachtete Langlois, weil seine verschwitzte Hose ihm am Hinterteil klebte und wegen der Panik, die ihn in Gegenwart des Direktors und manchmal auch am Telefon befiel, wenn er den Namen eines Advokaten oder eines großen Tiers mit Adelsprädikat hörte. Der Unglückliche bemühte sich vergebens, die alte Dame milder zu stimmen oder sogar für sich einzunehmen. An diesem Abend tänzelte er im Büro umher. «Nicht wahr, Madame Herbillon, Sie finden mich doch sympathisch?» Mersault übersetzte gerade vegetables, vegetables, und hob den Blick zu der Glühbirne empor, die mit ihrem Schirm aus gefalteter grüner Pappe über seinem Kopf hing. Vor sich hatte er einen grellfarbigen Kalender, auf dem die Dankprozession der Neufundlandfahrer abgebildet war. Schwämmchen, Schreibunterlage, Tintenfass und Lineal befanden sich wohlausgerichtet auf seinem Tisch. Seine Fenster gingen auf riesige Holzstapel, die auf gelb-weißen Frachtdampfern aus Norwegen hergeschafft worden waren. Er horchte. Hinter der Mauer atmete das Leben auf dem Meer und im Hafen in kräftigen dumpfen und tiefen Zügen. So nahe und doch für ihn so fern … Das Sechs-Uhr-Schlagen befreite ihn. Es war ein Samstag.
Zu Hause angekommen, legte er sich hin und schlief bis zum Abendessen. Er briet sich Eier, die er gleich aus der Pfanne aß (ohne Brot, da er vergessen hatte, welches zu kaufen), dann legte er sich hin und schlief bis zum nächsten Vormittag. Er wachte erst kurz vor Mittag auf, machte seine Morgentoilette und ging hinunter zum Essen. Wieder zurückgekehrt, löste er zwei Kreuzworträtsel, schnitt sorgfältig eine Reklame für Kruschensalz aus und klebte sie in ein Heft, das schon mit vielen munteren Opas angefüllt war, die Treppengeländer hinunterrutschten. Darauf wusch er sich die Hände und trat auf den Balkon. Es war ein schöner Nachmittag. Das Pflaster glänzte, wenige und noch eilige Leute waren unterwegs. Er folgte jedem Einzelnen aufmerksam mit dem Blick und ließ erst von ihm ab, wenn er außer Sehweite war. Dann nahm er einen neuen Passanten aufs Korn. Zuerst kamen Familien, die einen Spaziergang machten, zwei kleine Jungen in Matrosenanzügen mit knielangen Hosen, eingezwängt in ihre steifen Kleidungsstücke, und ein kleines Mädchen mit einer großen rosa Schleife und schwarzen Lackschuhen. Hinter ihnen eine Mutter in braunem Seidenkleid, gleich einem von einer Boa umringelten unförmigen Tier, und ein sehr viel besser aussehender Vater mit einem Spazierstock in der Hand. Etwas später kamen die jungen Leute aus dem Viertel vorbei, mit pomadisiertem Haar und roter Krawatte, stark taillierter Jacke mit einem gestickten Ziertaschentuch und vorn breiten Schuhen. Sie strebten zu den Kinos im Zentrum und beeilten sich laut lachend, um noch die Trambahn zu erwischen. Hinter ihnen leerte sich die Straße allmählich. Die Vorstellungen hatten angefangen. Jetzt gehörte das Viertel den kleinen Ladenbesitzern und den Katzen. Wiewohl noch immer rein, lag der Himmel doch glanzlos über den Feigenbäumen, die die Straße säumten. Gegenüber von Mersaults Fenster stellte der Tabakhändler einen Stuhl vor seine Tür und setzte sich rittlings darauf, beide Arme auf die Lehne stützend. Die Straßenbahnen, eben noch überfüllt, waren jetzt fast leer. In dem kleinen Café Chez Pierrot kehrte der Kellner in dem verödeten Gastraum das Sägemehl zusammen. Mersault drehte ebenfalls seinen Stuhl, stellte ihn so hin wie der Tabakhändler und rauchte hintereinander zwei Zigaretten. Er kehrte in sein Zimmer zurück, brach ein Stück Schokolade ab und nahm kauend wieder seinen Platz am Fenster ein. Kurz darauf verdunkelte sich der Himmel, wurde aber gleich wieder klar. Dennoch hatten die vorüberziehenden Wolken auf der Straße etwas wie eine Verheißung von Regen zurückgelassen, sodass sie noch dunkler wirkte. Um fünf Uhr kamen Trambahnen angerattert, die von den Fußballstadien am Stadtrand Trauben von Zuschauern zurückbrachten, die auf den Trittbrettern und an den Handgriffen hingen. Die nächsten Wagen brachten die Spieler zurück, die an ihren kleinen Reisetaschen zu erkennen waren. Sie brüllten und verkündeten, aus vollem Halse grölend, dass ihr Club nie untergehen werde. Mehrere machten Mersault ein Zeichen. Einer rief: «Die haben wir drangekriegt!» – «Ja», sagte Mersault nur und nickte mit dem Kopf. Allmählich tauchten mehr Autos auf. Bei manchen waren die Kotflügel und die Stoßstangen mit Blumen geschmückt. Dann änderte sich abermals das Tageslicht. Über den Dächern bekam der Himmel einen rötlichen Schein. Mit Beginn des Abends belebten die Straßen sich wieder. Die Spaziergänger kehrten zurück. Die Kinder waren müde, weinten oder ließen sich ziehen. In diesem Augenblick ergoss sich aus den Kinos des Viertels ein Strom von Zuschauern auf die Straße. Mersault las aus den entschiedenen und wichtigtuerischen Gesten der jungen Leute, die herauskamen, den unbewussten Kommentar zu dem Abenteuerfilm, den sie gesehen hatten. Die Besucher der Stadtkinos kehrten etwas später zurück. Sie wirkten gesetzter. Zwischen Gelächter und derben Späßen trat in ihrem Gesichtsausdruck und in ihrer Haltung etwas von der Sehnsucht nach einem Leben in dem glanzvollen Stil zutage, das der Film ihnen vor Augen geführt hatte. Auf und ab gehend bevölkerten sie auch weiterhin die Straße. Auf dem Bürgersteig gegenüber von Mersaults Fenster bildeten sich schließlich zwei Ströme. Die jungen Mädchen des Viertels, ohne Hut, kamen Arm in Arm einher und bildeten den einen. Die jungen Burschen, aus denen der andere bestand, riefen ihnen scherzhafte Bemerkungen zu, über die sie lachten, während sie gleichzeitig die Köpfe abwendeten. Die gesetzteren Leute gingen in die Cafés oder bildeten auf dem Bürgersteig Gruppen, die wie Inseln von der wogenden Flut der Passanten umbrandet wurden. Die Straße war jetzt beleuchtet, und die elektrischen Lampen ließen die ersten Sterne verblassen, die sich am nächtlichen Himmel zeigten. Unterhalb von Mersault breiteten sich die Gehwege mit ihrer Ladung von Menschen und Lichtern aus. Die Lampen spiegelten sich