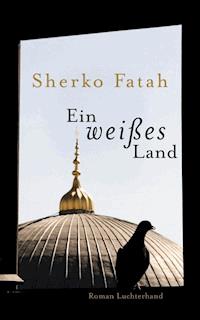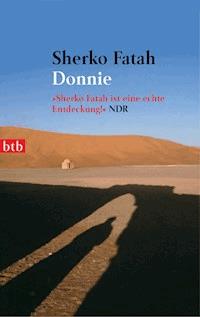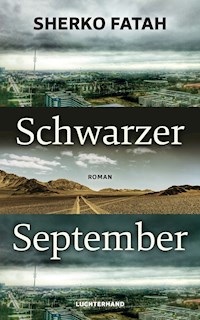18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2023
Was tun, wenn die eigene Tochter nach Syrien reist, um einen Glaubenskrieger zu heiraten? – »Einer der politisch hellsichtigsten deutschen Schriftsteller.« DIE ZEIT
Feinfühlig und scharfsinnig erzählt Sherko Fatah eine erschütternde Vater-Tochter-Geschichte vor dem Hintergrund der Konflikte im Nahen Osten, die auch das heutige Westeuropa längst erreicht haben.
Eine Tochter verschwindet. Sie ist aufgebrochen, um sich in Syrien mit einem Glaubenskrieger zu verheiraten, den sie im Internet kennengelernt hat. Zurück bleibt ein Vater, der sich Vorwürfe macht. Hätte Murad seiner Tochter Naima nur mehr von seinem Herkunftsland erzählt, von dem er sich hier in Deutschland endlich gelöst hat. Hätte er ihren Fremdheitsgefühlen nur mehr Beachtung geschenkt. Vielleicht wäre sie dann nicht im Namen der Religion in eine Welt heimgekehrt, die ihr vollkommen unvertraut ist. Murad sieht nur eine Lösung: Er muss Naima finden. Und so nimmt er Kontakt zu Schleusern auf, reist in das Kurdengebiet an der türkisch-syrischen Grenze und stellt sich dabei auch seiner eigenen Vergangenheit. Als ihm die Schleuser ein Audiotagebuch präsentieren, das von einer Frau in Rakka aufgenommen wurde, mit großer Wahrscheinlichkeit Naima, entscheidet Murad, die gefährliche Reise in das Herrschaftsgebiet des Islamischen Staates auf sich zu nehmen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Ähnliche
Inhalt:
Hätte Murad seiner Tochter Naima nur mehr von seinem Herkunftsland erzählt, von dem er sich hier in Deutschland endlich gelöst hat. Hätte er ihren Fremdheitsgefühlen nur mehr Beachtung geschenkt. Vielleicht wäre sie dann nicht im Namen der Religion in eine Welt heimgekehrt, die ihr vollkommen unvertraut ist. Vielleicht hätte sie sich nicht entschlossen, sich in Syrien mit einem wildfremden Glaubenskrieger zu verheiraten. Aber Naima ist tatsächlich verschwunden, ohne Verabschiedung. Murad sieht nur einen Ausweg: Er muss sie finden. Und so nimmt er Kontakt zu Schleusern auf, reist in das Kurdengebiet an der türkisch-syrischen Grenze und stellt sich dabei auch seiner eigenen Vergangenheit. Als ihm die Schleuser ein Audiotagebuch präsentieren, das von einer Frau in Rakka aufgenommen wurde, mit großer Wahrscheinlichkeit Naima, entscheidet Murad, die gefährliche Reise in das Herrschaftsgebiet des Islamischen Staates auf sich zu nehmen …
»Ich werde, dachte Murad, glücklich sein, wenn ich sie wiederhabe, ganz sicher werde ich glücklich sein. Aber nichts, wirklich nichts kann mich versöhnen, mit dem, was sie getan hat.«
Autor:
SHERKOFATAH wurde 1964 in Ostberlin als Sohn eines irakischen Kurden und einer Deutschen geboren. Er wuchs in der DDR auf und siedelte 1975 mit seiner Familie über Wien nach Westberlin über. Er studierte Philosophie und Kunstgeschichte. Für sein erzählerisches Werk wurde er zahlreich ausgezeichnet, zuletzt mit dem Großen Kunstpreis Berlin der Akademie der Künste und dem Adelbert-von-Chamisso-Preis. Außerdem erhielt er den Aspekte-Literaturpreis, wurde mehrfach für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises gewählt.
Sherko Fatah
Der große Wunsch
ROMAN
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: buxdesign | Daniela Hofner unter Verwendung eines Motivs von © plainpicture / Mona Alikhah
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30214-6V003
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Für Susanne
Wie Funken einer von Riesenhand ausgeschlagenen Fackel überzog ein Schweif von Sternen den schwarzen Himmel; sie leuchteten nicht, schienen nur zitternd zu verglimmen, ohne jedoch zu verschwinden. Dann zogen ganz allmählich Wolken auf.
Der Weg ins Tal, dorthin, wo die Fahrten der Transporter ihren Ausgang nahmen, führte mitten durch eine einsame Wolke, die von den anderen am noch blassen Morgenhimmel zurückgelassen schien. Murad stieg durch den Nebel hinab und starrte auf die vor ihm sich zögernd zeigenden Abschnitte der beschädigten Straße. Nach ein paar hundert Metern verdünnte sich die milchige Masse, und im kühlen Frühlicht wurden der Berghang links und die Schlucht rechts sichtbar. Die Straße war nun deutlich zu erkennen als eine dem Gestein abgerungene Ausbuchtung, die dabei war, wieder in ihm zu verschwinden. Ihr Rand an der Schlucht war buchstäblich zerfressen, und in den Bissstellen gab sie den Blick in die farblose Tiefe frei. Von Rissen durchzogen, verschwand die Straße hinter der nächsten Biegung, um entfernt wieder zu erscheinen, ein grauweißes Band an der endlosen Bergflanke, dem man aus der Ferne kaum ansah, dass es abwärtsführte.
Hinter ihm lag die syrische Grenze, ein Ort im Nirgendwo, der aber einen klangvollen Namen trug, jedenfalls auf der Landkarte. Dieser Name war es Murad wert gewesen, hier mit einem Transporter heraufzufahren. Als er angekommen war, hatte er vor einer hölzernen Brücke gestanden und Hunderten von Tagelöhnern dabei zugesehen, wie sie Lastwagen entluden. Sie trugen, hintereinandergehend, Röhren, Kisten und Säcke über die Brücke und einen grasbedeckten Bergrücken hinauf. Was er sah, war eine Ameisenstraße, die keinem sichtbaren Pfad folgte und dennoch geordnet verlief. In gleichmäßigen Windungen schlängelte sie sich dahin. Diese Leute gingen in keiner Spur, sie waren die Spur.
Ich bin kein Tourist, dachte er, wie um sich davon zu überzeugen. Ich bin zu alt für Abenteuer in gottverlassenen Gegenden. Unwillkürlich erinnerte er sich an die vielen Geschichten, die ihm sein Vater erzählt hatte; Wanderungen durch die Berge, genau in diesem Grenzland, seltsame Begegnungen und Abenteuer, die zum Teil eher der Imagination dieses Mannes entsprungen sein mussten, als dass sie auf wirklichen Erlebnissen beruht hätten. Vielleicht hatten ihn diese alten Geschichten hierherverschlagen, vielleicht war er unbewusst der Stimme seines Vaters gefolgt, um doch noch einmal diese Landschaft zu sehen, in der er fern verwurzelt war, ohne recht zu wissen, was das eigentlich bedeutete. Ich bin hier, um meine Tochter zu finden, die von Deutschland aus herkam, um einen verrückten Traum zu realisieren, sagte er sich und wusste, schon dieser Anlass für die Reise hätte seinen Vater den Kopf schütteln lassen. Er, der schon so lange fort und so weit entfernt von ihm war, hätte ihn ganz sicher mit seinen lächelnden Augen angeschaut, ohne dabei im Geringsten amüsiert zu sein. Er war ein kluger Mann gewesen. Kein Intellektueller, wie sie Murad später in Europa getroffen hatte, aber ein erstaunlich genauer Beobachter. Jeden Vogel, der sich im Sommer im Feigenbaum des Gartens niederließ, kannte er genau. Nicht der wissenschaftlichen Bezeichnung nach, vielmehr gab er ihnen eigene Namen: das kleine Huhn, der Taubenhafte, die Behelmte, der Schwätzer. Das allein wäre nicht besonders gewesen, hätte er nicht eines Tages einen toten Vogel mitgebracht, den er an der Straße gefunden hatte, und behauptet, genau dieser sei es gewesen, der drei Jahre zuvor daheim auf dem Fensterbrett gesessen habe. Er identifizierte ihn an einer kahlen Stelle über dem Auge. Ich hätte gern gewusst, wie sicher dieses Verfahren war, dachte Murad. Man flüchtet sich ja gern zu irgendwelchen wissenschaftlichen Methoden, die angesichts solcher Geschichten versprechen, Gewissheit zu bringen. Besonders, wenn man im Westen lebt. Aber wie viele dieser Vögel eine solche bläulich graue Stelle über dem linken Auge haben, kann niemand wissen. Der Zweifel an den Worten meines Vaters, den ich schon als Kind aus irgendeinem Grund empfand, dachte Murad, ist ebenso ein Phantom wie die Hoffnung auf Gewissheit in dieser Frage.
Als er den Tagelöhnern lange genug zugeschaut hatte, war der Lastwagen, der ihn hierhergebracht hatte, schon wieder davongefahren. Er versuchte, einen der Fahrer der verbliebenen Transporter dazu zu bringen, ihn mitzunehmen. Alle aber winkten ab, womöglich befürchteten sie, keinen Gewinn aus einer solchen Rückfahrt zu schlagen, als sie Murads inzwischen verstaubte Kleidung sahen. Einer immerhin nickte schließlich und ließ ihn einsteigen, als er ihm den Ort nannte, zu dem er wollte. Sie saßen eine Weile schweigend nebeneinander, Murad musterte den kleinen Schrein aus Plastik auf dem Armaturenbrett, die Kettchen, Girlanden und Zettel. Dann gab ihm der Mann zu verstehen, dass er doch nicht in seine Richtung fahren würde, obwohl es nur diese eine gab. Murad blickte in sein regungsloses Gesicht, schüttelte den Kopf und stieg aus.
Auf der Straße sah er die leeren Lastwagen an sich vorbeifahren. Wider besseres Wissen hielt er noch den Daumen hinaus, dann trat er nur noch zur Seite an den äußersten Rand der Straße. Der Hang unter ihm bestand aus Geröll und Schutt, der aussah wie übrig geblieben vom Bau der Straße. Erst viel weiter unten war gelbliches Gras zu sehen, das in der feuchten, dunklen Erde wuchs. Nun begann der Abstieg, das Geräusch des letzten Lastwagens verschwand hinter ein paar für Murad noch unsichtbaren Biegungen. Das Schaben seiner Schuhsohlen auf der von Steinchen und Steinbrocken übersäten Straße war alles, was zurückblieb.
Einerseits war er froh darüber, dass der Weg kaum merklich bergab führte. So konnte er wie ein Spaziergänger schlendern, und seine Knie wurden nicht allzu sehr belastet. Andererseits machte ihn diese Tatsache unruhig, denn sie ließ ihn erahnen, welche Strecke er würde gehen müssen. Sie waren in der Dunkelheit der Nacht stundenlang bergauf gefahren. Vielleicht lag es am Alter des Lastwagens, doch er hatte das Gefühl, die Auffahrt sei viel steiler gewesen, als sie jetzt aussah. Der Blick in die Schlucht beim ersten Morgenlicht und der Druck auf den Ohren sagten ihm jedenfalls, wie weit hinauf sie gekommen waren. Wie oft hatte der Fahrer vor einem besonders zerstörten Teilstück der Straße seine Stirn und den kleinen Schrein berührt? Wie oft war der Blick auf den in der Nacht sichtbaren Fluss frei geworden, von dem hier oben nichts zu sehen und zu hören war? Schwer einzuschätzen, aber je mehr Momente ihm wieder einfielen, in denen der Fahrer den Wagen abgebremst hatte, um den Segen Gottes herabzubitten, für sich oder auch nur für die Stützkraft der Straße, desto mehr fürchtete Murad um die in nächster Zeit bevorstehende Verabredung mit dem Boten.
Er wanderte bis zum Mittag, dann war eine Rast nötig. Die Sonne stand, von Wolkenschleiern überzogen, wie ein kalter, gesichtsloser Engel über dem morastfarbenen Berg mit seinen Abschürfungen. Als er hinaufblickte, erschien ihm der Berg wie der Rand einer Grube, bereit, so wie vor Stunden den letzten Lärm der rettenden Autos, nun auch das Licht dort oben zu verschlucken. In der Nähe des Berges wurde ihm kühl, so hielt er sich an der Seite zur Schlucht hin. Dort kauerte er sich nieder, stand aber rasch wieder auf, als ihm der Gedanke kam, dass seine mittägliche Befürchtung noch wahr und es dunkel werden könnte, bevor er die Strecke bewältigt hatte.
Er trottete weiter und dachte wieder an den Boten. Ihre Verabredung war etwas vage; als sie sich Wochen vorher getroffen hatten, blieb die Möglichkeit der Verzögerung oder auch Planänderung zwar unausgesprochen, doch unvermeidbar. Trotzdem wollte Murad sie unbedingt einhalten, denn allein die Tatsache, dass dieser Mann informiert war über den Grund für seine Reise, dass er sich auf dem Handy sogar ein Foto von Murads Tochter Naima hatte zeigen lassen, machte ihn vertrauenswürdig. Auf das bevorstehende Gespräch mit dem Mann, der überraschenderweise sehr gut Deutsch sprach, konzentrierte er sich jetzt. Am Ende dieses Fußmarsches, weit unten im Tal, würde er ihn treffen und mit ihm die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Naima. Murad spürte bei diesem Gedanken Wärme seine Brust durchströmen, und augenblicklich suchten ihn Bilder seiner Tochter heim; ihr dichtes dunkles Haar mit diesen festen Locken, die dem Wind und sogar dem Regen standhielten, als wären sie aus Draht, und, seltsamerweise, ihre langen Fingernägel, die sie irgendwo hatte gestalten lassen wie kleine Kunstwerke. Es schien, als wären sie mit winzigen Blüten und Perlen besetzt und mit kleinen Ornamenten verziert. Jemand hatte das auf ihre Fingernägel, auch auf die der kleinen Finger, gemalt, dachte Murad und schüttelte im Gehen den Kopf. Er fand das jetzt erstaunlicher als damals, als er es gesehen hatte, weil es ihm von hier aus fern erschien, ebenso fern wie seine Tochter.
Sie ist nicht so fern von dir, zwang er sich zu denken. Es war genau diese Überzeugung, mit der er an den Ort am Ende der Welt gekommen war, nach Flug und endloser Busreise nun bezeichnenderweise zu Fuß, und zu dem er nach einem sinnlosen Ausflug an die Grenze jetzt wieder unterwegs war. Nach seiner Ankunft vor einigen Tagen hatte er seinen Seesack im Zimmer abgelegt und folgte dann den Anweisungen eines alten Mannes, der ihm mürrisch und kurz die Hausordnung erklärte. Nachdrücklich wies er darauf hin, dass die Kanalisation seit einiger Zeit verstopft war. Für »das Kleine« ginge es, für »das Große« aber schickte der Mann Murad zum Fluss.
Er saß in einer Nische des Raumes und hielt ein auffallend kleines, abgegriffenes Buch in den Händen, in welchem er unablässig kopfschüttelnd gelesen hatte, bevor Murad ihn ansprach. Alles um sie herum war aus Holz, der Schemel, auf dem der alte Mann saß, die eng gestellten Bänke, die Wände des Raumes, der Lobby, Restaurant und Kramladen in einem war, und die Treppe, die zu den zwei Kammern oben führte. Murad verließ das Haus und ging über die Straße dieser Western-Stadt zu einer Anhöhe, von der aus ein Pfad abwärts zum Fluss führte. Von den großen Ufersteinen stieg Gestank auf. Getrieben von einem absurden Reinlichkeitsbedürfnis ging Murad weiter, um ihm zu entgehen, aber auch der Pfad war stellenweise von Haufen bedeckt. Irgendwann hatte sich der Gestank zu einem Geruch verdünnt. Er kletterte zwischen den Gesteinsbrocken zum Fluss hinab und betrachtete bei der Notdurft das schäumende Wasser. Der Boden stank überall, nicht einmal das Wasser brachte etwas wie Frische in diese schwere, alles überdeckende Ausdünstung. Als er den Pfad wieder erklommen hatte und den ziemlich weiten Weg zurückgegangen war, sah er das Schulhaus des Ortes etwas zurückgesetzt in einer Baumgruppe stehen. Ein Holzhaus, ohne äußerliche Schäden, aber dunkel, wie angelaufen.
Jetzt, auf der Straße, im anhebenden Wind und der seit dem frühen Morgen unveränderten Landschaft wurde Murad bewusst, dass jene Anhöhe genau am Ende dieses Weges lag und der Treffpunkt mit dem Boten damit auch schon in diesem Moment unbestreitbar mit ihm verbunden war.
Ohne einen Blick auf die Uhr wanderte er weiter, seinem Empfinden nach etwa zwei Stunden lang. Die Zeit der Zeiger hatte sich losgelöst von der Zeit seiner Schritte, ein winziges, mechanisches Geräusch war von ihr geblieben, und der Kreis, den die Metallstäbchen beschrieben, schien ihm, wenn er den Ärmel zurückschob und darauf blickte, ohne Zuwachs oder Minderung immer derselbe zu bleiben. Auch die Landschaft veränderte sich kaum. Die sinnlose Unform des Berges begleitete ihn wie eine Zwangsvorstellung; allmählich glaubte er, auf der linken, erdfarbenen Seite seines Gesichtsfeldes blind zu werden. Über der Schlucht lag eine Art mehligen Lichtes, welches alles, was man hätte sehen können, eher bedeckte als zeigte.
Nach einer weiteren Biegung senkte sich die Straße für einen halben Kilometer nun deutlicher, und ein Plätschern schreckte Murad auf. Er ging schneller und blickte schließlich hinauf zur unsichtbaren Quelle eines fadendünnen Wasserfalls, der in Bergfalten und über Stufen herabfiel und die Straße überschwemmte, um über den Rand hinweg seinen Weg abwärts fortzusetzen.
Das Wasser schmeckte eher nach Himmel als nach Erde und ließ ihn kurz wieder zu jenem Wanderer werden, als der er sich eigentlich schon lange nicht mehr fühlte. Jetzt fielen ihm auch die Berge auf der anderen Seite der Schlucht auf. Sie bildeten definierte Erhebungen und waren fotoalbumtauglich. Für die nächste Zeit ließ er sie nicht aus den Augen und vermied folglich den Blick auf die Bergmasse neben sich.
Er schaffte noch etwa einen Kilometer, bevor er einer Erschöpfung nachgab, die er gleich im Moment, da er stehen blieb, als übertrieben empfand. Murad kauerte sich an den Rand der Straße und blickte in die Schlucht hinab; beinahe kam er sich verwegen vor. Aber wie verwegen konnte einer aus dem Westen schon sein in einer Gegend wie dieser, bevölkert von gut organisierten Gotteskriegern, von denen viele zwar auch aus dem Westen herbeiströmten, die meisten aber tatsächlich kriegserprobte Söldner waren oder Leute, die durch die Foltergefängnisse der nahöstlichen Regime gegangen waren.
Vielleicht war auch der Bote einer von ihnen, möglicherweise aber war er nur ein Blender. Jedenfalls kniff dieser Mann, an den er jetzt zurückdenken musste, seine Augen zu schmalen Schlitzen zusammen, wenn er an seiner Zigarette zog und das Gefängnis des jordanischen Geheimdienstes in Amman wie beiläufig erwähnte, von dem er behauptete, die ganze Welt wisse inzwischen, dass man es die »Fingernagelfabrik« nannte. Murad fragte sich, ob er zu viele Filme gesehen hatte oder aus Erfahrung sprach. Er ertappte sich dabei, wie er die Fingerspitzen seines Gegenübers begutachtete, um sich diese Frage zu beantworten.
Während der Mann damals weiterhin langsam, weniger nachdenklich als gehemmt, gesprochen hatte, war Murads Blick auf die in Tücher gehüllte Frau gefallen, die das Restaurant, in dem sie sich verabredet hatten, offenbar führte und, wenn nichts zu tun war, in einem Stuhl zusammensank wie eine schwere Puppe. Das lenkte ihn ab, er sah sie von ihren dunklen Gewandfalten wie eingeschnürt und erschrak beim Anblick des von feinen Runzeln und tiefen Furchen überzogenen Gesichts einer Bettlerin, die plötzlich neben ihrem Tisch stand. Sie hielt sich gebeugt, schlang die Hände vor dem Kinn ineinander und schnitt Grimassen. Murad lehnte sich weit zurück. Der Bote aber fingerte nach seinen Zigaretten und gab ihr eine, woraufhin sie die Hand an die Stirn legte. Kurz blickte sie Murad an, als erwarte sie auch von ihm etwas, gleich darauf aber war Erstaunen in ihren Augen zu erkennen. Sie beugte sich nach vorn, als wolle sie die Schultern um die Zigarette in ihren Händen schließen, drehte sich um und machte sich davon.
»Du bist ziemlich blass«, sagte der Bote und fügte hinzu: »Fall nicht vom Stuhl.«
Eine überraschend aufmerksame Beobachtung, mit der der Mann recht gehabt hatte. Was Murad von da an bis auf die Gebirgsstraße, auf der er nun rastete, begleitete, war ein Durchfall, der nur mithilfe einer Windel unter eine gewisse, zeitlich begrenzte Kontrolle zu bringen war. Hier in der Einsamkeit konnte er wenigstens die Furcht vor dem Gestank vergessen. Dennoch fragte er sich bei jedem der plötzlichen Magenkrämpfe, wie viel von der Flüssigkeit, die aus ihm tröpfelte oder manchmal, wie jetzt nach dem Trinken am Wasserfall, strömte, das Handtuch zwischen seinen Beinen noch aufnehmen konnte.
Die Straße führte ihn unablässig an der Flanke des Berges entlang, und er hoffte auf einen weiteren Wasserfall, um sich waschen zu können. Diese Hoffnung lenkte ihn ab von einem Himmel, der allmählich grau wurde, und von den immer deutlicher sichtbaren Felshängen auf der anderen Seite der Schlucht. Murad senkte den Blick auf die Straße und die darauf verstreuten Steine und schritt, die härter werdende Windel spürend, eilig voran.
Nach der nächsten Biegung ging es steiler bergab. Er sah sich schon Stunden, Tage später mit wundgescheuerten Schenkelinnenseiten gehen und gehen, da hörte er tatsächlich das Plätschern von Wasser. Diesmal ergoss es sich direkt aus dem Berg und versickerte kurz vor der Straße. Er blieb stehen und horchte auf Motorengeräusche. Obwohl er seit Stunden nur vom Brausen eines zwischen den Bergen wie irritiert drehenden Windes umgeben war, schien es ihm möglich, dass ausgerechnet jetzt ein Wagen vorbeikam.
Vielleicht lag es am bloßen Dasein einer Straße, aber er konnte sich nur verschämt entkleiden. Als er seine Hose ausgezogen hatte und die Enden des Handtuchs an ihm hinunterschlappten, drehte er sich noch einmal um, nur um nicht allzu versunken zu wirken in die bevorstehende, idiotische Tätigkeit. Seine Eitelkeit ließ es einfach nicht zu, derjenige zu sein, von dem später einmal berichtet wurde, er wusch sich mutterseelenallein im Gebirge seine Windel, während ein Laster an ihm vorbeifuhr, dessen Insassen – vielleicht sogar Touristen – eher den Einsturz der Straße als diesen Anblick erwartet hatten. Jetzt, die Windel vorsichtig hervorziehend und wie ein riesiges, unter Schmerzen abgezogenes Pflaster von sich haltend, spürte er zum ersten Mal die Weite in seinem Rücken, diesen ganzen blassgrauen Raum, in dem sogar die umgestürzten Riesenzapfen der Berge Platz fanden.
Er hockte vor der Quelle, drückte zur Stabilisierung ein Knie an den Berg und hielt das Handtuch ins Wasser. Es war übersät von rötlichen und weißen Flecken. Er schüttelte und wrang, tat es ausgiebiger als nötig, wie um seine Wiederentdeckung der Reinlichkeit zu feiern. Nachdem er sich auch selbst gewaschen hatte, stand er mit nacktem Hintern da und überlegte, ob er das Handtuch trocknen lassen sollte. Der Blick zum Himmel verhieß jedoch nichts Gutes. Er musste sich darauf einstellen, einen gewaltigen Marsch in der Dunkelheit zu bewältigen, und nicht einmal die Sterne würden seinen Weg erhellen, denn aus dem milchigen Schleier war eine veritable Nebeldecke geworden. Rasch legte er sich die nasse Windel an und zog die Hose darüber. Als hätte sein Darm auf dieses Signal gewartet, entleerte er sich mit einem Knurren. Murad stakste unsicher weiter, denn wie immer fühlte es sich an, als hätte eine große Menge Flüssigkeit seinen Körper verlassen, was aber eine Illusion war.
Es dämmerte, und die Straße nahm kein Ende. Wären die beiden Berge jenseits der Schlucht nicht ganz allmählich doch zurückgeblieben, Murad hätte geschworen, keine fünfhundert Meter hinter sich gebracht zu haben. Die Lücke, die jetzt in der Schlucht entstand, gab ihm jedoch nicht den ersehnten Blick in das Tal frei, sondern versank in der sich erhebenden Dunkelheit. Auch der Berg hatte sich verändert. In einigen Metern Höhe klebten große Büsche an der Flanke und bildeten einen dunklen Kranz, der die noch höher gelegenen Flächen verdeckte. Dieser Kranz begleitete ihn nun, jedenfalls solange er ihn noch sehen konnte.
Er fror und war schwer vor Müdigkeit; das Gefühl der Verlassenheit schien förmlich in ihm aufzuplatzen. Ich werde die eine Straße des Ortes entlanggehen, sagte er sich immer wieder, werde das Gasthaus betreten, den Mann mit dem Buch begrüßen wie einen nahen Verwandten, in mein Zimmer gehen und endlich auf der Pritsche liegen. Eine Hand, tief vergraben im offenen Seesack, würde genügen, um ihm das Gefühl des Zuhauseseins zu geben. Niemand, nicht einmal der Bote, würde ihn wecken können, und nach einer langen Zeit des Schlafes würde sein erster Blick dem hellen Fenster gelten, den verstreuten, ärmlichen Hütten auf dem Hügel, die er betrachten würde, als wären es die roten Dächer einer alten und vertrauten europäischen Stadt.
Im Gehen sann er seiner merkwürdigen Prägung durch europäische Städte nach. Gemäß seiner Herkunft hätte ihm als Mann aus dem sogenannten Orient das armselige Nest hier in den Bergen viel näher sein müssen. Doch er empfand nichts als Fremdheit, wenn er in diese Gegend der Welt zurückkam. Das war wohl ein Grad von Entfremdung, mit der sein Vater, als er vor vielen Jahren mit seiner jungen, hochschwangeren Frau nach Europa auswanderte, nie gerechnet hätte. Doch sogar das Essen und das Wasser können der nächsten Generation unverträglich werden, dachte Murad und entließ unter fühlbaren, konvulsivischen Darmbewegungen ein wenig neue Flüssigkeit in sein Handtuch. Migration verändert Menschen, vor allem aber deren Kinder.
Gerade weil er das so oft beobachtet hatte, kam Murad das Verhalten seiner eigenen Tochter wie ein Rückfall vor, wie der hoffnungslose Versuch, zurückzukehren in eine Welt, die sie kaum kannte. Hätte man ihn danach gefragt, wäre er zu schwören bereit gewesen, dass Naima eine zwar noch sehr junge, aber in allem nach vorn schauende Frau war, im Begriff, ihre Möglichkeiten in der westlichen Welt auszuloten. Es war nun etwa zehn Monate her, seitdem Naima im Sommer des letzten Jahres verschwunden war. Als er nach Wochen durch Dorothee davon erfuhr, hieß es, sie sei mit irgendeinem neuen Freund auf eine längere Reise gegangen. So hatte sie es ihrer Mutter angekündigt, ohne dabei einen Widerspruch auch nur zu erwarten. Diese Reise schien ihr sehr wichtig zu sein, meinte Dorothee und stellte fest, dass Naima keinerlei Fragen nach ihrer neuen Beziehung zuließ. Murad erinnerte sich schmerzlich klar daran, wie überzeugt er davon war, seiner Tochter in dieser Hinsicht alle Freiheiten gewähren zu müssen. Naima war erwachsen und konnte, so schwer das zu akzeptieren sein mochte, wenn sie wollte, sogar ein neues Leben an einem anderen Ort beginnen. Dass wir uns um sie sorgen, verpflichtet sie zu nichts, hatte Murad damals großspurig verkündet. Ihm erschien dieser plötzliche Aufbruch mit einem neuen Freund als Ausdruck jugendlicher Rebellion. Und vielleicht hatte er sich auf eine gewisse Weise auch gegen Dorothee auf die Seite Naimas geschlagen, in der irrigen Annahme, hier deren Recht auf Loslösung und Freiheit verteidigen zu müssen. Natürlich aber erwartete er, seine Tochter nach einiger Zeit wiederzusehen.
Doch es gab keinen Kontakt. Dorothee war ohnehin skeptischer und wurde mit der Zeit immer unruhiger, bis schließlich auch er die Sache ernster zu nehmen begann. Damals brachten sie ein wenig mehr über ihren neuen Freund in Erfahrung, aber es genügte bei Weitem nicht, um sie zu beruhigen. Immerhin gab es gelegentliche Posts in den sozialen Netzwerken, die sie wissen ließen, dass Naima noch am Leben war. Doch sie beantwortete keinerlei Nachrichten und informierte weder Murad noch Dorothee darüber, wo sie sich gerade befand. Es brauchte Zeit, bis er die Notwendigkeit verspürte, aktiv zu werden. Eine Vermisstenanzeige bei der Polizei stellte sich als wenig aussichtsreich heraus. Obwohl sie ihm versicherten, Nachforschungen anzustellen, schienen ihn die Beamten zugleich wissen lassen zu wollen, wie gering die Aussichten auf Erfolg waren.
So zog sich das Warten hin und wurde im Laufe des Winters unerträglich. Alles änderte sich an jenem Tag, als ihn ein Polizeibeamter am Telefon darüber informierte, dass Naima das Land in Richtung Türkei verlassen hatte. Diese Information sei sicher, sagte er und fügte ohne weitere Erklärung an, er, Murad, wisse ja, die Türkei grenze an Syrien. In diesem Moment setzte sich in Murads Kopf jenes neue Bild seiner ihm plötzlich fremden Tochter zusammen, das ihn bis hierher begleitete.
Zuvor wäre er nie auf den Gedanken gekommen, Naima könnte gemeint sein, wenn es in den Medien hieß, viele junge Frauen würden sich Gotteskriegern anschließen, die sie aus dem Internet oder sonst woher kannten. Aber wie auch immer die Verwandlung Naimas im Einzelnen vonstattengegangen war, noch jetzt, hier auf dieser Gebirgsstraße, wollte er laut ausrufen: Das kann nicht wahr sein; wozu die vielen Jahre Schule, all die westliche Liberalität, ihre kurzen Röcke, ihr Make-up und ihre designten Fingernägel, wenn dies hier das Ergebnis war?
Die Dunkelheit um ihn war nun so ungeheuer, dass sie ihm physisch im Weg zu stehen schien. Er schritt gegen etwas Dichtes an und starrte aus weit aufgerissenen Augen auf die Straße, um ihren Verlauf zu erkennen. Wie dunkel kann es werden im Nebel, zwischen Bergen?, fragte er sich. Ein Blick zur Seite zeigte ihm noch Lichtreste, wie ein übergroßer Schiffsbug löste sich ein weiterer Berg aus der Dunkelheit. Murad blickte in die Schlucht hinab. Die Geröllbrocken waren weich konturiert und grau, weiter unten zerflossen sie in den Schatten, die zwischen seinem Berg und dem Hang nichts übrig ließen als schwarzen Raum für die Kinderfantasie eines Sprungs oder Seiltanzes über die Leere.
Wie konnte Naima in ihrem Alter noch glauben, die Welt sei so harmlos und zugänglich wie in ihren YouTube-Videos, wo selbst der Krieg als eine touristische Sensation dargestellt wurde, eine Abfolge von schnell geschnittenen Explosionen und Gewaltszenen im Wechsel mit langen Schwenks über weite Landschaften, all das unterlegt mit Musik? Wie konnte sie glauben, ihren Platz finden zu können an der Seite eines bewaffneten Fremden? Er war wohl ein junger Franzose, hatte Murad inzwischen herausgefunden. Aber sie hätte einen jungen Franzosen auch anderswo kennenlernen können. Wenn es um mehr als eine Liebschaft ging, dachte er, dann war wohl auch Abenteuerlust beteiligt, der Wunsch nach einem Ausbruch aus dem allzu vertrauten, reizlosen Alltag. Konnte das tatsächlich die banale Begründung für einen so radikalen Schritt sein? Es fiel ihm schwer, die Dinge durch Naimas Augen zu sehen, doch als Vater glaubte er, den Versuch wieder und wieder unternehmen zu müssen.
Vielleicht bewohnt sie die Welt anders, sagte er sich manchmal. Inzwischen war er selbst weit gereist, und doch wäre es ihm seltsam vorgekommen, eine Bewohnerin wie sie zu sein, eine Bewohnerin der ganzen weiten Welt, die sie aus Bildern und ihren eigenen Träumen zusammensetzte, wodurch diese Welt aber um keinen Quadratzentimeter kleiner und um keine Morastpfütze ärmer wurde. Nur manchmal, in den Flugräumen der Erinnerung, wo sich Busse und Züge, Boote und vielleicht sogar Rikschas in Bilderfolgen verwandelten, konnte er ein wenig wie Naima sein, die noch gar nicht begonnen hatte, die Schwere all dieser Dinge zu empfinden. Aber was wusste er schon von der Psyche seiner Tochter, wenn selbst ihre Mutter an der Deutung scheiterte?
Plötzlich setzte Schneetreiben ein, große Flocken taumelten ihm entgegen und bildeten vor ihm einen instabilen Tunnel. Unwillkürlich beschleunigte Murad seinen Marsch, blieb jedoch sofort stehen, als er bemerkte, dass sich am Hang etwas bewegte. Er konnte dort oben so gut wie nichts mehr erkennen und lauschte vornehmlich auf die Geräusche. Erst war ein Tapsen und Scharren zu hören, dann wurde es still. Das irritierte ihn noch mehr als die plötzliche Anwesenheit von etwas Lebendigem. Er ging weiter. Der Schnee fiel lautlos und störte seine Orientierung. Zehn Schritte weiter war das Geräusch wieder deutlich zu hören: Wo er die Büsche ausgemacht hatte, begleitete etwas seinen Marsch. Dass dort jemand sein könnte, wagte er nicht anzunehmen. Der Gedanke an ein Tier war, da er sich nicht im Dschungel befand, weniger bedrohlich als der an einen Menschen. Er machte die Probe, blieb stehen und wartete. Was immer es war, es huschte oben an ihm vorüber und blieb irgendwo vor ihm stehen.
Als er diesmal weiterging, hatte sich die Landschaft verändert, ohne dass er sie noch sah. Sie war jetzt wieder jene vollkommen abgeschiedene Welt aus Geröll und Nebel, die ihn aus irgendeinem Grund zu diesem Ausflug angeregt hatte, ihn jetzt aber ängstigte. Was Murad vorwärtstrieb und zugleich so zusammenpresste, dass sogar sein Durchfall zur Ruhe kam, war die Gewissheit, niemand würde ihm helfen können, was auch immer von jetzt an geschah. Seine ganze Verlorenheit drängte sich in dem plötzlichen Erkennen zusammen, dass, was auch immer dort oben mit offenbar flinken Schritten keine Mühe hatte, ihm zu folgen, allein für ihn dort war und daher ihm und nur ihm bevorstand. Dieser Berg, an dem er seit Stunden entlangkrabbelte, schien ihn nun von sich zu stoßen. Er schlich an der äußersten Kante der Straße entlang und war doch noch immer dem Hang viel zu nahe. Er überlegte, wohin er ausweichen konnte, wenn das oder der dort oben herunterkommen würde. Aber es war ihm trostlos klar, diese Straße hatte sich in eine Falle verwandelt.
Der Schnee fiel so dicht, Murad wäre ins Leere gestolpert, wenn nicht der Mond über dem Berg hervorgekrochen wäre, nur ein blasser Fleck im grauweißen Gestöber, und doch eine Lampe, wenn auch von einem öden Vorhang verschleiert. Nach einiger Zeit waren die Büsche am Hang wieder zu sehen und überdeutlich auch die Bewegung darin. Er ging mechanisch weiter, immer darauf bedacht, jetzt nicht noch abzustürzen. Nach dem ersten Schrecken beruhigte ihn die Tatsache, dass das Wesen dort oben Abstand von ihm hielt.
Das Schneetreiben ließ allmählich nach, die Straße war rutschig geworden. Murad erreichte die nächste Biegung und eine Stelle, an der der Hang beschädigt war. Er wusste, ihm war das Glück nicht gewogen. Jetzt würde er sehen, was ihn verfolgte, denn um weiterzukommen, musste es auf die Straße herunterkommen. Alles, was er tun konnte, war gehen, so schnell er es vermochte. Halb rutschend, mit rudernden Armen umging er den riesigen Kratzer im Berg und folgte blind den ins Mondlicht gestreuten Brocken auf der Straße. Zunächst blieben die Geräusche hinter ihm zurück, dann veränderten sie sich.
Er wollte nicht zurückschauen, aber eine unbezähmbare und furchtlose Neugier, eine Gier, in der der Geist vom verwundbaren Körper und seinen Ängsten befreit zu sein schien und die nur in den Augen und Ohren lebte, ließ ihn den Kopf wenden und viel genauer, als es in diesem Augenblick möglich zu sein schien, den großen, dunklen Hund betrachten, der aus dem Berg floss und auf der glänzenden Straße emporwuchs. Der Hund trottete los, die Schnauze dicht über dem Boden. Wenn er jetzt aufschloss, blieb Murad nichts übrig, als vorwärtszufliehen; ein kaum aussichtsreiches Unterfangen. Als hätten sich seine Glieder in Holz verwandelt, setzte er einen Schritt vor den anderen und kniff die Augen zusammen.
Die Straße verschwand nach wenigen Metern in der Dunkelheit, die Schlucht neben ihm war bodenlos. Er schaute den Hang hinauf und sah sich seit Stunden an einem riesigen, sich wandelnden Gesicht entlangwandern – etwa auf Höhe der Unterlippe.
Der Hund hielt offenbar Abstand und wurde dadurch in Murads Rücken zum Ungeheuer. Was wusste er über die Tiere, hier, wo die Begegnung mit den Menschen so sehr im Vordergrund stand? Was wusste er überhaupt über Tiere, außer den Dingen, die man im Fernsehen erfuhr? Während er voranhastete, fiel ihm der Arbeitselefant ein, den er vor Jahren in Indien gesehen hatte. Er stand mitten auf der Straße zwischen Autos, Fahrrädern, Eselskarren und Menschen. Seine kleinen Augen musterten das Treiben mit einem Ausdruck verletzlicher Geduld. Als Nächstes fielen ihm das Kali-Fest und die Opfer für die Göttin der Zerstörung ein. Wie erstaunt war er gewesen über diesen Blutkult. Er dachte an die Schafe und Ziegen, die auf dem Opferplatz vor dem Angesicht der Göttin standen, daran, wie der Schlächter mit einem schwertartigen Messer auf das Einverständnis der Tiere wartete und, da es meist lange auf sich warten ließ, schließlich einen Eimer Wasser über ihre Köpfe gießen ließ, damit sie sich schüttelten – eine absichtsvoll missverstandene Bewegung, welche den tödlichen Streich zur Folge hatte und einen weiteren Schwall Blutes, der sich auf den mittäglich heißen Pflastersteinen des Platzes mit den umhergewehten Blüten vermischte, sie berührte, umschloss, verfärbte und schließlich fortschwemmte. Die Hände der Opfernden und der Betenden berührten diesen Blutstrom, der ihren Abdruck aufnahm, kurz stehen ließ und dann verschluckte, diese Handspuren, welche sich gleich darauf wiederfanden im pausbäckigen Steingesicht der dürstenden Göttin, die auf all das mit blutbeschmierten Lidern und Lippen herabzulächeln schien, als wolle sie sagen: Bald auch du.
Mehr Hunde lösten sich vom Hang. Sie überholten ihn und jagten voraus. Jetzt war Unruhe um ihn; als hätten die Tiere bis zu seinem Erscheinen geruht, zeigten sie sich nun munter und ohne Scheu. Murad ging weiter, und das Einzige, worin ein Schutz für ihn lag, war diese Bewegung des Gehens, seine Verbindung mit der Straße und deren Ziel irgendwo voraus. Sie durfte nicht unterbrochen werden, denn alles um ihn war nicht für ein Verharren, sondern ausschließlich für die Passage gedacht – gedacht von ihm, der es einfach nicht anders wahrnehmen konnte. Er war an keinem Ort, er war in Bewegung und viel mehr als seine Augen und Ohren gaben seine allmählich ermüdenden Knie Kunde von der Umgebung.
Der Frühjahrsschnee wurde nicht mehr verweht, er taumelte nur noch feierlich herab; diese Weihnachtsstimmung gab der absurden Hundekarawane vor ihm etwas Harmloses, das er aber beim besten Willen nicht empfinden konnte. Im Mondlicht glichen die hellen und dunklen Körper einander, ihre Bewegungen waren mehr hör- als sichtbar. Murads Magen knurrte auf, und die Tiere spitzten die Ohren. Gleich darauf ergoss sich ein neuer Schwall in die Windel, was allerdings kein Zeichen von Entspannung sein konnte. Er hoffte inständig, seine Verfolger oder Begleiter würden das Knurren aus den unkontrollierbaren, tieferen Regionen seines Körpers nicht als Kontaktaufnahme missverstehen, sozusagen von Tier zu Tier.
Als er in der Ferne das Licht neben der Straße sah, spürte er in der aufsteigenden Hoffnung zum ersten Mal die Kälte, die auf ihm gelastet hatte. Er ging ruckartig schneller, und nur die Furcht vor einem Angriff des großen Hundes ließ ihn nicht rennen. Er wagte einen Blick über die Schulter und sah den Hund keine zwanzig Meter hinter sich. Schneeflocken hingen in seinem Fell, die Haare an seiner Schnauze wiesen, an den Lefzen vereist, wie Fangzähne zu Boden. Murad war sehr aufmerksam, ließ das Tier nicht aus den Augen. Während er es ansah, kam es plötzlich näher, als hätte sich das Objekt der Verfolgung verändert, als er dessen Gesicht sah. Rasch wandte sich Murad um und versäumte dabei nicht, die anderen Hunde ins Auge zu fassen. Zwei waren stehen geblieben und schauten zu ihm zurück. Ihre Augen waren kaum zu erkennen, dafür ihre Atemfahnen in der abgekühlten Luft. Der zuvorderst Laufende schickte sich an zurückzukommen. Er war kleiner als die anderen, aber sein Kopf wirkte unförmig groß. Er tapste vorsichtig, doch zielstrebig auf Murad zu.
Erst jetzt wurde ihm klar, dass er es wirklich mit Hunden zu tun hatte. Bisher waren sie ihm vorgekommen wie Lebewesen einer anderen Welt. Als der erste wenige Meter vor ihm zum Stehen kam, gewann er damit eben das Lästige und Alltägliche eines Hundes, der sich schüttelt, streckt und die Nähe eines beliebigen Menschen sucht.
Erneut beschleunigte Murad seine Schritte, um den Hund nicht vor sich zu haben, was darin hätte resultieren können, stehen bleiben zu müssen. Das Tier verharrte am Straßenrand und ließ ihn passieren. Murad hielt sich in der Mitte und eilte vorbei, die Hunde sammelten sich hinter ihm.
Sein größtes Problem bestand nun darin, langsam zu gehen. Das Licht lag näher, es war von Schwarz umgeben, als leuchte es aus einer dunklen Nische. Der Atem der Hunde war laut genug, seinen eigenen zu übertönen. Murad glaubte fest, einen Straßenabschnitt von der Hinfahrt wiederzuerkennen. Die Fahrbahn war mit fladenförmigen Teerstücken ausgebessert worden. Er war sicher, die Hunde kamen näher, und musste daran denken, wie sein Freund Aziz, ein junger Mann, den er in Berlin kennengelernt hatte, damals auf der gemeinsamen Reise durch Indien einen Schlächter bestechen wollte, damit er ihn eines der Tiere töten ließe, wie dieser aber wiederholt würdevoll ablehnte und dadurch die ihm anhaftende, blutbespritzte Schäbigkeit verschwand vor der Tatsache, dass seine Art des Tötens strengen Regeln folgte, die er auch zu verteidigen bereit war.
Was sich da am Straßenrand näherte, war eine Hütte, zusammengezimmert aus Balken, Kartons und Decken. Der Stoff am Eingang ließ eine Lücke. Kein Mensch war zu sehen. Murad hockte sich vor die Öffnung, sagte: »Hallo?«, und duckte sich dann hinein.
Das Innere war vom Licht einer Kerosinlampe ungleichmäßig erhellt. Gleich vor ihm saß ein junger Mann mit schmutzigem Gesicht im Schneidersitz am Boden und blickte Murad ohne nennenswerte Überraschung an. Eine alte Frau entdeckte er erst nach ein paar Augenblicken; sie kauerte zwischen Kisten und Strohbündeln, nichts an ihr bewegte sich, außer dem zahnlosen Mund mit seinen weichen, ausgeleiert wirkenden Lippen. Der Mann hob die Hand zum Gruß, nachdem Murad es getan hatte. Murad murmelte ein paar Worte des Dankes und blickte durch den Eingang zurück auf die Straße. Die Hunde waren tatsächlich verschwunden.
Nun versuchte er, sich mit dem Mann zu verständigen. Er kramte ein Geldstück hervor und legte es auf einen der Ziegelsteine, von denen es in der Hütte mehrere gab. Danach wies er mit dem Zeigefinger auf einen Topf voller Hühnereier. Der Mann griff hinein, nahm eines heraus, schmiegte kurz seine Handflächen darum und reichte es Murad. Dann richtete er sich auf, soweit das möglich war, und bewegte sich auf Knien zur Feuerstelle. Während er Tee in ein Wasserglas füllte und es Murad hinhielt, flüsterte er auf die Alte ein, die aber kein Wort von sich gab.
Murad schlug das Ei auf einem der Steine auf und schlürfte es in einem Zug aus. Dann trank er den Tee, der den Geschmack in seinem Mund auslöschte. Der Geruch in der Hütte beruhigte ihn, denn mit seinem eigenen stand es nicht zum Besten. Der Mann kauerte sich wieder hin, und die beiden beobachteten Murad. Niemand unternahm auch nur den Versuch, ein Gespräch zu beginnen. Alles, was blieb, war lächeln. Was Murads schweifendem Blick erst jetzt auffiel, war, dass dem Mann der linke Unterschenkel fehlte und in der Nähe des Eiertopfes eine roh gezimmerte Krücke lehnte.
Er dachte an die frei stehenden Häuser, die man hier auf dem Land sehen konnte; dunkle Gemäuer mit hölzernen Fensterläden. Und oft lehnte sich ein verschlafen aussehender Mann aus einem dieser Fenster und sah den Bussen nach, während die Frauen in solchen verlorenen, ins steinige Land gesetzten Ortschaften um die Häuser herum immer tätig zu sein schienen. An einen dieser Verschlafenen erinnerte ihn dieser ruhige Mann mit den zerzausten Haaren. Diese Leute hier mussten allerdings sehr arm sein, einen anderen Grund gab es nicht für das Wohnen so weit abseits größerer Siedlungen. Gern hätte Murad jemandem mitgeteilt, was er empfand, als der Tee ihn aufwärmte. Doch er unterdrückte das starke Gefühl der Rührung, welches er seiner Schwäche zuschrieb.
Er verabschiedete sich von den Leuten und kroch aus der Hütte. Als er zur Straße hinaufkletterte, stand dort eine weitere Gestalt mit Krücken. Im blassen Licht hielt Murad sie zunächst für einen Felsbrocken. Dann aber spreizte sich ein Arm ab. Murad begrüßte den Jungen, blieb jedoch nicht stehen, sondern umging ihn wie ein natürliches Hindernis.
Entlang der Straße gab es noch mehr Verschläge von der Art, wie er ihn gerade verlassen hatte, aber nur dieser eine war beleuchtet. Das Gehen fiel ihm jetzt schwer, seine Knie waren unbeweglich geworden. Er spähte nach den Hunden, fand aber keine Spur mehr von ihnen. Dafür kamen ihm zwei traurige Gestalten entgegen. Sie waren so vermummt wie manchmal die Aussätzigen und blieben stehen, als er sie passierte. Murad konnte weder ihre Gesichter noch ihre Hände sehen, nur die Füße, die in Latschen steckten. Um an ihnen vorbeizukommen, hielt er sich nahe dem Hang, der hier mehr Bewuchs zeigte. Er fragte sich, was diese Leute wollten. Sie bettelten nicht und wirkten ebenso erstaunt über die Begegnung wie er. Ihre Köpfe drehten sich zu ihm um, als er sie passiert hatte. Er grüßte sie noch einmal und wandte dann endgültig den Blick von diesen Bündeln auf dürren Beinen.
Ein neues Geräusch trieb ihn voran. Es war schon in der Hütte zu hören gewesen, wurde jetzt aber klarer vernehmbar: Unten in der Schlucht rauschte der Fluss, und an diesem Fluss lag der Ort. Er musste an sein leeres, frisch gestrichenes Zimmer denken. Und wenn er dort wäre, fragte er sich, wie würde es dann weitergehen? Niemand wusste, wann der Bote wiederauftauchte, ob er überhaupt jemals wiederkäme. Dieser Mann aber war die einzige Verbindung Murads zu Naima, die in ihrem selbst gewählten, neuen Leben nichts ahnte von der Reise ihres Vaters, welche ein hilfloser Versuch war, sie zu retten. Aber wie rettet man jemanden, auch wenn man ihn noch so sehr liebt, vor dessen eigenen Wünschen? Er hätte sich augenblicklich, hier auf der kalten Straße, das Rudel Hunde noch immer irgendwo hinter sich, hineinsteigern können in seine Erinnerung an das Kind, das Naima gewesen war, ihre wache Schüchternheit, an Dutzende kleine Momente mit ihr, die ihm einfielen. Doch was änderte das daran, dass er sie nicht kannte, nicht so, wie sie jetzt war, die Frau eines Fremden, der wie sie, aber mit einer Waffe in der Hand, sein heilloses Glück in diesem heillosen Kalifat suchte? Nichts, es änderte nichts daran. Murad war bewusst, er hätte zu Hause in Deutschland warten können, dasitzen, aus dem Fenster starren und ausharren, bis sie eines Tages zurückkäme, ganz sicher verwandelt durch ihr düsteres Abenteuer und, so stellte er sich vor, mehr ernüchtert, als er es je gewesen war. Inmitten von Mord und Totschlag kann man nicht einfach nur reifen, man wird stumpf wie die Umgebung, in der man etwas wie Normalität aufbauen wollte, während Monat um Monat die Schreie der Sterbenden, Schüsse und Explosionen und natürlich auch die Furcht in der Luft liegen. Er musste wenigstens den Versuch unternehmen, Naima von diesem Alltag zu befreien, auch wenn es bedeutete, sie vollständig ins Unrecht zu setzen, sie zu behandeln wie eine Drogensüchtige, die man zur Vernunft bringen musste.
Dabei war sie selbst, jedenfalls nach ihren letzten Mitteilungen auf Facebook zu schließen, zutiefst davon überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. »Zum ersten Mal in meinem Leben«, schrieb sie dort, »bin ich konsequent gewesen.« Dieser Satz ging ihm nicht aus dem Kopf. Was meinte sie damit, wieso war es dieser jungen Frau so wichtig, konsequent zu sein? Im Gehen schüttelte er den Kopf und fragte sich, wer ihr das eingeredet haben mochte.
Seine Schritte, das gleichförmige Geräusch der Schuhsohlen auf der Straße, die ganze Monotonie der Lauftätigkeit durchsetzte sein erschöpftes Denken und gab ihm den Takt vor. Seine Gedärme hatten sich leer gespuckt, das war eine Erleichterung. Dafür aber musste er die nächste Stunde auf Beinen gehen, die zusehends schwerer und unbeweglicher wurden. Noch immer begleitete ihn die Angst vor den Hunden. Tief im Inneren verspürte er jedoch auch etwas wie einen kräftigenden Zorn. Er hatte genug von alldem, was aus unbeleuchteten Winkeln hervorquellen mochte, von alldem nutzlos Existierenden, das sich stets nur zeigte, um wieder zu verschwinden, und wimmelnd oder streunend irgendwo in dieser Riesenwelt weiterlebte.
Murad ging an baumhohen Sträuchern und hausgroßen Felsbrocken vorüber, hastete abwärts, wenn die Straße sich senkte und schaute nicht um sich, sondern lauschte nur dem Rauschen des Flusses. Was zunächst ein feines Geräusch gewesen war, verstärkte sich, wurde unregelmäßiger, definierter. Allmählich lösten sich Nebengeräusche davon ab, und in seinem Kopf entstand wie aus großer Ferne das winzige Bild des glucksenden und strudelnden Flusslaufs.
Schließlich kam er unten an, war an einem einzigen der vielen Berge hinabgekrabbelt und stand in der zerklüfteten Talsohle, bereit, wem auch immer alle Anstrengungen der letzten Stunden zu vergeben. Der Fluss war nah, neben der Straße erstreckte sich dunkler Grasboden bis zum Ufer. Ein leichter, vom Wind fein verteilter Kotgeruch war um ihn, also konnte der Ort nicht mehr weit sein, und wie zur Begrüßung meldete sich nun auch sein Darm wieder.
Er verließ endlich die Straße. Erst wollte er nur auf der weichen Erde gehen, dann zog es ihn doch zum Fluss. In der Dunkelheit irrte er voran, bis die Ufersteine vor ihm lagen. Das Wasser strömte dunkel und leicht dahin, und Murad versank knietief im Morast. Seine Füße rutschten ruckweise tiefer in die zähflüssige Masse und kamen nicht durch einen harten Untergrund zum Stehen, sondern durch das unter ihnen zusammengedrückte Weiche. Der Gestank ließ keinen Zweifel daran, worin seine Füße versanken. Kurz kam ihm der Gedanke, in den Fluss zu steigen, wenigstens die Beine hineinzuhalten. Aber es ergab keinen Sinn, wenn er danach wieder durch den Kot gehen musste. So stapfte er gleich voran, erreichte einen Kieselpfad und stand in der Kühle des anbrechenden Morgens in der Ortschaft, die ausgestorben schien bis auf ein paar Ziegen.
Murad wusste, dass er den Leuten im Gasthaus so nicht unter die Augen treten konnte. In der Kälte war der Gestank zwar nicht stark wahrnehmbar, aber das würde sich ändern, sobald er das Haus betrat. Er schritt die Straße entlang, bog in eine Lücke zwischen den Häusern und kletterte, dem dahinter beginnenden Pfad folgend, hangaufwärts. Seine Erschöpfung schien ihn für neue Anstrengungen unempfindlich gemacht zu haben. Mit der Vorstellung, dass er sich noch immer am Hang desselben Berges abmühte, stieg er weiter, kam an ein kleines Maisfeld und sah dahinter wieder eine Steigung, was ihm nun doch alle Kraft nahm. Er fiel zu Boden. Keinen Moment hatte er an die Wegstrecken gedacht, die im Ort noch vor ihm lagen. Von fern schien er so zusammengedrängt und winzig, dass Murad mit keinerlei Mühen mehr rechnete, sobald er dort sein würde. Einmal am Boden, ließen ihn seine Kräfte im Stich. Er kroch in das Feld, die jungen Maishalme sanken nieder und bildeten eine löchrige Matte, die ihn kaum vor der kalten Erde schützte.
Als er erwachte, stand die Sonne schon über den Gipfeln. Anfangs glaubte er, etwas läge auf ihm, dann bewegte er seine Glieder einzeln und keuchte dabei. Er erhob sich und versuchte, auf der harten Windelwurst zum Sitzen zu kommen, was ihm aber nicht gelang. Also stand er auf. Eine vermummte Frau schlich in Richtung der Häuser, ohne ihn zu beachten. Die schalenartig festgetrocknete Kleidung kratzte und behinderte ihn. Er verließ das Feld und ging außen herum.
Vor dem Gasthaus stellte er fest, dass niemand da war. Gut so, er konnte ohne Umstände in sein Zimmer und zunächst die Kekse aus dem Seesack holen und in sich hineinstopfen; die einzige Nahrung, die er länger als zwanzig Minuten bei sich behalten konnte. Danach begab er sich zum Brunnen, holte Wasser herauf und begann, sich zu waschen. Ihm kam in den Sinn, wie sehr ihn das Waschen auf den Reisen, ob unter einer Dusche, am Wasserfall oder am Brunnen, an den freieren Alltag zu Hause erinnerte. Unterwegs stand man nie nackt in reinigenden Strömen, immer war diese Verrichtung durch etwas behindert. So auch hier: Er wollte die Kleider erst wechseln, wenn er sauber war, daher musste er sich zunächst unter dem Panzer waschen, der sich nur widerstrebend von der Haut lösen ließ. Auf dem Platz vor dem Haus konnte er nicht riskieren, sich auszuziehen, da jeder Vorbeikommende ihn dort sehen konnte. Er entfernte endlich die Windel und eilte ins Haus.
Als er sich auf dem Holzbett ausgestreckt hatte, blieb ihm gerade genug Zeit, die groben Balken der Zimmerdecke zu betrachten, die wie eine furchteinflößende Zeichnung alte Brandspuren zeigten. Murad spürte noch die Taubheit in seinen Armen und Beinen, gleich darauf schlief er tief und traumlos.
Er erwachte, als einer der jungen Laufburschen des Hotelbesitzers gegen seine Zimmertür hämmerte. Immer wenn er das tat, glaubte man, es hätte einen Unfall gegeben. Diesmal jedoch war die Aufregung echt, Murad bemerkte den Ausdruck von Erleichterung im Gesicht des Jungen, als dieser den Hotelgast erkannte, der von seinem langen Ausflug zurückgekehrt war. Er bestellte einen Tee und sah den Jungen davonhasten, eilig, um die gute Nachricht so schnell wie möglich zu verbreiten.
Jetzt fühlte sich Murad, als wäre er verprügelt worden. Sein Nacken, die Schultern und Oberschenkel waren wie versteinert. Gebeugt und sehr langsam schleppte er sich zum Fenster hinüber, zog den Vorhang beiseite und blickte auf den Vorplatz hinaus. Es herrschte bereits trübes Nachmittagslicht, hier oben in den Bergen war es besonders trostlos, wenn der Himmel so dicht bewölkt war wie jetzt. Auf dem Hof standen ein halbes Dutzend ausrangierte und völlig verrostete Metallbetten, zusammengedrängt wie eine Herde. Die Berggipfel in der Ferne entfärbten sich bereits. Kein Zweifel, dachte Murad, es wird schon wieder Abend. Der Gedanke deprimierte ihn über die Maßen. Er schlich zum Bett zurück und streckte sich wieder darauf aus. Obwohl er dabei ächzte und stöhnte, empfand er keine Entspannung. Es war, als raste sein Körper von einer Position der Erstarrung in die nächste ein, er kam sich vor wie die Blechfigur aus dem Wizard of Oz, und im Moment, da er an diesen alten amerikanischen Film dachte, war er auch schon wieder bei Naima.
Es wäre ihm lieber gewesen, sie nur als das verwirrte Opfer mächtiger Bilder und Versprechungen sehen zu können. Dagegen sprach, das wusste er, ihre Liebesgeschichte mit jenem Franzosen, für die es mehr gebraucht hatte als den bloßen Austausch von religiösen Parolen und Videoclips. Sie hatte sich darauf eingelassen und eine Entscheidung getroffen. Aber da war noch mehr, dachte er jetzt, was er bisher ignoriert hatte. Sie ist starrsinnig geworden in den letzten Jahren, jedenfalls hatte ihm das ihre Mutter erzählt. Nicht nur, dass sie wie jeder Teenager alles besser wusste, nein, sie bekämpfte ihre Mutter regelrecht. Sie habe Wut aufgebaut, enorme Wut, sagte Dorothee mit sorgenvollem Blick zu ihm, als sie eins ihrer seltenen Gespräche führten. Er hatte das damals als einen weiteren von vielen Vorwürfen aufgefasst. Seit ihrer Trennung gab es nichts, was er hätte richtig machen können oder je richtig gemacht hatte. Und alles, was mit Naima zu tun hatte, war besorgniserregend oder gar bedrohlich, wenn Dorothee ihm davon erzählte. Naimas Leistungen in der Schule ließen nach, sie benahm sich aggressiv und abweisend gegen Freunde und Freundinnen, schließlich schottete sie sich ab, schwänzte die Schule und verschwand für ganze Tage.
Natürlich war Murad darüber besorgt gewesen, auch wenn er seiner Ex-Frau insgeheim unterstellte, die ganze Sache zu übertreiben. Aber es gab da noch etwas anderes, das er sich nur ungern eingestand. Er empfand eine stärker werdende Entfremdung von seiner Tochter. Das lag nicht allein an der Scheidung, sondern auch daran, dass dieses Mädchen in einem westlichen Land in die Pubertät kam. Dadurch hatte Naima gewissermaßen größeren Anspruch auf Selbstbestimmtheit. Sein eigener Vater hatte Murad gegenüber einfach nur die Grenzen markiert und ansonsten jede Persönlichkeitsveränderung in diesem Alter ignoriert. Naima aber, und das war für Murad ein quälender Gedanke, entwickelte sich hinein in eine Freiheit, von der er als ihr Vater kaum eine Vorstellung hatte. Ich war viel jünger als sie, als ich nach Deutschland kam, dachte er, und alles, was ich kannte, waren Familienzwänge, einige politische Phrasen und mein brennender Ehrgeiz, etwas aus mir zu machen.