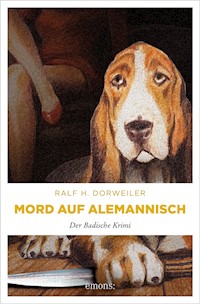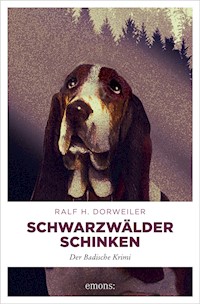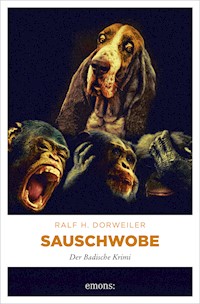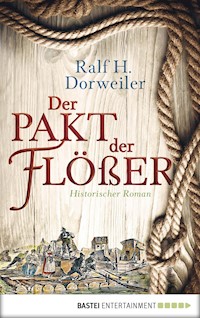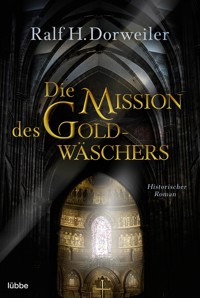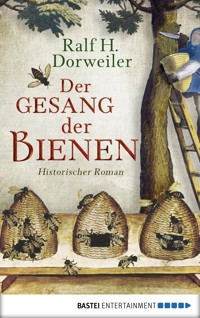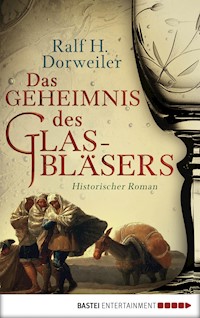9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Rieker und Ahrens
- Sprache: Deutsch
Der erste Fall für Rieker und Ahrens – ausgezeichnet mit dem Silbernen Homer 2025
Ein brutaler Mord erschüttert Hamburg. Und es bleibt nicht bei dem einen ...
Hamburg 1887. In einem Kontor wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt, die mit zahllosen Messerstichen getötet wurde. Der Fall wird zur Bewährungsprobe für den frisch zum Criminalcommissar beförderten Hermann Rieker. Bei seinen Ermittlungen trifft er auf Johanna Ahrens, Tochter eines Richters, die heimlich arme Frauen im Gängeviertel unterrichtet. Da Johanna in der Toten eine ihrer Schülerinnen erkennt, stellt sie auf eigene Faust Nachforschungen an. Dabei lernt sie einen Totenfotografen kennen, dessen Anatomiekenntnisse eine entscheidende Wendung für den Fall bringen. Doch als ein weiterer Mord die Hafenstadt erschüttert, wird klar: Der Täter kann jeden Moment erneut zuschlagen ...
Düster, atmosphärisch, atemberaubend spannend – der erste Fall für Criminalcommissar Hermann Rieker und Richterstochter Johanna Ahrens.
»Ein atmosphärischer und spannender historischer Krimi. Die Protagonisten überzeugen und ergänzen die Handlung mit Charme und Charisma.« Histo Couch
»Ein spannender und im besten Sinne unterhaltsam konstruierter historischer Kriminalroman (…). Zum Schluss überrascht Ralph H. Dorweiler noch mit einem besonderen Kniff und einer weiteren Anknüpfung an historische Ereignisse.« Krimi Couch
»In ›Der Herzschlag der Toten‹ verbindet Ralf Dorweiler die Entwicklung der Fotografie in der Kriminalistik mit einem fesselnden fiktiven Verbrechen zu einem historischen Krimi.« Literatur Radio Hörbahn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Hamburg 1887. Kurz nach seiner Beförderung zum Criminalcommissar wird Wilhelm Rieker mit seinem ersten eigenen Fall betraut: In einem verlassenen Kontor wurde eine Frauenleiche mit zahllosen Messerstichen im Rücken aufgefunden. Rieker steht vor einem Rätsel. Unterstützung bekommt er ausgerechnet von Johanna Ahrens, der Tochter eines wohlhabenden Richters. Johanna betreibt heimlich eine Schule für bedürftige Frauen und vermisst seit ein paar Tagen eine ihrer Schülerinnen. Sie identifiziert die Tote bei der Leichenschau – und lässt sich zu Riekers Unmut nicht davon abbringen, sich immer wieder in seine Ermittlungen einzumischen. Ein Totenfotograf, der das Mordopfer in Johannas Auftrag ein letztes Mal ablichten soll, liefert schließlich den entscheidenden Hinweis. Doch dann erschüttert ein weiterer Mord die Hafenstadt …
Autor
Ralf H. Dorweiler studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Köln, arbeitete als Schauspieler, im Management für internationale Konzerne und schließlich als Redakteur bei einer großen Tageszeitung. 2006 erschien sein erster Roman. Mittlerweile ist er hauptberuflicher Schriftsteller und lebt mit seiner Frau in Bad Pyrmont.
Ralf H. Dorweiler
Der Herzschlag der Toten
Historischer Kriminalroman
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe Oktober 2024
Copyright © 2024 by Ralf H. Dorweiler
Copyright © dieser Ausgabe 2024 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Umschlagmotive: © Mark Owen / Arcangel Images, © Vintage Germany; © FinePic®, München
Redaktion: Beate De Salve
LS · Herstellung: ik
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-31238-1V002
www.goldmann-verlag.de
Prolog
Donnerstag, 21. April 1887
»Eddi!«
Der unterdrückte Ruf und ein Rütteln an der Schulter weckten ihn nur langsam aus seinem traumlosen Schlaf.
»Eddi, wach auf!«
Verstört wandte er sich in der Dunkelheit in die Richtung von Paule, der ihn immer stärker schüttelte. Er spürte den Atem des Kumpans an seinem Ohr, eine abstoßende Mischung aus Fäulnis und zu viel von dem billigen Kümmel, den sie bis spät in die Nacht zusammen getrunken hatten.
Eddie wich mit dem Kopf zurück. »Was ist denn los?«
»Psst«, flüsterte Paule alarmiert. »Da ist jemand.«
»Paule, glaub mir, hier kann niemand sein.«
»Wir sind doch auch hier.«
Diesem Argument konnte Eddi sich nicht verschließen. Schwerfällig stemmte er sich in eine sitzende Position und lauschte in die Dunkelheit.
»Ich kann nichts hören«, sagte er nach ein paar Sekunden kraftlos und ließ sich wieder zu Boden sinken. Die Kälte aus dem Fundament kroch durch seine Decke und drang durch die feuchte Kleidung. Das war Gift für sein Bein. Er versuchte, den Schmerz nicht zu beachten. Am besten wäre jetzt ein Schluck aus der Pulle, aber die hatten sie längst ausgetrunken.
»Doch, da war was«, beharrte Paule, immer noch flüsternd. »Hier ist eben einer vorbei!«
»Das hast du bestimmt nur geträumt«, versuchte Eddi, ihn zu beschwichtigen. »Oder es war eine Ratte, die …«
Er stockte und setzte sich wieder aufrecht. Ein leises, entferntes Quietschen drang an seine Ohren. Wie von einer nicht geölten Tür. Schon war es wieder still. Vielleicht ein Wachmann? Oder ein Säufer, der – ebenso wie sie – bei diesem Dreckswetter einen trockenen Unterschlupf suchte? Beides war nicht gut, denn beides versprach nichts als Ärger. Auf jeden Fall mussten sie sich bereit machen, das alte Kontor notfalls schnell zu verlassen.
»Was sollen wir jetzt tun?«, wollte Paule wissen. Er war zwar der Ältere von ihnen, überließ Entscheidungen aber gerne seinem Kumpel.
Eddi zuckte mit den Schultern, doch dann wurde ihm bewusst, dass Paule das in der Dunkelheit nicht sehen konnte. Sie brauchten Licht. Er tastete nach den Phosphor-Streichhölzern in seiner Tasche und der kleinen Petroleumlampe, die neben seinem Kopf stehen musste. Es dauerte einen Moment, bis er den Zündkopf entflammt hatte und beißender Rauch aufstieg. Dann öffnete er das Frontglas der Lampe und hielt die schon wieder kleiner werdende Flamme an den Docht. Das Feuer fraß sich bald fest.
Ein schwacher rötlicher Schein beleuchtete Paules schiefe Visage. Mit zusammengekniffenen Augen starrte er Eddi fragend an. Seine Tränensäcke warfen lange Schatten über die Wangen bis zu seinem schmutzigen Bart.
»Wenn es ein Wachmann ist, müssen wir vielleicht rennen«, sagte Eddi. »Mach dich fertig. Aber leise!«
Er stellte seine Stiefel bereit und stemmte sich mithilfe seiner alten Krücke hoch. Dieser verdammte Schmerz! Es kam ihm vor, als würde sein Bein immer steifer. Er glitt in das Schuhwerk, während Paule hektisch die Decken zusammenrollte.
Beide verharrten gleichzeitig in ihrer Bewegung, wie eingefroren. Da war es wieder. Dieses Quietschen. Ein Blick zu Paule bewies ihm, dass der alte Säufer es ebenfalls gehört hatte. Eddi legte einen Finger auf die spröden Lippen.
Klock, klock, klock … Schritte. Schwere Schritte, die sich ihnen näherten. Er presste erneut den Zeigefinger auf den Mund. Paule nickte stumm und biss sich auf die Unterlippe.
Die Schritte wurden immer lauter. Schwere Sohlen hallten auf kaltem Stein. Eddi konnte das Weiße in Paules Augen erkennen. Schnell breitete er eine Wolldecke über die Lampe, bis nur noch ein tiefroter Schein durch das dichte Gewebe drang. Es sah aus wie ein letztes Stück Glut in der Asche eines Lagerfeuers. Licht verströmte sie keines mehr. Eddi starrte trotzdem wie ein Kaninchen vor der Schlange auf die Tür. Durch den Spalt am Boden erschien ein schwacher Lichtstreif. Die Schritte klangen schon ganz nah. Eddi war wie gelähmt. Klock, klock, klock …
Genau vor ihrer Tür setzte das Geräusch aus. Das Licht unter dem Türspalt war jetzt stärker, lief wie eine Pfütze in ihre Zuflucht hinein. Eddi spürte, wie ihm trotz der Kälte Schweiß auf die Stirn trat. Es gab keinen zweiten Ausgang, deswegen hatten sie diesen Raum ja gewählt. Sogar die hohen, schmalen Fenster waren mit Brettern vernagelt. Vor der Tür erklang ein Räuspern. Was machte der Mann da nur? Paule zog neben Eddi die Nase hoch. Nicht jetzt!, beschwor er ihn mit einem Knuff des Ellenbogens.
Bis auf das Pochen seines Pulses in den Ohren herrschte absolute Stille. Wie damals vor dem Angriff. Sie hatten gewusst, dass die Franzosen auf der anderen Straßenseite auf sie warteten, aber die Soldaten waren weder zu sehen noch zu hören gewesen. Bis sie plötzlich losschlugen. Sein Bein schmerzte, als zerschmettere ihm die Kugel den Knochen ein zweites Mal. Er biss die Zähne zusammen, um nicht laut aufzuschreien. Tränen der Anstrengung traten ihm in die Augen.
Klock, klock, klock … Endlich, der Mann ging weiter! Jetzt erst merkte Eddi, dass er die Luft angehalten hatte. Mit dem Atem drang ein leises Wimmern aus seinem Mund. Auch Paule seufzte erleichtert und setzte an, etwas zu sagen, doch Eddi hieb ihm erneut den Ellenbogen in die Seite.
Die Schritte verhallten. Eddi zitterte vor Anspannung. Er nahm einen eigenartigen Geruch wahr. Die Lampe! Hastig hob er die Wolldecke an. Zuerst blendete ihn das Licht, doch dann fiel sein Blick auf die Stelle, wo der Wollstoff auf dem Hitzeabzug gelegen hatte, und er erkannte, dass sie kurz vor dem Ankokeln war.
Er ließ die Decke zu Boden sinken und rieb sich das Bein, bis das Stechen wieder erträglich wurde. Dann ging er zur Tür und öffnete sie einen kleinen Spalt. Von dem Mann war nichts zu sehen. Weit weg hörte Eddi eine Tür zuschlagen.
»Verdammter Möwendreck!«, fluchte Paule und kratzte sich den schmutzigen Schädel. »War das ein Wachmann?«
Eddi zuckte mit den Schultern, nahm die Lampe auf und wandte sich im Flur in die Richtung, aus der das Quietschen gekommen war.
»Eddi?« Paule klang ängstlich. »Was hast du vor?«
»Nachsehen, was er hier wollte«, gab er zurück.
Ob ein Einbrecher das leere, abrissreife Kontor nutzte, um hier seine Beute zu verstecken? Eddi malte sich einen Seesack voll mit Goldschmuck und Silberbesteck aus. Falls sie einen solchen Schatz fanden, würde er sich für die unterbrochene Nachtruhe eine Entschädigung holen.
Paule nahm ihr Gepäck auf und folgte ihm. Der Gang machte einen Knick. Auf der einen Seite befanden sich feste Türen, auf der anderen Holzverschläge, deren Gattertore offen standen. Der Boden war voller Dreck. Alter Staub, heruntergefallener Putz, dazu Köttel von Ratten und Mäusen. Irgendwo drang Wasser durch das Mauerwerk. Eddi erkannte eine Spur von großen, breiten Stiefeln – die eines Hafenarbeiters? Die Abdrücke mussten von dem Unbekannten stammen und führten zu einer der Türen.
»Was, wenn der Kerl zurückkommt?«, fragte Paule.
Eddi hatte sich darüber noch keine Gedanken gemacht, zögerte aber nur kurz. Sie würden nachsehen, mitnehmen, was sie tragen konnten, und schnell wieder verschwinden.
Die Klinke, an der die Spur endete, hakte ein wenig, ließ sich dann aber doch hinunterdrücken. Die Tür war nicht abgeschlossen. Eddi schob sie mit der Krücke auf und erkannte am Quietschen, dass sie hier richtig waren. Mit rasendem Herzschlag hob er die Lampe an. Ihr Licht zitterte über Boden und Wände, dann fiel es auf weiße Haut. Schiet! Da war noch jemand! Eddi machte einen Satz zurück und stieß gegen Paule, der vor Schreck ein überraschtes Quieken von sich gab.
»O Gott!«, rief Eddi.
»Was ist?« Paule spähte an ihm vorbei. »O Gott«, stieß dann auch er hervor. »Was hat sie? Hallo? Fräulein?«
»Sie kann dich nicht mehr hören, du Köömbroder«, schimpfte Eddi und näherte sich vorsichtig der jungen Frau.
Sie saß vollkommen nackt und mit weit gespreizten Schenkeln gegen die Wand gelehnt. Blond war sie und sicher einmal hübsch gewesen. Mit gebrochenem Blick starrte sie zur Tür. Der Mund stand weit offen und entblößte weiße Zähne.
Paule ließ sein Bündel zu Boden fallen, ging zu ihr und rüttelte sie an der Schulter. »Lebst du noch, Fräulein?«
»Spinnst du? Fass sie nicht an!«
Doch es war zu spät. Der Kopf sank ihr wie in Zeitlupe auf die Brust und zog den Oberkörper mit sich nach vorne. Sie kippte um wie ein Sack Getreide.
»Schiet!«, fluchte Paule. »Die lebt nicht mehr. Leuchte mal hier!«
Eddi kam der Aufforderung nach und hob die Lampe. Im flackernden Licht sah er die Wunden am Rücken nun auch. Vor Schreck wäre ihm beinahe die Krücke aus der Hand gerutscht. Furchtbar!
»Das arme Kind«, flüsterte Eddi. »Die war höchstens zwanzig. Wer hat ihr das nur angetan?«
»Der Kerl von eben natürlich«, stellte Paule fest. »Komm, lass uns schleunigst abhauen!«
»Aber wir können sie doch nicht einfach so im Dunkeln allein lassen«, gab Eddi zurück. »Wir müssen die Udel holen.«
»Wir gehen garantiert nicht zur Polizei«, beschwor Paule ihn. »Zwei Suffbrüder wie wir, da ist die Sache für die doch gleich geklärt. Bevor du dich umsiehst, stehen wir beide vorm Scharfrichter!« Er fuhr sich mit dem Daumennagel quer über die Kehle.
Paule hatte recht. Und doch konnte Eddi die junge Frau nicht einfach so zurücklassen.
»Was, wenn ihre Seele noch in ihr steckt?«, fragte er.
Paule bekreuzigte sich. »Tot ist tot«, stellte er lapidar fest.
»Trotzdem können wir sie nicht so lassen«, sagte Eddi. »Komm, hilf mir mal.«
Kapitel 1
Donnerstag, 21. April 1887
O Tod, du alter Kapitän, es ist Zeit, den Anker zu lichten.
Die Länder hier langweilen uns, o Tod! Wir wollen zur See!
Wenn Himmel und Meer sich mählich tintenschwarz verdichten,
Sind unsere Herzen, du kennst sie, voll Strahlen, ohne Weh!
»Johanna Ahrens!«
Die strenge Stimme ihrer Mutter riss sie aus der bittersüßen Lektüre. Es gelang ihr gerade noch, den Band mit Baudelaires Gedichten unter dem Stoff des Unterkleides zu verbergen, bevor die Tür aufschwang.
»Du bist ja immer noch nicht fertig, Kind! Du hast doch nicht etwa wieder gelesen? Wo ist das Fräulein Anderson? In einer Viertelstunde fahren wir ab. Und es regnet immer noch.«
Ohne eine Antwort ihrer Tochter abzuwarten, rauschte Minna Ahrens wieder aus dem Ankleidezimmer hinaus. Sobald die Tür geschlossen war, befreite Johanna das Buch aus seinem Versteck und ließ sich wohlig zurück ins Sofapolster sinken. Sie suchte kurz die richtige Seite, um auch den zweiten Teil des Gedichts zu lesen:
Gieß ein, mach uns Mut, dein Gift in vollen Zügen zu trinken!
Wir möchten – unsere Hirne stehen in helllichtem Brand –,
ganz gleich ob Himmel oder Hölle, in Abgründe sinken,
das Neue finden in der Tiefe des großen Unbekannt!
Ergriffen schloss sie das Buch, drückte es an ihre Brust und atmete tief ein. Baudelaire! Der Tod war bei ihm kein dunkler Fährmann, sondern ein Kapitän, den man auf seinen abenteuerlichen Reisen begleiten wollte.
Sie versuchte, die Tränen zu unterdrücken, die sie aus tiefstem Herzen in sich aufsteigen fühlte. Wenn sie weinte, würden nur das dezent aufgelegte Rouge und die Wimperntusche verlaufen. Sie sprang auf und fächelte sich mit beiden Händen Luft zu.
Solche Männer wie Baudelaire gab es heute leider nicht mehr. Wäre zu erwarten, bald eine ihm verwandte Seele zu treffen, sie würde sich freudig von der Mutter verkuppeln lassen.
Das Neue finden in der Tiefe des großen Unbekannt!
Ach, wäre heute Abend doch nur einer dabei, der diese Zeile so sehnsuchtsvoll verstünde wie sie.
Sich schnell nähernde Schritte lenkten sie von ihren Gedanken ab. Es klopfte zaghaft an die Tür.
»Verzeihen Sie, Fräulein Johanna. Ihre Frau Mutter lässt ausrichten, dass sie mich gleich wieder entlassen wird, wenn Sie nicht in fünf Minuten für das Fest fertig angekleidet sind«, sagte Anita Anderson mit wackliger Stimme. Das schüchterne dänische Dienstmädchen befand sich erst seit einer knappen Woche bei ihnen in Anstellung. »Ich flehe Sie an, lassen Sie mich Ihnen doch helfen!«
Johanna hatte ihr vorhin bedeutet, sich alleine ankleiden zu wollen. Aber sie wollte auch nicht, dass Anita ihre Stelle verlor, also gab sie nach.
Knapp zehn Minuten später schritt sie abfahrbereit die Treppe ins Vestibül hinunter. Ihre Mutter zupfte am Mantel des Vaters herum, der längst perfekt saß, doch als Richter Hans Ahrens seine Tochter bemerkte, löste er sich aus den Fängen seiner Frau und winkte Johanna zu.
Auch ihre Mutter blickte nun auf. »Endlich, Kind! Wir kommen noch zu spät.«
»Das Warten hat sich jedenfalls gelohnt«, sagte der Vater stolz. »Die jungen Männer werden Schlange stehen, um sich auf deine Tanzkarte einzutragen.«
»Danke, Papa. Du siehst aber auch sehr stattlich aus«, gab sie das Kompliment zurück. Das brachte ihr von ihm ein Lächeln, von ihrer Mutter jedoch einen mahnenden Blick ein.
»So zu reden geziemt sich nicht für eine Frau«, sagte sie. »Sei züchtig, benimm dich respektvoll, und lass vor allem die Männer stets ausreden.«
»Das klingt ja beinahe, als wären Männer wertvoller als Frauen!«
»Ach, Johanna. Das werden wir jetzt nicht ein weiteres Mal ausdiskutieren«, sagte ihre Mutter erschöpft. »Los, fahren wir. Kutscher!«
Der melodiöse Rhythmus des langsamen Walzers brachte die Thienemann-Zwillinge dazu, ihre fülligen Oberkörper im Takt zu wiegen. Die beiden saßen gemeinsam mit Johanna am Rand der Tanzfläche an einem runden Tisch und strahlten sich gegenseitig an.
»Schön, oder?«, schwärmte Margarete.
»Was für ein gelungenes Fest!«, stimmte ihre Schwester Patrizia zu und rückte das Perlendiadem auf ihrem widerspenstigen Haar zurecht.
Johanna kannte die beiden jungen Frauen seit Kindertagen. Ihr Vater handelte mit Tee und exotischen Gewürzen und hatte das Geschäft zu einem kleinen Imperium ausgebaut. Die Zwillinge waren sein Ein und Alles.
»Es leert sich langsam«, mäkelte Margarete und wies auf die Tanzfläche, auf der lediglich noch vier Herren mit ihren Tanzpartnerinnen über das Parkett schwebten.
»Vorhin konnte man sich kaum bewegen, ohne dass einem jemand gegen den Knöchel trat«, pflichtete Patrizia ihr bei.
»Und die Schlange beim Fotografen war so lang, dass ich des Wartens bald überdrüssig war«, klagte Johanna.
Dass man an diesem Abend in einem Nebenraum Aufnahmen von sich machen lassen konnte, war neben der Musik einer der Höhepunkte des Festes von Deputationsrat Eulenbrinck gewesen.
»Wir haben uns …«, begannen die Thienemann-Schwestern gleichzeitig, was sie zum Kichern brachte.
»… erst gar nicht in der Schlange angestellt«, beendete Patrizia den Satz. »Als im letzten Monat unsere Großtante Elvira verstorben ist – Gott hab sie selig –, hat Papa einen Totenfotografen beauftragt.«
Margarethe übernahm: »Der Herr Eilers ist ein wahrer Künstler. Auf seiner Fotografie sieht die Großtante aus, als stünde sie mitten im Leben.«
Die Zwillinge wiegten begeistert die Köpfe hin und her.
»Und ihr habt euch von diesem Totenfotografen ablichten lassen?«, fragte Johanna entsetzt.
Margarete winkte ab. »Er macht auch Aufnahmen von Lebenden. Sie sind wirklich gelungen.«
Der Walzer fand ein Ende. Höflich applaudierten alle drei – ebenso wie die Tanzpaare und ein paar weitere Besucher des Festes – den Musikern, die gleich zu einem neuen Stück ansetzten.
»Neigt sich das Repertoire der Kapelle etwa dem Ende zu?«, fragte Johanna spöttisch. Sie war sich sicher, bereits zu Beginn des Abends zu diesem Lied getanzt zu haben.
Patrizia und Margarete überhörten Johannas Kritik und schauten strahlend aufs Parkett. Die Zwillinge hatten heute meist als Schwesternpaar getanzt. Nur wenige Herren hatten sich auf ihre Tanzkarten eintragen lassen, aber das störte die beiden kaum. Sie waren sich eigentlich selbst genug. Nur ab und zu beschwerten sie sich, dass ein Mann, der ihnen gefiel, keinen Zwillingsbruder hatte. Obwohl Johanna die beiden nett fand, waren sie nie wirklich enge Freundinnen geworden.
Nun saß sie in Ermangelung anderer Zerstreuung bei den beiden und fühlte langsam Müdigkeit in sich aufsteigen. Es war schon nach Mitternacht. Ein Wunder, dass ihre Eltern sie noch nicht zum Gehen drängten.
»Was machen unsere Väter nur so lange im Herrenzimmer?«, fragte sie, um das Gespräch in Gang zu halten.
»Sie rauchen, trinken, besprechen Geschäfte und machen Politik«, mutmaßte Margarete, und ihre Schwester nickte.
»Wahrscheinlich«, sagte auch Johanna. »Und Mutter sitzt bei den Damen und ärgert sich, dass ich einer standesgemäßen Hochzeit immer noch kein Stück näher gekommen bin.«
Die Zwillinge kicherten.
»Ich hatte den Eindruck, dass dir dieser Herr aus Bremen gefallen hat«, zog Patrizia sie auf.
»Frederik von Reusenhage«, ergänzte Margarete gedehnt.
»Ach was!« Johanna winkte ab.
Der Sohn eines Bremer Reeders war ein neues Gesicht in Hamburg und alleine deshalb schon interessant. Er hatte sie dreimal zum Tanz aufgefordert. Mit vierundzwanzig war er nur ein Jahr älter als sie, und Johanna musste zugeben, dass er ganz stattlich aussah. Tanzen konnte er allerdings nicht so gut. Viel wichtiger war ohnehin, dass er sowohl Baudelaire als auch Poe kannte und schätzte. Einen so interessanten Mann hatte ihre Mutter ihr vorher noch nie vorgestellt. Sie hatte Johanna förmlich dazu gedrängt, mit ihm zu tanzen. Doch Frederik hatte beim Walzer für ein Mädchen aus Braunschweig geschwärmt und Johanna um eine Einschätzung seiner Erfolgsaussichten aus weiblicher Sicht gebeten. Sicher würde seine Angebetete ihn gerne erhören, hatte sie ihm versichert.
»Darf ich bitten?«
Johanna schaute überrascht auf und blickte in ein Paar tiefblaue Augen. Sie gehörten zu einem Mann Mitte dreißig, groß gewachsen, mit breiten Schultern. Sein grau melierter Bart wirkte etwas altbacken, aber die Selbstsicherheit, mit der er ihr die Hand entgegenhielt, gefiel ihr. Sie machte allerdings keine Anstalten, sie zu ergreifen.
»Es gehört sich eigentlich, dass ein Herr sich einer Dame bekannt macht, bevor er sie zum Tanz bittet«, sagte sie betont kühl.
Er zog die Hand zurück, nahm eine aufrechte Haltung ein und schlug die Hacken so heftig aneinander, dass die Sohlen seiner frisch geputzt wirkenden Schuhe lautstark gegeneinanderstießen. So sauber die Schuhe auch waren, fiel Johanna doch auf, dass die Hose unten Falten und ab der Höhe des Schienbeins einen leicht schmutzigen Rand aufwies.
»Verzeihen Sie, meine Damen. Staatsanwalt Norbert Schermann. Sehr erfreut.« Er machte einen Diener und bot Johanna erneut die Hand dar. »Da der Vorstellung meiner Person damit Genüge getan sein sollte und ich nun kein Fremder mehr für Sie bin, darf ich vielleicht einen erneuten Anlauf wagen, Sie um den nächsten Tanz zu bitten?«
Johanna zögerte, doch dann bemerkte sie, dass ihre Mutter die Szene skeptisch von ihrem Platz aus beäugte. Offenbar hatte sie den Mann nicht zu ihr geschickt. Das war schon einmal ein Punkt, der für ihn sprach. Außerdem war sie neugierig. Eigentlich kannte sie die meisten Menschen aus dem beruflichen Umfeld ihres Vaters, aber dieser Norbert Schermann war ein geheimnisvoller Fremder, und das reizte sie.
Im Aufstehen legte sie die behandschuhte Rechte in seine breite Hand und folgte ihm auf die Tanzfläche.
»Darf ich nun auch Ihren Namen erfahren?«, fragte er, während das alte Lied ausklang.
»Johanna Ahrens.«
Er legte die Rechte an ihre Taille und hielt ihr die Linke hin. Johanna ergriff sie. Der Tanz begann.
»Sind Sie verwandt mit Richter Hans Ahrens?«
»Er ist mein Vater.«
»Ein äußerst ehrenwerter Mann, wie man hört.«
Er bewegte sich schnell und sicher auf dem Parkett.
»Sie kennen ihn nicht persönlich?«, fragte sie nach.
»Ich hatte noch nicht das Vergnügen«, bemerkte er und bremste, damit sie nicht gegen ein anderes Paar stießen.
»Dann sind Sie offenbar noch nicht lange in Hamburg tätig«, stellte Johanna fest.
»Gerade mal seit einem Vierteljahr«, bestätigte er.
»Und woher stammen Sie?«
»Aus Berlin.«
»Aus der Hauptstadt, soso. Und was treibt Sie zu uns an die Waterkant?«
Er leitete eine Solodrehung für sie ein und gab ihr einiges an Schwung mit. Beinahe hätte sie das Gleichgewicht verloren, doch er nahm sie zum rechten Zeitpunkt wieder in Empfang.
»Hoppla! Ich hoffe, ich bin Ihnen nicht zu grob. Ich tanze nur selten.«
»Sie tanzen sehr gut«, versicherte sie.
»Nicht halb so gut wie meine bezaubernde Tanzpartnerin.«
»Kein Wunder, dass Sie Staatsanwalt geworden sind«, sagte Johanna lächelnd.
»Wie meinen Sie das?«
»Ebenso wie beim Tanz führen Sie auch beim Gespräch souverän in die Richtung, die Ihnen gerade genehm ist.«
Als er sie fragend anblickte, fügte sie hinzu: »Sie haben vermieden, mir zu erklären, was Sie nach Hamburg geführt hat.«
Er lachte demonstrativ auf. »Ach das! Da gab es nichts zu vermeiden. Es tut mir leid, dass Sie diesen Eindruck gewonnen haben. Nun, es handelte sich schlicht um eine berufliche Angelegenheit. Ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte.«
Er führte sie erneut in eine Drehung, diesmal vorsichtiger. Der Mann lernte dazu.
»Und wieso treffen Sie erst jetzt hier ein? Das Fest hat doch seine beste Zeit längst hinter sich.«
»In Ihren Armen fühlt es sich fast so an, als stünde man vor der Anklage«, gab er grinsend zurück.
Johanna errötete, als er davon sprach, sich in ihren Armen zu befinden.
»Sie haben meine Frage schon wieder nicht beantwortet«, stellte sie fest.
»Sie haben recht. Ich war heute bis spät mit einem Fall beschäftigt.«
»Etwas Aufregendes?«, fragte sie neugierig.
»Wahrscheinlich nicht«, gab er kurz angebunden zurück. »Ich dürfte ohnehin nicht darüber sprechen.«
»Ich wette, dass es etwas Aufregendes war. Zum Glück konnten Sie noch die Stiefel gegen die Tanzschuhe tauschen.«
Er wirkte überrascht. »Wieso denken Sie, dass ich Stiefel trug?«, fragte er konsterniert.
»Ihre Hosenbeine weisen bis zu den Waden Falten auf, so als hätten sie in Stiefeln gesteckt. Sie sind aber trocken, während der Stoff darüber den Anschein macht, als wäre er feucht und etwas schmutzig geworden.«
»Sie sind eine genaue Beobachterin«, sagte er und leitete eine erneute Drehung ein, aus der heraus er in eine Promenade überging. Die letzten Takte drehte Schermann regelrecht auf und präsentierte eine Figur nach der anderen, sodass sie sich nicht mehr unterhalten konnten.
Schließlich endete das Stück, und Johanna spürte, dass ihre Wangen von der Bewegung errötet waren.
»Ich danke Ihnen für den Tanz, Fräulein Ahrens«, sagte der Staatsanwalt mit einer knappen Verbeugung. »Einen schönen Abend noch.«
»Einen schönen Abend«, brachte Johanna irritiert heraus und sah dem Mann nach. Schnieke war er – und ihr ein Rätsel geblieben. Sie war gar nicht dazu gekommen, ihn zu fragen, ob er Baudelaire kannte.
Kapitel 2
Freitag, 22. April 1887
Hermann Rieker wartete bei geöffneter Tür im Inneren der Kutsche. Es regnete. Seit Tagen schon zogen tiefgraue Wolken über die Stadt und wurden nicht müde, wahre Fluten über Hamburg abzuwerfen. Kräftiger Wind von der See schob beständig Nachschub heran. Auf der Straße suchten kleine Sturzbäche ihren Weg zum nächsten Straßenablauf in den Kanal, der kaum mit dem Schlucken nachkam. Die Regenrinne am Dach des alten Gebäudes vor Rieker lief bereits an mehreren Stellen über. Mit lautem Plätschern stürzte die Flut auf die Straße.
Zwei Constabler mit bis zur Pickelhaube hochgestellten Uniformkragen und ein Sergeant mit umgeschnalltem Degen hielten vor dem Eingangstor Wache und passten auf, nicht unter die Wasserfälle zu geraten. Einer der Polizisten stritt mit zwei Bauarbeitern.
»Ihr könnt sicher den ganzen Tag nicht rein«, drangen seine Worte trotz des lauten Prasselns auf das Kutschendach an Riekers Ohren. »Die Leiche liegt noch drinnen. Vielleicht morgen wieder.«
»Herr Commissar!« Das war die Stimme von Manuel Kracht. Der Criminalsekretär kam mit einem aufgespannten Regenschirm herbeigelaufen und klappte den Tritt an der Kutsche für seinen Vorgesetzten herunter. »Ganz schönes Schietwetter heute wieder, was?« Er hob den Schirm hoch über die Kutschentür.
»Wann wurde die Leiche gefunden?«, fragte Rieker ohne Umschweife. Er stieg aus und achtete darauf, mit seinen blank geputzten Oxford-Schuhen nicht in eine zu tiefe Pfütze zu treten. Den Gehstock setzte er nicht auf dem Boden ab.
»Um halb acht, von einem Arbeiter«, gab Kracht zurück.
»Schirm!«, mahnte Rieker, denn einige Regentropfen trafen auf seine rechte Schulter, sodass der teure Mantel nass wurde.
Kracht kippte den Schirm noch etwas weiter. Rieker bedauerte nur kurz, dass es nun der Junge war, der den Regen abbekam. So funktionierten Hierarchien eben, egal ob bei der Hamburger Criminalpolizei, der Armee oder sonst wo im Kaiserreich.
»Sie haben den Mann hierbehalten?«
»Er hat nichts Besonderes gesehen.«
»Also haben Sie ihn gehen lassen.«
»Ich dachte …«, begann Kracht, doch Rieker ließ ihn nicht ausreden.
»Was hat der alte Kleinschmidt immer gesagt?«
»Das Denken soll man den Commissaren überlassen«, zitierte Kracht kleinlaut.
Das laute Plätschern auf dem gespannten Stoff verschluckte die nächsten Worte. Erst als sie das Eingangstor erreichten, wurde es stiller.
Rieker trat durch die Tür, überprüfte den Sitz seines Anzugs und richtete den Binder.
»Sie haben also mit dem Arbeiter gesprochen, der die Leiche gefunden hat?«, riet er. Ohne die Antwort abzuwarten, fügte er hinzu: »Wo müssen wir hin?«
Überall lagen Bauschutt und Werkzeuge herum. Eine Schubkarre lehnte neben einem Sandhaufen an einer Wand, und durch eine ausgehängte Tür sah Rieker einen Berg von abgeschlagenem Putz. Staub und Dreck waren allgegenwärtig. Während er das wirre Durcheinander an Spuren auf dem Boden betrachtete, registrierte er beiläufig, dass der Glanz seiner Schuhe bereits von einer schmutzigen Mattheit überzogen war. Sie gelangten zu einem Treppenhaus. Breite Stufen führten nach oben. Die in den Keller waren schmaler gebaut.
»Nach unten«, erklärte Kracht. »Der Arbeiter hatte dort eigentlich nichts mehr zu tun. Er hat nur einen Hammer vermisst und gedacht, er hätte den vielleicht im Keller liegen gelassen.«
Rieker war wenig begeistert. Er konnte Keller nicht ausstehen. Alleine beim Blick hinab schlug sein Herz schneller, und sein Mund wurde trocken.
»Wie viele Leute sind hier heute schon durchgelaufen?«, fragte er. Im Schmutz auf den Stufen waren einige Schuhabdrücke zu erkennen.
Kracht schluckte. »Eine Menge. Zuerst der Arbeiter, dann seine Kollegen, vier oder fünf. Danach haben sie einen Wachmann gerufen, und der Vorarbeiter ist mit runter. Und später natürlich die Polizei.«
»Wie viele Beamte?«
»Ich, ein Sergeant und drei Constabler.«
»Dann ist die Spurenlage also unwiederbringlich zerstört«, fasste Rieker gepresst zusammen. »Eigentlich sollten Sie mittlerweile wissen, dass eine möglichst unberührte Spurenlage der Schlüssel zum Ermittlungserfolg ist.«
»Ich konnte nichts dafür«, verteidigte Kracht sich.
Rieker schwieg dazu. Er nahm sich eine brennende Öllampe, die auf einem Hocker am Treppenabgang stand, und leuchtete auf die Stufen vor sich. Aufmerksam suchte er den Boden ab, bevor er zögerlich die Treppe betrat. Doch falls es etwas zu sehen gegeben hatte, war es zertrampelt worden. In dem längeren Gang am Fuß der Treppe verhielt es sich nicht anders.
»Was ist das für ein Lagerhaus?«, wollte Rieker wissen.
»Ein altes Kontor, zum Teil einsturzgefährdet. Es hätte sich wohl nicht gelohnt, noch mal Geld reinzustecken. Die Handelsgesellschaft residiert jetzt am Sandthorkai. – So, wir sind fast da.«
Das hatte Rieker erwartet, denn vor einer Tür hielt ein unglücklich dreinblickender Constabler Wache. Sein Schnurrbart verdeckte die ganze Oberlippe. Der Mann grüßte Rieker und trat bereitwillig zur Seite.
Drei auf dem Boden stehende Öllampen und etwas Tageslicht aus einem nicht besonders gut vernagelten Lichtschlitz oben an der Außenwand beleuchteten die Szenerie. Auf dem Boden unter diesem Schlitz lag eine in eine Wolldecke gewickelte Leiche, wie man an den hervorschauenden nackten Frauenfüßen unschwer erkennen konnte. Ein säuerlicher Gestank hing in dem Raum, der allerdings nicht von der Toten ausging, sondern von einem Haufen Erbrochenem drei Meter entfernt.
»Wissen wir, von wem das stammt?«, erkundigte sich Rieker.
»Vermutlich von der Person, die die Frau hergebracht hat«, antwortete Kracht. »Jedenfalls war es schon da, als der Arbeiter heute früh hereinkam.«
Während Rieker auf die Tote zuging, spürte er, wie sich die Härchen auf seinen Armen aufstellten. Er hatte in seinem Leben schon eine Menge Leichen gesehen, doch nicht ein einziges Mal hatte ihn der Anblick kaltgelassen. Dem Tod gegenüberzutreten würde wohl immer etwas Besonderes bleiben.
»Es wird im Laufe der Zeit einfacher«, hatte sein Mentor Kleinschmidt gesagt. Aber auch er war am Fundort einer Leiche oft still und in sich gekehrt geblieben.
Die Wolldecke war ebenso derb wie die, mit der sie sich im Krieg gegen die Franzmänner schlafen gelegt hatten. Die Teile waren nahezu unzerstörbar und hielten warm, dafür wogen sie viel zu viel und waren kratzig.
Dieses Exemplar hatte offenbar einiges mitgemacht. Die Decke stank und war mit Flecken übersät. An einer Ecke war sie schon sehr fadenscheinig.
Rieker betrachtete die zugedeckte Tote von allen Seiten. Sie war regelrecht in die Decke eingerollt worden. Auf der hinteren Seite schaute ein dünner Arm mit einer zarten Hand unter dem Stoff hervor. Die Stellung der Füße verriet, dass sie auf dem Rücken lag.
»Ich habe die Decke nach meiner Überprüfung wieder so gelegt, wie ich sie vorgefunden habe«, informierte ihn Kracht.
Rieker fischte seine Kautschukhandschuhe hervor und zog sie sich konzentriert über beide Hände. Viele Kollegen spotteten darüber, wie penibel er stets darauf achtete, die Leichen nicht zu berühren. Kracht wartete geduldig, während Rieker sich bückte und die Kante der Decke ergriff. Er schlug sie vorsichtig um und legte die Tote frei.
Eine vollkommen nackte Frau lag vor ihm. Ihre bleiche Haut machte im flackernden Licht einen wächsernen Anschein. Das Opfer war jung gewesen, allerhöchstens fünfundzwanzig Jahre alt, eher zwanzig. Zierlich, aber nicht dürr. Blaurot gefärbte Totenflecken bedeckten Brüste, Bauch und Oberschenkel. Hohe Wangenknochen, ein ausgeprägtes Kinn, volles blondes Haar. Die Zähne waren erstaunlich weiß, die Zunge lag tief im weit geöffneten Rachen. Ihre von einem milchigen Todesschleier überzogenen Augen starrten stumpf an die Decke des Raums, der ihr Grab geworden war.
An den Hand- und Fußgelenken konnte Rieker Spuren einer Fesselung erkennen. Die Haut wirkte dort wund und gerötet, am rechten Handgelenk prangte ein ausgewachsener Bluterguss. Am Hals waren auf den ersten Blick keine Würgemale auszumachen.
Rieker sah sich den Kopf genauer an. Von dieser Seite aus entdeckte er keine Anzeichen, die auf eine Wunde schließen ließen, wie sie ein Schlag mit einem harten Gegenstand verursacht hätte.
Er merkte, dass er die Luft angehalten hatte. Beim Ausatmen ließ er die Decke sinken und stellte sich wieder auf.
»Wir haben sie noch nicht umgedreht«, sagte Kracht, Riekers nächste Frage vorausahnend.
»Gut. Dann helfen Sie mir jetzt dabei!«
Dass die Tote auf eine Wolldecke gebettet war, machte die Sache einfacher. Sie packten den Stoff gemeinsam an der Seite und drehten den Körper so, dass die Frau auf dem Bauch zu liegen kam.
»Herrgott!«, rief Kracht angewidert und wandte sich schnell ab.
Rieker hielt sich krampfhaft an seinem Gehstock fest. Auch er hätte am liebsten weggesehen.
Die junge Frau war erstochen worden. Allerdings hatte es ihr Mörder nicht dabei belassen, ihr das Messer ein einziges Mal in den Rücken zu rammen, sondern es war ihr wieder und wieder in den Leib gestoßen worden. Der Bereich von den Schulterblättern bis zur Taille war das reinste Schlachtfeld, vollkommen zerrissen, zerschnitten und zerfetzt. Ein Stück der Wirbelsäule war erkennbar, und Knochensplitter steckten in dem geschundenen Fleisch, das aussah, als wäre es durch einen Fleischwolf gedreht worden.
Kracht würgte.
»Nicht auf die Leiche!«, befahl Rieker streng.
Der Criminalsekretär sprang ein paar Schritte weg, doch schließlich gelang es ihm, den Würgereiz zu unterdrücken.
Rieker fühlte sich selbst kaum besser, konnte sich das vor dem Jungen aber nicht anmerken lassen.
»Geht es?«, fragte er ihn.
»Ich denke.«
»Kein Blut und auch nur begrenzte Leichenflecken«, stellte Rieker fest.
»Wie kommt das?« Kracht klang im Moment nicht so, als sei er wirklich an einer Antwort interessiert.
»Nun, augenscheinlich wurde ihr das nicht hier angetan. Der Täter hat sie an Armen und Beinen angebunden und dann immer wieder auf sie eingestochen. Nachdem der Blutfluss versiegt war, hat er sie wohl gereinigt. Aber warum nur?« Die letzten beiden Worte waren eher an sich selbst gerichtet, die nächste Frage hingegen stellte er Kracht: »Haben wir schon eine Ahnung, wer die Tote sein könnte?«
Der Criminalsekretär war immer noch bleich. Statt zu antworten, schüttelte er den Kopf.
»Sie sollten umgehend die Vermisstenfälle durchgehen. Schauen Sie nach, ob eine der Beschreibungen auf unsere Tote zutrifft. Ansonsten … Moment, warten Sie …«
Rieker war noch etwas aufgefallen. Die Wolldecke hatte eine runde, leicht angekokelte Stelle in der Größe eines Fünfmarkstücks. Aus einem Impuls heraus beugte er sich darüber und roch daran. Brandaromen.
»Was ist?«
»Nur noch mehr Rätsel. Helfen Sie mir, sie wieder umzudrehen!«
Bevor Rieker die Decke wieder über sie breitete, sah er sich noch die Hände der Toten an. Die Leichenstarre war längst eingetreten. Sie trug keinen Ring, aber an ihrer linken Hand war die Haut am Ringfinger etwas heller. Ein schmaler Streifen, der auf eine dünne Ringschiene schließen ließ, kaum mehr als ein dicker Draht. Vermutlich hatte der Mörder ihr das Schmuckstück abgenommen. Wegen des Werts?
Bei einer so dünnen Ringschiene sicher nicht, dachte Rieker. Trotzdem hatte der Täter sich die Mühe gemacht, ihr den Ring abzuziehen. Noch ein Rätsel mehr.
»Lassen Sie das Kontor vorerst absperren und noch einmal komplett durchsuchen!«, befahl er Kracht, als sie die Treppe hinaufgingen. »Im Leichenhaus sollen sie eine Totenschau vornehmen, dann machen Sie sich an die Vermisstenliste. Und die Constabler sollen in den umliegenden Häusern nachhören, ob gestern jemand etwas Verdächtiges gesehen hat. Sie wissen, dass von Stresenbeck schnell Erfolge sehen will.«
Ein Schutzmann bewachte den Eingang des Stadthauses, von wo aus die Beamten und Polizisten die Vorgaben von Senat und Bürgerschaft umsetzten – zum Wohle der Bürger der Stadt. Neben der Polizeibehörde fanden sich hier auch die Politische und die Criminalpolizei. Letztere war nur dürftig besetzt und nutzte ein paar Räume in den oberen Etagen.
Als er in seiner winzigen Kammer angekommen war, fand Rieker einen Zettel vor, der ihn aufforderte, sich unverzüglich in von Stresenbecks Bureau zu melden. Er stellte den Gehstock weg und hängte den Mantel ordentlich auf. Zwei weitere Briefumschläge lagen auf dem aufgeräumten Schreibtisch, doch die würde er besser später bearbeiten. Jetzt musste er zuerst zum Inspektor. Geduld gehörte nicht zu dessen Stärken.
»Herr Rieker, treten Sie ruhig ein!«, begrüßte ihn Elisabeth Böll. Die Vorzimmerdame des Inspektors stand von ihrem Schreibtisch auf und lächelte ihn freundlich an.
»Guten Tag, Fräulein Böll«, sagte Rieker. »Ist er auch da?«
»Natürlich, er hat schon zweimal nach Ihnen gefragt.« Sie rollte mit den Augen und klopfte gegen die dunkel gebeizte Tür. Als Antwort erklang ein tiefes Grollen, das sie als Erlaubnis zum Öffnen interpretierte.
»Herr Rieker ist da, Herr von Stresenbeck.«
»Ah ja. Endlich! Er soll eintreten.«
Fräulein Böll trat zur Seite. Als Rieker an ihr vorbei in das Bureau des Inspektors schritt, nahm er ein süßliches Parfüm an ihr wahr. Sie schloss die Tür hinter ihm.
Criminalinspektor Karl-Wilhelm von Stresenbeck saß feist in seinem dunkel gebeizten Ledersessel. Vor ihm stand eine Tasse mit schwarzem Tee. Von der krummen Zigarre in seiner Hand stieg Tabakrauch empor und verlieh der Luft einen beißenden Geschmack.
Rieker unterdrückte den Reiz, sich zu räuspern. Auf dem ausladend großen Palisanderschreibtisch stand eine riesige Schreibgarnitur aus Bronze, die den Kampf eines Elefanten mit einem Löwen darstellte. Die Porzellanschale daneben wurde vom Inspektor als Aschenbecher missbraucht.
»Wo waren Sie so lange?«, fragte der Vorgesetzte ohne jeden Gruß.
»Ich habe den Fundort der Leiche in Augenschein genommen, Herr Inspektor. Dabei sollte Gründlichkeit vor Eile stehen, wie Commissar Kleinschmidt immer gesagt hat.«
»Der Herr sei seiner Seele gnädig!«, sagte von Stresenbeck beiläufig. »Gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse?«
Wie sollte er jetzt schon große Erkenntnisse gewonnen haben?, fragte sich Rieker. Er war hier angekommen, zur Leiche geschickt worden und gerade erst zurückgekehrt. Trotzdem sollte es nicht aussehen, als habe er nichts in den Händen.
»Wir haben es mit der Leiche einer unbekannten weiblichen Person zu tun, zwischen zwanzig und fünfundzwanzig Jahre alt. Todesursache waren zahlreiche Messerstiche in den Rücken«, fasste er deshalb zusammen. »Sie war offensichtlich gefesselt, und nach der Tat muss sie gewaschen worden sein. Anschließend hat der Täter sie nackt in eine alte Wolldecke gewickelt und so in einem abbruchreifen Kontor abgelegt.«
»Das klingt in der Tat recht ungewöhnlich«, sagte von Stresenbeck ernst und paffte an seiner Zigarre. »Wann wurde sie getötet?«
»Dem Zustand der Leiche nach zu urteilen, muss es im Laufe des gestrigen Tages passiert sein, vielleicht am frühen Abend. Die Leichenstarre war eingetreten, als wir kamen, die Verwesung hatte noch nicht spürbar eingesetzt. Aber es war ja auch kühl in dem Keller.«
Von Stresenbeck legte die Zigarre ab, stützte sich auf die Tischplatte und wuchtete seinen massigen Körper hoch. Er trug einen etwas altmodisch wirkenden Anzug mit Weste. Sein grauer Backenbart reichte bis zum hohen Kragen des weißen Hemdes.
»Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden, Rieker«, begann er. »Ich habe meine Zweifel, ob Sie der Richtige für diesen Fall sind.«
»Ich bin Criminalcommissar«, gab Rieker kühl zurück. »Für Mordermittlungen werde ich bezahlt.«
»Sie wissen genau, worum es mir geht.«
Rieker schüttelte den Kopf.
»Es ist gerade mal drei Tage her, dass ich Ihnen die Beförderungsurkunde überreicht habe.«
»Ich bin bereit für meinen ersten Fall«, sagte Rieker bestimmt. »Immerhin habe ich vorher sechs Jahre an der Seite von Commissar Kleinschmidt gedient.« Unwillkürlich ballte er die Hände zu Fäusten.
»Wer wüsste das besser als ich, Rieker? Trotzdem hätten Sie eigentlich noch ein paar Jahre als Sekretär vor sich gehabt, wenn Kleinschmidt nicht gestorben wäre. Ohne General von Welmensiel …«
»Er hat mich ohne mein Zutun und ohne mein Wissen empfohlen«, beteuerte Rieker.
Von Stresenbeck wandte sich zur Wand, an der ein großformatiges Gemälde hing. In dem opulenten Goldrahmen fuhr ein unter Dampf stehender Luxusliner auf den Betrachter zu, begleitet von winzig wirkenden Lotsenboten. Das Wasser der Norderelbe war rau.
»Sie sollten Ihre neue Aufgabe als Commissar mit einem alltäglicheren Fall beginnen«, sprach von Stresenbeck in einem fast fürsorglichen Tonfall weiter. »Ein kleiner Raub mit Todesfolge, ein schöner klassischer Überfall vielleicht. So etwas.« Er drehte sich wieder zu Rieker.
»Sie wollen mich von dem Fall abziehen?«
Der Inspektor schüttelte beschwichtigend den Kopf. »Ich möchte Sie nur nicht überfordert wissen, Rieker.«
»Wie kommen Sie darauf, dass ich überfordert sein könnte?«, entfuhr es ihm schärfer, als er es vorgehabt hatte.
»Jetzt beruhigen wir uns erst einmal!« Die buschigen Augenbrauen des Inspektors zogen sich wie Gewitterwolken zusammen. Dennoch sprach er ruhig weiter: »Ich habe doch gar nicht vor, Sie von dem Fall abzuziehen. Im Gegenteil.«
Rieker entspannte sich ein wenig, aber er blieb auf der Hut. »Was soll das heißen?«
»Das heißt, dass Sie sich weiterhin an diesem Mord abarbeiten und vielleicht sogar damit beweisen können«, sagte von Stresenbeck. »Ich habe allerdings vor, Ihnen ein Netz zu spannen, wie bei den Hochseilartisten im Circus. Was sagen Sie?« Er strahlte Rieker jetzt freudig an.
»Ich verstehe nicht ganz …«, gab der zweifelnd zurück.
»Commissar Breiden hat angeboten, Sie bei Ihrem ersten Fall zu unterstützen«, trumpfte der Inspektor auf. »Er wird sich im Hintergrund halten und nur eingreifen, wenn Ihre Ermittlungen ins Stocken geraten.«
Rieker schüttelte unwillkürlich den Kopf. »Sie wollen ihm die Ermittlungen verantwortlich übergeben? Ich soll mich ihm unterordnen? Das können Sie nicht tun!«
»Ich wüsste nicht, wer mich daran hindern sollte, Rieker.« Der Tonfall des Inspektors war lauernd scharf.
Rieker löste die verkrampften Fäuste. »Ich war am Fundort der Leiche, die nächsten Ermittlungsschritte sind eingeleitet, und ich habe es mir verdient, auch weiterhin derjenige zu sein, der den Fall zu verantworten hat«, argumentierte er. Als er erkannte, dass er den Inspektor mit seinen Worten nicht erreichte, fügte er bestimmt hinzu: »Sie selbst haben mich zum Commissar befördert. Wenn Sie mich jetzt Breiden unterstellen, werden die Leute denken, Sie trauten Ihrem eigenen Urteil nicht mehr.«
Von Stresenbeck ließ sich seufzend in seinen Ledersessel sinken und nippte an dem Tee. Danach schaffte er es durch mehrmaliges Ziehen, den Glutrest seiner Zigarre wieder zum Leben zu erwecken.
Ungeduldig wartete Rieker auf die Entscheidung des Inspektors, der mit einem gereizten Gesichtsausdruck den Rauch ausatmete.
»Ich erwarte prompte Ergebnisse, Rieker«, sagte er schließlich. »Haben wir uns verstanden?«
Rieker war erleichtert. Er nickte eifrig.
»Ich gebe Ihnen über das Wochenende Zeit, die Sache aufzuklären.«
»Das sind gerade einmal zwei Tage!«, stellte Rieker bestürzt fest.
»Mit heute sind es drei Tage. Sie werden mich am Montag um zwölf Uhr hier an meinem Schreibtisch über den Stand der Ermittlung unterrichten. Und ich hoffe für Sie, dass Sie dann einen Mörder vorweisen können.« Von Stresenbeck pochte mit dem Zeigefinger auf die Tischplatte, als er weitersprach: »Bringen Sie mich nicht dazu, meine Entscheidung zu bereuen. Wenn der Fall bis dahin nicht abgeschlossen ist, wird Breiden übernehmen. Ohne Wenn und Aber. Das ist mein letztes Wort. Und jetzt legen Sie besser los. Sie verschwenden nur Ihre Zeit. Schönes Wochenende!«
Kapitel 3
Freitag, 22. April 1887
Johanna Ahrens warf das französische Kleid, in dem sie gerade noch ein spätes Frühstück zu sich genommen hatte, auf das Sofa. Dann knöpfte sie das Mieder vorne auf. Endlich konnte sie sich wieder frei bewegen! Nur Unterrock, Hemd und Strümpfe ließ sie an.
In der Kleidertruhe war unter Leibchen und Unterröcken ihre einfachere Garderobe versteckt. Der dunkle, grobe Leinenstoff des Rocks war schlicht, aber sauber verarbeitet, ebenso die weiße Bluse mit hochgeschlossenem Kragen. Das ältere Jäckchen war am Ärmel geflickt, und dem einfachen Hut sah man an, dass er nicht viel gekostet hatte.
Johanna gähnte. Normalerweise fanden Feste wie das, auf dem sie am vergangenen Abend gewesen war, an Freitagen oder Samstagen statt. Das Geburtstagsfest von Deputationsrat Eulenbrinck hatte eine willkommene Abwechslung in der Woche bedeutet. Bis spät in die Nacht hatte sie getanzt und sich sogar erstaunlich gut unterhalten gefühlt, nicht zuletzt mit diesem etwas sperrigen Staatsanwalt Norbert Schermann. Gut, er war fast doppelt so alt wie sie, aber hinter seinem adretten Erscheinungsbild lag etwas, das sie anzog. Leider hatte ihre Mutter direkt nach diesem Tanz zum Aufbruch gedrängt. Immerhin war es schon ein Uhr gewesen.
Johanna betrachtete sich im Spiegel: Die Verwandlung war gelungen. Zufrieden griff sie nach der alten Ledertasche. Das Gewicht mehrerer Bücher war deutlich zu spüren. Jetzt musste sie nur noch ungesehen verschwinden.
Vom Ankleidezimmer war es bloß ein Katzensprung bis zu einer unscheinbaren Tür, die zum hinteren Treppenhaus führte. Während in den herrschaftlichen Räumen geöltes Parkett und Orientteppiche als Bodenbelag vorherrschten, waren es ab hier mit Ranken verzierte Bodenfliesen. Johanna mochte sie. Sie sahen immer so frisch aus und erinnerten an die Parks, in denen sie so gerne spazieren ging.
Jetzt aber genug mit dem Träumen, ermahnte sie sich. Sie hatte schließlich Wichtigeres zu tun.
Johanna lauschte. Es waren keine Schritte zu vernehmen. Die Luft schien rein zu sein. Geduckt, als ob man sie dann nicht so leicht sehen könnte, lief sie die Stufen hinab.
Seit drei Monaten war der Ablauf jeden Mittwoch und jeden zweiten Freitag derselbe: Sie berichtete den Eltern von einem geplanten Einkauf, einem Besuch bei ihren Pferden oder einer Kutschfahrt mit einer Freundin. Dann stahl sie sich aus dem Haus, ließ sich von einer Mietkutsche in die Stadt bringen und ein gutes Stück vor ihrem Ziel absetzen. Den Rest des Weges ging sie zu Fuß. Dort, wo es sie hinzog, brauchte niemand zu wissen, dass sie sich eine Kutsche leisten konnte.
In einer Gasse in den Gängevierteln hatte sie einen ehemaligen Schusterladen angemietet. Ein kleines Fenster ließ Licht in den Hauptraum, war aber so hoch angebracht, dass Neugierige nicht einfach hineinspähen konnten. Es gab genug Platz für die zehn Frauen, die an den mit Stühlen versehenen Schreibpulten saßen, während sie selbst an der vorne angebrachten Tafel unterrichtete.
Hier war sie Johanna, die Lehrerin. Dass sie aus einer anderen Welt stammte, wusste niemand. Wahrscheinlich hätte auch niemand verstanden, wieso sie ein Collier versetzt hatte, um die Möbel und die kleinen Tafeln anzuschaffen, mit denen die Frauen das Schreiben und Rechnen üben konnten. Und selbst ihre Schülerinnen, die sie zunächst mühsam und mit viel Überredungskunst hergelockt hatte, wären wahrscheinlich zu einer so »feinen Dame« auf Distanz gegangen.
Als Johanna heute in der kleinen Schule ankam, war Lea bereits da. Die bodenständige ältere Frau hatte früh ihren Mann verloren und keinen neuen an Land gezogen. Ihr Kopf arbeitete nicht besonders schnell, dafür hatte sie ein großes Herz. In der kleinen Schule hatte sie zu ihrer Freude eine Aufgabe gefunden, die ihr bei den anderen Frauen Respekt einbrachte. Neben Johanna war sie die Einzige, die einen Schlüssel für die Räumlichkeiten hatte. Sie richtete alles vor Unterrichtsbeginn und sorgte im Anschluss dafür, dass die Zimmer in der kommenden Woche wieder sauber waren.
Auch ein paar der anderen Frauen waren bereits eingetroffen. Rotraud stand wie meist schüchtern in der Ecke, taute aber auf, sobald Johanna sie umarmte. Sarah und die beiden Ediths warteten ebenfalls schon auf den Beginn der Lektionen. Maria versuchte, ihre Tochter in den Schlaf zu singen. Erika, mit fast sechzig Jahren die Älteste in ihrer Gruppe, half ihr tatkräftig dabei, war aber mit ihrer schrillen Stimme wahrscheinlich der Grund dafür, dass das Kind weiterhin schrie, statt zu schlafen. Kurz nach Johanna traten Wiebke und Swantje durch die Hintertür ein.
Obwohl es draußen bereits elf Uhr schlug und alle sich auf ihre Plätze setzten, begann Johanna noch nicht mit dem Unterricht. Eine Frau fehlte.
»Hat jemand etwas von Ansje gehört?«, fragte sie in die plappernde Runde.
Die Frauen verneinten.
»Ich habe sie vorgestern zum letzten Mal gesehen«, sagte Lea. »Da hat sie gemeint, dass sie heute wiederkommen will.«
»Wir warten noch ein paar Minuten«, beschloss Johanna. Sie sortierte ihre Bücher und Papiere ein weiteres Mal, während die Kleine von Maria endlich müde wurde. Das Schreien ging in ein leises Wimmern über, dann schlief das Kindchen ein.
Johanna trat zum Fenster und stieg auf einen Hocker, um auf die schmale Gasse schauen zu können. Der beständige Regen der letzten Tage war in ein Nieseln übergegangen. Fast schien es etwas heller zu werden, und es waren mehr Leute unterwegs. Nur von Ansje war nichts zu sehen.
Johanna schüttelte bedauernd den Kopf. »Gut, wir fangen an. Ich wollte heute mit euch etwas Rechnen üben und dann Geografie.«
Lea verdrehte die Augen.
Einfache Rechnungen waren den Frauen natürlich bekannt. Jede von ihnen konnte Preise zusammenzählen oder etwas abziehen, zumindest wenn es um glatte Werte ging. Sie mussten es auch können, denn viele waren alleinstehend oder hatten Männer, auf die kein Verlass war. Diese Frauen mussten selbst für ihren Lebensunterhalt und den ihrer Kinder aufkommen, und das taten sie in der Regel, wenn auch eher schlecht als recht. Rotraud arbeitete als Putzfrau, Sarah als Kindermädchen, Maria bügelte in einer Wäscherei. Eine der Ediths bediente in einer Kneipe, die so heruntergekommen war, dass Johanna sie nie betreten würde. Die jüngere Edith tanzte in einer Matrosenbar. Ebenso wie sie verdienten sich auch einige der anderen gelegentlich etwas dazu, indem sie sich prostituierten.
All ihren Schülerinnen gemein war der Wunsch, dem Leben eine neue Richtung zu geben und Sicherheit zu gewinnen. Der Schlüssel dafür lag in der Bildung, davon war Johanna überzeugt. Bildung gab den Frauen Mittel an die Hand, ihr Leben selbstbestimmter zu führen – schwierig in einer Zeit, in der man entweder als Tochter dem Vater oder als Ehefrau dem Mann zu willenlosem Gehorsam verpflichtet war.
Johanna besaß das Privileg, in ein wohlhabendes, angesehenes und reiches Haus geboren worden zu sein. Sie hatte eine weit überdurchschnittliche Ausbildung durch Privatlehrer genossen und dabei Freude am Lernen gefunden. Das ging so weit, dass sie sich ständig neue Bücher besorgte und las, las, las.
Von Louise Otto-Peters war ihr ein Satz untergekommen, der sie schließlich dazu gebracht hatte, ihre kleine Schule zu gründen: »Die Teilnahme der Frauen an den Interessen des Staates ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht.«
Pamphlete von Frauenrechtlerinnen zu lesen kam für die meisten ihrer Schülerinnen nicht infrage. Oftmals musste Johanna ihnen das Lesen und Schreiben erst beibringen, und das ging langsamer, als sie es gehofft hatte. Die Lernerfolge stellten sich bei ein bis zwei Lektionen pro Woche nicht bei allen gleich schnell ein. Wo Lea immer weitere Wiederholungen benötigte, löste Ansje eine Aufgabe flott und mit Bravour. Die junge Frau war erst viermal dabei gewesen, doch Johanna gefiel es, wie sie das Wissen regelrecht aufsaugte. Sie war sogar nach Unterrichtsende noch geblieben, um im Gespräch mit ihrer Lehrerin mehr zu erfahren. Umso mehr verwunderte es Johanna, dass Ansje dem Unterricht heute ohne eine Entschuldigung ferngeblieben war.
Als die anderthalb Stunden vorüber und ein paar Aufgaben für zu Hause vergeben waren, bedankten sich die Frauen bei Johanna. Die einen verschwanden gleich, andere blieben noch zu einer schnellen Suppe, die Lea auf dem alten Kohlenherd im Nebenraum warm machte.
»Ich hatte wirklich gedacht, dass Ansje heute auftauchen würde«, sagte Johanna.
»Ihr ist wohl was dazwischengekommen«, gab Wiebke zurück, die nur zwei Häuser von ihr entfernt wohnte.
»Hast du sie heute schon gesehen?«
»Das letzte Mal vor ein paar Tagen. Soll ich bei ihr vorbeigehen und fragen, warum sie nicht gekommen ist?«
Johanna schüttelte den Kopf. »Danke, aber ich denke, das mache ich selbst.«
Ansje lebte im Kornträgergang in einem der Gängeviertel in der Altstadt. Alte, krumme Fachwerkhäuser reckten sich hoch wie Bäume, die Licht suchten. Die schmalen Gassen zwischen den verwinkelten Bauten waren gepflastert, und in ihrer Mitte liefen die Abwässer zusammen. Darüber waren in den oberen Geschossen Leinen gespannt, aber im Regen hatte hier niemand Wäsche aufgehängt.
Das Haus, das Wiebke ihr zeigte, sah noch einigermaßen gut aus. Während die Schülerin heimging, betrat Johanna es durch die offen stehende Tür. Im Flur standen Eimer mit Kohlenasche und Fischabfällen. Johanna hielt sich die Nase zu.
Sie passierte vier Wohnungstüren, stieg über eine Tonne mit alter Kleidung und gelangte schließlich zu einer steilen Holztreppe, die die Etagen miteinander verband. Laut Wiebkes Beschreibung befand sich Ansjes Wohnung im zweiten Stock. Dort fand sie schnell die Tür, an die jemand mit Kohle Kalferer geschrieben hatte. Die Schrift war verwischt.
Johanna klopfte, doch drinnen blieb alles still. Irgendwo unten bellte ein Hund. Ein Kleinkind plärrte.
Ein zweites, kräftigeres Pochen wurde ebenfalls nicht beantwortet, zeigte Johanna aber, dass etwas mit dem Kastenschloss im Inneren nicht stimmte. Es schien nicht mehr fest auf der Tür zu sitzen, denn wenn sie bestimmter klopfte, hatte die Holztür so viel Spiel, dass Johanna durch einen fingerbreiten Spalt in die Wohnung schauen konnte. Sie drückte gegen die Tür.
»Ansje?«, rief sie vorsichtig hinein. »Ich bin es, Johanna.«
Sie erhielt keine Antwort. Wahrscheinlich war Ansje unterwegs.