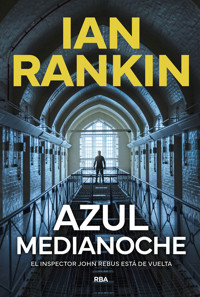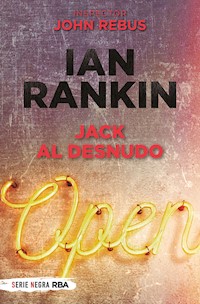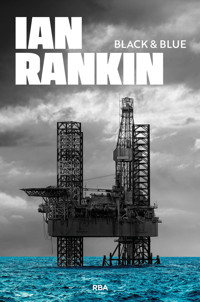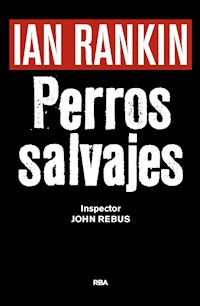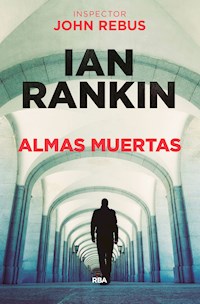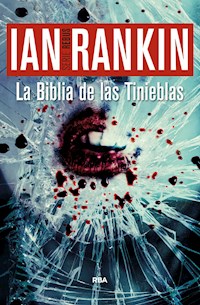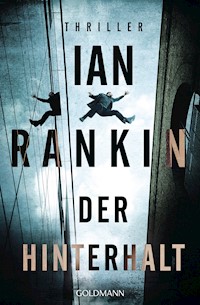
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Je größer die Lüge, umso schrecklicher die Wahrheit ...
Als die Kameras des Londoner Satellitenkontrollzentrums mehrere Minuten ausfallen, vermuten nur Martin und sein Kollege Paul einen Angriff auf das Sicherheitssystem. Am nächsten Tag kommt Paul nicht zur Arbeit, seine Festplatte ist verschwunden, sein Schreibtisch geräumt. Kurz darauf stürzt in den USA eine Raumfähre bei der Landung ab, und Martin beschleicht ein furchtbarer Verdacht: Wenn diese Vorfälle zusammenhängen, dann ist nicht nur Paul in Gefahr, sondern auch die diplomatischen Beziehungen mit den USA. Zusammen mit der Journalistin Jill kommt Martin einer unglaublichen Verschwörung auf die Spur, die ihn nicht nur sein Leben kosten könnte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Als die Kameras des Londoner Satellitenkontrollzentrums mehrere Minuten ausfallen, vermuten nur Martin und sein Kollege Paul einen Angriff auf das Sicherheitssystem. Am nächsten Tag kommt Paul nicht zur Arbeit, seine Festplatte ist verschwunden, sein Schreibtisch geräumt. Kurz darauf stürzt in den USA eine Raumfähre bei der Landung ab, und Martin beschleicht ein furchtbarer Verdacht: Wenn diese Vorfälle zusammenhängen, dann ist nicht nur Paul in Gefahr, sondern auch die diplomatischen Beziehungen mit den USA. Zusammen mit der Journalistin Jill kommt Martin einer unglaublichen Verschwörung auf die Spur, die ihn nicht nur sein Leben kosten könnte …
Mehr Informationen zu Ian Rankin und lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Ian Rankin
Der Hinterhalt
Thriller
Aus dem Englischen von
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel
»Westwind« bei Orion, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Januar 2021
Copyright © der Originalausgabe by John Rebus, 1990, 2019
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Covermotiv: Arcangel Images (477787)
Redaktion: Kerstin von Dobschütz
AG · Herstellung: ik
Satz- und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-27131-2V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für meine Schwestern,
Westwind, Flatterwind, Lotterwind, Weiberwind, falscher Wind, du, dort hinter dem Wasser.
George Bernard Shaw, Die heilige Johanna
EINLEITUNGDESVERFASSERS
Westwind erschien erstmalig am Donnerstag, dem 1. März 1990. Mein Tagebucheintrag für diesen Tag vermerkt diese Tatsache folgendermaßen: »Ja, Westwind bekam bei Erscheinen EINE Rezension (im Guardian, eine sehr kleine noch dazu). O Gott. Ein Flop vom ersten Tag an.«
Sie sehen, in den ersten Monaten des Jahres 1990 war ich nicht in einer, wie man heute sagt, »guten Position«, wie meinem Tagebuch aus jener Zeit regelmäßig zu entnehmen ist. Hier zum Beispiel Mittwoch, der 28. Februar: »Ich habe mich heute gefragt, wann wird Westwind wohl erscheinen? Ich weiß, es war für März geplant, und Bücher werden immer donnerstags herausgebracht. Aber morgen kann es sicher nicht passieren – Barrie & Jenkins (mein damaliger Verlag) hätten sich sonst sicher wg. Publicitymöglichkeiten gemeldet. Und meine Autorenexemplare hätten doch auch schon da sein müssen, oder? Aber als ich nach Hause kam, erwartete mich eine Geschenkflasche Whisky. Da muss es doch wohl morgen sein – mit so wenig Tamtam!«
Es ist leicht, mit Zuversicht auf mein jüngeres Ich zurückzublicken, aber ich fing damals erkennbar an, den Glauben an meine Fähigkeiten zu verlieren und an meiner Zukunft als publizierbarer Autor zu zweifeln. Außerdem schuftete ich mich wund; ich hatte einen Tagesjob in London und versuchte, in der freien Zeit, die mir blieb, Gelegenheit zum Schreiben zu finden. Mein erster Rebus-Roman, Verborgene Muster, war ohne viel Trara 1987 erschienen. Am 12. März jenes Jahres schrieb ich in mein braves Tagebuch: »Ich sollte am Satellitenroman arbeiten, mit anderen Worten an Westwind. Ich arbeite nicht.« Na ja, nicht gerade nicht, denn ich feilte noch an dem Spionagethriller, der im folgenden Jahr unter dem Titel Der diskrete Mr. Flint erscheinen sollte. Ich wohnte in Tottenham und arbeitete als Assistent im National Folktale Centre, das damals zum Middlesex Polytechnic gehörte. Das bedeutete, dass ich – ungewöhnlich für London – zu Fuß zur Arbeit gehen konnte. Außerdem hatte ich dort Zugang zu einem Computer, während ich zu Hause immer auf einer lärmenden elektrischen Schreibmaschine herumhämmerte. Nicht, dass der Computer mit seinen großen Floppy Disks mir besonders nützlich gewesen wäre: Ich kannte sonst (meinen Verlag eingeschlossen) niemanden, der einen Computer benutzte. Mein erster Amstrad-Wordprocessor sollte erst einige Zeit später kommen, und das Faxgerät an meinem Arbeitsplatz war so rätselhaft wie die Sphinx.
Ich weiß nicht genau, wie ich auf den Gedanken kam, ein Techno-Thriller sollte mein nächstes Projekt sein.
Verborgene Muster war ein ziemlich traditioneller Whodunit gewesen, und Der diskrete Mr. Flint war ein Spionageroman, beeinflusst von Graham Greenes Der menschliche Faktor. Westwind dagegen sollte mit einem abstürzenden Weltraumshuttle und einem Satelliten mit einer Fehlfunktion anfangen. Jetzt kommt es mir so vor, als hätte ich mich langsam an die Sorte Schriftsteller herangetastet, zu der ich gern gehören wollte. Hoch oben auf der Liste stand: erfolgreich genug, um meinen Tagesjob aufzugeben. Ich hatte es mit dem Kriminalroman und dem Spionageroman versucht, und jetzt probierte ich es mit einem Hightech-Thriller von der Art, die sich palettenweise an Flughäfen und in Bahnhöfen verkaufte. So kam es, dass ich meine Nachbarschaftsbücherei in der Tottenham High Road besuchte und die Bibliothekarin bat, mir alles zu geben, was mit Weltraumshuttles und der Arbeit von Satelliten zu tun hatte. Viele der Bücher, die ich so sammelte, erwiesen sich als zu technisch für mich: Mein Examen hatte ich in englischer Literatur gemacht, nicht in Mathematik und Physik –, aber ein paar erwiesen sich doch als nützlich. (Heute kann ich zugeben, dass eins davon ein Kinderbuch war.) Dazu kam der treue Road Atlas of theUSA von Rand McNally, denn ein Teil der Geschichte sollte in den USA spielen (internationale Verkäufe ahoi!), und außerhalb von Romanen, Filmen und Fernsehsendungen hatte ich dieses Land noch nie gesehen.
Wie Sie sehen, ich war jung, hungrig, naiv – und getrieben.
Ich werfe noch einen Blick in mein Tagebuch, das mir bei dieser Einleitung helfen soll, und sehe überrascht, wie lange ich mit Westwind schwanger gegangen bin. Die erste Erwähnung finde ich im Mai 1987, und im Juni war ich vergnügt bei der Arbeit. Damals lautete der Titel noch Coffin Burial, und mein einziges Problem war, dass meine Schreibmaschine repariert werden musste. Im Juli 1987 hämmerte ich munter darauf herum, während ich gleichzeitig Der diskrete Mr. Flint redigierte. Zum August hin kamen mir Zweifel, aber im September fand ich manches »sehr spannend« geschrieben und sprach von »Herzklopfen«. Im Dezember war die erste Fassung fertig, und der Titel hatte sich zu Westwind geändert. (Ich weiß nicht, woher Coffin Burial gekommen war – ich glaube, es war ein Gedicht, aber im Internet finde ich nichts. Nach meiner Erinnerung könnte es von John Masefield gewesen sein, aber in einem Verzeichnis seiner Werke finde ich es auch nicht. Allerdings fand ich unter seinen Gedichten eins mit dem Titel The West Wind. Zufall?)
Mein Agent las das Buch über die Feiertage und meldete sich im Januar 1988. Er war nicht begeistert und verlangte massive Änderungen, bevor er es einem Verlag schickte. Okay, also schrieb ich das Buch bis März um, aber dann wurde es anscheinend still. Das Fernsehen interessierte sich für Verborgene Muster, und außerdem arbeitete ich am Drehbuch für eine potenzielle Verfilmung meines ersten Romans Das dunkle Herz der Schuld. Ich bereitete außerdem das Erscheinen von Der diskrete Mr. Flint vor und bewarb mich um Jobs, bei denen ich ein bisschen mehr verdiente als am Middlesex Poly. Als der Mai kam, arbeitete ich an meinem neuen Rebus-Roman (der das Tageslicht schließlich als Das zweite Zeichen erblicken sollte), und im Sommer hatte ich Arbeit als Journalist bei einer Monatszeitschrift namens Hi-Fi Review gefunden. Der diskrete Mr. Flint war erschienen und bekam ein paar gute Kritiken (während der Verkauf entschieden träge lief), und Westwind stagnierte. Es wurde September, und mein Agent entschuldigte sich dafür, dass er immer noch keinen Abnehmer für das umgeschriebene Buch gefunden hatte, aber ich hatte so viel zu tun, dass ich es fast nicht bemerkte. Mein neuer Job bedeutete, dass ich zweimal täglich neunzig Minuten fahren musste. Unterwegs verschlang ich die Romane, die ich für die Zeitung Scotland on Sunday rezensierte. Man hatte mich außerdem gefragt, ob ich Drehbuchideen für die Serie The Bill auf ITV vorschlagen wollte, und zwischendurch arbeitete ich immer wieder am Rebus-Roman …
Dann, dem Himmel sei Dank, rief mein Agent an und hatte Neuigkeiten. Mein alter Lektor bei Bodley Head (die sowohl Verborgene Muster als auch Der diskrete Mr. Flint gekauft hatten) hatte den Verlag gewechselt und war jetzt bei Barrie & Jenkins, und er wollte deren mageres Belletristikprogramm wiederbeleben. Kurz gesagt, er wollte Westwind haben. Im Januar 1989 besprachen wir weitere Überarbeitungen, und im März unterschrieb ich einen Vertrag. 1989 arbeitete ich weiter an Das zweite Zeichen, während ich Westwind überarbeitete und immer noch als Hi-Fi-Kritiker arbeitete. Im Juli war Westwind endlich fertig. Inzwischen jedoch hatte ich eine neue Lektorin, und ihr gefiel der Ton mancher Passagen nicht: Sie fand sie für einen Thriller zu humoristisch. Sie wollte ein tougheres Buch, und ich tat mein Bestes, sie zufriedenzustellen, was aber eine neuerliche Überarbeitung erforderte. Damit wären wir am 1. März 1990, dem Erscheinungsdatum.
Nicht, dass jemand etwas bemerkte. Es gab eine Hardcover- und eine Paperbackauflage sowie eine Ausgabe im Seniorengroßdruck. In die USA verkaufte es sich nicht, und kein fremdsprachiger Verlag wollte es haben. Mehr noch, es hatte so lange gedauert, bis das Buch endlich in Druck ging, und es hatte so viele Veränderungen und Revisionen erlebt, dass ich selbst auch nicht mehr viel Begeisterung dafür aufbringen konnte. Jedes Mal, wenn mein Agent oder ein Lektor mich gebeten hatte, es zu überarbeiten, hatte ich zugestimmt, bis es sich gar nicht mehr anfühlte, als wäre es mein Buch. Auf alle Fälle war es nicht das, was ich einmal hatte schreiben wollen.
Also entschied ich, es in einem dunklen Winkel meines Bewusstseins zur Ruhe zu betten, wo es das Tageslicht nie wieder sehen sollte.
Bis Twitter mich umstimmte.
Es war gelegentlich vorgekommen, dass ein Fan bei einer Signierstunde erzählte, er habe es gelesen und es habe ihm gefallen. Solche Fans hatten entweder in Wohltätigkeitsläden Glück gehabt oder bei einem Antiquariatsbuchhändler eine Menge Geld auf den Tisch gelegt. Ja, das Buch hatte seine Fans, aber ich gehörte nicht dazu, bis jemand auf Twitter mich überredete, noch einmal einen Blick hineinzuwerfen. »Es ist besser, als Sie glauben, Ian.« Es war so lange her, dass ich es gelesen hatte, dass es mir jetzt vorkam, als hätte jemand anders es geschrieben. Das erwies sich als Vorteil: Ich konnte objektiv sein, während ich das Buch im Eiltempo durchlas. Ja, es hatte ein paar Schwächen, und einige Satzkonstruktionen wirkten überfrachtet. Außerdem kam es mir ein bisschen unzeitgemäß vor, andererseits aber auch prophetisch. Ich hatte es in einem alternativen 1990 angesiedelt, wo amerikanische Truppen aus Europa abgezogen wurden. Internationale Spannungen sind auf dem Höhepunkt. Amerika zieht sich zurück, und das Militär fragt sich besorgt, welche Richtung Europa in Zukunft einschlagen wird. Satelliten umkreisen die Erde, die potenziell dazu benutzt werden, alles und jeden auszuspionieren. Niemand weiß, wem er vertrauen kann oder was passieren wird.
Ja, ich sah jede Menge Parallelen zur gegenwärtigen geopolitischen Lage, aber es machte mir auch Spaß, es zu lesen. Die Figuren erwachten zum Leben, der Plot kam zügig voran, die Schurken waren furchterregend, die Helden glaubwürdig. Und, oh – die Nostalgie! Zentralverriegelung für Autos war offenbar noch ziemlich neu (wohlgemerkt, nicht die zentrale Fernbedienung), denn ich erwähne sie mehr als einmal. Es gab den Filofax, die Floppy Disk und die Videokassette. Die Leute rauchten im Flugzeug, Tower Records war am Piccadilly Circus angekommen, und Deutschland war in Ost und West geteilt.
Ich hatte vergessen, dass der Lauschposten, in dem Martin Hepton arbeitet, in Binbrook, Lincolnshire, liegt – an einem Ort, den ich ausgesucht hatte, weil meine Schwester Maureen (die mit einem Techniker der Royal Air Force verheiratet war) mehrere Jahre dort gewohnt und ich sie als Schüler über ein oder zwei lange, heiße Feriensommer besucht hatte – damals, als ich noch sicher war, dass ich entweder Rockstar oder Dichter werden würde. Unter anderem habe ich deshalb das Gefühl, Coffin Burial könnte aus einem Gedicht stammen. Aber im Laufe der Arbeit an dem Buch missfiel mir dieser Titel immer mehr. Mein britischer Spionagesatellit hieß Zephyr, und Zephyr ist eine sanfte Brise oder der »Westwind«. Eingedenk dessen (und beeinflusst von Alan Moores Comic Watchmen) betitelte ich meinen Spionageroman Watchman (Der diskrete Mr. Flint), vielleicht weil ich die Idee hatte, meine Spionageromane könnten alle mit W anfangen. Der dritte Rebus-Roman würde schließlich Wolfman (Wolfsmale) heißen (bevor ein scharfsinniger Lektor in den USA mich bat, ihn Tooth and Nail zu nennen, um Leser mit einer Abneigung gegen Horrorliteratur nicht abzuschrecken). Das Zitat von George Bernard Shaw, das dem Buch als Motto voransteht, war wahrscheinlich auch nur eine glückliche Fügung – »der falsche Wind dort hinter dem Wasser« konnte sich auf die USA ebenso gut wie auf Russland beziehen. Auf alle Fälle weist es darauf hin, dass die, die man für seine Freunde hält, durchaus verborgene Absichten und zweifelhafte Beweggründe haben können.
Ich habe den Text der ersten Ausgabe noch einmal überpoliert und die mangelhaften Sätze und Szenen hoffentlich getilgt. Hier und da sind ein paar Wörter hinzugefügt und andere entfernt oder geändert worden, aber im Wesentlichen ist das dasselbe Buch, das es immer war, nur dreißig Jahre älter und ein bisschen weiser …
Ian Rankin, 2019
TEIL I
Der heutige Tag markiert möglicherweise das Ende einer großartigen Allianz, wenn Hunderte amerikanischer Militärs auf die Transportflugzeuge warten, die sie nach Hause bringen werden, fort von dem Land, bei dessen Verteidigung sie so lange geholfen haben. Gestern Abend floss so manche Träne, als sie sich von den Freunden verabschiedeten, die sie in diesem Land gefunden haben. Sie gehen nicht gern, und wir lassen sie nicht gern gehen. Aber Großbritannien ist jetzt ein Teil Europas, und es war eine demokratische Entscheidung, uns von unseren früheren Verbündeten zu trennen. Beten wir zu Gott, dass es sich nicht am Ende als törichte Entscheidung erweist. Schon jetzt hört man geflüsterte Zweifel an der Effizienz der europäischen Verteidigungssysteme, und als Insel sollten wir doppelt besorgt sein angesichts unserer reduzierten Abwehr, angesichts der Schutzmacht, derer wir nun beraubt sind. Womöglich ist der Mörtel zwischen unseren Ziegeln entfernt worden. Wer weiß, wann der Wolf aus dem Osten kommt und zu uns hereinwill?
Leitartikel im London Herald, 15. Juli 1990
1
Er betrachtete den Planeten Erde auf seinem Monitor. Es war ein eindrucksvoller Anblick. Um ihn herum taten andere das Gleiche, wenn auch nicht mit dem gleichen Erstaunen. Manche waren im Laufe der Jahre blasiert geworden: Hast du eine Erde gesehen, hast du alle gesehen. Aber nicht Martin Hepton. Er empfand immer noch Achtung, Ehrfurcht, Emotionen, was auch immer. Wenn er von einem spirituellen Gefühl gesprochen hätte, hätten die anderen ihn vielleicht ausgelacht. Also behielt er seine Gedanken für sich. Und betrachtete den Planeten.
Sie alle taten es, sie verzeichneten ihre separaten Daten im Computer und behielten die Erde vom Himmel aus im Auge, ohne je den Boden unter den Füßen zu verlieren. Hepton wurde manchmal schwindlig bei dem Gedanken: Dies ist die einzige Erde, die es gibt, und wir alle sind auf sie angewiesen, jeder Einzelne. In solchen Augenblicken erschien der Gedanke an Krieg unmöglich.
Die Bodenstation in Binbrook war in fast jeder Hinsicht klein, aber doch groß genug für ihre Zwecke, und sie lag mitten in der grünsten Landschaft, die Hepton je gesehen hatte. Er war hier in Lincolnshire geboren, aber im London der Sechzigerjahre aufgewachsen, im »Swinging London«. Der Swing war allerdings an ihm vorbeigegangen. Er hatte ständig über diesem oder jenem Lehrbuch gebrütet und das alles kaum bemerkt – die bunten Kleider, die lässige Attitüde, das ganze Hippie-Dekor. Zu oft hatte er die Nase, wenn sie nicht in einem Buch steckte, zum Himmel erhoben und eine Litanei von Himmelskörpern und Sternbildern aufgesagt. Und es hatte ihn hierhergeführt, als sei er einem vorherbestimmten Plan gefolgt. Er hatte nach dem Himmel gegriffen, und er hatte ihn berührt. Dank Zephyr.
Zephyr war der Grund hinter all dieser Aktivität, hinter all den Monitoren und geschäftigen Stimmen. Zephyr war ein britischer Satellit. Der britische Satellit. Es war nicht der einzige, den sie hatten, aber es war der beste. Bei Weitem der beste. Er konnte zu fast allem verwendet werden – Wetterbeobachtung, Kommunikation, Überwachung. Er konnte sich aus seinem Orbit bis auf hundert Meter zur Erde herunterfallen lassen, ein makelloses Bild aufnehmen und sich dann wieder in den Orbit hinaufschießen, bevor er seine Informationen zur Bodenstation sandte. Er war wirklich ein cleverer kleiner Gauner, und hier saßen seine Kindermädchen und behielten ihn genau im Auge, während er die Britischen Inseln im Auge behielt. Anscheinend wusste niemand ganz genau, warum Großbritannien zurzeit Zephyrs Zielobjekt war. Es ging das Gerücht, dass man ganz oben – das heißt, beim Militär und beim Verteidigungsministerium – den Wunsch geäußert habe, dieses Hoheitsgebiet zu inspizieren. Hepton war es recht. Er würde nie genug davon bekommen, die verschiedenen Monitore anzustarren, zu sehen, was der Satellit sah, und dafür zu sorgen, dass alles aufgezeichnet, registriert und verifiziert wurde, um dann von Generälen und Männern im Nadelstreifen studiert zu werden.
Er hatte seine eigenen Vorstellungen von der gegenwärtigen Überwachung. Die Vereinigten Staaten zogen ihre Truppen aus Europa ab. Alles sah nach freundschaftlicher Übereinkunft aus, aber in der Presse waren Gerüchte aufgekommen, die besagten, es habe einigen Druck vom europäischen Festland gegeben und die amerikanischen Generäle seien nicht sehr glücklich mit ihrem Abzug. Die Gerüchte hatten zu einigen rechtsgerichteten Demonstrationen geführt, die verlangt hatten: »Amerika soll bleiben! Amerika soll bleiben!«, und bald war eine Organisation mit diesem Namen gegründet worden. Jetzt gab es weitere Demonstrationen und Mahnwachen vor den europäischen Botschaften der Partner Großbritanniens. Nicht gerade das, was man als Pulverfass bezeichnen konnte, aber Hepton konnte sich vorstellen, dass die Regierung die Sache unter Kontrolle behalten wollte. Und wer eignete sich besser als Zephyr, um einen Konvoi von Protestierenden zu beobachten oder Kundgebungen in diversen Teilen des Landes im Auge zu behalten?
Und zwar auf Knopfdruck.
»Kaffee, Martin?« Ein Becher erschien neben seiner Konsole. Hepton schob sich den Kopfhörer in den Nacken.
»Danke, Nick.«
Nick Christopher deutete mit dem Kopf auf den Monitor. »Was Gutes im Fernsehen?«, fragte er.
»Nichts als alte Wiederholungen«, antwortete Hepton.
»Ist das nicht typisch im Sommerloch? Aber ehrlich gesagt, ich werde noch wahnsinnig, wenn wir nicht bald ein neues Programm kriegen.«
»Vielleicht kommt demnächst was Spannendes.«
»Wie meinst du das?«, fragte Christopher.
»Na ja.« Hepton umfasste den Plastikbecher mit beiden Händen. »Ich hab gehört, dass die Chefs heute hier sind. Vielleicht wird Fagin eine Simulation für sie ansetzen, um ihnen zu zeigen, dass wir fit sind.«
»Alles für einen Schuss Adrenalin.«
Hepton sah Nick Christopher an. Angeblich hatte es eine Zeit gegeben, in der er mehr als nur einen Schuss Adrenalin gebraucht hatte. Aber so war es im Stützpunkt: Wenn nichts passierte, schossen die Gerüchte ins Kraut. Christopher zog eine zusammengefaltete, zerfledderte Zeitung aus der Gesäßtasche. Das Kreuzworträtsel war beinahe fertig. Hepton schüttelte bereits den Kopf.
»Du weißt, ich bin nie gut darin«, sagte er. Nick Christopher war kreuzworträtselsüchtig. Er kaufte alles, von Rätselbüchern für Kinder bis zur Times, um seine Sucht zu befriedigen, und im Regal über seinem Schreibtisch standen dicke Bücher, die ihm bei dieser Beschäftigung halfen: Lexika, Synonym- und Antonym-Wörterbücher und Anagramm-Sammlungen. Oft bat er Hepton um Hilfe, und sei es nur, um zu zeigen, wie dicht er vor der Lösung des schwierigsten Rätsels des Tages stand. Jetzt zuckte er die Achseln.
»Na, dann sehen wir uns in der Pause.« Er kehrte zurück zu seiner eigenen Konsole.
»Kekse gehen auf mich«, sagte Hepton.
Plötzlich dröhnte die Luft, als eine Alarmsirene losging. Christopher drehte sich um und lächelte ihn an, als wollte er ihm zu seiner Vorahnung gratulieren. Hepton stellte seinen Kaffee hin, ohne davon zu trinken, und sah auf seinen Monitor. Er war erfüllt von den flackernden weißen Punkten des statischen Rauschens. Die anderen Bildschirme in der Nähe zeigten das gleiche elektronische Schneegestöber.
»Sichtkontakt verloren«, sagte jemand unnötigerweise.
»Wir haben jeden Kontakt verloren«, rief eine andere Stimme.
Wie es aussah, hatte Fagin sie tatsächlich in die Falle gehen lassen. Sofort wurde es hektisch. Drehstühle rollten hierhin und dorthin, Konsolen wurden verglichen, Tasten klapperten, Anrufe gingen über die Sprechanlagen. Wider Willen genossen alle hin und wieder eine Notsituation, echt oder nicht. Es gab ihnen Gelegenheit zu zeigen, wie effizient sie waren und wie schnell sie reagieren und reparieren konnten.
»Schalte zum Back-up-System.«
»Logge auf Kanal zwei ein.«
»Ich bekomme eine sehr träge Reaktion.«
»Dann rede nicht mit Schnecken.«
Ein Arm schob sich an Heptons Schulter vorbei, gab auf seinem Keyboard ein paar Zahlen ein, um sein eigenes zu einer Reaktion zu veranlassen. Nichts. Es war, als habe ein Fernsehsender sein Abendprogramm beendet. Der Kontakt zum Satelliten war verloren. Wie zum Teufel hatte Fagin das hingekriegt?
Hepton hob den Kaffeebecher an die Lippen, trank einen großen Schluck und verzog dann das Gesicht. Anscheinend hatte Nick Christopher einen ganzen Beutel Zucker hineingeschüttet.
»Lieber Gott«, murmelte er, und seine Finger huschten über die Tasten.
»Neu eingeloggt!«
»Aber hier keine Antwort.«
»Ich bekomme gar nichts.«
Eine Stimme kam aus den Lautsprechern und beendete den elektronischen Alarm.
»Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung.«
Sie verstummten und sahen einander an, und jeder erkannte die eigene Panik im Blick der anderen. Keine Übung! Aber es musste eine Übung sein, denn sonst hätten sie soeben Blech und Plastik im Wert von tausend Millionen Pfund verloren. Für wie lange verloren? Hepton sah auf die Uhr. Das System war vor mehr als zwei Minuten ausgefallen. Das bedeutete, es war wirklich ernst. Eine weitere Minute konnte eine Katastrophe bedeuten.
Fagin, der Chef der Operation, war aus dem Nichts erschienen und lief von Konsole zu Konsole, als sei dies eine Art Partyspiel. Zwei hochrangige Offiziere waren ebenfalls da; sie sahen aus, als kämen sie eben aus einem Meeting. Sie trugen Akten unter dem Arm und standen am hinteren Eingang, denn sie hatten keine Ahnung von dem System und wussten nicht, wie sie helfen sollten.
Das war typisch. Die Leute, die über das Geld bestimmten und die Befehle erteilten, hatten von nichts eine Ahnung. Deshalb war das Budget für Zephyr so knapp. Hepton warf noch einmal einen Blick auf die beiden am Eingang. Graue, ratlose Gesichter, die sich bemühten, interessiert und besorgt auszusehen, obwohl sie nicht wussten, weshalb sie besorgt sein sollten.
Plötzlich stand Fagin neben ihm.
»Können Sie was sagen, Martin?«
»Nein, Sir.«
»Was ist denn passiert?« Fagin hatte Vertrauen zu Hepton und wusste, dass er sorgfältig arbeitete.
Hepton zuckte die Achseln und fühlte sich absolut machtlos. »Es hat eben angefangen zu schneien«, sagte er und deutete auf den Monitor. »Das ist alles.«
Fagin nickte und war verschwunden. Sein Ansehen als kompetenter Fachmann stand kurz vor der Vernichtung. Als hielte man einen Magneten an eine Diskette – so schnell konnte alles verschwinden.
Und dann: »Moment!« Das war Nick Christophers Stimme.
»Ja«, rief jemand von weiter hinten. »Ich kriege wieder was. Der Funkkontakt ist wieder da.« Kurze Pause. »Nein, wir haben ihn erneut verloren.«
Die beiden Offiziere wechselten einen Blick und sahen auf die Uhr. Hepton konnte nicht fassen, was er da sah. Anscheinend war ihre Zeit knapp. Da schwirrte ein Hightech-Objekt im Wert von einer Milliarde Pfund blind im Orbit herum oder war dabei, auf die Erde zu stürzen, und sie machten sich Sorgen wegen der Zeit.
»Sind Sie sicher, dass Sie ihn hatten?«, rief Fagin.
»Ja, Sir.«
»Na, dann fangen Sie ihn wieder ein!«
»Ich versuch’s ja.«
Obwohl das Adrenalin in seinen Adern rauschte, empfand Hepton plötzlich eine innere Ruhe. Alles würde gut werden. Sie brauchten nur auf das Schicksal zu vertrauen und die richtigen Tasten zu drücken. Aber wem wollte er etwas vormachen? Zephyr war unwiederbringlich verloren.
Jemand stand hinter ihm. Er drehte sich um und sah Paul Vincent, der ihm konzentriert über die Schulter spähte. Vincent war der jüngste unter den Kollegen der Leitstelle und der am wenigsten selbstbewusste.
»Willst du sehen, wie ein Profi das macht, Paul?« Hepton grinste nervös und starrte wieder auf seinen Bildschirm, auf dem Vincents Spiegelbild zurückgrinste. Er klapperte weiter auf seiner Tastatur. Alle denkbaren Kombinationen hatte er inzwischen ausprobiert, alle rationalen Möglichkeiten ausgeschöpft. Jetzt versuchte er es auf irrationale Weise und befahl dem Computer das Unmögliche.
Paul Vincents Gesicht war plötzlich an seinem Ohr, obwohl die Augen des jungen Mannes anscheinend immer noch auf den Monitor blickten.
»Hör mal, Martin, ich will dir etwas zeigen.«
»Was?«
Vincent wandte den Blick nicht vom Bildschirm. Seine leise Stimme war kaum hörbar in dem Trubel ringsum.
»Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen«, flüsterte er, »jedenfalls nicht hundertprozentig. Aber ich glaube, da oben ist etwas im Gange. Entweder das, oder ich hab etwas falsch gemacht. Ich hatte es vorhin auf dem Monitor.«
»Was meinst du damit, ›etwas im Gange‹?«
»Ich weiß es noch nicht genau. Fremde Daten.«
»Hast du es gemeldet?«
»Natürlich.«
Vielleicht waren die hohen Tiere deshalb hier, und vielleicht hatten sie deshalb einen Moment lang ausgesehen, als hätten sie Angst.
»Reden wir von einem fremden Eingriff?« Auch Hepton sprach mit leiser Stimme.
»Ich weiß es nicht. Ich könnte wilde Vermutungen anstellen, aber ich glaube, das wäre nicht hilfreich. Ich möchte, dass du meine Daten bestätigst.«
»Wann hat es angefangen?«
»Vor ungefähr einer halben Stunde.«
»Zufall?«
Unvermittelt jauchzte jemand, Jubel kam auf, und ein paar Leute applaudierten.
»Wir haben ihn wieder!«
Heptons Blick ging zu seinem Monitor. Sie hatten ihn tatsächlich wieder. Er sah die verschwommenen, aber erkennbaren Umrisse Großbritanniens, aufgenommen aus dieser unglaublichen Höhe. Das Bild war unscharf, aber das konnten sie beheben. Die Hauptsache war, dass Zephyr wieder arbeitete.
»Panik vorbei.« Er drehte sich zu Paul Vincent um. »Was ist jetzt mit diesen fremden Daten?«
»Ich habe sie ausgelesen und gesichert. Komm und sieh’s dir an.«
Paul redete, ohne mit der Wimper zu zucken, und immer noch leise in dem zunehmenden Lärm um sie herum. Er war jung, aber kein Idiot, das wusste Hepton. Ein erstklassiges Examen in Astrophysik aus Edinburgh, danach ein Forschungsaufenthalt in Australien. Kein Idiot, aber auch kein erfahrener Praktiker. Seine Aufgabe – sein Spezialgebiet, für das er allein zuständig war – bestand in der Überwachung des Raums um Zephyr herum, der Suche nach Satellitenschrott, Müll, Meteoriten und Störwellen. Noch nie hatte er einen Fehler begangen, wenn es darauf ankam. Noch nie.
»Okay, Paul«, sagte Hepton, »gib mir zwei Minuten, um hier Ordnung zu machen, und dann komme ich und sehe es mir an.«
»Danke.« Vincent sah erleichtert aus wie ein Mann, dem man versichern muss, dass die rosa Elefanten, die er sieht, tatsächlich da sind. Und vielleicht waren sie es ja. Er verließ Hepton und kehrte zu seiner Konsole weiter hinten zurück. Vielleicht ließ der Kleine auch nach. Vor einer Woche hatte er eine Schmollphase gehabt, die mit irgendeiner Freundin zu tun hatte. Berufsrisiko. Schichtdienst, unregelmäßige Arbeitszeiten, manchmal tagelange Anwesenheit in der Kontrollstation. Zu viert in einem Zimmer mit zwei Etagenbetten. Hepton war nicht sicher, ob er selbst das noch lange aushalten würde, auch wenn er diese Erdbeobachtungen liebte. Wer kam je auf die Idee, ihn zu fragen, ob er einsam war? Niemand. Er dachte an Jilly und fragte sich, was sie wohl tat, während er hier saß. Er wollte sich nicht vorstellen, was sie tat.
Die Offiziere waren anscheinend aus irgendeinem Grund erfreut. Na ja, sie hatten Zephyr zurückbekommen, oder? Der eine sagte etwas zum anderen, und Hepton las ihm die Worte »drei Minuten vierzig« von den Lippen ab. Der andere nickte und lächelte wieder. Sie sprachen also darüber, wie lange der Satellit den Kontakt zu seiner Bodenstation verloren hatte. Drei Minuten vierzig Sekunden. Länger als jemals zuvor. Beinahe zu lange.
Um ihn herum wurde es ruhig. Fagin war zu den beiden Offizieren gegangen und sprach mit ihnen. Sie steckten die Köpfe zusammen, und ihre Augen glänzten. Hepton konnte ihre Lippen nicht mehr sehen. Na, es ging ihn auch nichts an. Er machte sich daran, seine Konsole in Ordnung zu bringen. Er hatte ein bisschen zu viele falsche Tasten in der falschen Reihenfolge gedrückt. Ein paar Korrekturen waren notwendig. Anschließend würde er Paul Vincent auf der anderen Seite des Raums besuchen.
»Noch Kaffee?« Das war Nick Christopher.
»Du hast beim ersten Mal Zucker hineingetan.«
»Aus Versehen. Ehrlich. Ich hole dir einen neuen.«
»Nicht nötig. Was, glaubst du, ist vorhin schiefgegangen?«
»Ich würde sagen, das war ein Schluckauf. Gelegentliche Fehlfunktionen gibt es überall. Unter uns gesagt, ich glaube, Zephyr ist zusammengeschustert worden wie der alte Ford mit dem gleichen Namen. Wir haben Glück, wenn er auf Kurs bleibt.«
»Der Ausfall hat drei Minuten vierzig Sekunden gedauert.«
»Was?«
»Die Offiziere haben die Zeit gestoppt.«
»Dann war es vielleicht eine Übung.«
»Ich glaube, Paul Vincent ist anderer Meinung.«
»Martin, du redest in Rätseln.«
»Sorry.«
»Was ist jetzt mit dem Kaffee?«
»Ohne Zucker diesmal?«
»Versprochen. Ohne Zucker.«
»Okay.«
Die Offiziere waren gegangen, und Fagin hatte sie begleitet, wahrscheinlich um sie zu verabschieden. Hepton fragte sich, wie das Wetter draußen sein mochte. Der Computer würde es ihm sagen, aber wäre es nicht viel schöner, hinauszuspazieren und selbst nachzusehen. Sonnig, mit kurzen Schauern, kühl, windig. Drinnen sorgte die Klimaanlage für gemäßigte, gleichmäßige Temperaturen, und die Beleuchtung war hell, ohne zu blenden. Das Gleiche galt für die Monitore. Man konnte sie den ganzen Tag anstarren, ohne Kopfschmerzen zu bekommen, was aber einen gelegentlichen Migräneanfall bei ihm nicht verhinderte. Er schob seinen Stuhl zurück. Auch der war so entworfen, dass er ein Maximum an Bequemlichkeit und ein Minimum an Stress bot. Er legte die Daumen rechts und links an den Nacken und drückte zu, und er spürte, wie die Nackenwirbel mit einem Knacks an ihren Platz rückten.
»Ohne Zucker«, sagte Christopher und reichte ihm den Becher.
»Danke.«
»Nur noch zwanzig Minuten bis zur Pause.«
»Gott sei Dank.«
»Was war das mit Paul?«
»Ach, er hat nur ein paar Daten, die ich mir ansehen soll.«
»Daten?« Christopher nahm einen Schluck von seinem Kaffee.
»Das weiß ich erst, wenn ich sie mir angesehen habe. Wahrscheinlich nichts Wichtiges. Du weißt ja, wie Paul ist.«
Christopher lächelte. »Wie ein Kind mit einer elektrischen Eisenbahn.«
»Genau«, sagte Hepton.
Als er schließlich zu Vincents Konsole hinüberging, war Paul nicht mehr da. Hepton warf einen Blick auf den Monitor. Er war schwarz. Er versuchte, sich einzuloggen, aber es ging nicht.
»Ein zeitweiliger Ausfall«, sagte Fagin hinter ihm. »Wollten Sie etwas?«
»Nur nachsehen.«
»Was nachsehen?«
»Ach, Sie wissen schon …«
»Tja, viel Vergnügen werden Sie nicht haben. Ein Teil der Platte ist gelöscht.«
»Sie meinen die Festplatte?«
»Ja.«
»Durch die Fehlfunktion?«
»Wahrscheinlich eher durch Vincents Panik.« Alle wussten, dass Fagin es auf Paul Vincent abgesehen hatte. Es hieß, Paul erinnere ihn zu sehr an seinen eigenen Sohn, der mit siebzehn das Elternhaus verlassen hatte und nie zurückgekehrt war.
»Wo ist Vincent übrigens?«
Fagin zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. Für kleine Mädchen?«
»Was ist eigentlich passiert?«
Fagin schien nachzudenken. »Ich bin einfach froh, dass wir ihn zurückhaben«, sagte er schließlich. »Den Rest finden wir irgendwann raus.«
»Das war also kein Test, mit dem Sie Ihre Freunde beeindrucken wollten?«
»Was für Freunde?«
»Die beiden Generäle.«
»Absolut nicht. Wie kommen Sie darauf?«
»Es sah aus, als hätten sie unsere Reaktionszeit gestoppt, das ist alles. Und sie schienen ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis zu sein.«
»Niemand verliert gern einen Satelliten, Martin.«
»Natürlich nicht. Sir. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden – ich habe gleich Pause. Ich glaube, ich sehe mal nach, wo Paul ist.«
»Okay.« Fagin nahm das interne Telefon und drückte auf ein paar Tasten. Die Panik war vorbei, das Leben musste weitergehen.
Drei Minuten vierzig Sekunden. Eine Fehlfunktion ließ sich normalerweise innerhalb von sechzig Sekunden lokalisieren und korrigieren. Es gab Back-up-Systeme, ein Computer war an jede Funktion des Satelliten gekoppelt und identifizierte und reparierte jeden Ausfall. Nach sechzig Sekunden konnte man annehmen, dass die Computer den Fehler nicht bemerkt hatten, und dann fing man an, sich Sorgen zu machen. Man nahm das Handbuch und kontrollierte alles selbst. Nach zwei Minuten geriet man in Panik.
Drei Minuten vierzig Sekunden. Die Generäle waren anscheinend zufrieden gewesen. Fagin war zufrieden. Paul Vincent hatte seine Beobachtungen gemeldet, aber niemand wollte etwas davon wissen. Was zum Teufel war hier los?
Hepton ging zu den Toiletten und warf dann einen Blick in die Kantine. Die Tischtennisspieler hatten Paul Vincent nicht gesehen, die Jungs, die sich einen Pornofilm ansahen, hatten Paul Vincent nicht gesehen, niemand hatte Paul Vincent gesehen. Er war verschwunden. Hepton setzte sich ins Fernsehzimmer, um nachzudenken. Die Pornodarsteller sprachen deutsch, aber man brauchte keine Sprachkenntnisse, um den Plot zu verstehen. Der Film wurde per Satellit gestreamt, wahrscheinlich von einer Station auf dem europäischen Festland. An einem langweiligen Wochenende hatten sie mehrere Stunden damit verbracht, die komplizierte Kommunikationstechnologie der Steuerzentrale mit zwei TV-Satelliten zu verbinden. Jetzt konnten sie jeden beliebigen Sender empfangen und jedes verschlüsselte Signal decodieren. Das Bild war heute nicht das schärfste, aber der Kameramann war den Akteuren nah genug, sodass es eigentlich nicht schlimm war …
Zephyr. Was wusste Paul Vincent über Zephyr?
Hepton erwischte Nick Christopher in der Kantine, wo er Pommes frites und Bohnen aufgabelte und mit der freien Hand ein offenes Buch hielt.
»Was liest du da?«
Christopher zeigte ihm das Cover. »Albert Camus. Der Fall. Hab ich in der Bibliothek gefunden.«
»Wie ist es?«
»Keine Ahnung. Ist noch nichts passiert. Was gibt’s denn?«
Hepton wurde bewusst, dass er die Ellenbogen auf den Tisch stützte und den Kopf auf beide Hände gelegt hatte.
»Ich kann Paul nicht finden.«
»Vielleicht will er nicht gefunden werden.« Christopher schob sich eine Gabel voll Bohnen in den Mund.
»Da hast du vielleicht recht.« Hepton nahm ein aufgeweichtes, lauwarmes Pommesstück von Christophers Teller.
Der Nachmittag nahm allmählich wieder seinen alltäglichen Lauf. Nach der Pause ging es zurück an die Konsolen. Aber das System gab die Ursache der Fehlfunktion nicht bekannt. Fagin ging von Monitor zu Monitor wie ein Fließband-Vorarbeiter. Er blieb an Heptons Tisch stehen.
»Anscheinend ist Paul Vincent schlecht geworden«, sagte er und kritzelte etwas auf sein Clipboard.
»Krank? Kann ich ihn sehen?«
»Er ist nicht auf der Toilette. Sie mussten ihn ins Krankenhaus bringen.«
»Gott, das kommt aber plötzlich.«
»Der Arzt meint, es ist schlichte Erschöpfung.«
Erschöpfung. Paul Vincent war nicht nur das jüngste Crew-Mitglied, sondern auch das fitteste. Zweimal täglich joggte er um das eingezäunte Gelände, eine Strecke von zweieinhalb Meilen, und das Fitnessstudio benutzte niemand außer ihm. Er hatte das Stehvermögen eines Athleten. Heptons Gedanken überschlugen sich. Das nächste Krankenhaus war zwanzig Meilen weit entfernt. Er musste hin.
Fagin war weitergegangen und studierte den nächsten Monitor. Hepton warf einen Blick hinüber zu Paul Vincents verwaistem Monitor. Der Stuhl war unter den Tisch geschoben, ein Anblick, der so endgültig wirkte wie ein zugeschraubter Sargdeckel. Ihn fröstelte. Die ganze Sache war sehr merkwürdig. Ein neugieriger Verstand hatte ihn in die Welt von Astronomie und Astronautik geführt, und der gleiche Verstand drängte ihn jetzt, sich das alles ein wenig genauer anzusehen. Und, ja, das würde er tun.
2
Rauch brannte in seinen Nasenlöchern, und er fühlte, wie das Blut sich an den faltigen Stellen seines Raumanzugs staute. Die Vibrationen im Shuttle wurden noch stärker und fühlten sich an wie auf einer Achterbahn. Als Kind hatte er auf einer Achterbahn einmal schreckliche Angst gehabt, und damals hatte er beschlossen, im Leben nie wieder vor etwas Angst zu haben – eine Entscheidung, die hier und jetzt ungültig wurde, denn ein so totales Entsetzen hatte er noch nie empfunden.
Durch die Scheibe konnte er einen kurzen Blick auf die Bodenmannschaft werfen. Die Feuerwehr raste bereits heran, aber zu spät. Funken sprühten vom brennenden Fahrgestell, und ein letzter, allumfassender Feuerball schleuderte ihn der fahlen Dunkelheit entgegen.
Aber dann war Adams mit blutigem Kopf plötzlich neben ihm, legte ihm die Hände um den Hals, drückte zu und schrie:
»Du Scheißkerl! Du Scheißkerl! Das vergesse ich nicht! Niemals! Nur die Beerdigung ist wichtig! Der Sarg muss begraben werden! The coffin must be buried!«
Das alles war so unnötig, dachte Dreyfuss. Wir sterben doch sowieso; warum lässt du mich nicht in Frieden sterben? Der Asphalt unter ihnen brodelte wie das Meer, wogend wie ein Jahrmarktkarussell. Adams’ Hände ließen nicht locker. Das Pochen des Blutes in Dreyfuss’ Ohren, das Kreischen von Metall, das Heulen der steuerlosen Triebwerke. Wie hatte das passieren können? Ein Totalausfall. Absolut und total, gerade als sie mit dem Landeanflug begannen. Wie hatte das passieren können? Es war typisch für sein Leben, dass er mit einer unbeantworteten Frage im Kopf sterben sollte.
Dann endlich verlor er das Bewusstsein.
Die Rettungsmannschaft stand bereit, schon seit dem ersten Hinweis darauf, dass mit dem Spaceshuttle Argos etwas nicht stimmte. Jetzt nahmen sie ihre Schläuche in Betrieb und umhüllten das havarierende Shuttle mit weißem Schaum, bis das ganze Ding aussah wie ein Kinderspielzeug in einem Schaumbad. Die Crew der Bodenstation war herausgekommen, um zuzusehen. An Bord waren sechs Mann gewesen, fünf Amerikaner und ein Brite, und jetzt beteten die meisten darum, dass wenigstens die Amerikaner noch am Leben waren. Der einzige Brite, Major Michael Dreyfuss, interessierte sie wenig. In diesen Zeiten ging es vor allem um die Nummer eins.
Die kleinen Brände waren schnell gelöscht. Zum Glück hatte die Argos nur noch wenig Treibstoff in ihren Tanks. Trotzdem war die metallene Außenhaut des Shuttles so heiß, dass man sie selbst mit Asbesthandschuhen nicht anfassen konnte. Aber endlich gelang es ihnen, die Luken aufzustemmen. Im Innern stank es nach Rauch, verbranntem Gummi und weniger angenehmen Materialien. Sie hatten damit gerechnet, Tote zu finden, aber niemand hatte erwartet, dass es fünf sein würden, von denen einer die Hände fest um den Hals des einzigen überlebenden Besatzungsmitglieds gekrallt hatte …
3
General Ben Esterhazy saß auf dem Rücksitz hinter dem Chauffeur seines Dienstwagens und fragte sich, warum in der Minibar kein Bourbon mehr war. Hoffentlich würde es auf dem Stützpunkt noch welchen geben. Nicht, dass vom Stützpunkt noch viel übrig war. Alles wurde demontiert und verpackt, und die Jungs wurden in die Staaten zurückgeflogen. Das verdammte Land war sowieso beschissen. Kurz nach dem Krieg hatte er ein paar Jahre in Deutschland verbracht. Die Leute hatten gehungert; eine Mutter hatte sich tatsächlich auf den Rücken gelegt und die Beine breitgemacht – für eine Dose Corned Beef und irgendeine Trockennahrung.
Allzu sehr schien das Land sich nicht verändert zu haben, aber inzwischen hatte Europa den Zweiten Weltkrieg vergessen und war noch größer geworden als sein Bauch. Die Rede war nur noch von Europa, einem Europa, das für die amerikanischen Streitkräfte, die zu einem schmalen Schutzwall gegen den Osten aufgestellt waren, keinen Platz mehr sah.
»Na, scheiß drauf.«
»Wie bitte, General?« Esterhazys Adjutant, Lieutenant Jerry Bosio, der vorn neben dem Fahrer saß, drehte sich um, damit er besser verstehen konnte, was der General sagte.
»Schon gut«, knurrte Esterhazy. Er nahm eine Flasche Glenfiddich und goss sich einen Fingerbreit von dem Whisky in ein Glas. Esterhazy hatte ein scharf geschnittenes, aggressives Gesicht mit einer spitzen Nase. Seit er einen Schreibtischjob bekommen hatte, hatte er zugenommen, aber nicht zu sehr. Er hatte keine Hängetitten wie manche Männer im mittleren Alter, und im Ringkampf trat er gegen Marines an, die halb so alt waren wie er.
»Wo zum Teufel ist das Soda?«, brummte er. Auf den Bonner Straßen herrschte die Flaute des mittleren Abends. Niemand schien sich weiter für den Dienstwagen oder seinen Fahrgast zu interessieren – in letzter Zeit waren in Bonn viele solche Autos unterwegs –, und Esterhazy war es nur recht. Das Letzte, was er gebrauchen konnte, wären Jubel- oder Buhrufe. Wenn sie jubelten, taten sie es dann, weil sie froh waren, die amerikanischen Truppen abziehen zu sehen? Oder weil sie froh über ihre Anwesenheit waren und sich wünschten, sie würden bleiben? Das wusste der Himmel, Ben Esterhazy wusste es nicht. Die Verhandlungen heute hatten sich in die Länge gezogen. Die Dolmetscher wirkten benebelt, und die Delegierten ebenfalls. Es ging dem Ende zu; der Abzug war bereits eingeleitet. Jetzt ging es eigentlich nur noch darum, ein paar i’s mit Pünktchen zu versehen. So etwas war noch nie Esterhazys Sache gewesen.
Aber jetzt war seine Rolle in der Komödie zu Ende, und heute Abend würde er in die Staaten zurückfliegen. Er entspannte sich, nahm einen Schluck Whisky und legte den Kopf an die Kopfstütze. Er fuhr nach Hause. Die Arbeit war getan. Er war noch einmal gekommen, um den Schein zu wahren, und hatte dieses und jenes Papier unterschrieben. Jetzt konnte er wieder zu den Männern in Washington gehen und ihnen sagen, dass die Arbeit erledigt war. Nicht, dass es sie wirklich interessierte. Wenn Europa seinen Kram allein machen wollte – bitte sehr. Das war das Gesicht der Demokratie. Aber wenn es Krieg gäbe, wären die Männer in ihren Anzügen die Ersten, die in Deckung gingen, und die Ersten, die die Truppen geradewegs wieder in die Todeszone schickten.
»Na, scheiß auf sie.«
»Sir?«
»Schon gut.«
»Sir …«
Esterhazy sah, dass der Adjutant die Hand in einen Attachékoffer geschoben hatte, einen Umschlag herausnahm und versuchte, den General darauf aufmerksam zu machen.
»Was zum Teufel ist das?« Esterhazy riss ihm das Papier aus der Hand.
»Eine Nachricht für Sie, Sir«, sagte Bosio. »Ich habe vergessen, sie Ihnen zu geben.«
»Idiot.« Esterhazy riss den Umschlag auf und faltete das Blatt, das darin war, auseinander.
SCHADE,DASSSIENICHTZURBEERDIGUNGKOMMENKONNTEN.
General Ben Esterhazy lächelte zum ersten Mal an diesem Tag.
4
Martin Hepton legte das Telefon hin. Beim dritten Versuch hatte er etwas Konkretes über Paul Vincent herausgefunden. Paul war nicht mehr im Krankenhaus. Er war in ein Sanatorium verlegt worden, zur »Erholung«, wie der Krankenhausarzt es genannt hatte. Erschöpfung, das war alles. Mehr war es nicht.
Hepton ging durch den Korridor, blieb vor dem Fitnessstudio stehen und stieß dann die Tür auf. Es war ein gut eingerichtetes Studio. In einem gesunden Körper wohnte ein gesunder Geist. Aber niemand benutzte dieses Studio. Niemand außer Paul Vincent. Hepton trat an das Multi-Gym, die sogenannte »Foltermaschine«, und zog sich an der Klimmzugstange hoch. Er berührte die Stange mit dem Kinn und entspannte die Arme dann langsam, bis seine Füße wieder den Boden berührten.
»Das war einer«, sagte eine Stimme hinter ihm. Es war Nick Christopher. Lächelnd ließ er die Tür hinter sich zufallen.
Hepton lächelte ebenfalls. Er zog sich noch einmal hoch, aber jetzt kostete es Anstrengung, und er landete schwer wieder auf den Füßen.
»Zwei«, zählte Christopher.
»Genug für heute.« Hepton spürte, wie das Blut in seiner Brust pochte.
»Hat dieser Mann keine Kondition? Das frage ich mich.«
»Okay, lass sehen, was du so schaffst.«
»Geh zur Seite, du Spargel.« Christopher zog ein Kreuzworträtselheft aus der Gesäßtasche und gab es Hepton, und dann packte er die Stange und zog sich hoch. Er schaffte fünfzehn Klimmzüge, bevor er sich schwer atmend ausruhte.
»Ich bin beeindruckt«, sagte Hepton
»Wenn es einen Grund gibt, weshalb regelmäßiger Sex gut für dich ist«, sagte Christopher und nahm sein Kreuzworträtselheft zurück, »dann ist es dieser: Du kriegst starke Arme davon.« Sie lachten beide.
»Ich hab keine Ahnung, was Sex ist«, sagte Hepton.
»Dann ist das dein Problem«, sagte Christopher. »Du hast keine Ahnung.« Er schwieg kurz und fragte dann: »Wie läuft’s mit Jilly?«
»Was soll da laufen? Ich hab von ihr nichts mehr gehört, seit sie nach London gegangen ist.«
»Hast du versucht, sie anzurufen?«
»Nur einmal jeden Tag.«
»Du hast also das Gefühl, es ist aus?«
»Nur ein bisschen.«
»Tut mir leid, das zu hören, Martin.«
Hepton zuckte die Achseln. Noch einmal packte er die Stange und schaffte zwei Klimmzüge.
»Was ist mit Paul?«, fragte Christopher.
»Was soll mit ihm sein?«
»Hast du was rausgefunden?«
»Anscheinend ist er in einem Genesungsheim.«
»Gott, dann muss es ja schlimm sein. Ich dachte, da kommen nur Sterbende und Tote hin.«
Hepton versuchte einen dritten Klimmzug, scheiterte und ließ sich zu Boden fallen. »Dann kannst du mir da ein Zimmer reservieren«, sagte er. »Aber vorher spendierst du mir noch was zu trinken.«
Sie setzten sich in die Cafeteria, tranken Cola aus Dosen und aßen Chips.
»Das soll Gehirnnahrung sein?«, fragte Christopher. »Was hältst du davon, dass dieses Shuttle, die Argos, einfach so gecrasht ist?«, wollte er dann wissen.
»Ich glaube, unser Mann hatte Glück, dass er lebendig rausgekommen ist.«
Natürlich hatte die Nachricht auf Seite eins gestanden. Morgen würde sie in den Hintergrund treten, aber heute war Major Mike Dreyfuss berühmt, und wahrscheinlich, dachte Hepton, hatte der Mistkerl sich das immer gewünscht. Hepton hatte zwei sehr gute Gründe, auf Mike Dreyfuss eifersüchtig zu sein. Zum einen hatte der Mann tatsächlich den Himmel berührt, während er selbst ihn nur betrachten konnte.
Zum andern hatten Dreyfuss und Jilly eine lange gemeinsame Vergangenheit. Ein Liebespaar waren sie vielleicht nie gewesen – obwohl er sich da auf ihr Wort verlassen musste –, aber sie waren Freunde gewesen, sehr gute Freunde, und während sie Hepton Zugang zu ihrem Bett und ihrem Körper gewährt hatte, waren ihre Gedanken ihm immer verschlossen geblieben. Aber sie hatte immer mit so viel Zärtlichkeit von Dreyfuss gesprochen …
»Na«, sagte Nick Christopher, »ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich jetzt entspannen kann. Ich meine, da sitzt er in Amerika als einziger Überlebender einer Katastrophe, bei der alle Amerikaner an Bord ums Leben gekommen sind, und hier schmeißen wir die Yankees aus Europa raus. Das macht uns da drüben nicht gerade beliebt.«
»Ich weiß, was du meinst«, sagte Hepton und hatte Mühe, ein Lächeln zu unterdrücken. Stattdessen stopfte er sich den Mund mit Chips voll. Ja, Dreyfuss mochte auf Seite eins stehen, aber aus lauter falschen Gründen.
5
Das diffuse Licht färbte das polierte Gold des … Hier endete die Beschreibung. Sein Verstand war überfordert. Er beschloss, ein Auge zu öffnen, nur ein bisschen, und er sah wässrig verschwommene Blau- und Grau- und Weißtöne, überströmt von goldenem Licht. Er blinzelte und öffnete beide Augen, und er sah, dass er in einem Krankenhausbett lag. In einem Einzelzimmer. Lavendelblau gestrichene Wände, Apparate neben dem Bett, eine Infusion am linken Arm. Durch die Lamellen der Jalousien strahlte der ungefilterte Sonnenschein. Goldenes Licht.
Er lebte also noch.
Eine Krankenschwester saß dösend in der Hitze des Zimmers. Ein Paperback-Roman lag auf ihrem Schoß. Wo war er? Warum war er so zerschlagen? Sein Mund war wund. Dann erinnerte er sich – das Shuttle hatte eine Bruchlandung hingelegt. Sie hatten das Fahrgestell nicht ausfahren können. Überhaupt nichts hatte funktioniert. Der Bordcomputer war komplett ausgefallen. Wie zum Teufel hatte das passieren können?
Und was war mit Heinemann, O’Grady, Marshall, Wilson, Adams? Hatten sie überlebt, oder waren sie tot? Vor allem interessierte ihn, was aus Hes Adams geworden war. Er stieß einen leisen Pfiff aus, so gut es ging und ohne dass es allzu wehtat. Es genügte. Die Krankenschwester regte sich, öffnete die Augen und lächelte ihn an. Dann schloss sie sie wieder und streckte sich. Ein frühmorgendliches, ausgiebiges Gähnen, noch ein Lächeln, als seien sie zusammen im Bett aufgewacht, wie ein Liebespaar.
»Guten Tag, Mr. Dreyfuss. Wie fühlen Sie sich?«
Dreyfuss. Das war sein Name. Als Name so gut wie jeder andere. Er versuchte, ihre Frage zu beantworten, aber seine Kehle war wund und trocken. Er schluckte mühsam, und sie schien zu verstehen; sie stand auf und goss Wasser aus einer Karaffe in ein Glas. Auf seinem Nachttisch standen Blumen. Nicht viele, nur zwei kleine Sträuße.
Das Wasser war lauwarm, und das Schlucken fiel ihm schwer.
»Danke«, sagte er mit rasselnder Stimme. »Tut gut.« Wenn er sprach, hatte er das Gefühl, als würde jemand mit Schmirgelpapier in seiner Kehle herumreiben.
»Sie haben lange geschlafen.«
»Wie lange?«
»Ein paar Tage, glaube ich. Ich habe hier erst seit ein paar Stunden Dienst.«
»Wo bin ich?«
»Im Sacramento General.«
Das klang wie der Titel eines schlechten Westerns. Vermutlich war es einfach ein Krankenhaus in Sacramento. In Sacramento war er noch nie gewesen. Bei der Shuttle-Mission hatte er unter anderem dabei sein wollen, um ein bisschen mehr von den Staaten zu sehen. Vorher war er erst dreimal hier drüben gewesen und nie sehr lange. Als Kind in den zusehends verschwindenden Slums von East Edinburgh hatte er von all dem geträumt – von Raumfahrern und von Amerika –, und er hatte seine Träume mit Spielzeugraketen inszeniert, die er Hals über Kopf in den Untergang geschickt hatte.
»Die anderen …«, fing er an, aber die Schwester hatte schon den Rufknopf über seinem Bett gedrückt. Gott, sie hatte eine tolle Figur in diesem dünnen Kittel aus weißer Baumwolle. Fast schmeckte er … Aber was schmeckte er in seinem Mund, unter der trockenen Verkrustung und dem faden Nachklang des Wassers?
Rauch, Blut, Angst. Und Hände, die an ihm zerrten. Warum zerrten sie an ihm?
»Guten Tag, Major Dreyfuss.«
Ein Mann in einem weißen Kittel und mit einem beruhigend baumelnden Stethoskop am Hals hatte die Tür aufgestoßen.
Hinter ihm kamen zwei andere, der eine in Generalsuniform, der andere sah aus wie ein Bedenkenträger aus dem Außenministerium. Sie hielten sich links und rechts von dem Arzt wie zwei Tumore, die ihm aus den Rippen wuchsen. Gut, dachte Dreyfuss, seine Beschreibungsgabe kehrte zurück.
»Hallo«, sagte er, aber der Arzt studierte sein Krankenblatt und dann die Krankenschwester. Er lächelte sie an.
»Ich glaube, ich habe Sie noch nicht gesehen, oder?«
Sie lächelte zurück. »Nein, Doktor. Ich heiße Carraway.«
»Und, Schwester Carraway, hat der Patient sich gut benommen?«
»Ja, Doktor.« Sie sah Dreyfuss an und lächelte wieder. Der Arzt wandte sich ihm zu. »Wie fühlen Sie sich?«
»Hundertprozentig, Doktor. Wann darf ich aufstehen?«
Der Arzt lachte. »Vorläufig noch nicht, fürchte ich.«
»Warum so eilig?«, blaffte der General. Die Frage war ernst gemeint.
Dreyfuss schloss die Augen.
»Jetzt habe ich einen Rückfall, Doc«, seufzte er. »Ich bin allergisch gegen Idioten.«
»Ja, Sie Scheißkerl …«, fing der General an, aber der Zivilist hob die Hand und schnitt ihm das Wort ab.
Dreyfuss öffnete die Augen, starrte auf die Jalousie und versuchte, sich zu erinnern, wo er diese Farbe schon einmal gesehen hatte, diese goldene Farbe, und wo er dieses Wort gehört hatte.
Ein Feuerball. Brennender Treibstoff. Die Stimme von Hes Adams in seinem Ohr: Du Scheißkerl …
»Lassen Sie ihn, Ben«, sagte der Zivilist. »Er ist traumatisiert. Wahrscheinlich weiß er nicht, was er sagt.«
»Das weiß er ganz genau.«
»Kommen Sie.« Der Zivilist führte den General entschlossen zur Tür. »Ich spendiere Ihnen einen Drink, und Sie können mich mit der Geschichte von Bonn langweilen.«
Der Arzt sah den beiden nach und schien sich ein bisschen zu entspannen. Er kam zum Bett.
»Nette Jungs«, bemerkte Dreyfuss. Anscheinend verstand der Arzt ihn nicht. Er lächelte.
»Sie meinen General Esterhazy und Mr. Stewart.«
»Wenn sie so heißen.«
»So heißen sie.« Der Arzt sah zu, wie Dreyfuss noch einen Schluck Wasser trank. »Wunde Kehle?«
»Ein bisschen«, sagte Dreyfuss. »Hören Sie, meine Frage war ernst gemeint. Wann darf ich aufstehen?«
»Haben Sie noch ein bisschen Geduld.« Ein dünner Lichtstrahl leuchtete in Dreyfuss’ linkes, dann in sein rechtes Auge. »Was wissen Sie noch über den Unfall, Major?«
»Über welchen Unfall?« Dreyfuss lächelte, als er sah, wie der Arzt erschrak. »War ein Scherz«, sagte er. »Ich erinnere mich an einen Feuerball. Sah wirklich aus wie ein Ball. Es war, als könnte ich ihn wegkicken. Aber stattdessen hat er mich weggekickt. Und dann muss ich wohl in Ohnmacht gefallen sein.«
»Und wo waren Sie da?«
»Im Shuttle natürlich. Das Shuttle hieß Argos, und wir waren im Landeanflug. Wir waren zu sechst.«
»Und was hatte das Shuttle gemacht?«
Dreyfuss dachte demonstrativ nach.
»Major?«
»Ich … ich kann mich anscheinend nicht erinnern«, log er, aber es war ihm ein Rätsel, warum sein Instinkt ihm riet, seine wiedererwachenden Erinnerungen für sich zu behalten.
»Na, machen Sie sich keine Sorgen deswegen.« Dreyfuss merkte, dass Schwester Carraway ihn anstarrte. Als ihre Blicke sich trafen, schaltete sie ihr Lächeln wieder ein. »Erinnern Sie sich an die Namen der anderen Crewmitglieder?«, fragte der Arzt jetzt.
»Mal sehen.« Dreyfuss versuchte, so auszusehen, als müsse er scharf nachdenken, und er fragte sich, warum Schwester Carraway sich so sehr für seine Antwort interessierte. »Heinemann«, sagte er schließlich. »Adams, Marshall, O’Grady, Wilson.«