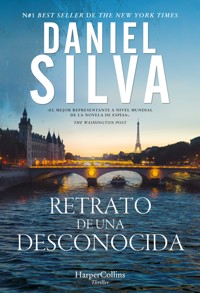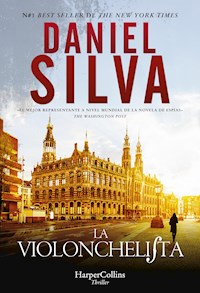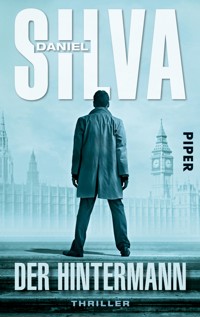
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Europa wird von islamistischen Selbstmordattentätern heimgesucht. Mossad-Agent Gabriel Allon soll dem amerikanischen Geheimdienst helfen, die Hintermänner der Terroristen zu finden. Denn der von der CIA mühsam aufgebaute Informant Rashid al-Husseini hat bei einem Besuch in Saudi-Arabien überraschend die Seiten gewechselt. Mit wem genau arbeitet Rashid jetzt zusammen? Wer organisiert die Attentate? Um dies zu ergründen, soll Gabriel zusammen mit ausgewählten Experten ein vermeintliches islamistisches Netzwerk aufbauen. Bald kommt er so den Terroristen dicht auf der Spur, allen voran dem Meisterspion Malik al-Zubair. Doch der erweist sich als ebenbürtiger Gegner …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für meine wundervollen Kinder Nicholas und Lily, die ich mehr liebe und bewundere, als sie jemals wissen werden. Und wie immer für meine Frau Jamie, die alles möglich macht.
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Wulf Bergner
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96222-3
© Daniel Silva 2011 © der deutschsprachigen Ausgabe: Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München Published by arrangement with HarperCollins Publishers, LLC. Die amerikanische Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Portrait of a Spy« bei HarperCollins, NewYork. Umschlaggestaltung: Mediabureau Di Stefano, Berlin unter Verwendung eines Fotos von CollaborationJS/Arcangel Images
Der Dschihad wird so amerikanisch wie Apfelkuchen und so britisch wie Fünfuhrtee.
Anwar al-Awlaki, al-Qaida-Prediger und -Anwerber
TEIL I
Tod auf dem Markt
1
LIZARD-HALBINSEL, CORNWALL
Es war der Rembrandt, der die endgültige Lösung des Rätsels brachte. In den beschaulichen Shops, in denen sie einkauften, und den dunklen kleinen Pubs am Hafen, in denen sie tranken, rügten sie sich später dafür, dass sie die unverkennbaren Anzeichen übersehen hatten, und belächelten einige ihrer ausgefalleneren Theorien über seine tatsächliche Arbeit. Denn keiner von ihnen hatte nicht einmal in seinen wildesten Träumen die Möglichkeit erwogen, dass der schweigsame Mann, der am Ende der Gunwalloe Cove genannten Bucht wohnte, ein Kunstrestaurator sei, noch dazu ein weltberühmter.
Er war nicht der erste Außenseiter, der mit einem Geheimnis, das er zu bewahren wünschte, nach Cornwall herunterkam, aber nur wenige hatten ihres eifersüchtiger oder stilvoller und listiger gehütet. Allein die merkwürdige Art, wie er ein Haus für sich und seine schöne, viel jüngere Frau gemietet hatte. Nachdem er sich für ein romantisches Cottage auf den Klippen entschieden hatte – allen Berichten nach ohne vorherige Besichtigung –, hatte er eine volle Jahresmiete auf höchst diskrete Weise über einen obskuren Hamburger Anwalt vorausgezahlt. Zwei Wochen später zog er dort draußen ein, als führe er ein Kommandounternehmen gegen einen feindlichen Vorposten durch. Allen, die ihn bei seinen ersten Streifzügen durchs Dorf kennenlernten, fiel seine extreme Verschlossenheit auf. Er schien keinen Namen zu haben – zumindest keinen, den er verraten wollte –, und selbst über seine Nationalität konnte nur spekuliert werden. Duncan Reynolds, vor zwanzig Jahren bei der Eisenbahn pensioniert und wegen seiner Lebensklugheit in Gunwalloe allgemein geachtet, beschrieb ihn als »ein Rätsel von einem Mann«, während andere Urteile von »abweisend« bis »unerhört grob« reichten. Trotzdem waren sich alle darüber einig, dass ihr kleines Dorf Gunwalloe im Westen Cornwalls – zum Guten oder Schlechten – ein interessanteres Fleckchen geworden war.
Im Lauf der Zeit bekamen sie heraus, dass er Giovanni Rossi hieß und wie seine schöne Frau aus Italien stammte. Noch merkwürdiger wurde es jedoch, als ihnen aufzufallen begann, dass auf den Straßen des Dorfs und der näheren Umgebung spätnachts vermutlich Kriminalbeamte in neutralen Dienstwagen unterwegs waren. Und dann gab es noch die beiden Kerle, die manchmal in der Bucht angelten. Einig war man sich darüber, dass sie die schlechtesten Angler waren, die man je gesehen hatte. Die meisten vermuteten sogar, sie seien überhaupt keine Angler. Wie in einem Nest wie Gunwalloe nicht anders zu erwarten, löste das alles eine intensive Diskussion über die wahre Identität des Zugereisten und das tatsächliche Wesen seiner Arbeit aus – eine Diskussion, die zuletzt durch das Porträt einer jungen Frau, Öl auf Leinwand, 104 mal 86Zentimeter, von Rembrandt van Rijn beendet wurde.
Wann das Gemälde eingetroffen war, ließ sich nicht genau feststellen. Sie vermuteten, das sei irgendwann Mitte Januar gewesen, denn ab diesem Zeitpunkt änderte sich sein Tagesablauf radikal. Gestern war er noch mit finsterer Miene, als ringe er mit einem schlechten Gewissen, über die steil abfallenden Klippen der Lizard-Halbinsel marschiert. Am Tag darauf stand er mit Pinsel und Palette vor der Staffelei in seinem Wohnzimmer und hörte dabei so laut Opernmusik, dass man das Gejaule noch in Marazion jenseits der Mount’s Bay hören konnte. Weil sein Cottage ziemlich nahe am Küstenweg stand, konnte man ihn – wenn man an genau einer Stelle haltmachte und sich den Hals verrenkte, versteht sich – in seinem Atelier erblicken. Anfangs sah es ihnen danach aus, als ob er an einem eigenen Bild arbeite. Aber in den folgenden Wochen zeigte sich immer deutlicher, dass er den Beruf eines Konservators oder, was die geläufigere Bezeichnung war, eines Restaurators ausübte.
»Was zum Teufel heißt das?«, fragte Malcolm Braithwaite, ein alter Hummerfischer, der auch im Ruhestand noch nach Meer roch, eines Abends im Pub Lamb & Flag.
»Das heißt, dass er das verdammte Ding auffrischt«, sagte Duncan Reynolds. »Ein Gemälde ist wie ein lebendiges, atmendes Wesen. Wird es alt, kriegt es Schuppen und schlafft ab – genau wie du, Malcolm.«
»Wie ich höre, ist’s ein junges Mädchen.«
»Hübsch«, sagte Duncan nickend. »Wangen wie Äpfel. Echt zum Anbeißen.«
»Wissen wir den Künstler?«
»Daran arbeiten wir noch.«
Und das taten sie wirklich. Sie schlugen in vielen Büchern nach, recherchierten im Internet und suchten den Rat von Leuten, die mehr von Kunst verstanden als sie selbst – womit sie repräsentativ waren für drei Viertel der Einwohner von West Cornwall. Anfang April nahm Dottie Cox aus dem Dorfladen ihren ganzen Mut zusammen und befragte einfach die schöne junge Italienerin, als diese bei ihr einkaufte. Die Frau wich der Frage mehrdeutig lächelnd aus. Dann schlenderte sie mit ihrer umgehängten Strohtasche zu dem Häuschen auf der Klippe zurück, während ein frischer Frühlingswind ihr dichtes dunkles Haar zerzauste. Schon wenige Minuten nach ihrer Rückkehr verstummte das Operngejaule, und die Jalousien auf der dem Küstenweg zugekehrten Hausseite schlossen sich wie Augenlider.
Auch in der folgenden Woche blieben sie geschlossen, bis der Restaurator und seine schöne Frau ohne Vorwarnung verschwanden. Einige Tage lang fürchteten die Einwohner von Gunwalloe, die beiden seien endgültig fort, und einige machten sich sogar Vorwürfe, weil sie herumgeschnüffelt und sich zu sehr für das Privatleben des Paars interessiert hatten. Dann stieß Dottie Cox, als sie eines Morgens die eben eingetroffene Times durchblätterte, zufällig auf einen Bericht aus Washington, D.C., über die Enthüllung eines lange verschollen gewesenen Rembrandtgemäldes – eines Porträts, das dem Gemälde, das in Mr.Rossis Cottage gewesen war, täuschend ähnlich sah. Und damit war das Rätsel gelöst.
Wie es der Zufall wollte, stand in dieser Ausgabe der Times auf der Titelseite auch ein Bericht über eine Serie von mysteriösen Explosionen in vier geheimen irakischen Nuklearanlagen. Niemand in Gunwalloe wäre auf die Idee gekommen, zwischen beiden Meldungen könnte es einen Zusammenhang geben. Wenigstens damals noch nicht.
Der Restaurator war ein anderer Mann, als er aus Amerika zurückkam. Das konnte jeder sehen. Obwohl er bei persönlichen Begegnungen zurückhaltend blieb – und er war weiterhin niemand, den man in der Dunkelheit hätte erschrecken wollen –, war ihm offenbar eine große Last von den Schultern genommen worden. Auf seinem kantigen Gesicht erschien gelegentlich sogar ein Lächeln, und das Leuchten seiner unnatürlich grünen Augen wirkte etwas weniger distanziert. Sogar seine langen täglichen Spaziergänge nahmen eine neue Qualität an. Wo er sonst wie besessen über die Wanderwege geeilt war, schien er jetzt wie ein Wesen aus dem Reich König Arthurs, das nach langen Jahren in fremden Landen heimgekehrt war, über die nebelverhangenen Klippen zu schweben.
»Mir kommt’s vor, als wäre er von einem heiligen Eid entbunden worden«, meinte Vera Hobbs vom Backshop. Aber als sie aufgefordert wurde, darüber zu spekulieren, was er geschworen oder wem er sich verpflichtet haben könnte, wollte sie nichts weiter dazu sagen. Wie das ganze Dorf hatte sie sich schon bei dem Versuch blamiert, seinen Beruf zu erraten. »Außerdem«, fügte sie warnend hinzu, »wär’s besser, ihn in Ruhe zu lassen. Sonst bleibt er nächstes Mal, wenn er den Lizard mit seiner hübschen Frau verlässt, vielleicht endgültig weg.«
Als ein herrlicher Sommer allmählich in den Herbst überging, wurden Spekulationen über die Zukunftspläne des Restaurators zur Lieblingsbeschäftigung aller Dorfbewohner. Weil der Mietvertrag für das Cottage im September auslief und nichts darauf hinzudeuten schien, dass er ihn verlängern wollen würde, unternahmen sie einen heimlichen Versuch, ihn zum Bleiben zu überreden. Was der Restaurator brauche, beschlossen sie, sei etwas, das ihn an die kornische Küste fesseln könne: ein Job, der seine einzigartigen künstlerischen Fähigkeiten erforderte, damit er etwas anderes zu tun hatte, als über die Klippen zu marschieren. Was dieser Job genau sein und wer ihn ihm geben könnte, war gänzlich unklar, aber sie machten sich daran, diese schwierigen Fragen gemeinsam zu lösen.
Nach langen Überlegungen kam schließlich Dottie Cox auf die Idee, ein »Festival der Schönen Künste in Gunwalloe« zu veranstalten, bei dem der berühmte Restaurator Giovanni Rossi den Ehrenvorsitz übernehmen würde. Genau das schlug sie am folgenden Morgen seiner Frau vor, als diese zur gewohnten Zeit ihre Einkäufe machte. Mrs.Rossi reagierte darauf mit einem Lachanfall. Das Angebot sei schmeichelhaft, sagte sie, als sie sich wieder gefangen hatte, aber vermutlich nichts, worauf Signor Rossi sich einlassen werde. Wenig später lehnte er offiziell mit Dank ab, und das Festival der Schönen Künste in Gunwalloe ging sang- und klanglos unter. Aber das machte nichts, denn einige Tage später erfuhren sie, der Restaurator habe das Haus auf der Klippe für ein weiteres Jahr gemietet. Auch diesmal zahlte er eine volle Jahresmiete auf höchst diskrete Weise über denselben obskuren Hamburger Anwalt im Voraus.
Damit fand das Dorfleben zu einer gewissen Normalität zurück. Am späten Vormittag konnten sie den Restaurator sehen, wenn er mit seiner Frau ins Dorf kam, um Einkäufe zu erledigen, und am frühen Nachmittag war er wieder zu sehen, wenn er in seiner Barbour-Jacke und mit einer tief in die Stirn gezogenen flachen Mütze über die Klippen wanderte. Und wenn er es versäumte, höflich zu grüßen, nahmen sie ihm das nicht weiter übel. Wenn ihn irgendetwas zu beschäftigen schien, ließen sie ihn in Ruhe, damit er dem ungestört nachgehen konnte. Und kam einmal ein Fremder ins Dorf, beobachteten sie ihn auf Schritt und Tritt, bis er wieder fort war. Der Restaurator und seine Frau mochten ursprünglich aus Italien stammen, aber jetzt gehörten sie zu Cornwall, und Gott sei dem Dummkopf gnädig, der versuchte, sie von hier wegzuholen.
Auf der Lizard-Halbinsel gab es jedoch ein paar Leute, nach deren Überzeugung hinter dieser Geschichte mehr steckte – und einen Mann, der zu wissen glaubte, was es war. Er hieß Teddy Sinclair, betrieb in Helson eine ziemlich gute Pizzeria und war leicht für große und kleine Verschwörungstheorien zu begeistern. Teddy glaubte, die Mondlandungen seien ein Schwindel. Teddy glaubte, die Anschläge vom 11.September 2001 seien ein Insiderjob gewesen. Und Teddy glaubte, der Mann aus der Gunwalloe Cove habe mehr zu verbergen als die geheime Fähigkeit, Bilder zu heilen.
Um seine Theorie ein für alle Mal zu beweisen, lud er die Dorfbewohner am zweiten Donnerstag im November in den Lamb & Flag ein und entrollte dort eine grafische Darstellung, die irgendwie Ähnlichkeit mit dem periodischen System der Elemente hatte. Angeblich bewies sie ohne jeden Zweifel, die Explosionen in den iranischen Atomanlagen seien das Werk eines legendären israelischen Geheimagenten namens Gabriel Allon gewesen – und ebendieser Gabriel Allon lebe jetzt unter dem Namen Giovanni Rossi friedlich in Gunwalloe. Als das Gelächter endlich verhallt war, bezeichnete Duncan Reynolds das als die dämlichste Idee, die ihm zu Ohren gekommen sei, seitdem irgendein Franzose beschlossen habe, Europa brauche eine gemeinsame Währung. Aber Teddy ließ sich nicht beirren, was sich nachträglich als völlig richtig erweisen sollte. Gewiss, er mochte unrecht haben, was die Mondlandungen und die Anschläge vom 11.September betraf, aber in Bezug auf den Mann aus der Gunwalloe Cove stimmte seine Theorie hundertprozentig.
Am folgenden Morgen, dem Gedenktag für die Gefallenen der beiden Weltkriege, verbreitete sich im Dorf die Nachricht, der Restaurator und seine Frau seien verschwunden. Vera Hobbs hastete in nahezu panischer Befürchtung in die Bucht hinüber und sah durch die Fenster des kleinen Hauses. Das Malmaterial des Restaurators lag auf dem niedrigen Tisch, und auf der Staffelei stand ein Gemälde von einer auf einem Sofa ausgestreckten Nackten. Vera brauchte einen Augenblick, bis sie kapierte, dass das Sofa mit dem im Wohnzimmer identisch war – und das Aktmodell mit der Frau, die jeden Vormittag in ihren Backshop kam. Trotz ihrer Verlegenheit konnte Vera sich kaum von dem Anblick lösen, denn das Bild gehörte zu den schönsten, die sie je gesehen hatte. Ein sehr gutes Zeichen sei das, sagte sie sich auf dem Rückweg ins Dorf. Kein Mann, der auf der Flucht war, würde ein solches Gemälde zurücklassen. Der Restaurator und seine Frau würden irgendwann wiederkommen. Und Gott sei dem verdammten Teddy Sinclair gnädig, wenn sie’s nicht taten.
2
PARIS
Der erste Sprengsatz detonierte um 11.46Uhr auf der Avenue des Champs-Élysées in Paris. Der Direktor des Nationalen Sicherheitsdiensts würde später sagen, er habe keine Warnung vor einem geplanten Anschlag erhalten – eine Behauptung, die seine Gegner für lachhaft gehalten hätten, wenn die Zahl der Bombenopfer nicht so hoch gewesen wäre. Die Warnsignale seien unverkennbar gewesen, sagten sie. Nur Blinde oder wissentlich Ignorante hätten sie übersehen können.
Aus dem Blickwinkel Europas hätte der Anschlag zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Nach Jahrzehnten üppig dotierter Sozialhaushalte standen viele Staaten des alten Kontinents finanziell am Abgrund. Ihre Verschuldung erreichte schwindelnde Höhen, die Reserven waren aufgezehrt, und ihre verwöhnte Bevölkerung war überaltert und desillusioniert. Sparsamkeit war das Gebot der Stunde. Im gegenwärtigen Klima gab es keine heiligen Kühe mehr, an die sich niemand heranwagte: der Gesundheitsetat, Bildungsausgaben, Subventionen für Kunst und Kultur, sogar Rentenansprüche wurden alle drastisch gekürzt. Unter den sogenannten Randstaaten Europas brach eine Volkswirtschaft nach der anderen zusammen. Griechenland versank langsam in der Ägäis, Spanien hing am Tropf von IWF und EZB, und das irische Wirtschaftswunder hatte sich als Luftblase erwiesen. In den smarten Brüsseler Salons schreckten viele Eurokraten nicht davor zurück, etwas laut auszusprechen, das einst undenkbar gewesen war – dass der Traum von der Integration Europas im Sterben lag. Und in depressiven Anwandlungen fragten manche von ihnen sich sogar, ob Europa, wie sie es kannten, vielleicht ebenfalls im Sterben liege.
Ein weiterer Glaubensartikel lag in diesem November in Scherben: die Überzeugung, Europa könne einen endlosen Strom von muslimischen Einwanderern aus seinen früheren Kolonien aufnehmen und trotzdem seine Kultur und Lebensweise unverändert bewahren. Was als zeitlich befristetes Programm zur Behebung des Arbeitermangels nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hatte, hatte inzwischen das Antlitz eines ganzen Erdteils auf Dauer verändert. Unruhige muslimische Vororte umgaben fast jede Großstadt, und in einigen Staaten würde es voraussichtlich noch vor der Jahrhundertwende eine muslimische Mehrheit geben. Keiner der Machthabenden hatte sich die Mühe gemacht, die einheimische Bevölkerung zu fragen, bevor die Tore weit geöffnet wurden, und jetzt – nach langen Jahren relativer Passivität – begannen die Einheimischen sich zu wehren. Dänemark hatte die Bestimmungen für Eheschließungen und Familiennachzug von Immigranten drastisch verschärft. Frankreich hatte das Tragen der Burka in der Öffentlichkeit verboten. Und die Schweizer, die sich kaum untereinander vertrugen, hatten beschlossen, sie wollten ihre ordentlichen Groß- und Kleinstädte von Minaretten freihalten. Britische und deutsche Spitzenpolitiker hatten Multikulti, das im postchristlichen Europa buchstäblich zu einer Ersatzreligion geworden war, für tot erklärt. Die Mehrheit werde sich nicht länger dem Willen der Minderheit beugen, erklärten sie. Und sie werde über den in ihrer Mitte blühenden Extremismus nicht länger hinwegsehen. Europas alter Zwist mit dem Islam schien in eine neue und potenziell gefährliche Phase eingetreten zu sein. Es gab viele, die befürchteten, das könnte ein ungleicher Kampf werden. Die eine Seite war alt, müde und überwiegend mit sich selbst zufrieden. Die andere konnte sich von einer Karikatur in einer dänischen Zeitung zu mörderischer Wut aufstacheln lassen.
Nirgends waren die Probleme, vor denen Europa stand, deutlicher sichtbar als in Clichy-sous-Bois, einer von Arabern bewohnten unruhigen Banlieue gleich außerhalb von Paris. Diese Vorstadt, in der schon 2005 die tödlichen Unruhen ausgebrochen waren, hatte mit die höchste Arbeitslosenquote des Landes und führte auch die Kriminalstatistik mit an. Clichy-sous-Bois war so gefährlich, dass nicht einmal die französische Polizei sich in die von Menschen wimmelnden Wohnsiedlungen wagte – auch nicht in die, in der Nasim Kadir, ein 26-jähriger Algerier, der in dem berühmten Restaurant Fouquet’s arbeitete, mit zwölf weiteren Mitgliedern seiner Großfamilie lebte.
An diesem Novembermorgen verließ er die Wohnung noch bei Dunkelheit, um sich in einer Moschee zu reinigen, die mit saudischem Geld erbaut worden war und einen in Saudi-Arabien ausgebildeten Imam hatte, der kein Französisch sprach. Nach diesem wichtigen islamischen Ritual fuhr er mit dem Bus 601A in den Vorort Le Raincy, wo er einen RER-Zug bestieg, der ihn zum Gare Saint-Lazare brachte. Auf dem Bahnhof stieg er zur letzten Etappe seiner Fahrt in die Pariser Metro um. Unterwegs erweckte er weder bei Kontrollpersonal noch Mitreisenden den geringsten Verdacht. Seine dicke Daunenjacke verbarg die Tatsache, dass er eine Sprengstoffweste trug.
Um 11.40Uhr, zur gewohnten Zeit, kam er aus der Metro-Station George V. und ging die Champs-Élysées entlang weiter. Zeugen, die das Glück hatten, das Inferno zu überleben, würden später aussagen, äußerlich sei ihm nichts anzumerken gewesen, obwohl der Inhaber eines beliebten Blumengeschäfts behauptete, ihm sei aufgefallen, mit welch entschlossenem Schritt Kadir auf den Restauranteingang zumarschiert sei. Zu den davor Stehenden gehörten der Staatssekretär im Justizministerium, ein Nachrichtensprecher eines französischen Fernsehsenders, ein Model, das die gegenwärtige Ausgabe der Zeitschrift Vogue zierte, eine bettelnde Zigeunerin mit ihrem Kind an der Hand und eine fröhlich plappernde Gruppe japanischer Touristen. Der Selbstmordattentäter sah ein letztes Mal auf die Uhr. Dann zog er den Reißverschluss seiner Daunenjacke auf.
Ob der Anschlag durch den traditionellen Ruf »Allahu akbar!« angekündigt wurde, ließ sich nie genau klären. Einige Überlebende behaupteten, ihn gehört zu haben. Andere schworen, der Attentäter habe seinen Sprengsatz wortlos gezündet. Was den Klang der Detonation selbst betraf, hatten die Menschen, die am nächsten gestanden hatten, keine Erinnerung daran. Ihre Trommelfelle waren zu stark geschädigt. Einer wie der andere erinnerte sich an einen blendend weißen Lichtblitz. Das Licht des Todes, so nannte ihn jemand. Das Licht, das man in dem Augenblick sieht, in dem man Gott zum ersten Mal gegenübertritt.
Die Bombe selbst war konstruktiv und baulich ein kleines Wunderwerk an Präzision. Dies war kein Sprengsatz nach einer Anleitung aus dem Internet oder einer der Broschüren, die in Salafistenmoscheen in Europa kursierten. Er war bei Kampfeinsätzen in Palästina und im Irak perfektioniert worden. Verstärkt wurde seine Sprengwirkung durch in Rattengift eingelegte Nägel – ein Trick, der den Selbstmordattentätern der Hamas abgeschaut war –, die wie eine Kreissäge durch die Menge schnitten. Die Detonation war so gewaltig, dass ihre Druckwelle die fast zweieinhalb Kilometer östlich gelegene Pyramide im Louvre erzittern ließ. Alle Personen in unmittelbarer Nähe des Attentäters wurden in Stücke gerissen, halbiert oder geköpft – die bevorzugte Strafe für Ungläubige. Noch in vierzig Schritt Entfernung verloren Menschen Gliedmaßen. Am äußersten Rand der Todeszone schienen die Toten unversehrt. Äußerlich vom traumatischen Erlebnis verschont, waren sie an der Druckwelle gestorben, die in ihren inneren Organen wie ein Tsunami gewütet hatte. Ein gnädiges Schicksal hatte es ihnen erlaubt, unbemerkt zu verbluten.
Die ersten am Tatort eintreffenden Gendarmen erblickten Schreckliches. Abgerissene Gliedmaßen bedeckten das Pflaster gemeinsam mit Schuhen, um 11.46Uhr stehengebliebenen zertrümmerten Armbanduhren und Handys, von denen einige vergebens klingelten. Wie um die Opfer zu verhöhnen, waren die sterblichen Überreste des Attentäters zwischen ihnen verteilt – bis auf dessen Kopf, der mindestens dreißig Meter entfernt auf einem Lieferwagen gelandet war. Kadirs Gesichtsausdruck wirkte eigenartig heiter.
Der französische Innenminister war binnen zehn Minuten nach der Detonation am Tatort. Beim Anblick des Massakers rief er aus: »Bagdad ist in Paris angekommen!« Siebzehn Minuten später kam es nach Kopenhagen in den Vergnügungspark Tivoli, wo sich um 12.03Uhr ein Selbstmordattentäter mitten in einer Kindergruppe, die ungeduldig an der Achterbahnkasse anstand, in die Luft sprengte. Der dänische Sicherheits- und Nachrichtendienst PET ermittelte rasch, dass der Schahid in Kopenhagen geboren, dort zur Schule gegangen und mit einer Dänin verheiratet gewesen war. Dass seine eigenen Kinder auf dieselbe Schule wie die Opfer gingen, schien ihn nicht gestört zu haben.
Für Sicherheitsexperten in ganz Europa war dies die Verwirklichung eines albtraumhaften Szenarios: koordinierte und raffiniert ausgeführte Angriffe, die offenbar von einem erfahrenen Spezialisten organisiert und geleitet worden waren. Sie fürchteten, die Terroristen würden bald wieder zuschlagen, aber zwei wichtige Informationen fehlten ihnen. Sie wussten nicht, wo. Und sie wussten nicht, wann.
3
ST. JAMES’S, LONDON
Später würde die Abteilung Terrorismusbekämpfung der Londoner Metropolitan Police viel wertvolle Zeit und Ressourcen in den Versuch stecken, die Bewegungen von Gabriel Allon, dem legendären, aber eigenwilligen Sohn des israelischen Geheimdiensts, der jetzt offiziell pensioniert war und unauffällig in Großbritannien lebte, an diesem Vormittag zu rekonstruieren. Aus den Aussagen neugieriger Nachbarn war bekannt, dass er sein Cottage in Cornwall kurz nach Tagesanbruch verlassen und in Begleitung seiner schönen italienischen Frau Chiara in seinen Range Rover gestiegen war. Weil Großbritannien mit einem geradezu orwellschen Netz aus Überwachungskameras überzogen ist, ließ sich feststellen, dass die beiden die Londoner Innenstadt in Rekordzeit erreichten und – wahrscheinlich durch eine göttliche Fügung – einen fast legalen Parkplatz an der Piccadilly fanden. Von dort aus gingen sie zu Fuß zum Mason’s Yard, einem ruhigen gepflasterten Innenhof mit Ladengeschäften in St.James’s, und klingelten an der Tür von Isherwood Fine Arts. Nach Aufzeichnungen der Überwachungskamera auf dem Hof wurden sie um 11.40Uhr eingelassen, obwohl Maggie, Isherwoods neueste mittelmäßige Sekretärin, in ihrem Besucherbuch irrtümlich 11.45Uhr eintrug.
Die seit 1968 auf italienische und niederländische Altmeistergemälde in Museumsqualität spezialisierte Galerie hatte ursprünglich in Bestlage der eleganten New Bond Street in Mayfair residiert. Als Hermès, Burberry, Cartier und dergleichen sie ins Exil in St.James’s getrieben hatten, hatte sie dort drei Geschosse eines heruntergekommenen ehemaligen Lagerhauses von Fortnum & Mason übernommen. Unter den inzestuösen, lästerlichen Dorfbewohnern von St.James’s stand die Galerie schon immer in dem Ruf, ziemlich gutes Theater zu bieten. Komödie und Tragödie, atemberaubende Höhepunkte und bodenlose Abgründe, alles immer mit einem Hauch von Verschwörung dicht unter der Oberfläche. Das lag größtenteils an der Person des Galeristen. Julian Isherwood litt unter einem für einen Kunsthändler fast tödlichen Makel – er besaß Gemälde lieber, als dass er sie verkaufte. Deshalb war er mit einem großen Lagerbestand an toter Ware belastet, wie sie in der Branche hieß. Gemälde, für die kein Käufer jemals einen fairen Preis zahlen würde. Gerüchteweise hieß es, Isherwoods Bestand werde nur von der Sammlung der englischen Königsfamilie übertroffen. Selbst Gabriel Allon, der seit über dreißig Jahren Gemälde für die Galerie restaurierte, hatte nur eine vage Vorstellung von Isherwoods Lagerbeständen.
Sie trafen ihn in seinem Büro an – eine große, leicht gebeugte Gestalt, die an einem Schreibtisch lehnte, auf dem sich Kataloge und Monografien türmten. Zu einem grauen Nadelstreifenanzug trug Isherwood eine lavendelfarbene Krawatte, die ihm seine neueste Geliebte am Abend zuvor geschenkt hatte. Wie üblich wirkte er leicht verkatert, eine Note, die er kultivierte. Sein Blick war trübselig auf den Fernseher gerichtet.
»Ihr habt die Nachrichten vermutlich gehört?«
Gabriel nickte langsam. Chiara und er hatten die ersten Meldungen gehört, als sie durch die westlichen Vorstädte von London gefahren waren. Die Fernsehbilder stimmten ziemlich genau mit den Bildern überein, die vor Gabriels innerem Auge standen: die mit Plastikplanen abgedeckten Leichen, die mit Blut bedeckten Überlebenden, die Gaffer, die erschrocken ihre Hände vors Gesicht hielten. Daran änderte sich nie etwas. Das würde sich vermutlich auch in Zukunft nicht ändern.
»Ich war erst letzte Woche mit einem Kunden zum Lunch im Fouquet’s«, sagte Isherwood und fuhr sich mit einer Hand durch seine ziemlich langen grauen Locken. »Wir haben uns an genau der Stelle verabschiedet, wo dieser Verrückte heute seine Bombe gezündet hat. Was wäre, wenn wir uns erst heute getroffen hätten? Ich hätte …«
Isherwood brach ab. Eine typische Reaktion auf ein Attentat, dachte Gabriel. Die Lebenden versuchten immer, irgendeine Verbindung, und sei sie noch so vage, zu den Toten herzustellen.
»Der Selbstmordattentäter in Kopenhagen hat Kinder mit in den Tod gerissen«, sagte Isherwood. »Kannst du mir bitte erklären, welcher Zweck durch die Ermordung unschuldiger Kinder gefördert wird?«
»Angst«, sagte Gabriel. »Sie wollen uns Angst einjagen.«
»Wann ist damit endlich Schluss?«, fragte Isherwood. Er schüttelte angewidert den Kopf. »Wann um Himmels willen hört dieser Wahnsinn auf?«
»Du solltest wissen, dass diese Frage sinnlos ist, Julian.« Gabriel senkte die Stimme und fügte hinzu: »Schließlich beobachtest du diesen Krieg schon sehr lange aus der ersten Reihe.«
Isherwoods Reaktion bestand aus einem melancholischen Lächeln. Sein urenglischer Name und sein ganz und gar britisches Auftreten tarnten die Tatsache, dass er im Grunde genommen gar kein Engländer war. Nach Nationalität und Reisepass Brite, ja, aber in Deutschland geboren, in Frankreich aufgewachsen und jüdischen Glaubens. Nur eine Handvoll zuverlässiger Freunde wusste, dass Isherwood 1942 als Kinderflüchtling nach London gelangt war, nachdem zwei baskische Schäfer ihn über die verschneiten Pyrenäen getragen hatten. Und dass sein Vater, der renommierte Pariser Kunsthändler Samuel Isakowitz, mit Isherwoods Mutter im Konzentrationslager Sobibor ermordet worden war. Obwohl Isherwood die Geheimnisse seiner Vergangenheit sorgfältig gehütet hatte, war die Geschichte seiner dramatischen Flucht aus dem von Deutschen besetzten Europa dem israelischen Geheimdienst zu Ohren gekommen. Und Mitte der Siebzigerjahre, während einer Welle von palästinensischen Anschlägen auf israelische Ziele in Europa, war er als Sajan – als freiwilliger Helfer – angeworben worden. Isherwood hatte nur den einen Auftrag: Er sollte mithelfen, die operative »Legende« eines Kunstrestaurators und Attentäters namens Gabriel Allon aufzubauen und zu erhalten.
»Merk dir bitte nur eines«, sagte Isherwood. »Du arbeitest jetzt für mich, nicht für sie. Dies ist nicht dein Problem, mein Lieber. Nicht mehr.« Er zielte mit der Fernbedienung auf den Fernseher, und das blutige Chaos in Paris und Kopenhagen verschwanden, zumindest vorläufig. »Sehen wir uns lieber was Schönes an, einverstanden?«
Die begrenzten Räumlichkeiten in dem alten Lagerhaus hatten Isherwood dazu gezwungen, sein Imperium senkrecht zu staffeln: Bilderlager im Erdgeschoss, Geschäftsräume im ersten Stock und im zweiten Stock ein prachtvoller Ausstellungsraum nach dem Vorbild von Paul Rosenbergs berühmter Pariser Galerie, in der der junge Julian so viele glückliche Stunden zugebracht hatte. Als sie den Raum betraten, fiel die Mittagssonne durch ein Oberlicht herein und beleuchtete ein großformatiges Ölgemälde, das auf einer mit Musselin bedeckten Staffelei stand. Dargestellt waren eine Madonna und Kind mit Maria Magdalena vor einer idyllischen Landschaft im Abendlicht, ganz offensichtlich ein Werk der Venezianischen Schule. Chiara zog ihren kurzen Lackledermantel aus und setzte sich auf die Ottomane im Museumsstil in der Mitte des Raums. Gabriel blieb mit einer Hand an seinem schmalen Kinn und leicht zur Seite geneigtem Kopf dicht vor dem Gemälde stehen.
»Wo hast du das gefunden?«
»In einem großen Kalksteinklotz unweit der Küste in Norfolk.«
»Hat der Klotz einen Besitzer?«
»Der besteht auf Anonymität. Ich kann nur sagen, dass er einen Adelstitel trägt und riesige Ländereien besitzt, aber erleben muss, dass seine Bargeldreserven alarmierend rasch schwinden.«
»Also hat er dich gebeten, ihm ein paar Gemälde abzunehmen, damit er sich noch ein Jahr über Wasser halten kann.«
»Wenn er das Geld weiter mit vollen Händen ausgibt, gebe ich ihm höchstens zwei Monate.«
»Wie viel hast du dafür bezahlt?«
»Zwanzigtausend.«
»Wie großzügig von dir, Julian.« Gabriel sah zu Isherwood hinüber und fügte hinzu: »Ich vermute, dass du deine Fährte verwischt hast, indem du ihm ein paar zusätzliche Gemälde abgekauft hast.«
»Sechs wertlose Schinken«, gestand Isherwood ein. »Aber wenn sich bestätigt, was ich in diesem Fall vermute, war das eine gute Investition.«
»Provenienz?«, fragte Gabriel.
»Das Gemälde wurde von einem Vorfahren des Besitzers Anfang des neunzehnten Jahrhunderts auf dessen Kavalierstour durch Europa im Veneto gekauft. Seit damals war es im Familienbesitz.«
»Zuschreibung?«
»Werkstatt Palma Vecchio.«
»Tatsächlich?«, fragte Gabriel skeptisch. »Wer behauptet das?«
»Der italienische Kunstkenner, der den damaligen Verkauf vermittelt hat.«
»War er blind?«
»Nur auf einem Auge.«
Gabriel lächelte. Viele der Italiener, die reisende englische Adlige »beraten« hatten, waren Scharlatane gewesen, die einen regen Handel mit wertlosen Kopien, die Meistern aus Florenz und Venedig zugeschrieben wurden, getrieben hatten. Gelegentlich war es vorgekommen, dass sie sich andersherum geirrt hatten. Isherwood vermutete, das vor ihnen auf der Staffelei stehende Gemälde falle in die zweite Kategorie. Das glaubte auch Gabriel. Als er mit dem Zeigefinger übers Gesicht der Magdalena fuhr, hatte er den Schmutz von zwei Jahrhunderten an der Fingerspitze.
»Wo hat es gehangen? In einem Kohlebergwerk?«
Er kratzte leicht an dem stark verfärbten Firnis. Dieser bestand wahrscheinlich aus Mastix oder Dammarharz, das in Terpentin aufgelöst worden war. Entfernen ließe es sich nur in mühsamer Arbeit durch eine sorgfältig zusammengestellte Mischung aus Azeton, Methylproxitol und Terpentinersatz. Gabriel konnte nur vermuten, welche Baustellen ihn erwarteten, sobald der Firnis ganz abgetragen war: Archipele von Pentimenti, eine Wüste aus Oberflächenrissen und -spalten, große Farbverluste, die bei früheren Restaurierungen übertüncht worden waren. Und hinzu kam noch der Zustand der Leinwand, die vor Altersschwäche faltig herabsackte. Dagegen gab es nur ein Mittel: Die Leinwand musste neu aufgezogen werden – ein riskantes Verfahren, das auf Druck, Hitze und Feuchtigkeit basierte. Jeder Restaurator, der schon mal eine Leinwand neu aufgezogen hatte, konnte das durch Narben beweisen. Gabriel hatte einmal ein großes Stück eines Gemäldes von Domenico Zampieri zerstört, weil er ein Bügeleisen mit defektem Thermostat benutzt hatte. Auch wenn das vollständig restaurierte Gemälde wieder unversehrt wirkte, war es definitiv das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Zampieri und der Werkstatt Gabriel Allon.
»Na?«, fragte Isherwood gespannt. »Wer hat das verdammte Ding gemalt?«
Gabriel überlegte angestrengt. »Um eine definitive Zuschreibung vornehmen zu können, brauche ich Röntgenaufnahmen.«
»Mein Mann kommt heute Nachmittag vorbei, um welche zu machen. Aber wir wissen beide, dass du für eine vorläufige Zuschreibung keine brauchst. Du bist wie ich, mein Lieber. Du gehst seit hunderttausend Jahren mit Gemälden um. Du erkennst ein Meisterwerk, wenn du eines siehst.«
Gabriel angelte eine kleine Lupe aus der Innentasche seiner Lederjacke und untersuchte damit die Pinselstriche. Als er sich leicht nach vorn beugte, konnte er spüren, wie die vertraute Form seiner Beretta, einer 9-mm-Pistole, sich in seine linke Hüfte grub. Seit er mit dem britischen Geheimdienst zusammengearbeitet hatte, um das irakische Atomprogramm zu sabotieren, durfte er zu seinem persönlichen Schutz ständig eine Waffe tragen. Außerdem hatte er einen britischen Pass bekommen, den er für Auslandsreisen benutzen durfte, solange er nicht im Auftrag seines alten Diensts unterwegs war. Aber das ließ sich praktisch ausschließen. Die illustre Laufbahn Gabriel Allons war definitiv beendet. Er war nicht länger Israels Racheengel. Er war ein Restaurator, der für Isherwood Fine Arts arbeitete, und England war seine neue Heimat.
»Du vermutest etwas Bestimmtes«, sagte Isherwood. »Das sehe ich in deinen grünen Augen.«
»Das tue ich«, bestätigte Gabriel, der weiter fasziniert die Pinselstriche betrachtete, »aber ich möchte erst eine zweite Meinung hören.«
Er sah sich über die Schulter hinweg nach Chiara um. Sie spielte mit einer Strähne ihrer wilden Locken und machte dabei ein leicht nachdenkliches Gesicht. In dieser Pose sah sie den Frauen auf dem Gemälde täuschend ähnlich. Was kaum überraschend war, wie Gabriel wusste. Chiara, die von Juden abstammte, die 1492 aus Spanien vertrieben worden waren, war in Venedig im ehemaligen Ghetto aufgewachsen. Es war durchaus möglich, dass einige ihrer Vorfahren Meistern wie Bellini, Veronese oder Tintoretto Modell gestanden hatten.
»Was denkst du?«, fragte er.
Chiara trat neben Gabriel vor das Gemälde und schnalzte wegen seines Zustands missbilligend mit der Zunge. Obwohl sie an der Universität Römische Geschichte studiert hatte, hatte sie schon viele von Gabriel vorgenommene Restaurierungen begleitet und war dadurch selbst zu einer ausgezeichneten Kunsthistorikerin geworden.
»Dies ist ein ausgezeichnetes Beispiel für eine Sacra Conversazione, ein Gespräch unter Heiligen, eine idyllische Szene, in der die Personen vor einer ästhetisch friedvollen Landschaft angeordnet sind. Und wie jedes Kind weiß, gilt Palma Vecchio als der Erfinder dieser Form.«
»Was hältst du von dem Zeichenstil?«, fragte Isherwood wie ein Anwalt, der einer wohlgesonnenen Zeugin einen Hinweis gibt.
»Für Palma ist sie eigentlich zu gut«, antwortete Chiara. »Seine Palette war konkurrenzlos, aber er ist nie für einen sehr guten Zeichner gehalten worden – nicht einmal von seinen Zeitgenossen.«
»Und die Frau, die Modell für die Madonna gestanden hat?«
»Wenn ich mich nicht irre, was unwahrscheinlich ist, hat sie Violante geheißen. Sie erscheint auf einigen von Palmas Gemälden. Aber in Venedig hat es damals einen weiteren berühmten Maler gegeben, der sie sehr gern gemocht haben soll. Sein Name war …«
»Tiziano Vecellio«, sagte Isherwood und führte damit ihren Gedanken zu Ende. »Besser als Tizian bekannt.«
»Glückwunsch, Julian«, sagte Gabriel lächelnd. »Du hast für lachhafte zwanzigtausend Pfund einen Tizian an Land gezogen. Jetzt musst du nur noch einen Restaurator finden, der es wieder in Form bringen kann.«
»Wie viel?«, fragte Isherwood.
Gabriel runzelte die Stirn. »Es braucht schrecklich viel Arbeit.«
»Wie viel?«, wiederholte Isherwood.
»Zweihunderttausend Dollar.«
»Ich könnte jemanden finden, der’s für die Hälfte macht.«
»Das stimmt. Aber wir wissen beide, was passiert ist, als du das letztes Mal probiert hast.«
»Wie bald kannst du anfangen?«
»Bevor ich irgendwelche Verpflichtungen eingehe, muss ich in meinem Terminkalender nachsehen.«
»Ich zahle hunderttausend als Vorschuss.«
»Dann kann ich sofort anfangen.«
»Ich schicke dir das Bild übermorgen nach Cornwall«, sagte Isherwood. »Die Frage ist nur: Wann bekomme ich es wieder zurück?«
Gabriel gab keine Antwort. Er starrte kurz auf seine Armbanduhr, als verdächtige er sie, falsch zu gehen, dann sah er nachdenklich zu dem Oberlicht auf.
Isherwood legte ihm eine beruhigende Hand auf die Schulter. »Nicht mehr dein Problem, mein Lieber«, sagte er. »Jetzt nicht mehr.«
4
COVENT GARDEN
Eine Straßensperre der Polizei kurz vor dem Leicester Square hatte den Verkehr auf der Charing Cross Road zum Erliegen gebracht. Gabriel und Chiara hasteten durch eine Nebelbank aus Auspuffgasen und gingen auf der Cranbourn Street weiter. Diese Straße war von Pubs und Coffee Bars für die Touristenhorden gesäumt, die unabhängig von der Jahreszeit Tag und Nacht ziellos durch Soho zu wandern schienen. Diesmal bemerkte Gabriel sie anscheinend gar nicht. Er hatte nur Augen für das Display seines Handys. Die Zahl der Opfer in Paris und Kopenhagen stieg weiter an.
»Wie schlimm ist’s?«, fragte Chiara.
»Achtundzwanzig auf den Champs-Élysées und weitere fünfunddreißig im Tivoli.«
»Weiß man schon, wer dafür verantwortlich war?«, fragte Chiara.
»Dafür ist’s noch zu früh«, sagte Gabriel, »aber die Franzosen glauben, es könnte die al-Qaida im islamischen Maghreb gewesen sein.«
»Traust du ihr zu, zwei Anschläge dieser Art zu koordinieren?«
»Sie hat Zellen in ganz Europa und Nordamerika, aber die Analysten am King Saul Boulevard haben ihr eigentlich nie recht zugetraut, spektakuläre Anschläge à la Bin Laden auszuführen.«
Am King Saul Boulevard in Tel Aviv hatte Israels Auslandsgeheimdienst seine Zentrale. Er trug einen langen und absichtlich irreführenden Namen, der nur sehr wenig mit seinem eigentlichen Tätigkeitsbereich zu tun hatte. Für alle, die dort arbeiteten, war er »der Dienst«, sonst nichts. Selbst im Ruhestand lebende Agenten wie Gabriel und Chiara benutzten niemals seinen richtigen Namen.
»Meinem Gefühl nach sind das keine Bin-Laden-Nachahmer«, sagte Chiara. »Ich tippe eher auf …«
»Bagdad«, sagte Gabriel. »Für Anschläge im Freien sind die Opferzahlen hoch. Das lässt auf einen erfahrenen Bombenbastler schließen. Wenn wir Glück haben, hat er seine Signatur hinterlassen.«
»Wir?«, fragte Chiara.
Gabriel steckte sein Mobiltelefon wortlos ein. Sie hatten den chaotischen Kreisverkehr am Ende der Cranbourn Street erreicht. Dort gab es zwei italienische Restaurants – das Spaghetti House und das Bella Italia. Er forderte Chiara auf, sich für eines der beiden Lokale zu entscheiden.
»Ich habe keine Lust, mein langes Wochenende in London im Bella Italia zu beginnen«, sagte sie mit düsterer Miene. »Du hast mir einen richtigen Lunch versprochen.«
»Meiner Ansicht nach kann man’s in London weit schlechter treffen als mit dem Bella Italia.«
»Außer man ist in Venedig geboren.«
Gabriel lächelte. »Für uns ist ein Tisch in einem hübschen Restaurant namens Orso in der Wellington Street reserviert. Es ist sehr italienisch. Ich dachte, wir könnten über den Covent Garden dorthin gehen.«
»Hast du überhaupt noch Lust dazu?«
»Wir müssen etwas essen«, sagte er, »und ein Spaziergang im Park tut uns beiden gut.«
Sie hasteten über den Kreisel in die Garrick Street, auf der zwei Beamte der Metropolitan Police in limonengrünen Jacken den arabisch aussehenden Fahrer eines weißen Kastenwagens kontrollierten. Die Besorgnis der Fußgänger war fast mit Händen greifbar. Auf einigen Gesichtern sah Gabriel blanke Angst. Auf anderen spiegelte sich grimmige Entschlossenheit, wie gewohnt weiterzumachen. Chiara hielt seine Hand umklammert, als sie an den Auslagen der Geschäfte vorbeischlenderten. Sie hatte sich schon lange auf dieses Wochenende in London gefreut und war entschlossen, es sich durch die schlimmen Nachrichten aus Paris und Kopenhagen nicht verderben zu lassen.
»Du hast Julian ein bisschen hart rangenommen«, sagte sie jetzt. »Zweihunderttausend sind das Doppelte deines üblichen Honorars.«
»Es geht um einen Tizian, Chiara. Julian verdient trotzdem noch sehr gut daran.«
»Du hättest wenigstens seine Einladung zu einem Lunch zur Feier des Tages annehmen können.«
»Ich wollte nicht mit Julian zum Lunch gehen. Ich wollte mit dir essen.«
»Er hat eine Idee, die er mit dir besprechen möchte.«
»Was für eine Idee?«
»Eine Partnerschaft«, sagte Chiara. »Er will, dass wir Partner in seiner Firma werden.«
Gabriel blieb stehen. »Ich hoffe, dass ich mich unmissverständlich klar ausdrücke, wenn ich sage, dass ich absolut kein Interesse daran habe, Miteigentümer der oft insolventen Galerie Isherwood Fine Arts zu werden.«
»Warum nicht?«
»Schon aus dem Grund«, sagte er und setzte sich wieder in Bewegung, »dass wir keine Ahnung haben, wie man ein Geschäft führt.«
»Du hast in der Vergangenheit ein paar sehr erfolgreiche Unternehmen geleitet.«
»Das ist leicht, wenn man einen Geheimdienst hinter sich hat.«
»Du stellst dein Licht unter den Scheffel, Gabriel. Wie schwierig kann es sein, eine Galerie zu führen?«
»Unglaublich schwierig. Und Julian hat wieder und wieder bewiesen, wie leicht man in Schwierigkeiten geraten kann. Selbst die erfolgreichste Galerie kann untergehen, wenn sie sich ein paarmal verzockt.« Gabriel betrachtete sie aus dem Augenwinkel heraus. »Wann hast du diese kleine Vereinbarung mit Julian ausgehandelt?«
»Das klingt so, als hätten wir uns hinter deinem Rücken gegen dich verschworen.«
»Weil ihr genau das getan habt.«
Chiara gestand ihm mit einem Lächeln zu, er habe recht. »Das war, als wir zur Vorstellung des Rembrandts in Washington waren. Julian hat mich beiseitegenommen und mir erzählt, er spiele tatsächlich mit dem Gedanken, sich aus dem Geschäftsleben zurückzuziehen. Er will die Galerie jemandem übergeben, dem er vertraut.«
»Julian zieht sich niemals zurück.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher.«
»Wo war ich, als dieser Deal ausgebrütet wurde?«
»Ich glaube, du warst kurz unterwegs, um mit einer investigativen Journalistin aus England zu sprechen.«
»Warum hast du mir bisher kein Wort davon gesagt?«
»Weil Julian mich darum gebeten hat.«
Durch sein gereiztes Schweigen machte Gabriel klar, dass Chiara gegen einen der Grundsätze ihrer Ehe verstoßen hatte. Geheimnisse, auch unbestreitbar triviale, durfte es zwischen ihnen nicht geben.
»Tut mir leid, Gabriel. Ich hätte etwas sagen sollen, aber Julian hat auf Geheimhaltung bestanden. Er hat gewusst, dass du instinktiv Nein sagen würdest.«
»Er könnte die Galerie im Handumdrehen Oliver Dimbleby verkaufen und sich auf eine Karibikinsel zurückziehen.«
»Hast du dir überlegt, was das für uns bedeuten könnte? Möchtest du tatsächlich Gemälde für Oliver Dimbleby reinigen? Oder für Giles Pittaway? Oder glaubst du, du könntest freiberuflich ein paar Aufträge von der Tate oder der National Gallery bekommen?«
»Das klingt, als hätten Julian und du schon alles genau durchdacht.«
»Das haben wir.«
»Dann solltest vielleicht du Julians Partnerin werden.«
»Nur, wenn du Gemälde für mich reinigst.«
Gabriel merkte, dass Chiara es ernst meinte. »Eine Galerie zu führen, bedeutet nicht nur, an glanzvollen Auktionen teilzunehmen und in schicken Restaurants in der Jermyn Street lange beim Lunch zu sitzen. Und es ist nichts, was man als Hobby betreiben kann.«
»Danke, dass du mich als Dilettantin abtust.«
»So hab ich’s nicht gemeint, das weißt du genau.«
»Du bist nicht als Einziger aus dem Dienst ausgeschieden, Gabriel. Ich bin auch nicht mehr dabei. Aber im Gegensatz zu dir kann ich mir die Zeit nicht mit beschädigten Altmeistergemälden vertreiben.«
»Du willst also Kunsthändlerin werden? Du wirst deine Tage damit verbringen, Unmengen von mittelmäßigen Gemälden in Augenschein zu nehmen – immer auf der Suche nach einem weiteren verschollenen Tizian. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du nie einen findest.«
»Klingt gar nicht schlecht, finde ich.« Chiara sah sich auf der Straße um. »Und dann könnten wir vielleicht hier leben.«
»Ich dachte, dir gefiele Cornwall.«
»Sogar sehr«, sagte sie. »Nur nicht im Winter.«
Gabriel schwieg einen Augenblick. Ein Gespräch dieser Art erwartete er seit einiger Zeit. »Ich dachte, wir wollten ein Kind«, sagte er.
»Das dachte ich auch«, sagte Chiara. »Aber ich glaube fast nicht mehr daran. Nichts, was ich versuche, scheint zu klappen.«
In ihrer Stimme lag ein resignierter Tonfall, den Gabriel noch nie gehört hatte. »Dann versuchen wir’s eben weiter.«
»Ich will nur nicht, dass du enttäuscht bist. Schuld daran ist die Fehlgeburt. Sie macht es anscheinend schwieriger, jemals wieder schwanger zu werden. Aber wer weiß? Vielleicht würde ein Tapetenwechsel helfen. Denk einfach mal darüber nach«, sagte sie und drückte seine Hand. »Mehr will ich gar nicht, Liebster. Vielleicht würde es uns gefallen, hier zu leben.«
Auf der fast italienisch anmutenden Piazza des Covent Garden Market stellte ein Straßenkomödiant zwei ahnungslose deutsche Touristen in einer Pose mit unübersehbar sexueller Anspielung auf. Während Chiara das Schauspiel an eine Säule gelehnt beobachtete, verfiel Gabriel in die würdelose Rolle des Beleidigten und ließ abwesend seinen Blick über die Menschen auf dem belebten Platz und der Balkon-Bar des Punch & Judy gleiten. Er war nicht auf Chiara wütend, sondern auf sich selbst. Im Mittelpunkt ihrer Beziehung hatten jahrelang nur er und seine Arbeit gestanden. Er war nie auf die Idee gekommen, Chiara könnte eine eigene Karriere anstreben. Wären sie ein normales Paar, hätte er das vielleicht vermutet. Aber sie waren kein normales Paar. Sie waren ehemalige Agenten eines der berühmtesten Geheimdienste der Welt. Und ihre Vergangenheit war viel zu blutig, als dass sie ein so öffentliches Leben hätten führen können.
Als sie die hoch aufragende Glasarkade des Markts betraten, war die Verstimmung ihrer Diskussion rasch verflogen. Selbst Gabriel, der alle Arten von Shopping verabscheute, hatte Spaß daran, gemeinsam mit Chiara durch die bunten Läden und Stände zu bummeln. Vom Duft ihres Haars angeregt, malte er sich den vor ihnen liegenden Nachmittag aus: erst ein ruhiger Lunch, dann ein netter Spaziergang zurück ins Hotel. Dort würde er Chiara im kühlen Halbdunkel ihres Zimmers langsam ausziehen und sie auf dem riesigen Bett lieben. Einen Augenblick lang konnte Gabriel fast glauben, seine Vergangenheit sei getilgt, seine Erfolge nur Fabeln, die im Archiv am King Saul Boulevard Staub ansammelten. Nur die Wachsamkeit blieb – das instinktive, nie erlahmende Misstrauen, das es ihm unmöglich machte, sich in der Öffentlichkeit jemals ganz entspannt zu bewegen. Diese Vorsicht zwang ihn dazu, in Gedanken eine Kohlestiftskizze von jedem Gesicht in der Menge zu erstellen. Und auf der Wellington Street, kurz vor ihrem Restaurant, brachte sie ihn dazu, ruckartig stehen zu bleiben. Chiara zupfte ihn spielerisch am Ärmel. Dann blickte sie ihm ins Gesicht und erkannte, dass irgendetwas nicht stimmte.
»Du siehst aus, als hättest du gerade ein Gespenst gesehen.«
»Kein Gespenst. Einen toten Mann.«
»Wo?«
Gabriel nickte zu einer Gestalt in einem grauen Wollmantel hinüber.
»Dort drüben.«
5
COVENT GARDEN, LONDON
Selbstmordattentäter verraten sich oft durch bestimmte Anzeichen. Lippen können sich unbeabsichtigt bewegen, während letzte Gebete aufgesagt werden. Augen können glasig ins Leere starren. Und das Gesicht kann um die Kinnpartie herum unnatürlich blass wirken, was darauf hinweist, dass ein verräterischer struppiger Vollbart erst vor Kurzem abgenommen worden ist. Der tote Mann ließ keines dieser Anzeichen erkennen. Sein Mund war geschlossen. Sein Blick war klar und zielgerichtet. Und sein Gesicht war gleichmäßig gebräunt. Er hatte sich seit Längerem regelmäßig rasiert.
Was ihn von allen anderen unterschied, war eine von der linken Schläfe herablaufende dünne Rinne von Schweißtropfen. Weshalb schwitzte er an einem kühlen Herbstnachmittag? Wieso waren seine Hände in den Manteltaschen vergraben, wenn ihm heiß war? Und warum war dann auch sein Mantel – mindestens eine Nummer zu groß, fand Gabriel – bis obenhin zugeknöpft? Hinzu kam sein Gang. Selbst einem sportlichen Mann Anfang zwanzig fällt es schwer, sich scheinbar normal zu bewegen, wenn er fünfundzwanzig Kilo Sprengstoff, Nägel und Kugellagerkugeln zu schleppen hat. Als der tote Mann auf der Wellington Street an Gabriel vorbeiging, hielt er sich unnatürlich aufrecht, als versuchte er dadurch das zusätzliche Gewicht in der Bauchregion zu kompensieren. Der Stoff seiner Gabardinehose vibrierte bei jedem Schritt, als zitterten seine Knie- und Hüftgelenke unter dem Gewicht des Sprengsatzes. Natürlich konnte der schwitzende junge Mann in dem übergroßen Mantel ein harmloser Bürger sein, der mittags Einkäufe machte, aber Gabriel vermutete etwas anderes. Er glaubte, dieser einige Schritte vor ihnen gehende Mann verkörpere das Finale eines ganz Europa umspannenden Terrortages. Erst Paris, dann Kopenhagen, nun London.
Gabriel wies Chiara an, in dem Restaurant Schutz zu suchen, und wechselte rasch auf die andere Straßenseite. Er beschattete den Mann ungefähr hundert Meter weit und beobachtete dann, wie er um die Ecke in den Eingang des Covent Garden Market abbog. Auf der Ostseite der Piazza gab es zwei Cafés, die beide zur Lunchzeit sehr gut besucht waren. Auf einem sonnigen Fleck zwischen ihnen standen drei Beamten der Metropolitan Police beieinander. Keiner von ihnen achtete auf den Mann, als er die Marktarkade betrat.
Jetzt musste Gabriel eine Entscheidung treffen. Naheliegend war, dass er den Polizeibeamten seinen Verdacht mitteilte – naheliegend, fand er, aber nicht unbedingt optimal. Höchstwahrscheinlich würden die Beamten auf seine Warnung reagieren, indem sie ihn beiseitenahmen und ausfragten, wodurch kostbare Sekunden verloren gingen. Oder – noch schlimmer – sie würden den Mann stellen, worauf er garantiert seinen Sprengsatz zünden würde. Obwohl praktisch jeder Beamte der Met eine grundsätzliche Unterweisung in Terroristenbekämpfung erhalten hatte, verfügten nur wenige über die Erfahrung oder die Feuerkraft, die notwendig war, um einen Dschihadisten, der den Märtyrertod sterben wollte, aufzuhalten. Gabriel verfügte über beides, und dies würde nicht der erste Selbstmordattentäter sein, den er ausschaltete. Er glitt an den drei Polizeibeamten vorbei und betrat die Arkade.
Der tote Mann hatte jetzt fast zwanzig Meter Vorsprung und marschierte wie auf einem Exerzierplatz den erhöhten Laufsteg der Haupthalle entlang. Gabriel vermutete, er trage genügend Sprengstoff und Kleineisen am Körper, um alle Menschen im Umkreis von fünfundzwanzig Metern zu töten. Dem Lehrbuch nach hätte Gabriel außerhalb dieser Zone bleiben sollen, bis es Zeit wurde, aktiv zu werden. Die äußeren Bedingungen erforderten jedoch, dass er den Abstand verringerte, auch wenn er sich dadurch in größere Gefahr brachte. Auch unter besten Voraussetzungen wäre ein Kopfschuss aus fünfundzwanzig Metern Entfernung selbst für einen Meisterschützen wie Gabriel Allon sehr schwierig gewesen. In dieser belebten Einkaufspassage war er nahezu unmöglich.
Gabriel spürte das Mobiltelefon in seiner Jacke schwach vibrieren. Er achtete nicht darauf, während er beobachtete, wie der tote Mann am Geländer des Laufstegs haltmachte, um auf seine Uhr zu sehen. Gabriel registrierte, dass sie am linken Handgelenk getragen wurde, was ziemlich sicher bedeutete, dass der Zündknopf sich in der rechten Hand befand. Aber weshalb sollte ein Selbstmordattentäter auf seinem Weg zum Märtyrertum auf die Uhr sehen? Das musste bedeuten, dass er den Auftrag hatte, sein Leben – und das möglichst vieler Unbeteiligter – zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beenden. Gabriel vermutete, hier spiele irgendeine Art Symbolismus eine Rolle. Das war oft der Fall. Al-Qaida-Terroristen und ihre Nachahmer liebten Symbole, vor allem wenn sie mit Zahlen zu tun hatten.
Inzwischen war Gabriel so nah an ihn herangekommen, dass er die Augen des toten Mannes sehen konnte. Sein Blick war klar und zielstrebig, ein ermutigendes Zeichen. Es bedeutete, dass er weiter an seinen Auftrag statt schon an die fleischlichen Freuden dachte, die ihn im Paradies erwarteten. Sobald er anfing, von den parfümierten glutäugigen Huris zu träumen, würde sich das auf seinem Gesicht abzeichnen. Dann würde Gabriel eine Entscheidung treffen müssen. Aber vorläufig wollte er, dass der tote Mann noch eine Zeit lang in dieser Welt blieb.
Der tote Mann sah ein weiteres Mal auf die Uhr. Gabriel warf einen raschen Blick auf seine: 14.34Uhr. Er glich die Ziffern mit der Datenbank seiner Erinnerung ab, suchte irgendeine Querverbindung. Er zählte sie zusammen, zog sie voneinander ab, multiplizierte sie, kehrte sie um und ordnete sie neu an. Dann dachte er an die beiden früheren Attentate. Das erste hatte sich um 11.46Uhr ereignet, das zweite um 12.03Uhr. Die Zahlen konnten Jahre des Gregorianischen Kalenders bezeichnen, aber Gabriel konnte keinen Zusammenhang erkennen, so sehr er sich auch bemühte.
Aus seinem Gehirn strich er die Stunden der Anschlagszeiten und konzentrierte sich rein auf die Minuten. Sechsundvierzig Minuten nach, drei Minuten nach. Dann begriff er. Diese Zeitangaben waren ihm so vertraut wie Tizians Pinselführung. Sechsundvierzig Minuten nach, drei Minuten nach. Das waren zwei der berühmtesten Augenblicke in der Geschichte des Terrorismus gewesen – die Minuten, in denen die beiden entführten Verkehrsmaschinen am 11.September 2001 ins World Trade Center gerast waren: American Airlines Flight 11 um 8.46Uhr in den Nordturm, United Airlines Flight 175 um 9.03Uhr in den Südturm. Das dritte Flugzeug, das an diesem Morgen sein Ziel getroffen hatte, war American Airlines Flight 77 gewesen, als die Maschine in die Westfassade des Pentagons gerast war. Das war um 9.37Uhr gewesen – 14.37Uhr in London.
Gabriel sah auf seine Quarzuhr, die wenige Sekunden nach 14.35Uhr anzeigte. Als er anschließend den Kopf hob, marschierte der Mann in dem grauen Mantel rasch weiter, hatte die Hände in den Manteltaschen vergraben und schien die Menschen um ihn herum gar nicht wahrzunehmen. Als Gabriel ihm folgte, vibrierte sein Handy erneut. Diesmal nahm er den Anruf entgegen und hörte Chiaras Stimme. Er erklärte ihr, der Selbstmordattentäter sei kurz davor, sich im Covent Garden Market in die Luft zu sprengen, und bat sie, Verbindung mit dem MI5 aufzunehmen. Dann steckte er das Telefon wieder ein und begann, die Entfernung zu der Zielperson zu verringern. Er fürchtete, dass bald viele Unschuldige sterben würden, und fragte sich, ob er das irgendwie verhindern konnte.
6
COVENT GARDEN, LONDON
Es gab natürlich noch eine weitere Möglichkeit – dass der wenige Schritte vor Gabriel gehende Mann nichts unter seinem Mantel hatte als ein paar zusätzliche Kilogramm Körperfett. Gabriel erinnerte sich an den Fall des in Brasilien geborenen Elektrikers Jean Charles de Menezes, den Londoner Polizisten in der U-Bahn-Station Stockwell erschossen hatten, weil sie ihn mit einem gesuchten islamischen Terroristen verwechselt hatten. Die zuständige Staatsanwaltschaft hatte sich geweigert, gegen die Beamten Anklage zu erheben – eine Entscheidung, gegen die Menschenrechtsaktivisten und Bürgerrechtler in aller Welt entrüstet protestiert hatten. Gabriel wusste, dass er unter vergleichbaren Um„ständen nicht mit solcher Milde rechnen konnte. Das bedeutete, dass er sich seiner Sache hundertprozentig sicher sein musste, bevor er handelte. Eines stand jedoch für ihn fest: Er war überzeugt, dass der Attentäter wie ein Maler seine Signatur hinterlassen würde, bevor er den Zündknopf drückte. Er würde wollen, dass seine Opfer wussten, dass ihr bevorstehender Tod nicht sinnlos war, sondern dass sie im Namen des Heiligen Krieges und im Namen Allahs geopfert wurden.
Vorerst blieb Gabriel nichts anderes übrig, als dem Mann zu folgen und abzuwarten. Langsam, unauffällig verringerte er den Abstand weiter, während er zugleich kleine Kurskorrekturen vornahm, um immer freies Schussfeld zu haben. Sein Blick blieb auf die untere Hälfte des Hinterkopfs des Mannes gerichtet. Wenige Zentimeter darunter saß der Hirnstamm, der für die Kontrolle der Sinnes- und Bewegungsorgane des menschlichen Körpers entscheidend war. Wurde der Hirnstamm durch einen Schuss verletzt, konnte der Selbstmordattentäter den Zündknopf nicht mehr drücken. Verfehlte Gabriel ihn jedoch, konnte der Märtyrer seinen Auftrag noch im letzten Todeszucken ausführen. Gabriel gehörte zu den weltweit wenigen Männern, die schon einmal einen Terroristen erschossen hatten, bevor er seine Bombe zünden konnte. Er wusste, dass der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg nur Bruchteile einer Sekunde ausmachen würde. Ein Misserfolg würde Dutzende von Unbeteiligten das Leben kosten – vielleicht auch Gabriel selbst.
Der tote Mann ging durch den Torbogen auf die Piazza, wo jetzt weit mehr Gedränge herrschte. Ein Cellist spielte eine Partita von Bach. Ein Jimi-Hendrix-Imitator mühte sich mit einer Elektrogitarre ab. Ein gut angezogener Mann, der auf einer Kiste stand, sprach mit lauter Stimme über Gott und den Irakkrieg. Der Selbstmordattentäter hielt direkt auf die Platzmitte zu, wo die Vorstellung des Komikers sehr zum Vergnügen seines großen Publikums neue Tiefen der Anzüglichkeit erreicht hatte. Mit Hilfe einer Technik, die er in seiner Jugend gelernt hatte, blendete Gabriel mental die Störgeräusche – von den Celloklängen bis zum lauten Gelächter der Menge – nacheinander aus. Dann sah er ein letztes Mal auf seine Armbanduhr und wartete darauf, dass der Mann in dem grauen Mantel seine Signatur hinterlassen würde.
Es war 14.36Uhr. Der tote Mann hatte den äußeren Rand der großen Zuschauermenge erreicht. Nach kurzem Zögern, als suche er eine Schwachstelle, um in sie eindringen zu können, zwängte er sich rücksichtslos zwischen zwei erschrockenen Frauen hindurch. Parallel zu ihm schlüpfte Gabriel einige Meter weiter rechts fast unbemerkt durch eine amerikanische Touristenfamilie. Die Zuschauer standen überall vier bis fünf Reihen tief und dicht nebeneinander, was Gabriel vor ein weiteres Problem stellte. In einer solchen Situation wäre die ideale Munition ein Geschoss mit Hohlspitze gewesen, das trotz größter Zerstörungskraft die Umstehenden am wenigsten gefährdet hätte. Aber Gabriels Beretta war mit gewöhnlichen 9-mm-Parabellumpatronen geladen. Deshalb würde er eine Position finden müssen, aus der er extrem steil nach unten schießen konnte. Andernfalls war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er als Kollateralschaden einen der Unbeteiligten erschoss, die er retten wollte.
Der Selbstmordattentäter hatte den innersten Zuschauerring durchbrochen und hielt jetzt auf den Komödianten zu. Sein Blick war glasig geworden, schien ins Leere zu starren. Seine Lippen bewegten sich. Das letzte Gebet … Der Straßenkomödiant nahm irrtümlich an, der tote Mann wolle mitspielen. Er trat lächelnd zwei Schritte auf ihn zu, erstarrte aber, als er die Hände aus den Manteltaschen kommen sah. Die linke Hand war leicht geöffnet. Die Rechte war zur Faust geballt, der Daumen darüber abgewinkelt. Trotzdem zögerte Gabriel noch. Was war, wenn es keinen Zündknopf gab? Was war, wenn die Faust einen Kugelschreiber oder ein Röhrchen mit Lippenbalsam umschloss? Gabriel musste sich seiner Sache sicher sein. Sag mir, was du vorhast, dachte er. Hinterlasse deine Signatur.
Der tote Mann drehte sich langsam nach den Zuschauern um. Die Gäste auf dem Balkon des Punch & Judy und viele der auf der Piazza stehenden Zuschauer lachten nervös. In Gedanken blendete Gabriel das Lachen aus und ließ diese Szene erstarren. Vor seinen Augen erschien sie wie von Canaletto gemalt. Die Personen der Handlung standen unbeweglich da. Nur Gabriel, der Restaurator, konnte sich frei zwischen ihnen bewegen. Er schlüpfte durch die vorderste Zuschauerreihe und konzentrierte sich auf die Stelle am Hinterkopf des Attentäters. Ein Schuss von schräg oben würde nicht möglich sein. Aber potenzielle Kollateralschäden ließen sich theoretisch auch anders vermeiden. Bei einem Schuss von unten würde das Geschoss über die Köpfe der Zuschauer hinweggehen und in die nächste Fassade einschlagen. Er stellte sich den Handlungsablauf vor – die links steckende Pistole mit der rechten Hand ziehen, tief in die Hocke gehen, zwei oder drei Schüsse abgeben, nach vorn stürmen – und wartete darauf, dass der tote Mann seine Signatur hinterlassen würde.
Die Stille in Gabriels Kopf wurde durchbrochen, als ein angeheiterter Gast auf dem Balkon des Punch & Judy grölte – ein Aufruf an den Märtyrer, dass er Platz machen solle, damit die Vorführung weitergehen könne. Der tote Mann reagierte darauf, indem er die Arme wie ein Langstreckenläufer, der das Zielband zerreißt, über den Kopf hob. An der Innenseite des rechten Handgelenks war eine dünne Litze zu erkennen, die vom Zündknopf zu dem Sprengsatz führte. Mehr Beweise brauchte Gabriel nicht. Seine Hand umfasste den Griff der Beretta unter seiner Jacke. Als der tote Mann »Allahu akbar!« rief, ließ Gabriel sich auf ein Knie sinken und zielte auf ihn. Erstaunlicherweise hatte er freies Schussfeld, sodass keine Gefahr bestand, einen Unbeteiligten zu treffen. Aber als er eben abdrücken wollte, zogen zwei kräftige Hände den Arm mit der Pistole nach unten, und das Gewicht zweier Männer drückte ihn aufs Pflaster.
In dem Augenblick, in dem Gabriel zu Boden fiel, hörte er einen scharfen Knall wie einen Donnerschlag und spürte, wie eine heiße Druckwelle über ihn hinwegfegte. Zunächst herrschte sekundenlang Stille. Danach setzten die Schreie ein: erst ein einzelnes lautes Kreischen, dann auftosendes Wehklagen. Gabriel hob den Kopf und sah eine Szene aus seinen Albträumen. Überall Körperteile und Blut. Dies war Bagdad an der Themse.
7
NEW SCOTLAND YARD, LONDON
Ein professioneller Geheimagent, auch wenn er pensioniert ist, kann kaum eine größere Sünde begehen, als sich von der örtlichen Polizei verhaften zu lassen. Weil Gabriel lange in dem Schattenreich zwischen gewöhnlicher und geheimer Welt gelebt hatte, war ihm das öfter passiert als den meisten seiner Kollegen. Aus Erfahrung wusste er, dass es bei solchen Gelegenheiten ein bestimmtes Ritual gab, eine Art Kabukitanz, der aufgeführt werden musste, bevor höhere Stellen eingreifen konnten. Er kannte den Ablauf gut. Zum Glück taten das auch seine Gastgeber.
Binnen Minuten nach dem Anschlag in London war er festgenommen und in rasender Fahrt zum New Scotland Yard, der Zentrale des Metropolitan Police Service, gebracht worden. Dort wurde er in einen fensterlosen Vernehmungsraum gesetzt, wurde wegen seiner Schürf- und Platzwunden behandelt und bekam eine Tasse Tee, die er unberührt stehen ließ. Wenig später traf ein Superintendent der Abteilung Terrorismusbekämpfung ein. Er begutachtete Gabriels Ausweise mit der Skepsis, die sie verdienten, und versuchte dann festzustellen, was »Mr.Rossi« dazu veranlasst hatte, auf dem Covent Garden Market eine verdeckt getragene Waffe zu ziehen, kurz bevor ein Terrorist seinen Sprengstoffgürtel gezündet hatte. Gabriel war versucht, selbst ein paar Fragen zu stellen. Vor allem interessierte ihn, weshalb zwei bewaffnete Angehörige der Met-Sondereinheit SO19 sich dafür entschieden hatten, ihn auszuschalten – statt den offenkundigen Terroristen, der dabei war, zahlreiche Unbeteiligte mit in den Tod zu reißen. Stattdessen nannte er als Antwort auf alle Fragen des Kriminalbeamten eine Telefonnummer. »Rufen Sie dort an«, sagte er und tippte auf die Stelle im Notizbuch des Mannes, wo dieser sie aufgeschrieben hatte. »Das Telefon wird in einem sehr großen Gebäude nicht weit von hier klingeln. Den Namen des Mannes, der sich meldet, werden Sie kennen. Zumindest sollten Sie das.«
Gabriel wusste nicht, welcher Polizeibeamte schließlich diese Nummer wählte, und hatte keine Ahnung, wann der Anruf endlich erfolgt war. Er wusste nur, dass er länger als unbedingt nötig im New Scotland Yard festgehalten wurde. Tatsächlich war es fast Mitternacht, als ein Kriminalbeamter ihn durch hell beleuchtete Flure zum Eingang des Gebäudes führte. In der linken Hand trug sein Begleiter einen braunen Umschlag. Nach Form und Größe enthielt er keine 9-mm-Pistole von Beretta.
Draußen war das nachmittags noch so freundliche Wetter in prasselnden Regen umgeschlagen. Unter dem Glasvordach wartete mit leise schnurrendem Motor ein viertüriger Jaguar mit Fahrer. Gabriel ließ sich den Umschlag geben und öffnete die hintere Tür der Limousine. Mit elegant übereinandergeschlagenen Beinen saß darin ein Mann, der wie geschaffen für seine Rolle war. Er trug einen perfekt sitzenden anthrazitgrauen Anzug mit silbergrauer Krawatte, die zu seiner Haarfarbe passte. Der Ausdruck seiner hellen Augen war normalerweise nicht zu deuten, aber jetzt verrieten sie Erschöpfung nach einem langen, schwierigen Abend. Als stellvertretender MI5-Direktor trug Graham Seymour einen Großteil der Verantwortung für den Schutz des Vereinigten Königreichs vor den Kräften des extremistischen Islams. Und trotz aller Bemühungen seiner Leute hatte der extremistische Islam wieder einmal gesiegt.
Obwohl die beiden Männer viele Jahre beruflich zusammengearbeitet hatten, wusste Gabriel nur wenig über Graham Seymours Privatleben. Er wusste, dass Seymour mit einer Frau namens Helen verheiratet war, die er liebte und bewunderte, und einen Sohn hatte, der als Vermögensverwalter in der New Yorker Filiale einer angesehenen englischen Bank arbeitete. Was Gabriel sonst über Seymour wusste, stammte aus der riesigen Datenbank des Diensts. Er war aus Englands glorreicher Vergangenheit übrig geblieben, ein Produkt des gehobenen Mittelstands, dessen Kinder dazu erzogen worden waren, später Führungsaufgaben zu übernehmen. Er glaubte an Gott, aber ohne besonders fromm zu sein. Er glaubte an sein Land, war aber nicht blind gegenüber dessen Fehlern. Er war ein guter Golfer, war aber bereit, im Dienst einer guten Sache auch einmal gegen einen schwächeren Gegner zu verlieren. Er war ein Mann, der von vielen bewundert wurde, und vor allem einer, auf den Verlass war – eine bei Spionen und Geheimagenten seltene Eigenschaft.
Graham Seymour war jedoch kein Mann, dessen Geduld grenzenlos war, wie sein missmutiger Gesichtsausdruck zeigte, als der Jaguar jetzt auf die Straße hinausfuhr. Er zog die nächste Morgenausgabe des Telegraph aus der Tasche in der Sitzlehne vor ihm und ließ sie auf Gabriels Schoß fallen. HERRSCHAFT DES SCHRECKENS

![Die Fälschung (Gabriel Allon 22) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a3c78f56d830648941e8541a912ece8c/w200_u90.jpg)
![Der Geheimbund (Gabriel Allon 20) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/b3f0442bd1f64b2b41e586c80150b3c0/w200_u90.jpg)
![Die Cellistin (Gabriel Allon 21) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5bdaaa9cd283b671c252c1b0a29ef6f0/w200_u90.jpg)


![Das Vermächtnis (Gabriel Allon 19) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2dc3fc2736d865447dbf9f082ac49b4/w200_u90.jpg)