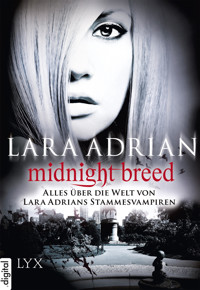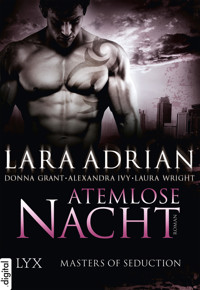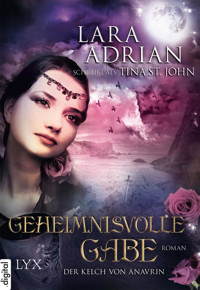
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kelch-von-Anavrin-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Kelch von Anavrin - das packende Finale!
In einer einzigen Nacht verlor Randwulf of Greycliff alles, was ihm lieb und teuer war. Seither wird er nur noch von Rachegedanken beherrscht. Im Norden Englands sucht er nach dem Mann, der seine Familie zerstört hat. Dabei trifft er auf die schöne Serena, die augenblicklich sein Herz berührt. Kann sie die Wunden der Vergangenheit heilen?
Der dritte Band der magischen Serie Der Kelch von Anavrin von Bestseller-Autorin Lara Adrian alias Tina St. John
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
LARA ADRIAN schreibt als TINA ST. JOHN
GEHEIMNISVOLLE GABE
Der Kelch von Anavrin
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Holger Hanowell
Für Celeste, Olivia und Jasper,
meine wunderschönen Nichten und
mein bezaubernder Neffe.
Ich wünsche mir für euch eine Welt
voller Frieden, Liebe und Freude.
1
Die Irische See vor der Küste Englands
Juni 1275
Unter dem pechschwarzen Himmel formte sich eine große Woge und schlug mit voller Wucht gegen die Bordwand. Es war nicht der erste Brecher, der den Rumpf erbeben ließ, das Schiff in eine bedrohliche Schräglage brachte und die aufgeweichten Planken mit sprühendem Wasser überzog. Heftig schlingerte die Kogge im tosenden Sturm, während das Ächzen der Spanten und Balken unter Deck von tiefem Donnergrollen überdröhnt wurde.
Randwulf of Greycliff saß abseits der wenigen Mitreisenden an Deck. Er lehnte mit angezogenen Knien an der schützenden Wand des Achterkastells, die Füße fest am Boden, und versuchte, sich gegen das Rollen und Stampfen des Schiffes zu stemmen. Seit der Abreise in Liverpool war das Unwetter schlimmer geworden und schien nicht nachlassen zu wollen. Drei Reisende waren am Morgen an Bord gekommen, als der Kapitän in der Hafenstadt neuen Proviant verladen ließ – zwei Männer und eine junge Frau. Zunächst glaubte Rand, die drei gehörten zusammen, doch das Ehepaar hatte schon bald unter einer von Motten zerfressenen Decke, die sich bereits fünf andere Passagiere teilten, Schutz gesucht. Sie alle zitterten am ganzen Leib, und ihren schreckgeweiteten Augen war anzusehen, dass sie nicht mehr an eine sichere Überfahrt glaubten.
Der andere Mann, der in Liverpool an Bord gekommen war, hatte offenbar ebenso wenig wie Rand die Absicht, sich zu den übrigen Mitreisenden zu gesellen. Einen Arm um die Reling gelegt, hockte er knapp ein Dutzend Schritte von Rand entfernt an Deck. Ohne Kopfbedeckung trotzte er dem heftigen Regen, der das zottelige dunkle Haar und den struppigen Bart des Mannes allerdings längst durchnässt hatte. Nur das Zucken der grellen Blitze beleuchtete die Schicksalsgemeinschaft, die auf dem schwankenden Schiff ausharrte.
»Ihr seht so jämmerlich aus, wie ich mich fühle«, rief der Mann Rand unvermutet zu und gab dazu ein Glucksen von sich. Mit der freien Hand hielt er Rand einen Gegenstand hin, der in dem zuckenden Licht kurz aufblitzte. Ein heftiger Donnerschlag ließ das Schiff erzittern. Rand erahnte die Umrisse einer verzierten Metallflasche. »Starker Würzwein. Trinkt, mein Freund. Das wird Euch wärmen.«
Auch wenn Rand keinen triftigen Grund sah, dem Mann zu misstrauen, ging er doch nicht auf das Angebot ein. Vielleicht war es der Blick des Fremden, der ihm nicht gefiel. Bis auf die Haut durchnässt, zog sich Rand die tropfnasse Kapuze seines Umhangs noch ein wenig tiefer in die Stirn und wappnete sich gegen die heftigen Windstöße.
Seitdem er die Reise vor nunmehr vierzehn Tagen angetreten hatte, war das Wetter für diese Jahreszeit ungewöhnlich schlecht. Sein Reiseziel – Schottland – lag einige Tagesreisen nördlich, doch die Fahrt würde sich noch weiter in die Länge ziehen, wenn sich die See nicht bald beruhigte. Allerdings machten die schweren schwarzen Wolken, die der Sturm über den Himmel jagte, jegliche Hoffnung auf eine Wetterbesserung zunichte.
Tatsächlich kam es ihm so vor, als sei das Meer wilder und aufgewühlter, je weiter er nach Norden kam. Ganz so, als wolle der Allmächtige Rand durch die entfesselte Naturgewalt hindern, seine unheilige Absicht weiterzuverfolgen.
Soll Er mir ruhig zürnen, dachte Rand mit grimmigem Blick, als der Sturm erneut die Kogge erfasste, die unter Ächzen an Backbord schwere Schlagseite erhielt. Die Frauen an Deck schrien auf, als der Bug sich neigte und noch mehr Wasser an Bord spülte.
Rand harrte im Schutz des Achterkastells aus und ließ sich von der wild wogenden See nicht einschüchtern. Der kalte Regen, den der böige Wind über das Deck trieb, brannte wie lauter kleine Nadelstiche in seinem Gesicht. Sollte doch das Meer anschwellen und der Sturm an seinem Umhang reißen – nicht einmal der Zorn Gottes würde ihn, Randwulf of Greycliff, von seinem Vorhaben abbringen.
Denn er sann auf Rache.
Es war sein einziges Ziel, und all sein Hass richtete sich gegen einen ganz bestimmten Menschen – falls dieser Schurke überhaupt ein Mensch war. Rand bezweifelte es. Silas de Mortaine mochte zwar aus Fleisch und Blut bestehen, und doch konnte in diesem Mann, der das Böse schlechthin verkörperte, nichts Menschliches mehr sein, schließlich befehligte er eine kleine, ihm treu ergebene Schar von Gestaltwandlern, die einer anderen Welt entstammten. Durch einen bösen Zauber an ihn gebunden, halfen ihm diese Geschöpfe bei seinem Streben nach Reichtum und Macht. De Mortaine schreckte vor nichts zurück, und wehe demjenigen, der es wagte, sich ihm in den Weg zu stellen.
Auch Unschuldige waren ihm schon zum Opfer gefallen, denn es war keine zwei Monate her, da hatten de Mortaines Schergen eine Frau und ein Kind ermordet.
Rands Gemahlin und seinen Sohn.
Die beiden hatten ihm alles bedeutet – Leben, Liebe und mehr Segnungen, als er je verdient hatte. Dessen war er sich sicher. Doch nun waren sie fort. Seitdem die zerbrechliche, liebe Elspeth und der kleine Todd erschlagen worden waren, hatte Randwulf of Greycliff nichts mehr, für das es sich zu leben lohnte.
Bis auf seinen Schwur, Vergeltung zu üben.
Und er würde die Seinen rächen und der Gerechtigkeit Genüge tun, indem er dem Mann einen langsamen und qualvollen Tod bereitete, der in einer höllischen Nacht voller Feuer und Schreie Rands Familie ermorden ließ. Seitdem drängten sich die furchtbaren Bilder immer wieder in seinen Geist, und er musste stets aufs Neue mit ansehen, wie das Blut seiner Frau und seines kleinen Jungen vergossen wurde.
Das Werkzeug seiner Rache führte Rand mit sich. Das Gewicht dieses Gegenstands drückte gegen seine Hüfte, wenn sich das Schiff auf die Seite legte: ein von Künstlerhand geformtes Artefakt, das er, sicher verborgen unter seinem weiten Umhang, in einem Lederbeutel aufbewahrte. Es gab nichts, das Silas de Mortaine mehr begehrte als den Schatz, den Rand und sein Waffengefährte Kenrick of Clairmont vor zwei Wochen in einer kleinen Kapelle auf dem berühmten Hügel von Glastonbury gefunden hatten.
Dieser Schatz – zusammen mit dem letzten Teilstück, das Rand in Schottland zu finden hoffte – war der Köder, den er brauchte, um Silas de Mortaine anzulocken. Und sobald der finstere Adlige käme, würde Rand mit hartem, unbarmherzigem Stahl Vergeltung üben.
Bei all dem rechnete er nicht damit, mit dem Leben davonzukommen, um den Sieg auszukosten. Ebenso wenig erlag er der Selbsttäuschung, er werde im Jenseits wieder mit seiner Familie vereinigt sein, da doch der Hass in seinem Herzen schwärte und an seinen Händen bald das Blut seines Feindes kleben würde. Und doch würde all dies nichts ändern. Der Tod von Elspeth und Todd konnte nicht ungeschehen gemacht werden, auch wenn Rand seine Seele dafür gegeben hätte.
»Für sie«, murmelte er vor sich hin. Die Worte verklangen im Regen, als der Sturm sie ihm vom Mund riss.
Wieder schlug eine Woge mit voller Wucht gegen die Kogge, das Salzwasser brannte Rand in den Augen. Als sich das Schiff erneut auf die Seite legte, stieß die junge Frau aus Liverpool einen Schrei des Entsetzens aus. Sie streckte die Hand aus, um eine kleine Börse zu fassen zu bekommen, die sich aus ihren Habseligkeiten gelöst hatte. Doch die Wellen schlugen gerade jetzt über dem Deck zusammen und spülten den kleinen Beutel rasch zur Bordwand. Schon ritt die Börse auf der Gischtkrone der zurückweichenden Woge hinab ins Meer.
»Die Brosche meiner Mutter war in diesem Beutel!«, wandte sich die junge Frau mit einem Wehklagen an ihren Mann, der sie tröstend in den Arm nahm.
»Ein jeder sollte seine Schätze festhalten. Nicht wahr, Freund?«
Über das Grollen des Sturms hinweg konnte Rand die Stimme des Mannes hören, der weiter vorn an der Reling hockte. Offenbar waren die Frage und der eigenartige Rat eher an Rand und weniger an das Paar gerichtet, das zitternd an der anderen Seite des Decks kauerte. Rand hob den Kopf und spähte durch den dichten Regen zu dem Fremden hinüber. Der Mann starrte ihn aus schmalen Augen an, die von einer schwarzen Haarlocke halb verdeckt waren. Dem stechenden Blick wohnte etwas Verschlagenes inne.
Und mit einem Mal fiel Rand auf, dass der Mann näher an ihn herangerückt sein musste. Nun war er kein Dutzend Schritte mehr von ihm entfernt, sondern hatte die Distanz um mehr als die Hälfte verkürzt.
»Ich bin nicht dein Freund«, grollte Rand mit warnendem Unterton. »Mir gefällt dein Blick nicht, Kerl. Ich rate dir, dich von mir fernzuhalten.«
Der Mann stieß ein raues Lachen aus. »Das rätst du mir also, was?«
»Ganz recht.« Unter dem schweren Umhang schloss Rand die Hand um den Knauf eines Dolchs, den er am Gürtel trug. »Und ich werde es dir nicht noch einmal sagen.«
Etwas an dem Gesicht des Fremden wirkte eigenartig. Ja, seine ganze Erscheinung war sonderbar. Der Regen schien die Gesichtszüge des Mannes zu verzerren, betonte die Konturen des bärtigen Kinns und die hervortretende Stirn. Die Augen, die so kühn und dreist auf Rand gerichtet waren, wirkten leblos. Doch in dem spärlichen Licht glaubte Rand, ein wildes Glimmen darin zu entdecken.
Sein untrügliches Gespür, das ihn in manch einem Kampf vor dem Schlimmsten bewahrt hatte, gemahnte ihn auch diesmal zur Vorsicht. Den Rücken weiterhin gegen die Wand des Achterkastells gedrückt und beide Füße fest auf dem Boden, war Rand bereit, jeden Augenblick aufzuspringen und sich zur Wehr zu setzen, mochte das Unwetter auch toben.
Der Fremde hielt sich an der Reling fest und zog sich daran hoch. Nun gab er ein Kichern von sich, und als er grinste, zeigte er seine schartigen Zähne. »Du eingebildeter, törichter … Mensch!«
Das letzte Wort spie er böse aus. Rand entfuhr ein Fluch, erkannte er doch plötzlich, wer da vor ihm stand.
Den schwarzen Himmel zerriss ein gezackter Blitz. Ein unheilvoller Donnerschlag ließ das Schiff erzittern. Randwulf aber achtete nicht weiter auf den Sturm, wischte sich die Gischtfetzen aus dem Gesicht und sprang auf, um einem der Schergen von Silas de Mortaine entgegenzutreten.
»Gib mir den Beutel«, fauchte der Mann, wobei sich seine Lippen über den aufblitzenden Zähnen kräuselten.
»Du bist ein toter Mann, wenn du ihn auch nur anrührst«, entgegnete Rand. Er wartete gar nicht erst auf den Angriff, da er es stets vorzog, einen Kampf selbst zu eröffnen. Rasch hatte er den Dolch gezogen und machte einen Schritt nach vorn.
Jenseits des Masts rief einer der Reisenden gegen eine weitere, kräftige Windböe an: »Hinsetzen, ihr Narren! Der Sturm wird euch über Bord wehen!«
Die Warnung verhallte jedoch unbeachtet und war angesichts dessen, was in diesem Augenblick auf dem Spiel stand, sinnlos. Der Sturm tobte mit unverminderter Kraft, eine Welle nach der anderen brach sich am Bug der Kogge, aber auf den regennassen, rissigen Planken war eine weitaus gefährlichere Macht am Werk. Dieser Bedrohung würde Rand sich stellen.
Mit einem Satz stürzte er sich auf de Mortaines Mann und bekam ihn an der Gurgel zu fassen. Der Dolch verfehlte sein Ziel nicht und bohrte sich in den Körper des Gegners, dessen Kehle sich ein Schmerzensschrei entrang. Blut floss, und in der Dunkelheit des Sturms lag der Geruch des herannahenden Todes. De Mortaines Helfershelfer bemühte sich, seine eigene Waffe zu ziehen, doch da stieß Rand bereits ein zweites Mal zu und trieb dem Mann den Dolch in die breite Brust.
Rand hatte damit gerechnet, dass die Kräfte des bärtigen Mannes nachlassen würden, und war verblüfft, als er doch auf stärkeren Widerstand traf. Der stämmige Körper mit der klaffenden Wunde schien sich unter Rands Hand zu verändern und erbebte wie unter einer seltsamen Macht. Die Finger, mit denen sich der Mann eben noch an ihn geklammert hatte, wurden länger und bohrten sich nun wie Klauen in sein Fleisch.
Überall dort, wo ihn der Gestaltwandler berührte, verspürte Rand ein schmerzhaftes Kribbeln auf der Haut, als habe ihn die versengende Kraft eines Blitzes erfasst. Doch er drängte das Gefühl beiseite und holte mit der Klinge zu einem weiteren harten Stich aus.
»Er tötet den armen Mann! Helft ihm …!«, schrie eine Frau hinter ihm. Doch schon im nächsten Augenblick, als die Reisenden mit ansehen mussten, was sich jetzt an Deck abspielte, erstarben ihnen die Worte auf den Lippen. Rand starrte in die böse funkelnden Augen eines wilden Tiers und sah das geifernde, weit aufgerissene Maul, das nach ihm schnappte.
Die Bestie, die unmittelbar vor Rand aufragte, stieß ein zorniges Brüllen aus, ehe sie die fleckigen Fangzähne in seinen Arm bohrte.
Rand spürte ein heftiges Brennen. Als eine tosende Welle den Schiffsrumpf schüttelte, sank er auf ein Knie, verzweifelt um Halt bemüht, während er mit seinem Widersacher rang. Die Schreie der anderen Reisenden mischten sich unter das Grollen des Donners. Gischtgekröntes Wasser lief über die Planken, und die Macht der Wellen brachte die Kogge an Steuerbord in eine Schräglage.
Rand streckte die Hand nach der Reling aus – und verfehlte sie.
Jetzt, da er ins Leere griff, verlor er vollends das Gleichgewicht. Der Wolf ging mit ihm zu Boden und zog ihn auf die rutschigen Planken hinab. Der Sturm spülte noch mehr Wassermassen über das Deck. Rand sah nur die dunklen Umrisse des Gestaltwandlers unter sich und spürte, wie sich das Untier mit ganzer Kraft aufbäumte, ehe ihn eine mächtige Woge erfasste. So sehr er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht, sich von den scharfen Zähnen zu befreien, die sich immer noch unbarmherzig in seinen Unterarm gruben. Sowie das Schiff sich wieder auf die Seite legte, verlor Rand völlig die Orientierung.
Von den Reisenden waren noch mehr Schreckensschreie zu hören. Die Frauen kreischten – Bruchstücke von Gebeten, die gewiss nicht erhört würden, drangen an Rands Ohren.
Von der Macht der Welle erfasst, die sich über das Deck ergoss, gelang es Rand gerade noch, tief Luft zu holen und sich auf die Eiseskälte einzustellen, bevor er zusammen mit dem Gestaltwandler über Bord und in die wild schäumenden schwarzen Fluten gerissen wurde.
Sofort drückten ihn die Wellen nach unten. Der Gestaltwandler gab seinen Arm frei, da er versuchte, sich gegen das Toben der See zu behaupten. Verzweifelt kämpfte Randwulf gegen den Sog der Wellen an, doch das Gewicht seines Umhangs und der übrigen Kleider behinderte ihn. Wie ein Stein sank er nach unten, doch schließlich gelang es ihm, sich seines schweren Umhangs zu entledigen. Als Nächstes trennte er sich von den Stiefeln, um Luft kämpfend, während ihn die kalte See zu verschlingen drohte.
Bei allen Heiligen – er ertrank.
Rand gierte nach Luft. Er öffnete die Augen und sah sich ausschließlich von Finsternis umgeben. Das Salzwasser raubte ihm die klare Sicht und brannte auf seiner blutenden Wunde. Mit allerletzter Kraft begehrte er gegen die Fluten auf und drängte nach oben, bis er die schäumende Oberfläche endlich durchbrach. Keuchend und gierig sog er die Nachtluft ein und verschluckte sich.
Im nächsten Augenblick schon wurde er wieder von dem Gestaltwandler in die Tiefe gerissen, der unter ihm im Strudel um sein Leben kämpfte und noch immer mit scharfen Klauen an Rands Bein zerrte. Die Bestie schlug wie wild um sich, zog sich an ihm hoch und erreichte ebenfalls die rettende Wasseroberfläche. Rand spürte, wie seine Tunika zerriss, als der Wolf in seinem Todeskampf die Pranken in Rands Brust und Oberschenkel bohrte.
Vor sich in der Dunkelheit nahm er schemenhaft wahr, wie der Körper des Gestaltwandlers wieder seine menschliche Form annahm, um sich im nächsten Augenblick erneut in ein wildes Tier zu verwandeln. Die ganze Zeit griff es ihn an, und die höllischen Augen glommen in tödlicher Absicht. Rand trat nach seinem Gegner und hatte für einen kurzen Moment die Gelegenheit, das Schwert aus der Scheide zu ziehen. Durch die Wassermassen in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt, war er nicht in der Lage, seine oft erprobten Fertigkeiten mit der Klinge anzuwenden. Der Gestaltwandler, der Rands Vorhaben nicht sehen konnte, schwamm erneut mit wild rudernden Bewegungen auf ihn zu. Rand hielt die lange Klinge unter der Wasseroberfläche verborgen und stemmte sich dann mit aller Kraft nach vorn.
Harte schwarze Krallen rissen an Rands Hals, nachdem der Wolf und Rand in tödlicher Umarmung zusammengeprallt waren. Doch da hatte Rand bereits mit dem Schwertarm durch die wogende See nach dem Gegner gestoßen und spürte, wie sich die Klinge durch den Leib der Bestie bohrte. Der Gestaltwandler schrie auf, und dem breiten Kiefer entrang sich ein Heulen, dem nichts Menschliches innewohnte. Mit einer schnellen Drehung des Handgelenks unterband Rand den markerschütternden Schrei. Warmes Blut lief ihm über die Hand und vermischte sich mit dem Meerwasser, als der tote Leib des Gestaltwandlers in der Finsternis davontrieb.
Im stetigen Auf und Ab der Wellen versuchte Rand, sich über Wasser zu halten, und sah sich verzweifelt nach dem Schiff um. Doch es war fort. Nun war er allein in dem Sturm, schutzlos dem Meer ausgeliefert und am Ende seiner Kräfte. In den kalten Fluten fühlten sich seine Gliedmaßen taub und bleischwer an, die zahllosen Risswunden brannten wie Feuer und bluteten stark.
Nun konnte er sich nur noch schwimmend retten.
Doch wohin musste er sich wenden?
Gähnende Dunkelheit umgab ihn. Um ihn herum war nichts als die offene See und der erbarmungslose Sturm, der ihm die Gischt ins Gesicht schlug. Nirgendwo waren die Umrisse der Küste zu erkennen, nur die weite Leere des Meeres. Die Wucht einer Welle drückte Rand wieder unter Wasser. Die wenigen Kleider, die er noch am Leib hatte, zogen ihn hinab, ebenso das Gewicht der Waffe und des wertvollen Artefakts, das er in dem Schulterbeutel bei sich trug.
Wenn er schwimmen wollte, musste er sich des Ballasts entledigen. Hastig streifte er sich die zerrissene Tunika vom Leib und ließ das Schwert los – im Nu wurde sein einziges Mittel der Verteidigung von den hungrigen Wellen verschlungen.
Nun hatte er nur noch den kostbaren Kelch.
Das schwere goldene Gefäß mit den beiden Steinen, die von unschätzbarem Wert waren, hatte sich bereits bei der Überfahrt als Bürde erwiesen. Doch von diesem Schatz würde Rand sich niemals trennen. Selbst dann nicht, wenn sein eigenes Leben auf dem Spiel stand.
Er brachte die schmerzenden Arme in Bewegung, schwamm los und versuchte mit dem Mut der Verzweiflung, sich über den tosenden Wogen zu halten. Der Schatz, den er bei sich trug – das Werkzeug seiner nahenden Vergeltung – würde ihn bis zum nächsten Küstenstreifen begleiten … oder für immer mit ihm auf den kalten Meeresgrund sinken.
2
Sonnenstrahlen fluteten durch die dichten Laubkronen und ließen die frischen grünen Blätter, die in der leichten Sommerbrise raschelten, in goldenem Licht erscheinen. Der Morgen dämmerte in zarten Rosa- und Bernsteintönen, die von den dünnen Wolkenbändern am hellblauen Himmel jenseits des Waldgrundes eingefangen wurden. Das Huschen der Waldtiere, die bei Anbruch des Tages im Unterholz nach Nahrung suchten, vermischte sich mit dem Tschilpen der Singvögel, während weiter oben auf dem dicken Ast einer uralten, ausladenden Eiche ein Taubenpärchen gurrte.
»Euch beiden einen guten Morgen«, rief eine junge Frau, die dem Verlauf eines schmalen Pfades folgte, der sich durch den Wald schlängelte.
Die Finger in weiche Lederhandschuhe gehüllt, raffte sie die Röcke ihres einfachen, ungebleichten Bliauts und ging weiter. Tau glitzerte auf ihren bloßen Füßen, und noch immer war der Boden nass von dem Unwetter, das am Abend zuvor losgebrochen war. Ein für die Jahreszeit ungewöhnlich heftiger Sturm war über das Land hinweggefegt. Grelle Blitze, gefolgt von schweren Donnerschlägen, hatten sich wie gelbe Bänder über das pechschwarze Firmament gezogen. Das Gewitter war furchteinflößend gewesen. Ihre Mutter hatte um ihr Leben gebangt und vor Angst aufgeschrien, wenn wieder einmal ein Donnerschlag die ärmliche Kate hatte erzittern lassen.
Doch Serena war diese Furcht fremd.
Insgeheim hatte sie sich an der Wucht des Unwetters berauscht. Hier draußen in der geradezu heiligen Abgeschiedenheit des großen Waldes, in dem sie seit inzwischen neunzehn Jahren lebte, ereignete sich sonst wenig Ungewöhnliches. Hier war sie sicher, und obwohl sie die friedliche Stille des einfachen, beschaulichen Lebens genoss, das sie zusammen mit ihrer geliebten Mutter führte, regte sich seit Kurzem etwas Eigenartiges in ihr. Beunruhigende Gedanken kamen ihr in den Sinn, und sie verspürte ein Sehnen nach Küstenstreifen, die wilder als die sandige Bucht waren, die sich auf der anderen Seite des Waldgrundes erstreckte.
Zu ebendiesem, ihr so vertrauten Strand wanderte Serena in diesem Augenblick, während ihre Gedanken um die immer gleichen Aufgaben kreisten, die sie später an der Waldhütte noch zu erledigen hatte. Sie musste Kräuter rebeln, Unkraut im Garten zupfen, Leinenwäsche waschen, die Hütte ausfegen …
Das war der tägliche Ablauf, wie sie sich mit einem Seufzer bewusst machte. Vor Stunden schon hatte ihre Mutter sie an die morgendlichen Pflichten erinnert. Doch sowie Calandras wachsame Augen auf etwas anderes gerichtet waren, hatte Serena die Gelegenheit genutzt, um ein wenig durch den Wald zu streifen, auf der Suche nach einer willkommenen Ablenkung. Das dumpfe Rauschen der Brandung verhieß Abenteuer, daher hielt Serena schnellen Schrittes auf die Küste zu.
Sowie sie den Waldrand durchbrach, blieb sie stehen, schloss die Augen, hob ihr Gesicht der Sonne entgegen und atmete genießerisch die herbe, salzige Seeluft ein. Ihre Zehen versanken langsam in dem warmen, grobkörnigen Sand, der sich nach dem wolkenbruchartigen Regen, der die ganze Nacht über niedergegangen war, noch nass und fest anfühlte.
Die grenzenlose Weite der Welt breitete sich vor ihren Augen aus. Serena trug ihr langes dunkles Haar offen, sodass der Wind hineinfuhr und ihr einzelne Strähnen spielerisch ins Gesicht wehte. Sie hörte den heiseren Schrei eines Seevogels, öffnete die Augen und entdeckte eine schneeweiße Möwe, die über ihrem Kopf kreiste. Serena erfreute sich an dem kühnen Flug des Vogels und lächelte, als die Möwe scheinbar mühelos den Winden trotzte und die Freiheit des leeren Küstenstreifens mit weit ausgestreckten Schwingen ausnutzte. Weiter hinten schwappten die gischtgekrönten Wellen an den Strand und liefen in dünnen Rinnsalen über den Sand zurück.
Einen Freudenlaut auf den Lippen, schritt Serena zum Wasser – und blieb auf halbem Weg wie angewurzelt stehen.
Ihr Blick fiel auf etwas Großes und Unförmiges inmitten des von Seetang überzogenen Treibguts, das etwas weiter unten auf dem Strand lag, unmittelbar am Wasser. Mit einer Hand schützte sie die Augen gegen die Strahlen der Sonne und spähte zu der Stelle hinüber, an der sie ein Meerestier vermutete, das gewiss während des Sturms an Land gespült worden war und nun reglos am Strand lag. Neugier mischte sich unter die Trauer um den verendeten Meeresbewohner, während sich Serena dem unglückseligen Geschöpf mehr und mehr näherte, ein leises Gebet auf den Lippen.
Doch wie erschrocken war sie, als sie unter den dunklen, verworrenen Strängen des Seetangs die bleiche Haut eines Menschen erahnte. Dort lag ein Mann, wie sie sogleich begriff. Ihre Augen weiteten sich vor Schreck, als ihr Blick auf kraftvolle Arme und einen bloßen Oberkörper fiel, der von tiefen Schnittwunden entstellt war. Hellrotes Blut, teilweise geronnen, sickerte noch aus den Wunden, den hässlichen Kratzspuren und dem Schnitt auf seiner Stirn. Die dünnen Rinnsale mündeten in einer kleinen Lache Salzwasser, in der der Körper des Mannes lag. Seine Kleidung wirkte auf den ersten Blick gewöhnlich – zumindest das, was davon noch übrig war. Der Mann trug nichts als zerfetzte, klamme Beinkleider, und alles an ihm sah zerschlagen und elendig aus.
Wie mochte er hergekommen sein?
Serena sah sich auf dem Strand um und suchte nach Anhaltspunkten oder Hinweisen, die Aufschluss über die Herkunft des Mannes geben konnten. Wenn er ein Schiffbrüchiger war, so schien er der Einzige zu sein, denn offenbar waren keine weiteren Opfer angespült worden. Auch von einem Schiffswrack fehlte jegliche Spur. Der Mann lag halb auf der Brust, seine rechte Schulter bohrte sich in den feuchten Grund, seine Wange ruhte auf dem Strand, als schlafe er. Seegras und nasse Strähnen seines dunkelbraunen Haars verdeckten beinahe seine ganze Gesichtshälfte. Eine Hand hatte er um den Gurt eines Lederbeutels geklammert, und das Weiße an seinen Knöcheln verriet, wie fest sein Griff war.
»Wer auch immer Ihr seid, ich bete, dass Ihr in Euren letzten Augenblicken nicht leiden musstet«, wisperte Serena und spürte eine Woge des Kummers in sich hochsteigen, während sie den armen Seemann so leblos zu ihren Füßen liegen sah.
Ernst beugte sie den Kopf, und ihre Augen verengten sich. Eine Welle erreichte ihn nun, umspülte seine langen Beine und hob den reglosen Körper leicht an, ehe das Wasser wieder über den Sand zurück und ins Meer lief. Als der große Leib sich bewegte, glitzerte etwas Metallenes an seinem Hals – ein kleiner Anhänger mit einer Kette, deren fein gearbeitete Glieder viel zu zierlich für einen so großen Mann waren. Vielleicht würde ihr der Anhänger ja verraten, wer der Fremde war oder woher er stammte.
Von Neugier getrieben, suchte sich Serena einen langen Stock in dem Treibgut und trat dann wieder neben den Mann. Ihre Finger zitterten in den ledernen Handschuhen.
Lege niemals deine Hände auf einen von ihnen. Nie darfst du einem Menschen so nah kommen, dass er dich mit seiner Boshaftigkeit beflecken könnte.
Die warnenden Worte ihrer Mutter hallten in Serenas Kopf nach, als stehe Calandra unmittelbar neben ihr. Seit sie denken konnte, hatte sie diesen eindringlichen Rat unzählige Male vernommen, sodass die Worte ihr ebenso vertraut waren wie ihr eigener Atem.
Berühre keinen von ihnen, denn die Menschen werden dir nichts als Kummer und Schmerz bereiten.
Unschlüssig nagte Serena am Rand ihrer Unterlippe. Von diesem leblosen Fremden hatte sie doch gewiss nichts zu befürchten. Sie umschloss den Stock fester und nahm all ihren Mut zusammen. Das von der Sonne gebleichte Holz glitt über die Schulterpartie des Mannes, und die zitternde Spitze des Stockes verriet, wie aufgeregt Serena war. Denn jetzt war sie im Begriff, den Mann zu berühren, auch wenn eine Armeslänge Holz ihre Hand von seiner Haut trennte. Mit einer schnellen Bewegung drückte sie den Stock gegen den Arm des Mannes.
Der schlaffe Leib rollte ungelenk auf den Rücken, wobei etwas von dem Seetang von Gesicht und Oberkörper des Fremden rutschte. Trotz der Entbehrungen hatte der Mann ansprechende Züge, auch wenn Serena gelernt hatte, der äußeren Erscheinung der Menschen nicht allzu viel Bedeutung beizumessen. Dies war nicht der erste Mann, den sie zu Gesicht bekam. Einmal, als sie sich zu weit in dem Waldstück vorgewagt hatte, war sie einem rotblonden Jüngling aus der nahe gelegenen Stadt Egremont begegnet. Der junge Edelmann hatte sich gerade auf der Jagd nach Hasen befunden; beinahe wäre Serena von einem Pfeil in den Rücken getroffen worden, als sie versucht hatte, der Aufmerksamkeit des Fremden zu entgehen. Seitdem hatte sie gelernt, vorsichtiger zu sein.
Doch die schlaksige Erscheinung des hochnäsigen jungen Burschen aus Egremont verblasste angesichts der harten Konturen dieses Mannes.
Zögernd kniete sich Serena neben dem Unbekannten in den Sand und beugte sich über den lang hingestreckten Körper, um den Mann, den die raue See herausgegeben hatte, genauer betrachten zu können. Er trug einen Vollbart. Eine Spur seidiger Haare zog sich vom Brustkorb über seine straffe Bauchdecke und verschwand im Bund seiner Hose. An seine Herzgegend schmiegte sich der goldene Anhänger, der ihre Neugier geweckt hatte. Es war ein zierliches Schmuckstück, das zu ihrer Mutter passen würde. Serena beugte sich weiter hinab und fragte sich, ob ihr die Machart des Anhängers etwas über den Mann verriete – oder über die Dame, für die er ursprünglich angefertigt worden war. Behutsam hob sie das filigrane Amulett mit der behandschuhten Rechten an. Zu ihrem Schrecken gaben die kleinen Kettenglieder in ihrer Hand nach, und die Kette löste sich vom Hals des Mannes. Rasch fing sie das Erinnerungsstück auf, ehe es in den feuchten Sand fallen konnte, und legte es vorsichtig in ihre mit Leder überzogene Handfläche.
Der Anhänger war der Form des Herzens nachempfunden, die fein getriebenen Glieder der Kette waren netzartig geformt und beinahe genauso zerbrechlich. Serena führte die freie Linke zum Mund und streifte sich mit den Zähnen den Handschuh ab. Das Gold fühlte sich an ihren Fingerspitzen warm an. Plötzlich ließ die schwache Hitze des Metalls sie zusammenzucken.
Vorsichtig beäugte sie den Mann, sah das frische Blut, das noch aus seinen Wunden sickerte. Sie runzelte die Stirn, und im nächsten Augenblick hielt sie vor Schreck die Luft an, denn sie gewahrte, wie sich die Brust des Mannes unter einem flachen Atemzug leicht hob. Offenbar hatte sie einen Laut des Erstaunens von sich gegeben, denn der Mann schlug die Lider auf, unter deren schwarzen Wimpern glasige braune Augen sichtbar wurden. Er blinzelte angestrengt, als versuche er, die Umgebung wahrzunehmen.
»Himmel!«, entfuhr es Serena in ihrem Schrecken. Rasch sprang sie auf, wich zurück und wäre beinahe über ihre eigenen Füße gestolpert. »Ihr lebt ja!«
Mit einem schweren Stöhnen rollte sich der Fremde mühsam auf die Seite. Ein rauer, erstickter Laut entrang sich seiner Kehle, als der Mann Salzwasser ausspie.
Unwillkürlich wich Serena weiter zurück, verblüfft und von einer anwachsenden Furcht erfüllt.
Er lebte.
Wie benommen ließ sie den Lederhandschuh in den Sand fallen. Ihre bloßen Fingerspitzen kribbelten, berührten sie doch noch den Anhänger, den sie dem Seemann vom Hals genommen hatte.
Berühre niemals einen von ihnen, hörte sie die ernsten Worte in ihrem Kopf. Die Menschen sind böse und grausam, jeder Einzelne von ihnen. Sie bringen dir nichts als Kummer und Schmerz.
»Hilfe …«, stammelte der Mann mit tiefer Stimme. Mühsam hob er den Kopf und suchte Serenas ängstlichen Blick. »Bitte … helft … mir.«
Er streckte die Hand nach ihr aus, doch Serena schrie auf, drehte sich um und rannte wie ein aufgeschrecktes Reh davon. Sie bahnte sich ihren Weg durch die Sträucher, eilte über den gewundenen Waldpfad zurück und achtete auf ihrer Flucht nicht auf die Dornen, die an ihren Röcken rissen und ihre bloßen Füße zerschrammten. Ganz außer Atem erreichte sie schließlich die Waldhütte. Ihre Mutter würde schon wissen, was nun zu tun war. Sie würde wissen, wie diesem Mann geholfen werden konnte.
»Mutter!«, rief sie aufgeregt, und ihre Stimme überschlug sich. »Mutter, wo bist du? Komm rasch!«
Calandra musste hinter der niedrigen Hütte gewesen sein, denn jetzt bog sie eilig um die Ecke. Sie wischte sich die Hände an der einfachen Schürze ab, die sie über dem graubraunen Bliaut trug. Dunkle Erdkrumen beschmutzten das schlichte Gewebe. Einzelne Strähnen ihres angegrauten, ehemals hellblonden Haars hatten sich aus dem langen Zopf gelöst und fielen ihr in das ovale, glatte Gesicht. Furcht und Schrecken beherrschten ihre Züge, als Calandra ihre Tochter erblickte.
»Was ist geschehen, Kind? Bist du verletzt?«
Serena schüttelte den Kopf. »Nein, ich nicht. Aber da ist ein Mann – er wurde an Land gespült!«
Calandra trat eilig vor und umfasste mit festem Griff Serenas Schultern. »Wo ist dein anderer Handschuh?«
»Ich weiß es nicht. Ich … muss ihn verloren haben.« Der harte Griff ihrer Mutter ließ sie zusammenzucken. »Der Mann ist verletzt, Mutter. Er blutet. Er bat mich, ihm zu helfen.«
Die Farbe wich aus Calandras Gesicht. »Er hat dich angesprochen? Himmel, Serena, du hast ihn doch hoffentlich nicht mit der bloßen Hand berührt!«
»Nein. Das würde ich niemals tun. Du hast mich doch gewarnt …«
Calandra stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, ehe sie ihre Tochter an sich drückte. »Ich habe dich vieles gelehrt, um dich auf einen Vorfall wie diesen vorzubereiten. Nun kommt ein Fremder, trägt seine Sorgen und Nöte in unser Haus und macht uns nichts als Schwierigkeiten.«
Serena entwand sich den Armen ihrer Mutter und schüttelte den Kopf. »Aber er ist doch in Schwierigkeiten. Er hat gelitten, Mutter, und wäre beinahe ertrunken. Komm, wir müssen ihm helfen.«
Calandra blieb reglos stehen. Und als sich Serena anschickte, zu dem Waldpfad zurückzulaufen, packte ihre Mutter sie beim Handgelenk und hielt sie zurück.
»Was stehst du noch da?«, fragte Serena und wunderte sich, warum die Frau, die schon so viele verwundete und kranke Tiere aufopfernd gesund gepflegt hatte, jetzt so überhaupt kein Mitgefühl zeigte. War Calandras Angst vor den Menschen wirklich so groß, dass sie jemandem, der in Not war, jegliche Hilfe verweigerte? »Wirst du nicht mitkommen?«
»Nein«, beschied Calandra ihr knapp. »Und ich werde dir nicht erlauben, noch einmal zu dem Mann zu gehen. Du wirst hierbleiben und den Fremden aus deinen Gedanken verbannen.«
Ungläubig starrte Serena ihre Mutter an und hatte das Gefühl, dass ihr die Frau, die ihr sonst alles bedeutete, in diesem Augenblick fremder war als der unbekannte Seemann, der an ihrem Küstenstreifen an Land gespült worden war. »Aber … er ist doch verletzt, vielleicht sogar schwer. Er blutet und leidet gewiss Schmerzen. Verstehst du denn nicht? Er ist schwach, und wenn wir ihm nicht helfen, wird er womöglich sterben.«
Calandra heftete ihren harten, unnachgiebigen Blick auf Serena. »Bete, dass seine Qualen bald ein Ende haben, mein Kind.«
3
Am Abend lag Serena im Bett und fand keinen Schlaf, da das schlechte Gewissen an ihr nagte. Wie sollte sie ruhen, wenn dort draußen in der Dunkelheit ein Mensch seinen womöglich letzten Atemzug tat? Er war hilflos, konnte sogar im Wechsel der Gezeiten ertrinken und vom Wasser wieder zurück ins Meer gezogen werden. In der Stille der kleinen Hütte legte Serena die Stirn in Falten, stieß die Decke dann entschlossen von sich und setzte sich in der schmalen Bettstatt auf.
Von der anderen Seite des Raums vernahm sie die leisen Atemgeräusche ihrer Mutter, die ruhig und friedlich auf ihrem Lager schlief.
Es erschien ihr ungerecht.
Sie hielt es nicht für richtig, dass ihre Mutter und sie nichts für den Fremden taten, der einsam und verlassen am Strand lag.
Serena hatte immer noch den Anhänger. Behutsam holte sie die Kette unter der dünnen Matratze hervor, unter der sie das Schmuckstück am Nachmittag versteckt hatte, damit ihre Mutter es nicht entdeckte und sie deswegen schalt. Schlangenförmig lagen die zierlichen goldenen Glieder in ihrer Hand, der fein gearbeitete Anhänger glitzerte im Mondlicht, das durch die nicht verdunkelten Fenster fiel. Sie hatte dem Mann das Kettchen nicht wegnehmen wollen, aber in ihrem Schrecken und bei ihrer überhasteten Flucht hatte sie es einfach mitgenommen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!