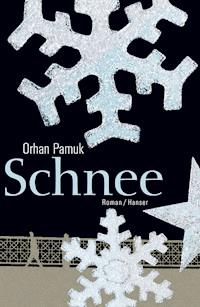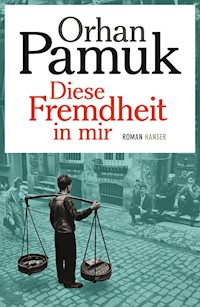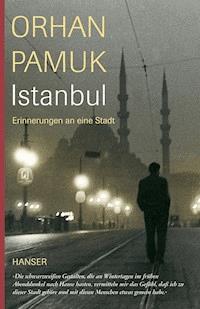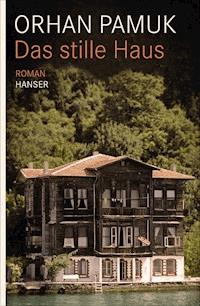Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Orhan Pamuk ist ein Augenmensch. Die Bilder eines Bellini faszinieren den in der Türkei lebenden Autor ebenso wie persische Miniaturen. In dieser Sammlung von Essays staunt der Nobelpreisträger für Literatur über die alltäglichen Wunder in New York, huldigt seinen Vorbildern der Literaturgeschichte und gibt Betrachtungen zu Politik und Zeitgeschichte preis. Vielleicht am schönsten sind seine Schilderungen aus dem Alltagsleben - der Tod einer Möwe oder die kindliche Melancholie der kleinen Tochter. Pamuks Essayband ist ein ganzer Kosmos, witzig, verspielt, manchmal provozierend, eine Fundgrube für alle Leser dieses großen Autors.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Orhan Pamuk
Der Koffer
meines Vaters
Aus dem Leben
eines Schriftstellers
Aus dem Türkischen von
Ingrid Iren und Gerhard Meier
Carl Hanser Verlag
Die deutsche Ausgabe folgt in Teilen dem türkischen Band
Öteki Renkler, erschienen 1999 bei İletişim in Istanbul.
Zahlreiche Texte wurden vom Autor neu durchgesehen.
ISBN 978-3-446-25172-4
© Orhan Pamuk 2010
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2010/2015
Alle Rechte für den Text »Der Koffer meines Vaters« © Nobelstiftung 2006
Schutzumschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung eines Fotos © Manuel Citak. Das Bild wurde 2000 in einem Kaffeehaus in Kars aufgenommen, als Pamuk für seinen Roman Schnee recherchierte.
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Inhalt
Leben
Der Koffer meines Vaters
Autobiographisches aus Anlass des Nobelpreises
Der implizite Autor
Notizen zum 29. 4. 1994 *
Meine schönste Uhr
Bemerkungen über Traum und Schuldgefühl
Poetische Gerechtigkeit
Hier war ich schon mal
Frühlingsnachmittage
Abends todmüde
Beim Aufstehen in stiller Nacht
Seit ich nicht mehr rauche
Die Möwe im Regen
Eine Möwe stirbt am Ufer
Das Haus des einsamen Mannes
Nach dem Sturm
Glücklich sein
Ich will nicht in die Schule
Rüya und ich
Wenn Rüya Kummer hat
Der Ausblick
Was ich über Hunde weiß
Istanbul
Brände und Abrisse *
Die Inseln *
Bosporusdampfer *
Amerika
Meine ersten Begegnungen mit Amerikanern
Ansichten aus der Hauptstadt der Welt *
Lesen und Bücher
Neun Notizen zu Buchumschlägen *
Lesen oder nicht lesen: Die Märchen ausTausendundeiner Nacht *
Tristram Shandy: Jeder sollte so einen Onkel haben *
Victor Hugos Passion für Größe *
Albert Camus *
Lesen im Stimmungstief *
Die Romanwelt von Thomas Bernhard *
Salman Rushdie: Die Satanischen Verse und die Freiheit des Autors *
Ahmet Hamdi Tanpınar: Was er im Gedicht suchte, fand er im Roman
Meine Bücher sind mein Leben
Zur Weißen Festung *
Das schwarze Buch: Zehn Jahre danach *
Eine Auswahl von Interviews zum Neuen Leben *
Zu Rot ist mein Name *
Eine Notiz zu Rot ist mein Name *
Aus dem Heft »Schnee in Kars« *
Bilder und Texte
Şirin ist verwirrt *
Im Wald, so alt wie die Welt *
Unbekannte Mörder und Kriminalromane: Der Kolumnist Çetin Altan und der Şeyhülislâm Ebussuud Efendi *
Bellini und der Osten *
Bedeutung *
Politik und Staatsbürgerschaft
Das nichtabgewogene Wort: Unser Recht auf Meinungsfreiheit
Der schlafende Mann
Die Provinzialisierung der Türkei
Saddam – Bush – Erdoğan
Paris Review
Über die Paris Review-Interviews
Das Paris Review-Interview
Textnachweis
Bildnachweis
Register
* übersetzt von Ingrid Iren
Leben
Der Koffer meines Vaters
Zwei Jahre vor seinem Tod übergab mir mein Vater einen kleinen Koffer, der Texte von ihm enthielt, Manuskripte, Hefte. In dem spöttischen Ton, der ihm so eigen war, sagte er zu mir, ich solle doch nach seinem Tod diese Sachen einmal lesen.
»Dann kannst du ja sehen«, sagte er leicht verlegen, »ob irgend etwas Brauchbares darunter ist, das sich dann veröffentlichen ließe.«
Wir standen in meinem Arbeitszimmer, umgeben von Büchern. Als wolle er eine schmerzliche Last loswerden, ging mein Vater unschlüssig im Zimmer herum und wusste nicht so recht, wohin mit dem Koffer. Schließlich stellte er das Ding in einem möglichst unauffälligen Eckchen ab. Kaum war dieser Moment beiderseitiger Peinlichkeit vorüber, da fanden wir auch schon erleichtert in unsere üblichen Rollen zurück und wurden wieder zu Menschen, die das Leben nicht allzuschwer nehmen und sich gerne darüber mokieren. Wir plauderten über dieses und jenes, über das ewige Einerlei der politischen Misere in der Türkei und über die Geschäfte meines Vaters, die mit schöner Regelmäßigkeit fehlschlugen.
Ich weiß noch gut, wie ich damals, nachdem mein Vater gegangen war, einige Tage lang an dem Koffer vorbeischlich, ohne ihn auch nur anzufassen. Ich kannte ihn ja schon aus Kindertagen, er war klein, schwarz, aus Leder und hatte abgerundete Ecken. Mein Vater benutzte ihn, wenn er zu kleinen Reisen aufbrach oder etwas Größeres ins Büro zu transportieren hatte. Als Kind machte ich ihn manchmal auf, wenn mein Vater von einer Reise zurückkam, wühlte in den Sachen herum und war betört von dem Geruch nach Kölnisch Wasser und fremden Ländern. Dieser Koffer war für mich ein wohlbekannter, reizvoller Gegenstand, der viel mit Vergangenheit und Kindheitserinnerungen zu tun hatte, und dennoch vermochte ich ihn nicht einmal zu berühren. Warum aber dies? Vermutlich lag es daran, dass der Kofferinhalt mir von geheimnisvoller Bedeutung schien.
Von dieser Bedeutung möchte ich hier nun sprechen. Davon nämlich, was ein Mensch betreibt, der sich in ein Zimmer zurückzieht, sich an einen Tisch setzt und versucht, mit Papier und Stift Zeugnis von sich abzulegen: Literatur.
Wenn ich es auch nicht über mich brachte, den Koffer zu öffnen, so waren mir doch einige der Hefte bekannt, die er enthielt, da ich meinen Vater darin hatte schreiben sehen. Überhaupt war mir die Art des Kofferinhalts nichts grundsätzlich Neues. Mein Vater besaß eine umfangreiche Bibliothek, hatte als junger Mann, gegen Ende der vierziger Jahre, in Istanbul Dichter werden wollen, hatte Paul Valéry ins Türkische übertragen, es aber schließlich nicht auf sich nehmen wollen, in einem rückständigen, an Lesern armen Land das harte Dasein eines Poeten zu führen. Mein Großvater war ein reicher Geschäftsmann gewesen, so dass mein Vater eine sorglose Kindheit und Jugend verbracht hatte und sich nicht um des Schreibens willen zu kasteien gedachte. Er liebte nun mal das Leben in all seiner Schönheit, und das verstand ich durchaus.
Was mich vom Inhalt des Koffers zunächst einmal fernhielt, war natürlich die Furcht, mir werde nicht gefallen, was dort zu lesen wäre. Mein Vater, dem dies bewusst war, hatte vorsorglich so getan, als nehme er selbst den Kofferinhalt nicht ganz ernst. Da ich zu jenem Zeitpunkt seit fünfundzwanzig Jahren Schriftsteller war, betrübte mich diese Einstellung. Andererseits konnte ich meinem Vater nicht böse dafür sein, dass er der Literatur nicht soviel Gewicht beimaß. Noch mehr aber fürchtete ich die Erkenntnis, mein Vater könne womöglich ein guter Schriftsteller gewesen sein. Was mich davon abhielt, den Koffer zu öffnen, war im tiefsten Grunde dies. Noch dazu konnte ich mir diesen Grund nicht eingestehen. Denn wäre aus dem Koffer meines Vaters echte, wahrhaftige Literatur zum Vorschein gekommen, so hätte ich in meinem Vater eine ganz andere Persönlichkeit sehen müssen. Das war ein furchtbarer Gedanke. Denn obwohl ich in fortgeschrittenen Jahren war, sollte mein Vater für mich nur mein Vater sein, und nicht etwa ein Schriftsteller.
Schriftsteller zu sein bedeutet für mich, dass man in sich selbst eine zweite, verborgene Persönlichkeit entdeckt und in jahrelanger geduldiger Mühe diese und ihr Umfeld sich herausschälen lässt. Und bei dem Wort Schreiben fallen mir nicht zuerst Romane, Gedichte und literarische Traditionen ein, sondern vielmehr der Mensch, der sich allein an einen Tisch setzt, in sich hineinhorcht und mit Worten eine neue Welt erschafft. Dabei mag er eine Schreibmaschine verwenden, sich die Bequemlichkeiten des Computers zunutze machen oder, wie ich seit über dreißig Jahren, das Papier mit einem Füller beschreiben. Er kann dabei Kaffee oder Tee trinken, rauchen, sich hin und wieder vom Schreibtisch erheben und zum Fenster hinaussehen, auf draußen spielende Kinder, eine dunkle Mauer oder, wenn er Glück hat, auf Bäume oder eine schöne Aussicht. Er kann Gedichte schreiben, Theaterstücke oder wie ich Romane. All diese Unterschiede aber entfalten sich erst auf der Grundlage der eigentlichen Tätigkeit, nämlich der Tatsache, dass man sich an einen Tisch setzt und sich geduldig dem eigenen Inneren zukehrt. Schreiben bedeutet, dass man die innere Einkehr in Worte fasst, dass man aus sich heraus voller Geduld, Hartnäckigkeit und Freude an einer neuen Welt arbeitet. Wenn ich am Tisch sitze und auf eine leere Seite nach und nach Wort um Wort schreibe und darüber Tage, Monate, Jahre vergehen, dann spüre ich, dass ich eine neue Welt erstehen lasse und einen anderen Mensch aus mir heraushole, so wie man Stein auf Stein eine Brücke oder eine Kuppel baut. Der Stein des Schriftstellers ist das Wort. Wir nehmen das Wort in die Hand, befühlen es, setzen es in Zusammenhang mit anderen Wörtern, betrachten es manchmal aus der Ferne, fahren mit dem Finger oder dem Stift gleichsam streichelnd oder abwägend darüber, dann setzen wir es an seinen Platz, zäh, geduldig, hoffnungsfroh, über Jahre hinweg, neue Sphären erschaffend.
Das Geheimnis des Schreibens liegt für mich daher nicht in einer von irgendwoher kommenden Inspiration, sondern in Hartnäckigkeit und Geduld. Die schöne türkische Redensart »mit einer Nadel einen Brunnen graben« könnte eigens für Schriftsteller geprägt worden sein. Seit jeher bewundere und begreife ich die Geduld des Märchenhelden Ferhat, der um der Liebe willen einen Berg durchbohrt. Als ich in dem Roman Rot ist mein Name von alten persischen Miniaturenmalern erzählte, die in jahrelanger leidenschaftlicher Übung immer wieder ein und dasselbe Pferd zeichneten, bis sie es schließlich auch mit geschlossenen Augen abbilden konnten, da war mir bewusst, dass ich eigentlich vom Beruf des Schriftstellers und von meinem Leben sprach. Um das eigene Leben allmählich als die Geschichte anderer Personen zu erzählen und in sich die entsprechende Erzählkraft zu verspüren, muss man, denke ich, dieser Kunst und diesem Handwerk geduldig viele am Schreibtisch verbrachte Jahre schenken und dabei einen gewissen Optimismus entwickeln. Die Muse, die manchem nie und manch anderem recht oft erscheint, liebt nämlich dieses Vertrauen und diesen Optimismus, und wenn der Schriftsteller sich gerade am allereinsamsten fühlt und am allermeisten an seinem Streben und Träumen und Schreiben zweifelt und meint, die Geschichte, an der er arbeitet, sei einzig und allein seine eigene Geschichte, dann kommt die Muse und schenkt ihm quasi all die Geschichten, Bilder und Vorstellungen, die er braucht, um das stetig aus ihm Hervorsprudelnde mit der Welt zu verbinden, die er gerade ersinnt. Im Laufe meines ganz dem Schreiben gewidmeten Lebens hat mich am meisten berührt, dass beglückende Sätze, Seiten, Bilder manchmal nicht mir selbst entstammten, sondern mir von einer fremden Kraft großzügig zu Füßen gelegt wurden.
Ich traute mich nicht, den Koffer meines Vaters zu öffnen und seine Hefte zu lesen, denn ich wusste, dass mein Vater nicht die Einsamkeit liebte, sondern ganz im Gegenteil Geselligkeit, seinen Freundeskreis, Salongespräche und Scherze, dass er also den Mühen, denen ich mich unterzog, gänzlich abhold war. Dann aber kam ich auf einen anderen Gedanken: All diese Vorstellungen von Selbstkasteiung und Geduld konnten ja auch lediglich Vorurteile sein, die ich aus meiner ganz persönlichen Lebens- und Schreiberfahrung bezog. Schließlich gab es doch eine ganze Reihe von glänzenden Autoren, die umgeben von Freunden im munteren Familienkreis lebten und im Gemeinschaftsgefühl geradezu badeten. Und außerdem war mein Vater, als ich noch ein Kind war, vor den Niederungen des Familienlebens nach Paris geflohen und hatte dort in einem Hotelzimmer – wie viele andere Schriftsteller – Heft um Heft vollgeschrieben. Ich wusste, dass ein Teil dieser Hefte in dem Koffer enthalten war, denn bereits Jahre zuvor hatte mein Vater begonnen, mir von diesem Abschnitt seines Lebens zu erzählen. Schon in meiner Kindheit hatte er diese Jahre erwähnt, damals aber ohne von seiner Verletzlichkeit zu berichten, von seinem Wunsch, Dichter zu werden, oder der Identitätskrise, die er in Pariser Hotelzimmern durchlitt. Er erzählte vielmehr, wie er in den Straßen von Paris oft auf Sartre gestoßen war; und über die Bücher, die er damals gelesen und die Filme, die er gesehen hatte, sprach er mit der Leidenschaft von jemandem, der eine wichtige Botschaft zu vermitteln hat. Dass ich selbst zum Schriftsteller geworden war, verdankte ich nicht zuletzt auch einem Vater, der zu Hause weit mehr von den Schriftstellern der Weltliteratur sprach als etwa von militärischen oder religiösen Führern. Vielleicht musste ich diese Hefte schon allein deswegen lesen und auch wegen der umfangreichen Bibliothek meines Vaters, der ich nicht wenig zu verdanken hatte. Der Tatsache, dass mein Vater, während er mit uns zusammenlebte, genauso wie ich gerne in einem Zimmer mit seinen Gedanken und seinen Büchern allein war, musste ich daher Achtung zollen, ohne mich um die literarische Qualität seiner Schriften weiter zu kümmern.
Doch je länger ich hilflos auf den Koffer starrte, um so klarer wurde mir, dass ich genau das nicht zustande bringen würde. Wenn mein Vater auf dem Sofa vor seinem Bücherregal lag, ließ er manchmal sein Buch oder seine Zeitschrift sinken und verfiel in langes Denken und Träumen. Sein Gesicht nahm dann einen ganz anderen Ausdruck an als sonst, wenn er am familiären Scherzen, Necken und Zanken teilnahm, und hatte etwas ganz nach innen Gewandtes, aus dem ich vor allem in jungen Jahren sorgenvoll schloss, meinen Vater müsse etwas bedrücken. Heute dagegen weiß ich, dass gerade diese Art von Bedrücktheit einer der Haupttriebe ist, die aus einem Menschen einen Schriftsteller machen. Um Schriftsteller zu werden, müssen wir – bevor noch Geduld und Leiden ihr Werk tun können – in uns den Drang verspüren, vor dem Leben in der Gemeinschaft, dem Alltag, dem Jedermannserleben wegzulaufen und uns allein in ein Zimmer zu sperren. Geduld und Hoffnung brauchen wir erst dann, damit unser Schreiben in tiefe Dimensionen reicht. Unser erster Antrieb aber ist der Wunsch, uns in ein Zimmer zurückzuziehen, ein Zimmer voller Bücher. Das schönste Beispiel für einen freien, unabhängigen Schriftsteller, der diese Bücher nach Gutdünken liest, mit ihnen Zwiesprache haltend auf die Stimme seines Gewissens lauscht und dann seine eigenen Gedanken fasst und seine eigene Welt herausbildet, ist natürlich Montaigne, der Begründer der modernen Literatur. Mein Vater war ein eifriger Leser Montaignes und empfahl ihn auch mir. Und so sehe ich mich auch heute in der Tradition jener Autoren stehen, die – wo immer auch in der Welt, sei es nun im Westen oder im Osten – sich von ihrer Gemeinschaft lösen und sich allein in ihre Kammer setzen.
So einsam, wie man vermuten könnte, sind wir dort aber nicht. Zur Seite stehen uns die Worte, die Geschichten, die Bücher von anderen, die literarische Tradition. Die Literatur ist meiner Ansicht nach das Wertvollste, was der Mensch geschaffen hat, um sich selbst zu verstehen. Menschlichen Gesellschaften, Stämmen, Völkern gelingt es in dem Maße, sich kulturell weiterzuentwickeln, in dem sie ihre Literatur ernst nehmen und auf ihre Schriftsteller lauschen, und bekanntlich ist es ein Vorbote dunkler, törichter Zeiten, wenn in einem Land Bücher verbrannt und Schriftsteller erniedrigt werden. Dabei ist Literatur nie die Angelegenheit einer einzelnen Nation. Der Schriftsteller, der sich zurückzieht und erst einmal eine Reise in sein Inneres antritt, wird dort im Laufe der Jahre eine Grundregel guter Literatur entdecken, und zwar, dass jene aus dem Talent besteht, unsere eigene Geschichte als die Geschichte anderer zu erzählen und die Geschichte anderer als unsere eigene. Und dazu brauchen wir als Ausgangspunkt die Geschichten und Bücher anderer Menschen.
Mein Vater verfügte über eine gutbestückte Bibliothek von etwa tausendfünfhundert Bänden, was auch für einen Schriftsteller mehr als ausreichend ist. Im Alter von zweiundzwanzig Jahren hatte ich mich zwar noch nicht durch die ganze Bibliothek gelesen, doch war mir jedes einzelne Buch irgendwie vertraut, so dass ich etwa wusste, wo mich eher leichte oder tiefgründige Lektüre erwartete und ob ein Werk als Klassiker und unverzichtbarer Bestandteil der Weltliteratur galt oder als amüsantes, aber doch zu vernachlässigendes Zeugnis lokaler Begebenheiten, und auch, welche Bücher von einem französischen Autor stammten, den mein Vater sehr schätzte. Manchmal stand ich sinnierend vor dieser Bibliothek und stellte mir vor, dass ich eines Tages eine ebensolche oder gar bessere besitzen und mir aus Büchern eine eigene Welt zimmern würde. Dabei kam mir die Bibliothek meines Vaters manchmal wie eine kleine Abbildung der Welt vor. Es war dies aber eine Welt, wie sie von Istanbul aus gesehen wurde. Gekauft hatte mein Vater die Bücher sowohl auf den Auslandsreisen, die ihn vor allem nach Paris und in die USA führten, als auch in seiner Jugend, in den vierziger und fünfziger Jahren, in den Buchläden in Istanbul, die damals fremdsprachige Literatur führten, und später in den alten und neueren Istanbuler Buchhandlungen, die auch ich alle kenne. In den siebziger Jahren begann ich selbst dann ernsthaft, mir eine eigene Bibliothek zusammenzustellen. Ich hatte damals noch nicht ganz beschlossen, Schriftsteller zu werden, ahnte jedoch – wie in meinem Buch Istanbul geschildert –, dass aus mir kein Maler werden würde, und wusste somit nicht recht, wohin mein Weg mich führen sollte. Zum einen verspürte ich in mir eine unbezähmbare Neugierde auf alles mögliche, eine Lesewut und einen übermäßig optimistischen Wissensdrang, zum anderen aber kam es mir so vor, als würde in meinem Leben etwas »fehlen«, als würde ich es nicht so leben können wie manch anderer. Das hatte zum Teil wohl damit zu tun, dass ich damals – wie auch beim Betrachten der Bibliothek meines Vaters – ziemlich deutlich empfand, fern vom Zentrum des Geschehens zu sein, so wie ja auch Istanbul uns in jenen Jahren vermittelte, dass wir eigentlich in der Provinz lebten. Der Gedanke, dass irgend etwas »fehle«, wurde außerdem dadurch genährt, dass mir nur allzu bewusst war, in einem Land zu leben, das einem Künstler, sei er nun Maler oder Schriftsteller, keine sonderliche Beachtung schenkte und ihm auch keinerlei Hoffnungen machte. Als ich mich in den siebziger Jahren, gleichsam um über diesen Mangel hinwegzukommen, mit dem Geld meines Vaters gierig daranmachte, in Antiquariaten vergilbte und verstaubte Bücher zu kaufen, war ich von der Armut, dem Durcheinander und der Hoffnungslosigkeit der am Straßenrand, in Moscheehöfen und an halbverfallenen Mauern etablierten Verkaufsstände kaum weniger beeindruckt als von der Lektüre jener Bücher selbst.
Sowohl das Leben als auch die Literatur vermittelten mir damals das Grundgefühl, »nicht im Zentrum zu stehen«. Es gab im Zentrum der Welt ein Leben, das reichhaltiger und lebenswerter war als das unsere und von dem ich wie alle Istanbuler und überhaupt alle Türken von vornherein ausgeschlossen war. Heute denke ich, dass der überwiegende Teil der Welt dieses Gefühl genauso empfand wie ich. Es gab außerdem eine Weltliteratur und deren ebenfalls weit von mir entferntes Zentrum. Eigentlich meinte ich mit Weltliteratur damals die westliche Literatur, und wir Türken waren auch davon ausgeschlossen. Die Bibliothek meines Vaters bestätigte mir das nur. Sie bestand zum einen aus heimischer Literatur und Büchern über Istanbul, in deren Details ich mich auch heute noch mit unvermindertem Behagen verliere, und zum anderen aus Bänden der westlichen Literatur, die der unseren so gar nicht ähnelte, was uns Anlass zu Betrübnis, aber auch zu Hoffnung gab. Lesen und schreiben bedeutete, aus der einen Welt herauszutreten und in der wundersamen Verschiedenheit der anderen einen Trost zu finden. Ich fühlte, dass mein Vater – so wie später ich selbst – manchmal einen Roman vor allem deshalb las, um sich aus seinem eigenen Leben in den Westen zu flüchten. Es kam mir auch so vor, als ob Bücher etwas seien, mit dem man über ein kulturelles Mangelgefühl hinwegzukommen sucht. Nicht nur das Lesen, sondern auch das Schreiben stellte eine Methode dar, um aus unserem Istanbuler Leben in den Westen zu gelangen. Die meisten Hefte in dem Koffer stammten aus der Zeit, als mein Vater zum Schreiben ganz bewusst nach Paris gefahren war und sich in ein Hotelzimmer eingeschlossen hatte, um erst das Ergebnis seiner Arbeit in die Türkei zurückzubringen. Als ich nun vor dem Koffer stand, merkte ich, dass mich das unangenehm berührte. Nachdem ich mich fünfundzwanzig Jahre lang in mein Zimmer zurückgezogen hatte, um in der Türkei als Schriftsteller bestehen zu können, kam nun beim Anblick dieses Koffers in mir ein Unmut darüber auf, dass ein Schriftsteller, um so zu schreiben, wie es ihm beliebt, sich vor der Gesellschaft, dem Staat, der Nation quasi verstecken musste. Vielleicht war ich gerade deswegen meinem Vater dafür böse, dass er das Schreiben nicht so ernst genommen hatte wie ich.
Eigentlich verübelte ich ihm, dass er nicht so lebte wie ich, dass er nie um irgendeiner Sache willen eine Auseinandersetzung riskiert hätte und lieber im Kreise seiner Freunde und in Harmonie mit der Gesellschaft ein von Lachen und Scherzen erfülltes Leben führte. Irgendwie wurde mir auch schmerzlich bewusst, dass ich ihm genaugenommen das nicht »verübelte«, sondern ihn vielmehr beneidete. Damals fragte ich mich nämlich immer auf meine spröde, unwirsche Art, worin denn eigentlich das Glück bestehe. Ist glücklich, wer allein in seinem Zimmer hockt und meint, ein intensives Leben zu führen? Oder vielmehr jener andere, der unter Menschen geht und das glaubt, was sie glauben, oder zumindest so tut und ruhig dahinlebt? Und wenn man aller Welt in Harmonie verbunden scheint, sich dann aber hinsetzt und heimlich schreibt, ist das dann Glück zu nennen oder eher Unglück? Es waren dies jedoch zu ungestüme Fragen. Woher wollte ich denn auch wissen, ob Glück überhaupt als Maßstab unseres Lebens diente? Die Leute, die Presse, alle taten immer, als sei es so und nicht anders. Lohnte es nicht gerade deshalb, einmal zu untersuchen, ob es sich nicht genau umgekehrt verhielt? Wieweit kannte ich überhaupt meinen Vater, den es doch immer von seiner Familie fortgetrieben hatte, und was wusste ich schon von dem, was ihn womöglich quälte?
Diese Fragen waren der erste Antrieb, der mich schließlich dazu brachte, den Koffer zu öffnen. Gab es im Leben meines Vaters irgendeinen Kummer, von dem ich nicht wusste, irgendein Geheimnis, das nur durch Schreiben zu bewältigen war? Kaum war der Koffer auf, da entströmte ihm der typische Reisegeruch. Ich erkannte gleich einige der Hefte wieder, die mein Vater mir Jahre zuvor einmal beiläufig gezeigt hatte. Ich nahm jedes einzelne in die Hand, die meisten stammten erwartungsgemäß aus der Zeit, als mein Vater uns als junger Mann in Istanbul zurückgelassen hatte und nach Paris gefahren war. Mir ging es nun so wie mit meinen Lieblingsschriftstellern, deren Biographien ich las: Ich wollte auch bei meinem Vater wissen, was er in meinem Alter gedacht und geschrieben hatte. Schon bald aber stellte ich fest, dass ich auf solches Material so schnell nicht stoßen würde. An den Texten, die ich hie und da ein wenig anlas, befremdete mich außerdem ein bestimmter Ton, den ich nicht als den Ton meines Vaters erkannte. Er klang nicht authentisch oder gehörte zumindest nicht zu der Person, die mir als mein authentischer Vater galt. Es steckte da eine Furcht in mir, die mich noch mehr bedrückte als das Gefühl, mein Vater könne als Schriftsteller nicht mein Vater sein. Meine grundsätzliche Furcht vor dem Nichtauthentischen war schlimmer als die Befürchtung, die Texte meines Vaters misslungen zu finden oder festzustellen, dass mein Vater sich zu sehr von diesem oder jenem Schriftsteller hatte beeinflussen lassen. Vor allem in jüngeren Jahren wuchs sich diese Furcht zu einer wahren Authentizitätskrise aus, die mich meine ganze Existenz, mein Leben, meinen Schreibwunsch und meine Texte beständig hinterfragen ließ. In meinen ersten zehn Jahren als Romanautor empfand ich sie besonders intensiv, kämpfte fortwährend dagegen an und hatte Angst, dass es mir eines Tages so gehen würde wie mit der Malerei und ich auch das Schreiben wegen solcher Erwägungen einmal aufgeben würde.
Damit sind die beiden Grundgefühle angesprochen, die der Koffer in mir auslöste: zum einen das Gefühl des Provinzialismus und zum anderen die Sorge um die Authentizität. Natürlich war es nicht das erstemal, dass ich dergleichen empfand. Ich hatte diese Gefühle in all ihren Ausprägungen, ihren Nebeneffekten und ihrer farblichen Vielfalt bis in ihre Nervenenden und Verknotungen hinein durch jahrelanges Lesen und Schreiben analysiert, seziert und vertieft. Vor allem in jüngeren Jahren hatte ich sie als unbestimmte Seelenschmerzen und stimmungsverderbende Empfindlichkeiten kennengelernt, als Verwirrungen, die hin und wieder aus Leben und Literatur auf mich einströmten. Eine echte Auseinandersetzung damit fand aber erst statt, als ich jene Gefühle literarisch verarbeitete (die Provinzialität in Schnee und in Istanbul, die Sorge um die Authentizität in Rot ist mein Name und im Schwarzen Buch). Schriftsteller sein bedeutet für mich somit auch, die geheimen Wunden, die wir in uns tragen und von denen wir höchstens in Ansätzen wissen, zu erkennen, uns geduldig damit auseinanderzusetzen, sie herauszuarbeiten und sie zu einem ganz bewussten Teil unseres Schreibens und unserer Persönlichkeit zu machen.
Schreiben bedeutet ferner, etwas auszudrücken, was jeder weiß, ohne zu wissen, dass er es weiß. Wir entdecken dieses Wissen, entwickeln es weiter, teilen es mit anderen und vermitteln damit dem Leser den Genuss, sich in einer wohlvertrauten Welt dennoch voller Erstaunen zu bewegen. Diesen Genuss bezieht der Leser aus unserem Talent, alles, was wir wissen, in seiner ganzen Wahrhaftigkeit in einen Text zu gießen. Der Schriftsteller, der in seinem Zimmer durch jahrelange Übung dieses Talent entfaltet und eine eigene Welt zu formen sucht, geht dabei von seinen eigenen Wunden aus und bringt damit bewusst oder unbewusst den Menschen ein tiefes Vertrauen entgegen. So habe ich stets darauf gezählt, dass auch andere Menschen die gleichen Wunden in sich tragen wie ich und ich deshalb verstanden werde. Jegliche wahre Literatur baut auf dem kindlichen Urvertrauen auf, dass die Menschen sich gleichen. Und wer sich jahrelang zurückzieht und schreibt, der wendet sich an diese Menschheit und an eine Welt ohne festes Zentrum.
Wie jedoch aus dem Koffer meines Vaters und natürlich auch aus den verblassten Farben unseres Istanbuler Lebens hervorgeht, gibt es sehr wohl ein Zentrum der Welt, das weit von uns entfernt ist. Auf das Provinzgefühl, das man wegen dieser Grundgegebenheit oft auf tschechowsche Weise erlebt, und auf die Authentizitätsangst, die als ihr Nebenprodukt auftritt, bin ich in meinen Büchern häufig eingegangen. Ich weiß auch aus eigenem Erleben, dass der größte Teil der Weltbevölkerung diese Gefühle teilt und sich auch mit gravierenderen Phänomenen wie Diskriminierung und Furcht vor Erniedrigung herumschlägt. Selbstverständlich besteht die Hauptsorge der Menschheit nach wie vor im Problem der Nahrung und Behausung. Davon aber künden heute das Fernsehen und die Presse viel schneller und leichter als die Literatur. Was die Literatur heute in erster Linie erzählen und erforschen sollte, das ist der Menschheit grundsätzliches Problem, nämlich Minderwertigkeitsgefühle, die Furcht, ausgeschlossen und unbedeutend zu sein, verletzter Nationalstolz, Empfindlichkeiten, verschiedenste Arten von Groll und grundsätzlichem Argwohn, nicht enden wollende Erniedrigungsphantasien und damit einhergehend nationalistische Prahlerei und Überheblichkeit. Diese Phantasien, die meist auf irrationale und überschwengliche Weise ausgedrückt werden, verstehe ich nur allzugut, sobald ich ins Dunkel meiner eigenen Seele blicke. In der außerwestlichen Welt, mit der ich mich ohne weiteres identifizieren kann, können wir immer wieder beobachten, dass die Empfindlichkeit von Menschenmassen und ganzen Völkerschaften sich in Befürchtungen niederschlägt, die geradezu an Dummheit grenzen. In der westlichen Welt wiederum, mit der ich mich nicht weniger leicht identifiziere, führen Reichtum sowie der Stolz darauf, an der Wiege von Renaissance, Aufklärung und Moderne gestanden zu haben, bisweilen dazu, dass man sich mit ähnlicher Einfalt viel zuviel auf sich einbildet.
Nicht nur mein Vater, sondern jeder von uns nimmt also den Gedanken von einem Zentrum der Welt zu ernst. Dabei ist ja das, was uns zum Schreiben in die Einsamkeit treibt, ganz im Gegenteil ein Gefühl des Vertrauens, nämlich der Glaube daran, dass das, was wir schreiben, eines Tages auch gelesen und verstanden wird, weil die Menschen auf der ganzen Welt ähnlich strukturiert sind. Es ist dies aber – und das weiß ich aus meinen und meines Vaters Texten – ein gedämpfter, vom Ingrimm über ein Außenseiterdasein angekränkelter Optimismus. Die Hassliebe, mit der Dostojewski sein Leben lang dem Westen begegnete, habe auch ich mitunter verspürt. Doch habe ich bei dem Dichter eine Lektion gelernt, die mich positiv stimmt, denn wenn Dostojewski auch von dieser Hassliebe ausging, so schuf er doch eine weit darüber hinausgehende Welt.
Wer dem Schreiben sein Leben widmet, der weiß genau, dass die Welt, die er aus welchen Gründen auch immer in jahrelanger hoffnungsvoller Arbeit kreiert, sich danach oft ganz anders verortet, als man dies erwartet hatte. Mögen wir uns auch voller Kummer oder Wut an den Schreibtisch gesetzt haben, wir gelangen dennoch über Kummer und Wut hinaus in eine andere Dimension. Konnte nicht auch meinem Vater das gelungen sein? Wenn man nach langer Reise in einer solchen Welt eintrifft, hat man das gleiche Gefühl, ein Wunder zu erleben, wie wenn sich nach langer Seefahrt eines Tages durch den Dunst das Schauspiel einer farbenprächtigen Insel entfaltet. Westliche Reisende mochten ähnlich empfinden, wenn sie mit dem Schiff von Süden her auf Istanbul zufuhren und sich allmählich der Morgennebel lichtete. Voller Hoffnung und Neugier waren sie zu der Reise aufgebrochen, und nun, nach langer Überfahrt, stand ihnen plötzlich eine Stadt, eine Welt vor Augen, mit ihren Moscheen und Minaretten, Häusern, Straßen, Gassen, Hügeln, Brücken. So wie sich ein begeisterter Leser gerne in den Seiten eines Buchs verliert, so mochten diese Menschen den Wunsch hegen, augenblicklich in die vor ihnen erscheinende Welt einzutauchen. Und haben wir uns an den Tisch gesetzt, weil wir in der Provinz waren, am Rande, wütend oder einfach melancholisch, so haben wir eine völlig neue Welt entdeckt, die uns diese Gefühle vergessen lässt.
Im Gegensatz zu früher ist für mich heute Istanbul das Zentrum der Welt, und zwar nicht nur deshalb, weil ich hier fast mein ganzes Leben verbracht habe, sondern auch, weil ich seit dreiunddreißig Jahren die Straßen, die Brücken, die Menschen, die Hunde, die Moscheen, die Brunnen, die seltsamen Helden, die Läden, die bekannten Persönlichkeiten, die wunden Punkte, die Tage und Nächte dieser Stadt beschreibe und mich stets mit alledem identifiziere. Die Vorstellungen, die ich dabei habe, entwickeln ein Eigenleben und werden in meinem Kopf wichtiger als die Stadt selbst, in der ich wohne. Dann scheint es, als ob alle Menschen und Straßen, alle Dinge und Gebäude begännen, miteinander zu sprechen und Beziehungen einzugehen, von denen ich nichts wusste, so als lebten sie nicht in meiner Vorstellung und meinen Büchern, sondern eigenständig und ganz für sich allein. Und die Welt, die ich geduldig ersonnen habe, so wie man »mit einer Nadel einen Brunnen gräbt«, kommt mir dann wirklicher vor als alles andere.
Nun, dachte ich beim Betrachten des Koffers möglichst vorurteilsfrei, vielleicht sind die Freuden des unverdrossen schaffenden Schriftstellers ja auch meinem Vater zuteil geworden. Nicht zuletzt war ich ihm dafür dankbar, dass er nie ein strenger und strafender Vater gewesen war, nie ein Unterdrücker, und dass er mir stets meine Freiheiten gelassen und meine Persönlichkeit geachtet hatte.
Meiner Phantasie kindhaft freien Lauf zu lassen, war mir vielleicht nur deshalb möglich, weil ich im Gegensatz zu den meisten meiner Freunde ohne Angst vor dem Vater groß geworden war, und manchmal war ich auch überzeugt, dass ich nur deshalb Schriftsteller werden konnte, weil mein Vater es einst hatte auch werden wollen. So musste ich also nachsichtig an diese Texte herangehen und versuchen, sie zu verstehen.
Derart gewappnet, öffnete ich endlich den Koffer, der seit Tagen am gleichen Fleck stand, entnahm ihm einige Hefte und begann unter Aufbietung meines ganzen Willens zu lesen. Was mein Vater geschrieben hatte? Ich kann mich an Beschreibungen von Blicken aus Hotelzimmern erinnern, an Gedichte, Aporien, Syllogismen … Ich fühlte mich nun wie jemand, der nach einem schweren Verkehrsunfall nicht genau weiß, was ihm passiert ist, und es so genau auch gar nicht wissen will. Wenn in meiner Kindheit die Eltern am Rande eines Streits waren und wieder einmal tödliches Schweigen ausbrach, schaltete mein Vater immer sofort das Radio an, und die Musik ließ uns das Vorgefallene schneller vergessen.
Die Funktion dieser Musik sollen jetzt ein paar launige Worte erfüllen, mit denen ich das Thema wechsle. Wie Sie wissen, lautet die Lieblingsfrage an Schriftsteller: Warum schreiben Sie eigentlich? Nun, ich schreibe, weil ich Lust dazu habe! Ich schreibe, weil ich nicht wie die anderen eine normale Arbeit machen kann. Ich schreibe, weil ich Ihnen und allen anderen sehr böse bin. Ich schreibe, weil ich gerne den ganzen Tag schreibend in meinem Zimmer sitze. Ich schreibe, weil ich die Wirklichkeit nur ertrage, wenn ich sie verändern kann. Ich schreibe, weil die ganze Welt wissen soll, was wir, ich und die anderen, in Istanbul, in der Türkei für ein Leben führen. Ich schreibe, weil ich den Geruch von Stift und Tinte liebe. Ich schreibe, weil ich an nichts so sehr glaube wie an die Literatur und den Roman. Ich schreibe, weil es mir Gewohnheit und Leidenschaft geworden ist. Ich schreibe, weil ich fürchte, vergessen zu werden. Ich schreibe, weil es mir Ruhm und Anteilnahme bringt. Ich schreibe, um allein sein zu können. Ich schreibe, um herauszufinden, warum ich Ihnen und allen anderen so böse bin. Ich schreibe, weil es mich freut, gelesen zu werden. Ich schreibe, weil ich einen Roman, einen Artikel, eine Seite angefangen habe und nun fertigbekommen will. Ich schreibe, weil das jeder von mir erwartet. Ich schreibe, weil ich in kindlicher Manier an die Unsterblichkeit von Bibliotheken glaube und daran, wie Bücher in den Regalen stehen. Ich schreibe, weil das Leben, weil die Welt, weil einfach alles unglaublich schön und überraschend ist. Ich schreibe, weil es Freude macht, diese Schönheit und diesen Reichtum in Worte zu fassen. Ich schreibe, weil ich eine Geschichte nicht erzählen, sondern erschaffen will. Ich schreibe, um das Gefühl loszuwerden, dass es irgendwo einen Ort gibt, an den ich – wie in einem Traum – niemals gelangen kann. Ich schreibe, weil ich nicht glücklich sein kann. Ich schreibe, um glücklich zu sein.
Eine Woche nachdem mein Vater den Koffer in meinem Arbeitszimmer gelassen hatte, kam er mich wieder besuchen, wie immer (ungeachtet meiner achtundvierzig Jahre) mit einer Tafel Schokolade in der Hand. Und wie immer sprachen und scherzten wir über alles mögliche, über Politik, über Familiengeschichten. Da fiel der Blick meines Vaters auf die Stelle, an der er seinen Koffer abgestellt hatte; der Koffer war nicht mehr da. Wir sahen uns an. Es entstand ein peinliches Schweigen. Ich sagte nicht, dass ich den Koffer geöffnet und in den Heften gelesen hatte, und wandte den Blick ab. Er verstand jedoch, und das verstand ich, was wiederum er verstand. Das ging so hin und her, aber nur ein paar Sekunden lang, denn mein Vater war ein glücklicher Mensch voller Selbstvertrauen und tat somit, was er immer tat: Er lachte. Und als er wieder ging, sagte er mir wie jedesmal väterlich aufmunternde Worte.
Ich sah ihm noch hinterher, wie stets voller Neid auf sein unbeschwertes, lebensfrohes Wesen. Doch weiß ich noch, dass sich an jenem Tag in mir auch ein schmähliches Glücksgefühl regte. Es war, wie sich denken lässt, das Gefühl, vielleicht nicht so ein ruhiges, sorgloses Leben geführt zu haben wie er, statt dessen aber den Anforderungen der Literatur genügt zu haben. Ich schämte mich für dieses Gefühl. Hatte mein Vater mir doch, statt mir als Unterdrücker zum Lebensmittelpunkt zu werden, stets meine Freiheit gelassen. All dieses lehrt uns, dass das Schreiben und die Literatur zutiefst mit einem Mangel in unserem Innersten sowie mit Glücks- und Schuldgefühlen verbunden sind.
Meine Geschichte hat aber noch einen zweiten, symmetrischen Aspekt, an den ich mich an jenem Tag erinnerte, und zwar erst recht voller Schuldgefühl. Mit Zweiundzwanzig hatte ich beschlossen, alles andere seinzulassen und Schriftsteller zu werden, hatte mich vier Jahre lang eingeschlossen und schließlich meinen ersten Roman Cevdet und Söhne fertiggeschrieben, und danach – also dreiundzwanzig Jahre bevor mein Vater bei mir seinen Koffer abstellte – war ich mit dem getippten Manuskript des noch unveröffentlichten Buchs zu meinem Vater gegangen, hatte es ihm mit zitternden Händen übergeben und ihn um seine Meinung dazu gebeten. Diese war mir sehr wichtig, und zwar nicht nur, weil ich auf seinen Geschmack und seine Intelligenz vertraute, sondern auch, weil er im Gegensatz zu meiner Mutter gegen meinen Berufswunsch nichts einzuwenden hatte. Mein Vater war daraufhin eine Weile unterwegs, und ich wartete ungeduldig auf seine Rückkehr. Als er zwei Wochen später wiederkam, lief ich zur Tür, um ihm zu öffnen. Mein Vater sagte nichts, umarmte mich aber gleich so herzlich, dass mir klar war, wie sehr ihm das Buch gefallen hatte. Eine Zeitlang standen wir uns dann überwältigt von unseren Gefühlen stumm und verlegen gegenüber. Als wir uns einigermaßen gefasst hatten, brachte mein Vater auf überschwengliche Weise zum Ausdruck, wie sehr er an mein erstes Buch glaubte, und sagte schließlich, eines Tages würde ich bestimmt jenen Preis gewinnen, den ich jetzt hier mit großer Freude in Empfang nehmen werde.
Er sagte das weniger, weil er wirklich daran glaubte oder um mir den Preis als ein Ziel zu setzen, sondern eher wie ein türkischer Vater, der seinen Sohn mit den Worten »Aus dir wird mal ein General!« motiviert. Jahrelang aber wiederholte er seinen Spruch jedesmal, wenn er mich sah, um mich eben zu ermutigen.
Im Dezember 2002 starb mein Vater.
Sehr verehrte Mitglieder der Schwedischen Akademie, die Sie mir diesen Preis und diese große Ehre zugesprochen haben, sehr verehrte Gäste, ich hätte sehr gewünscht, dass mein Vater heute unter uns wäre.
Autobiographisches aus Anlass
des Nobelpreises
In der einen Hälfte meines Buchs Istanbul ist von der Stadt die Rede, in der anderen Hälfte von meinen ersten zweiundzwanzig Lebensjahren. Ich weiß noch, wie furchtbar enttäuscht ich nach der Niederschrift war. Von dem, was ich unbedingt hatte erzählen wollen, hatte ich in Istanbul nicht einmal ein Zehntel untergebracht. Mit Erinnerungen an jene Jahre könnte ich noch zwanzig Memoirenbände füllen. Doch wurde mir bewusst, dass Autobiographien kein Mittel zum Erinnern darstellen, sondern eine Form des Vergessens.
Ich bin 1952 in Istanbul geboren. Mein Großvater war ein erfolgreicher Ingenieur und Unternehmer, der Firmen gegründet und mit dem Eisenbahngeschäft viel Geld verdient hatte. Mein Vater war in den gleichen Bereichen tätig, nur dass er ständig Geld verlor, anstatt welches hinzuzuverdienen. Ich war bis zum Abitur in Istanbuler Privatschulen und begann dann ein Studium der Architektur, das ich nach drei Jahren aufgab, um Schriftsteller zu werden. Vom siebten bis zum zweiundzwanzigsten Lebensjahr wollte ich eigentlich Maler werden. In all diesen Jahren war ich ständig voller Eifer und innerer Befriedigung damit beschäftigt, zu zeichnen und zu malen. Als ich mit dem Malen aufhörte, wusste ich zwar, dass ich nichts anderes wollte als ein Künstlerdasein; warum genau ich mich aber plötzlich aufs Schreiben verlegte und mich an meinen ersten Roman Cevdet und Söhne machte, war mir selbst nicht bewusst. Um dem Grund dafür auf die Spur zu kommen, schrieb ich viele Jahre später das Buch Istanbul.
Wenn ich an meine vierundfünfzig Lebensjahre zurückdenke, habe ich jemanden vor mir, der ständig voller Glücks- und Unglücksgefühle am Schreibtisch sitzt und arbeitet. Ich habe meine Bücher stets sorgfältig und geduldig und mit besten Vorsätzen geschrieben und immer an sie geglaubt. Erfolg, Ruhm und berufliches Glück … von selbst gekommen sind sie nicht. Meine Bücher werden heute in fünfundfünfzig Sprachen übersetzt, doch am meisten Mühe hat es mich gekostet, mein erstes Buch in der Türkei herauszubringen. Vier Jahre lang versuchte ich Cevdet und Söhne diversen Verlegern anzudienen. Und das, obwohl das Buch einen Preis für das beste unveröffentlichte Manuskript bekommen hatte …
1982, als das Buch schließlich herauskam, heiratete ich Aylin Türegün. Sie stammte aus den gleichen westlich orientierten, wohlhabenden Kreisen wie ich, war in die gleichen Schulen gegangen – wenn wir uns damals auch noch nicht kannten – und im gleichen Viertel aufgewachsen, so dass ich sie damit aufziehen konnte, ich hätte »ein Mädchen aus meinem Dorf« geheiratet. 1991 kam unsere Tochter zur Welt, die wir nach der Romanheldin aus dem Schwarzen Buch Rüya nannten.
Ich habe nie einen anderen Beruf als die Schriftstellerei ausgeübt. Von 1985 bis 1988 war ich als Visiting Scholar an der New Yorker Columbia University, während meine Frau dort ihren Doktor machte. Ich war fasziniert von der Vielfalt der amerikanischen Bibliotheken, Buchhandlungen und Museen. 2002 ließen meine Frau und ich uns scheiden. Sie und unsere Tochter sind noch immer meine besten Freunde. Im Jahre 2006, einen Monat vor der Erlangung des Nobelpreises, übernahm ich an der Columbia University eine Unterrichtstätigkeit (ein Semester pro Jahr).
Ein glücklicher Tag ist für mich ein gewöhnlicher Arbeitstag, an dem mir eine gute Seite geglückt ist. Das Leben jenseits des Schreibens erscheint mir oft unzulänglich und sinnlos. Die Leute wissen zwar um meine Abhängigkeit von Schreibtisch, weißem Blatt und Füller, und dennoch raten sie mir, ich solle doch mal Urlaub machen, ausspannen, mich amüsieren. Wer mich besser kennt, weiß um das Glück, das ich aus dem Schreiben beziehe, und sieht ein, dass es letztendlich nichts nützen würde, mich von Stift und Papier fernzuhalten. Ich gehöre zu den wenigen glücklichen Menschen, die nie etwas anderes getan haben, als in ihrem geliebten Beruf zu arbeiten.
Meine ganze Kindheit über war ich von einer großen Familie umgeben, von Onkeln und Tanten, Cousins und Cousinen. Meine beiden ersten Bücher Cevdet und Söhne und Das stille Haus sind Familienromane. Ich erzähle gern von großen Essen im Familienkreis, von familiären Zwistigkeiten und Sticheleien. In dem Maße aber, in dem unser Familienverband wirtschaftlich immer unbedeutender wird und Auflösungserscheinungen zeigt, büßt er sowohl seine beschützende Wirkung auf mich ein als auch seine Funktion als Zentrum, zu dem es mich immer wieder hinzieht. Dass ich mit zunehmendem Alter immer einsamer und mit zunehmender Einsamkeit immer berühmter werde, lässt mich manchmal erschaudern. Wenn ich mich abends im Bett zusammenkrümme und die Decke über mich ziehe, erfasst mich ein zugleich süßes und beängstigendes Gefühl, das mich zwischen Einsamkeit und Traum, zwischen Schönheit und Unerbittlichkeit des Lebens hin und her schwanken lässt, und es durchfährt mich wieder ein Schauer wie damals als Kind beim Hören und Lesen von Märchen und Gruselgeschichten.
In meinem Roman Das stille Haus habe ich mich anhand der Monologe der Großmutter mit dieser Phase des Halbschlafs auseinandergesetzt. In der Weißen Festung kommen ebenfalls Übergänge zwischen Traum und Wirklichkeit, Einbildung und Historie vor. Im eigentlichen Sinne zu meinem Ton gefunden habe ich jedoch erst mit dem 1985 begonnenen Schwarzen Buch. Damals lebte ich, inzwischen dreiunddreißig Jahre alt, in New York und war sehr mit Fragen meiner Identität und meiner Vergangenheit beschäftigt. Ich saß fortwährend in der Bibliothek der Columbia University und las und schrieb. Mein Heimweh nach Istanbul vermischte sich mit der Bewunderung für muslimische Kultur der Vergangenheit samt ihren osmanischen, iranischen und arabischen Elementen. Ich verfasste ausufernde Entwürfe und tastete mich beim Schreiben doch vor wie ein Blinder, ohne recht zu wissen, was ich da tat. Noch heute wundert mich, wie ich dieses Buch zustande gebracht habe.
Im Roman Das neue Leben sollte das, was ich für Das schwarze Buch entdeckt hatte, auf poetische Weise von neuem verhandelt werden, aber diesmal nicht in Istanbul, sondern in der Provinz. Für meine Mutter wiederum ist die eigentliche Überraschung der Roman Rot ist mein Name, wie sie immer wieder sagt. In meinen anderen Büchern verwundere sie nichts, schließlich wisse sie ja, aus welchem Lebensmaterial sie geformt seien. Rot ist mein Name habe dagegen etwas an sich, das sie sich nicht erklären könne, obwohl sie mich doch so gut kenne … Ich empfinde das als die höchste Auszeichnung, die einem Schriftsteller zuteil werden kann: von der eigenen Mutter zu hören, dass man Bücher schreibt, die besser sind als man selbst …
Mich selbst überrascht am meisten das Interesse, auf das der Roman Schnee gestoßen ist. Zuerst dachte ich mir, das habe wohl mit dem herkömmlichen Gegensatz zwischen Orient und Okzident zu tun oder mit aktuelleren Themen wie dem Irak-Krieg oder dem politischen Islam. Mittlerweile aber erkläre ich mir die Sache eher so, dass die Szene im Hotel Schneepalast, in der um den Inhalt einer politischen Verlautbarung gestritten wird, die größere Rolle dabei spielt. Doch höchstwahrscheinlich ist auch das eine falsche Vermutung. Schon zu Anfang der neunziger Jahre, als ich nur in der Türkei bekannt war, wurde ich von türkischen Journalisten beinahe feindselig gefragt, warum meine Bücher denn solchen Erfolg hätten. Eigentlich habe ich bis heute noch keine Erklärung gefunden, an die ich so richtig glauben kann. Als meine Bücher allmählich auch im Ausland gelesen wurden, bekam ich die gleichen Fragen auch von ausländischen Journalisten und Kulturredakteuren gestellt. Mir schwebt beim Schreiben immer ein Buch vor, das ich selbst gerne lesen würde. Und manchmal treffe ich damit anscheinend den Geschmack von vielen. Aber wahrscheinlich ist auch diese Erklärung wieder nicht minder falsch als all die anderen. Aber genauso gerne, wie man über sein Leben spricht, redet man als Schriftsteller über seine Bücher. Letztendlich ist das Leben eines Menschen wertvoller als seine Bücher. Was aber dem Leben Sinn und Wert verleiht, das sind wiederum die Bücher. Seit dem Moment, als ich zu schreiben begonnen habe, kann ich mein Leben ohnehin nicht mehr von meinen Büchern trennen. Später einmal werden meine Bücher als wichtiger und unterhaltsamer empfunden als mein Leben, denke ich mir. Wenn die Zeit zum Sterben gekommen ist, muss man an dergleichen wohl voller Ergebung glauben. Aber bis dahin wird es wahrscheinlich noch eine Weile hin sein.
Ich weiß, dass ich jetzt, im April 2007, im Alter von vierundfünfzig Jahren, schon mehr als die Hälfte meines Lebens hinter mir habe, aber ich glaube, dass mein bisher zweiunddreißig Jahre währendes Schriftstellerleben erst bei der Hälfte angelangt ist. Vor mir sollten noch einmal zweiunddreißig Jahre liegen, in denen ich Bücher schreiben kann, die meine Mutter und andere Leser überraschen.
Der implizite Autor
Ich schreibe nunmehr seit dreißig Jahren. Das sage ich schon eine ganze Weile, und allmählich stimmt es auch gar nicht mehr, denn mittlerweile sind es einunddreißig Jahre. Dennoch sage ich gerne, dass ich seit dreißig Jahren Romane schreibe. Obwohl auch das nicht ganz zutrifft. Zwischendurch schreibe ich auch Essays, Kritiken, schreibe über Istanbul oder über Politik und auch Reden so wie diese. Meine eigentliche Arbeit aber, mein unmittelbarer Bezug zum Leben, ist das Verfassen von Romanen. Nun gibt es brillante Schriftsteller, die über einen viel längeren Zeitraum hinweg schrieben, ohne viel Aufhebens davon zu machen. Bei Tolstoi, Dostojewski oder Thomas Mann, die ich sehr bewundere und immer wieder von neuem lese, hat das Schriftstellerdasein nicht dreißig, sondern über fünfzig Jahre gewährt. Warum erwähne ich dann meine dreißig Jahre überhaupt? Ich tue es deshalb, weil ich vom Romanschreiben als einer Gewohnheit berichten möchte.
Um glücklich zu sein, muss ich mich Tag für Tag in gewissem Maße mit Literatur beschäftigen. Es gibt ja Kranke, die jeden Tag einen Löffelvoll Medizin einnehmen müssen. Als Kind erfuhr ich, dass Zuckerkranke, um ein normales Leben führen zu können, jeden Tag eine Spritze bekommen müssen, und da taten mir diese Menschen sehr leid, da ich sie quasi für »Halbtote« hielt. Meine Abhängigkeit von der Literatur hat in gewisser Weise auch mich zu einem »Halbtoten« gemacht. Wenn ich insbesondere als junger Schriftsteller von manchen als »lebensfremd« bezeichnet wurde, dann hatte ich immer das Gefühl, sie spielten damit auf dieses Halbtotendasein an, dieses Gespensterhafte. Es kam mir manchmal so vor, als sei ich tot und versuchte meine Leiche durch die Literatur wieder zum Leben zu erwecken. Ich brauche also die Literatur wie ein Medikament. Als wäre es eine Spritze oder ein Löffelvoll Arznei, muss ich täglich meine Dosis Literatur »einnehmen«, die dann auch noch wie der Stoff eines Süchtigen bestimmte Eigenschaften aufzuweisen hat.
Es muss vor allem gute Literatur sein. Darunter verstehe ich, dass sie wahrhaft und überzeugend ist. Eine Romanpassage zu lesen, an die ich von ganzem Herzen glauben kann, macht mich glücklicher als alles andere und bringt mich dem Leben näher. Ferner ist es mir lieber, wenn der Autor schon verstorben ist. Meine tiefempfundene Bewunderung soll nach Möglichkeit auch nicht von einem Wölkchen Neid überschattet werden. Je älter ich werde, um so mehr komme ich zu der Einsicht, dass die besten Bücher von toten Autoren stammen. Wenn ein bewundernswerter Autor noch unter uns weilt, dann hat das etwas Gespenstisches. Und wie ein Gespenst sehen wir ihn an, wenn wir ihm auf der Straße begegnen, wir trauen unseren Augen nicht und schielen von fern zu ihm hin. Nur ein paar Wagemutige bitten das Gespenst um ein Autogramm. Manchmal denke ich über so einen Autor: Nun, bald stirbt auch er, und dann werden wir seine Bücher noch mehr schätzen. Aber natürlich gilt das nicht für alle Fälle …
Wenn ich schreibe, verhält es sich mit meiner täglichen Literaturdosis ganz anders. Das beste Heilmittel, die ergiebigste Glücksquelle ist nämlich für Menschen wie mich, täglich eine halbe Seite zu schreiben. Seit dreißig Jahren sitze ich so gut wie jeden Tag etwa zehn Stunden lang in meinem Zimmer am Schreibtisch und arbeite. Was ich in dieser Zeitspanne druckreif zu Papier brachte, ist in jenen dreißig Jahren im Durchschnitt jeweils etwas weniger als eine halbe Seite gewesen. Und noch dazu ist es meist knapp unter dem Qualitätsstandard, den ich als »gut« bezeichne. Da haben wir doch schon zwei ausgezeichnete Gründe zum Unglücklichsein.
Verstehen Sie mich aber bitte nicht falsch: Ein Literaturabhängiger meines Schlages ist nicht so oberflächlich, dass er durch die Schönheit, den Erfolg oder die Anzahl seiner Bücher schon zum glücklichen Menschen gemacht würde. Die Literatur soll ihm nicht über die Probleme seines ganzen Lebens hinweghelfen, sondern lediglich über den einen schweren Tag, den er gerade erlebt. Und eigentlich ist jeder Tag schwer. Das Leben ist schwer, wenn man nicht schreibt. Es ist auch schwer, wenn man nicht schreiben kann. Und schwer ist es auch dann, wenn man schreibt, denn schreiben ist sogar sehr schwer. Inmitten all dieser Verdrießlichkeiten geht es nun darum, genug Hoffnung zu schöpfen, um den Tag herumzubringen oder gar – wenn ein Buch so gut ist, dass es in andere Welten entführt – in heitere Stimmung zu kommen.
Ich will einmal erzählen, wie es mir ergeht, wenn ich an einem Tag nichts Ordentliches zustande gebracht habe und mich auch nicht zum Trost wenigstens in einem guten Buch habe verlieren können. Innerhalb kürzester Zeit wird mir dann die Welt zu einem furchtbaren, ja unerträglichen Ort, und wer mich kennt, der merkt mir das sofort an, weil ich dann ebendieser Welt auch gleiche. Meine Tochter etwa sieht mir abends auf der Stelle an, wenn ich tagsüber nichts Rechtes habe schreiben können. Ich würde das liebend gerne vor ihr verbergen, aber es gelingt mir nicht. In solchen Momenten ist mir leben oder nicht leben nämlich einerlei. Ich möchte dann mit niemandem sprechen, und niemand, der mich so sieht, hätte auch Lust, mit mir zu sprechen. Eigentlich gerate ich jeden Tag in diesen jämmerlichen Zustand, und zwar am frühen Nachmittag zwischen eins und drei, aber ich habe gelernt, damit umzugehen und mit den Heilmitteln des Schreibens und Lesens zu verhindern, dass ich gänzlich ins Leichenhafte verfalle. Wenn Reisen oder irgendwelche Scherereien, wie früher der Militärdienst und die hohe Gasrechnung oder heute politischer Verdruss oder sonst irgendwelche Hemmnisse, mich über längere Zeit daran hindern, meine nach Tinte und Papier duftende Medizin einzunehmen, dann ist mir, als würde ich aus lauter Verstimmung zu einer Art Betonmensch werden. Meine Bewegungen sind dann steif, in den Gelenken knirscht es, der Kopf wird zu Stein, und selbst mein Schweiß scheint einen anderen Geruch anzunehmen. Und dieses Unbehagen kann sich hinziehen, steckt doch das Leben voller Zumutungen, die den Menschen vom Trost der Literatur fernhalten. Im Getümmel einer politischen Versammlung, beim Schwatz mit Kommilitonen auf dem Korridor der Uni, bei einem Festtagsessen mit der gesamten Verwandtschaft, beim mühsamen Gespräch mit einem Menschen, der den Kopf voll hat mit Bildern aus irgendeiner Fernsehwelt, bei einem Arbeitstermin, beim Einkaufen, beim Notar oder beim Fotografen: bei all solchen Gelegenheiten geschieht es mir immer wieder, dass mir urplötzlich die Lider unerträglich schwer werden. Da ich mich nicht in mein Zimmer zurückziehen kann, weiß ich mir an solchen Orten oft keinen anderen Trost, als mitten am Tag einfach einzunicken.
Vielleicht gilt ja mein Verlangen nicht der Literatur als solcher, sondern der Gelegenheit, in einem Zimmer allein zu sein und meine Phantasie spielen zu lassen. Kaum darf ich das, so stellen sich mir die familiären oder beruflichen Anlässe, zu denen so viele Menschen zusammenkommen, in allerschönstem Lichte dar. Dann sehe ich etwa diese Menschen bei noch größeren Feiertagsessen frohgestimmter denn je in allen Einzelheiten vor mir. In der Phantasie wird mir nämlich alles interessant, attraktiv und wahrhaftig. Aus der herkömmlichen Welt, wie wir sie alle kennen, forme ich im Geiste eine neue Welt. Und damit sind wir beim Kern der Sache angelangt. Um gut schreiben zu können, muss ich mich erst mal so richtig unbehaglich fühlen, und um das zu bewerkstelligen, muss ich ins Leben eintauchen. Wenn ich mich dann auf Telefontrubel, Bürohektik, Liebe, Freundschaft, einen sonnigen Strand oder eine verregnete Beerdigung einlasse und also im Begriff bin, mich mitten ins Geschehen zu mischen, dann fühle ich plötzlich, dass ich ja eigentlich vielmehr am Rande stehe. Und dann beginnt die Phantasie zu arbeiten. Negativ ausgedrückt, beginne ich mich zu langweilen. Auf jeden Fall sagt mir eine innere Stimme: »Geh in dein Zimmer, setz dich an deinen Schreibtisch.« Wie es bei anderen ist, weiß ich nicht, aber Leute wie ich werden auf genau diese Art zu Schriftstellern. Ich denke allerdings, dass dies nur der Weg zur Prosa, nicht aber zur Poesie ist. Dies sagt wiederum etwas über die Eigenschaften meiner täglichen Medizin aus. An ihrer Bitterkeit lässt sich ablesen, dass sowohl das Leben als auch die Phantasie in gehörigem Maße an ihr Anteil haben müssen.