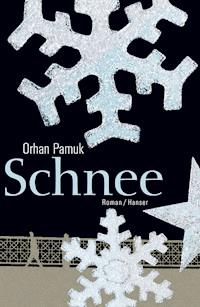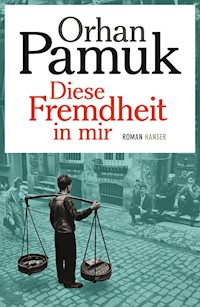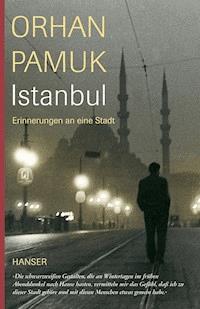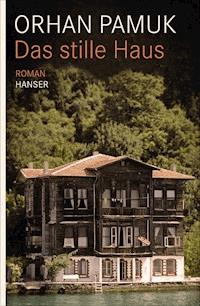Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Man schreibt das Jahr 1591, Istanbul ist vom Schnee bedeckt. Ein Toter spricht zu uns aus der Tiefe eines Brunnens. Er kennt seinen Mörder, und er kennt auch die Ursache für den Mord: ein Komplott gegen das gesamte Osmanische Reich, seine Religion, seine Kultur, seine Tradition. Darin verwickelt sind die Miniaturenmaler, die beauftragt sind, für den Sultan zehn Buchblätter zu malen, ein Liebender und der Mörder, der den Leser bis zum Schluß zum Narren hält. Ein spannender Roman, der, als historischer Krimi verkleidet, immer wieder auch auf die gegenwärtige Spannung zwischen Orient und Okzident verweist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 915
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Orhan Pamuk
Rot ist mein Name
Roman
Aus dem Türkischenvon Ingrid Iren
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe erschien erstmals 1998 unter dem Titel Benim Adım Kırmızı bei İletişim in Istanbul.
ISBN 978-3-446-25230-1
© 1998 İletişim Yayıncılık A.S. All rights reserved.
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München Wien 2001/2016
Schutzumschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung eines Ausschnitts aus einem Altarbild des Meisters von Flémalle (Robert Campin) von 1438 und aus einer Miniatur von Behzat, die die Ermordungt Chosrows zeigt © pentagram
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Für Rüya
»Wenn ihr jemand erschlagen habt und überden Täter streitet …«
Koran, Sure Bakara, 72
»Nicht gleichen sich der Blinde und der Sehende.«
Koran, Sure Al-Fatir, 19
»Allah ist Herr über Ost und West …«
Koran, Sure Bakara, 115
Inhalt
1 Ich bin tot
2 Mein Name ist Kara
3 Ich, der Hund
4 Sie werden mich Mörder nennen
5 Ich bin euer Oheim
6 Ich, Orhan
7 Mein Name ist Kara
8 Mein Name ist Ester
9 Ich, Şeküre
10 Ich bin ein Baum
11 Mein Name ist Kara
12 Man nennt mich Schmetterling
13 Man nennt mich Storch
14 Man nennt mich Olive
15 Mein Name ist Ester
16 Ich, Şeküre
17 Ich bin euer Oheim
18 Sie werden mich Mörder nennen
19 Ich, die Münze
20 Mein Name ist Kara
21 Ich bin euer Oheim
22 Mein Name ist Kara
23 Sie werden mich Mörder nennen
24 Mein Name ist Tod
25 Mein Name ist Ester
26 Ich,şeküre
27 Mein Name ist Kara
28 Sie werden mich Mörder nennen
29 Ich bin euer Oheim
30 Ich, Şeküre
31 Rot ist mein Name
32 Ich, Şeküre
33 Mein Name ist Kara
34 Ich, Şeküre
35 Ich, das Pferd
36 Mein Name ist Kara
37 Ich bin euer Oheim
38 Ich, Altmeister Osman
39 Mein Name ist Ester
40 Mein Name ist Kara
41 Ich, Altmeister Osman
42 Mein Name ist Kara
43 Man nennt mich Olive
44 Man nennt mich Schmetterling
45 Man nennt mich Storch
46 Sie werden mich Mörder nennen
47 Ich, Satan
48 Ich, Şeküre
49 Mein Name ist Kara
50 Wir beiden Gottesnarren
51 Ich, Altmeister Osman
52 Mein Name ist Kara
53 Mein Name ist Ester
54 Ich, die Frau
55 Man nennt mich Schmetterling
56 Man nennt mich Storch
57 Man nennt mich Olive
58 Sie werden mich Mörder nennen
59 Ich, Şeküre
Zeittafel
Vorbemerkung
Da dieses Buch ein türkischer Roman ist, dessen Handlung – auch wenn sie in osmanischer Zeit spielt – von Türken getragen wird, sind die türkischen Namen von Personen, Stadtvierteln und auch die Namen der Helden aus den altiranischen Legenden in türkischer Schreibweise wiedergegeben:
Bei Namen, Städtenamen, Titeln und Begriffen, die dem deutschen Leser bereits vertraut bzw. in deutschen Wörterbüchern enthalten sind, wurde die im Deutschen (teils in unterschiedlicher Fassung) eingebürgerte Umschrift beibehalten. Die arabischen Namen der Koransuren, ein Koranzitat und einzelne arabische Namen erscheinen auch in dieser gewohnten Umschrift. Trotz der Bemühung um größtmögliche Einheitlichkeit ließen sich in Einzelfällen gewisse Widersprüche nicht vermeiden.
Mein besonderer Dank gilt Christoph Neumann für seine unschätzbare fachliche Unterstützung.
Ingrid Iren
1Ich bin tot
Ein Toter bin ich nun, eine Leiche auf dem Grund eines Brunnens. Schon längst tat ich meinen letzten Atemzug, schlug mein Herz ein letztes Mal, doch niemand weiß, was mir geschah, nur mein ruchloser Mörder. Der aber, widerlicher Schuft, hat auf meinen Atem gehorcht und mir den Puls gefühlt, um sicherzugehen, daß ich wirklich tot war, dann hat er mir einen Tritt in die Weiche versetzt, mich zum Brunnen geschleppt, hochgezerrt und hineinfallen lassen. Mein Schädel, eingeschlagen von einem Stein, wurde beim Sturz in den Brunnen gänzlich zertrümmert, meine Stirn, meine Wangen wurden zerdrückt und waren hin, meine Knochen brachen, meinMund füllte sich mit Blut.
Vor vier Tagen schon hätte ich heimkommen müssen – meine Frau und die Kinder sind auf der Suche nach mir. Meine Tochter, ganz erschöpft vom Weinen, blickt zum Gartentor; aller Augen sind auf die Straße, auf das Tor gerichtet.
Sind die Augen wirklich auf das Tor gerichtet? Auch das weiß ich nicht. Vielleicht haben sich alle mit der Lage schon abgefunden, wie schrecklich! Hat man doch an diesem Ort einfach das Gefühl, jenes Leben, das man hinter sich ließ, ginge weiter wie bisher. Eine unendliche Zeit war vergangen bis zu meiner Geburt. Und jetzt nach meinem Tod kommt wieder eine unendlich währende Zeit! Nie habe ich darüber nachgedacht, als ich noch am Leben war; ich ging meiner Wege und weilte im Licht zwischen den beiden Zeiten der Dunkelheit.
Ich war glücklich, muß glücklich gewesen sein, das begreife ich jetzt. Meine Goldverzierungen waren die besten in der Werkstatt unseres Padischahs, und keiner der anderen Vergolder konnte es mit mir aufnehmen in dieser Meisterschaft. Zusammen mit solchen Arbeiten, die man mir noch außerhalb der Werkstatt gab, bekam ich hundert Asper im Monat auf die Hand. Dies alles macht meinen Tod natürlich noch unerträglicher.
Mir oblag nur das Ornamentieren und das Vergolden. Ich schmückte die Seitenränder, setzte Farbiges in den Rahmen, zeichnete bunte Blätter, Blüten, Zweige, Rosen und Vögel ein. Wolkenkringel im chinesischen Stil, dicht deckendes Blattwerk, bunte Wälder mit darin verborgenen Antilopen, Galeeren, Sultane, Bäume, Paläste, Pferde, Jäger … Früher hatte ich hin und wieder das Innere eines Tellers ausgeschmückt, manchmal die Rückseite eines Spiegels oder die Hohlseite eines Löffels, manchmal die Zimmerdecke einer Villa am Ufer des Bosporus oder auch die eines Landhauses, manchmal auch eine Truhe … In den letzten Jahren jedoch habe ich nur an Buchseiten gearbeitet, weil unser Sultan für Bücher mit Bildern viel Geld bezahlte. Daß ich begriffen hätte, als mir der Tod begegnete, wie unwichtig das Geld im Leben ist, kann ich nicht sagen. Die Bedeutung des Geldes ist dem Menschen auch dann noch bewußt, wenn er das Leben verloren hat.
Was ihr jetzt erlebt, ist ein Wunder, denn ihr könnt meine Stimme trotz meines Zustandes vernehmen, und ich weiß, ihr werdet nun folgendes denken: Laß das im Leben erworbene Geld! Beschreibe, was dir dort widerfährt. Was kommt nach dem Tod, wo ist deine Seele, wie sind sie, Paradies und Hölle, was siehst du dort? Wie ist das Sterben, hast du Schmerzen? Ihr habt recht. Ich weiß ja, daß der Mensch im Leben nur allzugern erfahren möchte, was im Jenseits vor sich geht. Erzählt man doch eine Geschichte von einem, der nur dieser Wißbegier wegen auf blutigen Schlachtfeldern zwischen den Leichen umhergewandert ist … Dieser Mann, der meinte, unter den sterbenden Kriegern vielleicht einen zu finden, der nach dem Hinscheiden wieder zum Leben erwacht war und ihm die Geheimnisse der anderen Welt verraten könnte, wurde von Timurs Soldaten als Feind betrachtet und deswegen mit einem Schwerthieb in zwei Teile gespalten, so daß er am Ende glaubte, die Menschen seien zweigeteilt in der anderen Welt.
Nichts dergleichen.Mehr noch, ich kann euch sagen, daß hier sogar die im Diesseits zwiegespaltenen Seelen wieder eins geworden sind. Im Gegensatz zu dem aber, was die Gottlosen, Ungläubigen, Ketzer und dem Teufel ergebenen Lästermäuler behaupten, gibt es ein Jenseits, Allah sei Dank. Daß ich von dort zu euch spreche, ist der Beweis dafür. Gestorben bin ich, doch nicht verschwunden, wie ihr seht. Andererseits muß ich zugeben, daß mir nirgendwo eins der goldenen oder silbernen Paradiesschlößchen über fließenden Wassern oder die Bäume mit riesigen Blättern und prallen Früchten oder die schönen Jungfrauen begegnet sind, von denen der Koran spricht. Indessen erinnere ich mich jetzt sehr wohl daran, wie oft und mit welchem Vergnügen ich die großäugigen Huris im Paradies gezeichnet habe, welche die Sure Al-Wakiah beschreibt. Natürlich konnte ich ebensowenig irgendwo jene vier Flüsse aus Milch, Wein, süßem Wasser und Honig ausmachen, die so große Phantasiebegabte wie Ibn Arabi in den verlockendsten Farben geschildert haben. Da ich die vielen Menschen, die zu Recht in ihren hoffnungsvollen Vorstellungen von der anderen Welt leben, nicht zum Unglauben verleiten will, muß ich sofort darauf verweisen, daß all diese Dinge mit meiner besonderen Lage zusammenhängen: Jeder gläubige Moslem, der ein wenig Wissen über das Leben nach dem Tode besitzt, wird mir zustimmen, daß ein Friedloser wie ich in meinem Zustand sich schwertut, die Ströme des Paradieses zu gewahren.
Kurz, ich, den man unter den Meistern der Malertruppe als Fein Efendi kennt, bin gestorben, aber nicht begraben. Deswegen konnte meine Seele meinen Körper nicht ganz und gar verlassen. Damit sich meine Seele – was immer ihr Schicksal sei – zum Paradies oder der Hölle begeben kann, muß ihr zunächst gelingen, aus dem Unrat meiner Körperhülle zu schlüpfen. Meine ungewöhnliche Lage, in die allerdings auch andere geraten, bereitet meiner Seele schreckliche Pein. Daß mein Schädel zertrümmert ist, mein Körper halb im eisigen Wasser mit gebrochenen Gliedern und voller Wunden verwest, fühle ich nicht, doch ich empfinde die tiefe Qual meiner Seele, die darum ringt, meinen Körper zu verlassen. Die ganze Welt, eingezwängt in mein Inneres, scheint mir enger und enger zu werden.
Dieses Gefühl zunehmender Enge läßt sich nur mit dem jener erstaunlichen Weite vergleichen, das ich in dem beispiellosen Augenblick des Todes empfand. Als mein Schädel so plötzlich von der Seite her durch den Stein getroffen und zertrümmert wurde, begriff ich zwar sofort die mörderische Absicht des gemeinen Kerls, konnte aber nicht glauben, daß es ihm gelingen würde. Ich muß voller Hoffnung gewesen sein, doch ist mir dies wohl nicht bewußt geworden in dem schattenhaften Dasein zwischen der Werkstatt und meinem Haus. Mit jedem Nagel meiner Finger und mit den Zähnen, die daran nagten, habe ich leidenschaftlich am Leben gehangen. Doch ich möchte euch mit dem Schmerz, den mir die weiteren Schläge auf meinen Kopf bereitet haben, nicht weiter langweilen.
Als mir voller Trauer bewußt wurde, daß ich sterben mußte, weitete sich mein Inneres auf unglaubliche Weise. Den Augenblick des Übergangs erlebte ich im Gefühl dieser Weite: So sanft war meine Ankunft hier, als sähe man sich schlafend im eigenen Traum. Mein letzter Blick erfaßte die schnee- und schmutzbedeckten Schuhe meines Mörders. Ich habe meine Augen wie im Schlaf geschlossen und bin auf angenehme Weise im Jenseits angelangt.
Nicht, daß mir die Zähne wie Kichererbsen aus dem blutigen Mund gefallen sind, daß mein Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zerquetscht wurde oder daß ich eingeklemmt am Grund eines Brunnens liegengeblieben bin, gibt mir jetzt Grund zur Klage, sondern daß man glaubt, ich sei noch am Leben. Es peinigt meine ohnehin ruhelose Seele, daß meine Lieben ständig an mich denken und sich vorstellen, ich sei immer noch in irgendeinem Winkel von Istanbul mit einer dummen Sache beschäftigt, ja sogar, ich liefe einer anderen Frau hinterher. Soll man doch schleunigst meine Leiche finden, das Totengebet sprechen, mich aufheben, forttragen und endlich begraben! Noch wichtiger aber – man entdecke meinen Mörder! Sei das Grab, in das man mich legt, noch so prächtig, so sollt ihr doch wissen, daß ich mich friedlos darin drehen und wenden und euch dazu bringen werde, die eigene Glaubenstreue in Zweifel zu ziehen, solange jener gemeine Kerl nicht ertappt wird. Findet den Hurensohn, meinen Mörder, dann werde ich euch in allen Einzelheiten erzählen, was ich zu sehen bekomme in der anderen Welt! Doch wenn der Mörder gefunden ist, müßt ihr ihn im Schraubstock foltern, acht bis zehn seiner Knochen knirschend brechen, vorzugsweise die der Brust, dann seine Kopfhaut mit den Spießen, die für diese Folter eigens gemacht sind, durchlöchern, ihn schreien lassen und seine ekelhaften, fettigen Haare einzeln ausrupfen.
Wer ist mein Mörder, gegen den ich eine solche Wut empfinde, und warum hat er mich auf diese gänzlich unerwartete Weise umgebracht? Versucht es herauszufinden! Die Welt ist voller gemeiner Mörder, die alle nichts taugen, der eine wie der andere, was soll’s, sagt ihr? Dann will ich euch sogleich warnen: Hinter meinem Tod steht eine widerwärtige Verschwörung gegen unseren Glauben, unsere Tradition und unsere Art, die Welt zu sehen. Öffnet eure Augen, erkundet, warum die Feinde des Islam, die Feinde jenes Lebens, an das ihr glaubt, mich umbrachten und eines Tages auch euch umbringen könnten. All die Worte des großen Predigers und Hodschas, Nusret von Erzurum, denen ich mit Tränen in den Augen gelauscht habe, bewahrheiten sich eins nach dem anderen. Selbst die größten Meister unter den Illustratoren würden nicht einmal in Bildern wiedergeben können, was uns geschieht, wenn man es als Geschichte in einem Buch niederschriebe, das laßt euch gesagt sein. Die erschütternde Kraft eines solchen Buches kommt genau wie beim Koran – Allah bewahre uns vor einem Mißverständnis! – aus der Art seiner Entstehung, die niemals in Bildern wiedergegeben werden kann. Ich zweifle, ob ihr imstande seid, das zu begreifen.
Seht ihr, auch ich fürchtete mich in der Zeit meiner Lehre vor der Stimme, die aus den Tiefen der Wahrheit, aus dem Jenseits kam, achtete aber nicht darauf, machte mich lustig darüber. Ich fand mein Ende am Boden dieses elenden Brunnens. Das gleiche kann auch euch geschehen, seid wachsam! Nun kann ich nichts weiter tun als hoffen, daß man mich vielleicht durch den eklen Geruch der Fäulnis findet, wenn ich so recht in Verwesung übergehe; und mir außerdem die Foltern vorzustellen, die ein Wohlmeinender an meinem gemeinen Mörder vornehmen wird, wenn man ihn gefunden hat.
2Mein Name ist Kara
Meine Ankunft in Istanbul, der Stadt, in der ich geboren wurde und aufgewachsen bin, hatte jetzt, nachdem ich zwölf Jahre fortgewesen war, der eines Schlafwandlers geglichen. Die Heimaterde ruft, sagt man von dem, der dem Tode nahe ist, auch mich hat der Tod gerufen. Nur Sterben sei hier, dachte ich zuerst, als ich den städtischen Boden betrat, dann begegnete mir die Liebe. Doch die Liebe war in jenem ersten Augenblick der Ankunft so weit entfernt und vergessen wie meine Erinnerungen an Istanbul. Zwölf Jahre zuvor hatte ich mich in die Tochter meiner Tante verliebt, die damals noch im Kindesalter gewesen war.
Während ich im Land der Perser durch endlose Steppen, schneebedeckte Gebirge und trostlose Städte reiste, Briefe überbrachte oder Steuern eintrieb, hatte ich bereits vier Jahre nach meinem Abschied von Istanbul bemerkt, wie das Antlitz meiner kindlichen Geliebten in meinem Gedächtnis allmählich verblaßte. Ich war verwirrt und versuchte mit größter Mühe, mich ihrer Züge zu erinnern, begriff jedoch, daß ein Gesicht, das man niemals mehr betrachtet, langsam in Vergessenheit geraten muß. Im sechsten jener Jahre im Osten, die ich als Schreiber und Reisender im Dienste einiger Paschas verbrachte, wurde mir endgültig klar, daß die Züge, die ich in meiner Phantasie zum Leben erweckte, nicht mehr die meiner Istanbuler Geliebten waren. Desgleichen wußte ich, daß mir im achten Jahr auch die falsche Erinnerung des sechsten Jahres entfallen war und mir mein Gedächtnis wieder etwas ganz anderes vorspielte. Als ich zwölf Jahre später, sechsunddreißig Jahre alt, in meine Stadt zurückkehrte, wurde mir schmerzlich bewußt, wie sehr und wie lange schon ich das Antlitz meiner Geliebten vergessen hatte.
Viele meiner Freunde, Verwandten und Bekannten aus meinem Viertel waren verstorben in diesen zwölf Jahren. Ich suchte den Friedhof auf, der auf das Goldene Horn hinunterschaut, und sprach Gebete für meine Mutter und meine Onkel, die während meiner Abwesenheit das Zeitliche gesegnet hatten. Der Geruch schlammiger Erde mischte sich unter meine Erinnerungen; an der Umrandung vom Grab meiner Mutter hatte jemand einen Krug zerbrochen, und beim Anblick der Scherben begann ich, warum auch immer, zu weinen. Ich weiß nicht, ob ich um die Toten weinte oder weil ich nach so vielen Jahren seltsamerweise noch immer am Beginn meines Lebens stand oder weil ich im Gegenteil ahnte, daß ich am Ende meiner Lebensreise angekommen war? Es hatte fast unmerklich zu schneien begonnen. Ich war in die vereinzelt umherwirbelnden Flocken eingetaucht und hatte in der Ungewißheit meines Lebens meinen Weg verloren, als ich bemerkte, daß mich ein finster aussehender Hund aus einer finsteren Ecke des Friedhofes beobachtete.
Meine Tränen versiegten, ich wischte mir die Nase. Der schwarze Hund wedelte freundlich mit dem Schwanz, und ich verließ den Friedhof. Danach mietete ich ein Haus, das früher von einem meiner väterlichen Verwandten bewohnt worden war, und ließ mich in dem Viertel nieder. Die Hausbesitzerin gemahnte ich an ihren Sohn, der im Krieg von safawidischen Soldaten getötet worden war. Sie würde für mein Wohlergehen sorgen und mir die Mahlzeiten zubereiten.
Ich verließ das Haus, irrte lange durch die Straßen, als sei es nicht Istanbul, sondern eine der Städte Arabiens am anderen Ende der Welt, ein vorübergehender Aufenthaltsort, den ich erkunden wollte. Waren die Straßen enger geworden, oder schien es nur so? An manchen Stellen, wo sie zwischen langen Häuserreihen von hüben und drüben eingeklemmt waren, mußte ich mich dicht an Türen und Wänden vorbeidrängen, um den Lastpferden auszuweichen. Waren die Reichen zahlreicher geworden, oder war auch dies nur scheinbar so? Ich sah einen prunkvollen Wagen, wie es ihn weder in Arabien noch im Land der Perser gab, er glich einer stolzen, von Pferden gezogenen Burg. Beim Çemberlitaş, der Verbrannten Säule, sah ich in Lumpen gehüllte, dreiste Bettler, die sich unter dem üblen Geruch, der vom Hühnermarkt herüberwehte, aneinanderdrängten. Einer war blind, er lächelte und starrte in den fallenden Schnee.
Vielleicht wollte ich’s nicht wahrhaben, wenn es hieß, früher sei Istanbul ärmer, kleiner und glücklicher gewesen, doch ich wußte es mit dem Herzen. Denn das Haus meiner Geliebten, die ich hier zurückgelassen hatte, stand noch immer an seinem Platz unter Linden und Kastanienbäumen, doch wohnte nun jemand anders hier, wie ich an der Tür zu hören bekam. Die Mutter meiner Geliebten, meine Tante, sei gestorben, der Onkel sei mit seiner Tochter verzogen und die Familie habe einiges Unheil ertragen müssen, sagten mir die neuen Bewohner, ohne zu merken, wie erbarmungslos sie das Herz und die Wunschträume eines anderen Menschen zerbrachen. Jetzt will ich aber nicht weiter darauf eingehen, will nur sagen, daß an den Zweigen der Linde in dem alten Garten Eiszäpfchen hingen, so groß wie mein kleiner Finger, und daß der Garten, der an sonnenwarme Sommertage und tiefes Grün erinnerte, den Menschen nun in seiner Trauer, Vernachlässigung und seiner Schneedecke an den Tod denken ließ.
Durch einen Brief, den mir mein Oheim nach Täbris geschickt hatte, war ich ohnehin schon über das Schicksal meiner Verwandten unterrichtet. Mit jenem Brief hatte mich der Oheim nach Istanbul gerufen, da er an einem geheimen Buch im Auftrag unseres Padischahs arbeitete und wünschte, daß ich ihm dabei half. Man habe ihm gesagt, ich sei während meiner Zeit in Täbris von osmanischen Paschas und Walis und von Bestellern aus Istanbul um die Anfertigung von Büchern gebeten worden. Tatsächlich hatte, wer von mir Bücher erwünschte, vorher zahlen müssen, dann war ich in Täbris auf die Suche nach jenen Illustratoren und Kalligraphen gegangen, die noch nicht aus Überdruß an den Kriegen und den osmanischen Soldaten von hier nach Kazvin oder einer anderen persischen Stadt geflohen waren, und hatte von den großen Meistern, die über Geldnot und Hintansetzung klagten, Bücher schreiben, illustrieren und binden lassen und diese Werke dann nach Istanbul auf den Weg gebracht. Ohne die Liebe zur Malerei und zu schönen Büchern, die mir der Oheim in meiner Jugend eingab, hätte ich mich auf diese Tätigkeit niemals eingelassen.
Der Barbier am Ende der zum Markt führenden Straße, in der mein Oheim einmal gewohnt hatte, war noch immer Meister in seinem Laden zwischen den gleichen Spiegeln, Rasiermessern, Schnabelkännchen und den Fäden aus Seife. Unsere Augen begegneten sich, doch weiß ich nicht, ob er mich erkannte. Es machte mir Freude, daß die Schüssel für die Haarwäsche, die er mit heißem Wasser füllte, am Ende ihrer Kette von der Decke schaukelnd noch immer den gleichen Bogen beschrieb.
Manche der Viertel, manche der Straßen, die ich in meiner Jugend durchstreift hatte, waren in Rauch aufgegangen, zu Asche verbrannt und verweht, es gab Brandlücken, wo einem die Hunde den Weg verstellten und die Irren den Kindern Angst einjagten, an manchen Stellen wieder hatten Reiche ihre Landhäuser errichtet, die einen wie mich, der aus der Ferne kam, in Erstaunen versetzten. Darunter waren einige mit den teuersten bunten Fenstern aus venezianischem Glas. An den über hohen Mauern vorspringenden Erkern konnte ich sehen, daß während meiner Abwesenheit viele von Wohlhabenheit zeugende zweistöckige Häuser errichtet worden waren.
Wie in so mancher anderen Stadt hatte das Geld auch in Istanbul seinen Wert ganz und gar verloren. Die Backstuben, die zur Zeit meiner Fahrt nach Osten für einen Asper ein riesengroßes, vierhundert Dirhem schweres Brot verkauft hatten, gaben jetzt für das gleiche Geld lediglich ein halb so großes Brot, dessen fader Geschmack außerdem nicht im geringsten an die Kindheit erinnerte. Wenn meine selige Mutter erlebt hätte, daß man für ein Dutzend Eier drei Asper hergeben mußte, wäre sie wohl der Meinung gewesen, die Hühner seien unverschämt und wir sollten schleunigst in eine andere Gegend ziehen, bevor sie uns auf den Kopf schissen, doch ich wußte recht gut, daß diese Münzen von minderem Wert überall im Umlauf waren. Wie man sich erzählte, kam dieses Falschgeld kistenweise mit den Handelsschiffen aus Holland und Venedig. Während früher in der Münzanstalt aus hundert Dirhem Silber fünfhundert Asper geprägt wurden, hatte man nun wegen der nicht enden wollenden Kriege gegen die Safawiden begonnen, achthundert Asper daraus zu prägen. Die Janitscharen sollen sich empört und das Saray unseres Padischahs wie eine feindliche Festung belagert haben, als sie sehen mußten, daß einige Asper ihrer Löhnung ins Goldene Horn fielen und wie weiße Bohnen, die man vom Gemüsesteg ins Meer schüttet, auf dem Wasser schwammen.
Ein Geistlicher namens Nusret, der in der Beyazıt-Moschee predigte und behauptete, ein Nachkomme aus dem Geschlecht des Propheten Mohammed zu sein, hatte sich aus Anlaß der allseits herrschenden Unmoral, der Teuerung, des Raubes und des Mordes einen großen Ruf erworben. Sämtliche Katastrophen, von denen Istanbul in den letzten zehn Jahren heimgesucht worden war, wie die Brände der Viertel Bahçekapı und Kazancılar, die immer wiederkehrende Pest, die jedesmal Zehntausende von Toten in der Stadt hinterließ, der Krieg gegen die Safawiden, der trotz seiner zahllosen Menschenopfer bisher kein Ergebnis gebracht hatte, und im Westen die Rückeroberung kleinerer türkischer Festungen durch aufständische Christen, all das begründete der Erzurumi genannte Prediger damit, daß man vom Wege des Propheten Mohammed abgewichen sei, sich von den Weisungen des Korans entfernt habe, den Christen gegenüber zuviel Nachsicht zeige, ganz offen Wein verkaufe und in den Derwischkonventen Musik mache.
Der Essiggemüsehändler, der begeistert war von dem Prediger aus Erzurum und mir diese Neuigkeiten erzählte, meinte, das Falschgeld, das überall auf den Märkten im Umlauf sei, die neuen Dukaten, die Florinen mit Löwenbild und die Asper mit immer weniger Silbergehalt würden den Menschen ebenso wie die alle Straßen füllenden Tscherkessen, Abchasen, Mingrelier, Bosnier, Georgier und Armenier unweigerlich in eine Verruchtheit treiben, von der man sich kaum mehr abwenden könne. Liederjane und Aufrührer träfen sich in den Kaffeehäusern, zerrissen sich die Mäuler bis zum Morgen. Kahlköpfige Halbnackte, opiumsüchtiges Narrenvolk, die Überreste der Kalenderi-Derwische, die alle vorgaben, dies sei der Weg Allahs, würden in ihren Konventen bis in den Morgen hinein zur Musik tanzen, sich hier und da mit Spießen durchstechen, und nachdem sie jede Art von Unanständigkeit begangen hätten, würden sie miteinander schlafen und es auch mit kleinen Buben treiben.
Ob ich den weichen Laut einer Ud hörte und ihm nachgehen wollte oder mir der giftige Essiggemüsehändler unerträglich wurde und mich die Wünsche und Erinnerungen genannte Wirrnis meines Verstandes einen Ausweg spüren ließ, weiß ich nicht genau. Doch ich weiß, daß nicht nur eure Seele, sondern auch euer Körper die Straßen einer euch am Herzen liegenden Stadt, die ihr oft durchstreift habt, noch viele Jahre später so gut kennt, daß eure Füße in einem Augenblick der Trauer bei dichtem, trübsinnigem Flockenfall ganz von selbst zu einer Anhöhe gelenkt werden, die ihr liebt.
So verließ ich den Hufschmied-Markt und schaute gleich neben der Süleymaniye-Moschee dem ins Goldene Horn fallenden Schnee zu: Auf den nach Norden schauenden Dächern und Kuppeln hatte sich an den vom Nordost getroffenen Kanten und Rändern der Schnee bereits festgesetzt. Die Segel eines einlaufenden Schiffes, so neblig bleigrau wie die Wasser des Goldenen Horns, sandten mir beim Einholen knatternd ihre Grüße zu. Zypressen und Platanen, der Anblick der Dächer, die wehmütige Abendstimmung, die Laute aus den unter mir liegenden Vierteln, die Rufe der Händler und das Geschrei spielender Kinder im Hof der Moschee – all das verschmolz in meinem Kopf und ließ mich ohne das geringste Erstaunen wissen, daß ich mein weiteres Leben nirgendwo anders als in dieser Stadt verbringen könnte. Einen Atemzug lang meinte ich, das seit Jahren vergessene Antlitz meiner Geliebten würde vor meinen Augen wiedererstehen.
Ich ging den Abhang hinunter, mischte mich unter die Menge. Nach dem Ruf zum Abendgebet aß ich mich in einer Innereienküche an Leber satt. In dem sonst leeren Laden hörte ich mir aufmerksam an, was der Besitzer erzählte, während er mir die Bissen liebevoll in den Mund zählte, als füttere er eine Katze. Nachdem es draußen auf den Straßen gänzlich dunkel geworden war, folgte ich seiner Anregung und bog in eine der engen Gassen hinter dem Sklavenmarkt ein und fand das beschriebene Kaffeehaus.
Drinnen war es voll und heiß. Ein Geschichtenerzähler, wie ich viele dieser Art in den persischen Städten gesehen hatte und wo sie nicht meddah, sondern perdedar hießen, saß auf einem erhöhten Platz neben dem Herd im Hintergrund und hatte ein Bild von einem Hund aufgehängt, das auf grobem Papier eilig hingeworfen, doch mit großem Talent gezeichnet worden war. Hin und wieder zeigte er auf den Hund und ließ seine Geschichte aus dem Maul des Tieres hören.
3Ich, der Hund
Wie ihr seht, sind meine Reißzähne so spitz und lang, daß sie kaum Platz finden in meinem Maul. Das gibt mir ein furchterregendes Aussehen, ich weiß, doch es gefällt mir. Einmal hat ein Fleischer die Größe meiner Zähne beachtet und gemeint: »Meine Güte, das ist kein Hund, das ist ein Schwein!«
Den habe ich so ins Bein gebissen, daß ich an den Spitzen meiner Zähne die Härte des Schenkelknochens gleich unterhalb vom Sitzfleisch spüren konnte. Nichts ist so ergötzlich für einen Hund, wie seine Zähne voller Wut und Begierde in das Fleisch eines gemeinen Feindes zu schlagen. Wenn sich mir eine solche Gelegenheit bietet und mein zu beißendes Opfer stupide an mir vorbeitrottet, dann wird mir schwarz vor Augen vor lauter Lust, meine Zähne schmerzen, und ganz unwillkürlich dringt das für euch so furchteinjagende Knurren aus meiner Kehle hervor.
Ich bin ein Hund, und da ihr nicht so vernünftige Wesen seid wie ich, fragt ihr, wie kann ein Hund sprechen! Andererseits aber scheint ihr einer Geschichte Glauben zu schenken, in der die Toten sprechen und die Helden nie gewußte Wörter gebrauchen. Hunde sprechen, aber zu dem, der hören kann.
Es war einmal vor langer Zeit, als ein ungehobelter Prediger aus einer Provinzstadt an eine der größten Moscheen der Residenz kam, sagen wir einmal, sie hieß Beyazıt-Moschee. Man sollte seinen Namen vielleicht verheimlichen und ihn zum Beispiel Husret Hodscha nennen, doch was soll man weiter lügen – er war ein dickköpfiger Mann, dieser Prediger. Wenn auch sein Verstand keinen Deut wert war, so besaß doch seine Zunge, maşallah!, um so mehr an Kraft. An jedem Freitag erschütterte er die Gemeinde so sehr, brachte sie so stark zum Weinen, daß es manchen Leuten schließlich an Tränen gebrach und sie in Ohnmacht fielen. Versteht mich bitte nicht falsch. Er selbst weinte nie, wie andere wortgewaltige Prediger, im Gegenteil, er zuckte nicht mit der Wimper, wenn alle anderen weinten, und seine Art, so zu reden, als rüge er die Gemeinde, steigerte noch seine Macht. Sie mußten es wohl mögen, gerügt zu werden, all die Leibgardisten, Palastpagen, Halwa-Köche, die Menge des gemeinen Volkes und Prediger seinesgleichen, denn sie hingen alle in sklavischer Ergebenheit an diesem Mann. Nun ja, ein Hund war er nicht, er war ein ganz gewöhnliches Menschenkind, und angesichts der bewundernden Menge kam er so recht von Sinnen und fand auf einmal nicht nur daran Geschmack, die Gemeinde zum Weinen zu bringen, sondern sie auch das Fürchten zu lehren. Das brachte außerdem mehr Gewinn, so daß er am Ende jedes Maß verlor und sich zu folgender Rede hinreißen ließ:
Der einzige Grund für die Teuerung, die Pest und die Niederlagen sei darin zu suchen, daß wir den Islam aus der Zeit unseres Propheten vergessen hätten, von anderen Büchern und Lügen verleitet wären und im Namen des Islam daran glaubten. Eine Seelenmesse lesen, gab es das zur Zeit des Propheten Mohammed? Gab es die Totenfeier nach vierzig Tagen, gab es Halwa und Krapfenbacken? Hat man den Koran zur Zeit des Propheten Mohammed nach Takt und Melodie gesungen? Gab es das, aufs Minarett zu steigen und sich hochnäsig aufgeblasen etwas auf seine ach so schöne Stimme und sein ach so arabisches Arabisch einzubilden und wie ein Jüngling im Weiberrock mit tänzelnd koketter Stimme melodisch zum Gebet zu rufen? Sie laufen zum Friedhof, flehen die Toten an und erhoffen sich Beistand von ihnen, sie laufen zu den Türben und beten wie Götzendiener den Stein an, hängen Fetzen auf, geloben dies und das. Gab es Sektenanhänger zur Zeit des Propheten Mohammed, die solche klugen Lehren erteilten? Ibn Arabi, der weise Lehrer der Sektenbrüder, hat sich versündigt, als er schwor, der Pharao sei gläubig gestorben. Mewlewi, Halweti, Kalenderi, all diese Sektierer, die Instrumente schlagend den Koran lesen, jene, die sich verzückt im Tanze wiegen und drehen und meinen, so beten wir gemeinsam mit den Knaben, sie alle sind Ungläubige. Niederreißen muß man ihre Stätten, sieben Ellen tief die Fundamente ausgraben und die Erde, die zutage kommt, ins Meer schütten, so daß man danach an solchem Ort das Gebet verrichten kann.
Dann sei dieser Husret Hodscha noch zügelloser geworden und habe sabbernd und speichelsprühend verkündet: Kaffee zu trinken ist Sünde, o ihr Gläubigen! Unser Prophet und Heiliger hat gewußt, daß Kaffee den Verstand benebelt, den Magen durchlöchert, Kreuzweh hervorbringt und unfruchtbar macht, er hat verstanden, daß der Teufel damit sein Spiel treibt, und sich deshalb des Kaffees enthalten. Außerdem sind heutzutage die Kaffeehäuser nur Plätze für Genießer, für die vergnügungssüchtigen Reichen, die Knie an Knie zusammenhocken und Sittenlosigkeiten jeder Art begehen, und überhaupt müßte man die Kaffeehäuser noch vor den Sektenhäusern schließen. Hat der arme Mann wohl Geld, um Kaffee zu trinken? Sie gehen ins Kaffeehaus, der Kaffee steigt ihnen zu Kopf, und sie lassen sich so weit gehen, daß sie zuhören und alles für wahr halten, was ihnen irgendein gemeiner Hund vorschwatzt; ein Hund ist das, seht, er beschimpft mich und unseren Glauben! – so des Husret Hodscha Rede.
Mit eurer Erlaubnis möchte ich auf die letzten Worte dieses Herrn Predigers eine Antwort geben. Ihr wißt natürlich, daß die ganze Schar der Pilger, Hodschas, Prediger und Imams nicht das geringste für uns Hunde übrig hat. Wenn’s nach mir geht, hängt die Sache damit zusammen, daß der Prophet Mohammed ein Stück von seinem Rock abgeschnitten hat, um eine Katze nicht zu wecken, die auf seinem Schoß eingeschlafen war. Man möchte also darauf verweisen, daß dieses noble Verhalten der Katze gegenüber für uns nicht gilt, und sagen, daß der Gesandte Gottes wegen unseres ewigen Krieges gegen dieses Geschöpf, dessen Undankbarkeit doch dem dümmsten Menschen bekannt ist, eine Feindschaft gegen uns Hunde hegt. Wir würden die Reinheit nach der Waschung wieder beschmutzen, heißt es, weswegen wir von den Moscheen ferngehalten werden, und daß uns die Diener aus deren Höfen seit Jahrhunderten mit dem Besenstiel hinausprügeln, ist das Ergebnis dieser falschen Deutung.
Ich möchte euch an die Sure Al-Kahf, eine der schönsten Suren des Korans, erinnern. Nicht der Unwissenden wegen, die sich unter uns in diesem schönen Kaffeehaus befinden und des Korans unkundig sind, sondern einfach nur, um euer Gedächtnis aufzufrischen. Diese Sure spricht von sieben Jünglingen, die es leid waren, unter den Götzendienern zu leben. Sie ziehen sich in eine Höhle zurück und schlafen ein. Allah versiegelt ihre Ohren, und sie liegen dreihundert Jahre lang im Schlummer. Als sich nach ihrem Wiedererwachen einer der sieben Jünglinge unter die Menschen mischt und eine Münze vorweist, die schon lange nicht mehr gängig ist, erfahren sie, wie lange sie geschlafen haben, und sind höchst erstaunt. Ich möchte euch, auch wenn es mir kaum zusteht, daran erinnern, daß im achtzehnten Vers dieser Sure, die von der Verbundenheit des Menschen mit Allah, von seinen Wundern, von der Flüchtigkeit der Zeit und von der Süße eines tiefen Schlafes spricht, auch von einem Hund die Rede ist, der am Eingang der Höhle namens Ashabi Kahf liegt, in der die sieben Jünglinge schlafen. Natürlich, jeder kann stolz darauf sein, wenn sein Name im Koran erwähnt wird. Als ein Hund bin ich stolz auf diese Sure und sage meinen Feinden, dies wird hoffentlich den Erzurumern, die von dreckigen Kötern reden, den Verstand zurechtrücken.
Worin liegt dann die eigentliche Bedeutung dieser Feindschaft gegen die Hunde? Warum behauptet ihr, der Hund sei unrein, und wenn ein Hund euer Haus betritt, warum wischt ihr dann alles von oben bis unten dreimal hintereinander mit reinem Wasser? Warum wird jemand nach seiner Waschung vor dem Gebet durch unsere Berührung wieder unrein, und warum gibt es die Vorschrift, euren Kaftan wie kopflos grillenhaftes Weibervolk siebenmal zu waschen, wenn die feuchten Haare eines Hundes am Saum jenes Kaftans eben einmal entlangstreichen? Und die Lüge, daß ein Topf, den ein Hund ausgeleckt hat, entweder fortgeworfen oder von neuem verzinnt werden muß, kann nur von den Verzinnern herumerzählt werden. Oder vielleicht von den Katzen.
Als man Dorf und Land und das Nomadenleben aufgab und sich in der Stadt niederließ, blieben die Hirtenhunde im Dorf zurück, und da sind wir Hunde unrein geworden. In der Zeit vor dem Islam war einer der zwölf Monate der des Hundes. Jetzt aber gilt der Hund als unheilbringend. Ich will euch, meine Freunde, die ihr an diesem Abend ein wenig Geschichten hören, ein wenig belehrt werden möchtet, nicht mit meinen Sorgen bekümmern; was mich erzürnt, ist das Räsonieren des Herrn Predigers, der unsere Kaffeehäuser schlechtmacht.
Was käme dabei heraus, wenn ich sage, niemand weiß, wer wohl der Vater von diesem Husret aus Erzurum ist? Man fragt ja auch, was für ein Hund bist du? Weil dein Meister ein meddah ist, der dein Bild in einem Kaffeehaus aufgehängt hat und Geschichten erzählt, willst du ihn schützen und machst den Herrn Prediger schlecht, pfui! Aber keineswegs, ich mache niemanden schlecht. Ich liebe unsere Kaffeehäuser sehr, und ihr sollt wissen, es kümmert mich auch wenig, daß mein Bild auf so billiges Papier aufgemalt wurde oder daß ich ein Hund bin, doch ich beklage mich darüber, nicht wie ein ordentlicher Mensch mit euch zusammensitzen und Kaffee trinken zu können. Unsereins gibt sein Leben für unseren Kaffee und für unsere Kaffeehäuser – nanu, was ist das? Seht mal her, mein Meister gießt mir Kaffee aus einem Töpfchen ein. Sagt nicht, wie kann ein Bild denn Kaffee trinken? Seht nur, seht, wie der Hund den Kaffee hinunterschlabbert!
Oh, meine Güte, hat mir das gutgetan, mir ist warm geworden, mein Blick ist klar, mein Verstand geschärft, und hört mal, was mir eingefallen ist: Wißt ihr eigentlich, was der Doge von Venedig der Tochter Seiner Majestät, unseres Padischahs, der Nurhayat Sultan, außer vielen Ballen chinesischer Seide und blaugeblümten chinesischen Tonschüsseln als Geschenk übersandt hat? Einen reizenden abendländischen Hund mit seidigem Fell, weicher als ein Zobel. Dieser Hund ist so zart und empfindlich, daß er ein Kleid aus roter Seide trägt. Einer unserer Freunde hat’s ihm besorgt, daher weiß ich, daß dieser Hund sogar den Beischlaf nicht ohne sein Kleidchen ausüben kann. In diesem Land der Franken tragen ohnehin alle Hunde Kleider. Wenn dort eine dieser so überaus vornehmen fränkischen Frauen einen nackten Hund oder etwa, ich weiß nicht, sein Ding zu sehen bekommt, dann soll sie mit dem Ausruf: »Ooh, das Tier ist ja nackt!« in Ohnmacht sinken, wie man sich erzählt.
Außerdem soll jeder Hund in dem fremden Land der Ungläubigen einen Besitzer haben. Mit einer Kette um den Hals werden sie wie die elendesten Sklaven gefesselt und jeder für sich durch die Straßen geschleppt und spazierengeführt. Dann holen diese Leute die armen Hunde gewaltsam ins Haus, ja, nehmen sie sogar mit ins Bett. Einmal abgesehen davon, daß kein Hund den anderen beschnüffeln und mit ihm Liebe treiben darf, läßt man sie nicht einmal zu zweit herumlaufen. Wenn sie sich so elend und gefesselt auf der Straße begegnen, können sie einander nur von weitem gramerfüllte Blicke zuwerfen, mehr nicht. Daß wir Hunde in den Straßen von Istanbul als Meute und gemeinsam frei herumstreichen, keinen Herrn und Besitzer anerkennen und, falls nötig, irgendwem den Weg abschneiden, uns in einer warmen Ecke zusammenrollen, wo’s uns paßt, uns im Schatten einem sanften Schlummer überlassen, daß wir hinscheißen, wo wir wollen, und beißen, wen wir beißen wollen – das sind Dinge, die den Ungläubigen nicht in den Kopf gehen. Ich habe schon gedacht, ob die Bewunderer des Erzurumers womöglich aus diesem Grund dagegen sind, daß man als Almosen und mit Gebeten den Hunden auf den Straßen von Istanbul Fleisch zuwirft und dafür auch Stiftungen gründet. Falls es in deren Absicht liegt, außer der feindlichen Haltung gegen die Hunde auch noch barbarisch zu sein, so muß ich sie daran erinnern, daß Feindschaft gegen das Hundevolk ohnehin nichts weiter als reine Barbarei ist. Und bei der hoffentlich nicht allzu fernliegenden Hinrichtung dieser Schufte werden uns die Scharfrichter, unsere Freunde, herbeirufen, wie sie es manches Mal als lehrreiches Beispiel tun, damit wir unseren Anteil zu fressen bekommen.
Dies möchte ich noch als letztes sagen: Mein vorheriger Efendi war ein sehr gerechter Mann. Wenn wir nachts auf Raub ausgingen, haben wir uns die Arbeit geteilt. Er schnitt dem Opfer die Kehle durch, sowie ich zu bellen begann, so daß man die Schreie des Kerls nicht hören konnte. Als Gegengabe zerstückelte er jene Schuldigen, die er bestraft hatte, kochte sie ab und überließ sie mir zum Fraß. Ich mag kein rohes Fleisch. Hoffentlich wird der Henker des Predigers aus Erzurum daran denken, damit ich das Fleisch dieses Dreckskerls nicht roh fressen muß und mir den Magen verderbe.
4Sie werden mich Mörder nennen
Hätte man mir eben noch, bevor ich diesen Toren umbrachte, gesagt, daß ich einem Menschen das Leben nehmen würde, hätte ich’s nicht geglaubt. Deswegen rückt meine Tat, einer fremden Galeone gleich, die am Horizont verschwindet, immer mehr in weite Ferne. Manchmal habe ich das Gefühl, ich hätte nie einen Mord begangen. Es ist vier Tage her, seit ich meinen armen Bruder Fein ganz gegen meinen Willen erschlug, und jetzt erst bin ich ein wenig mit dem Zustand vertraut.
Nur allzugern hätte ich diese unerwartete abscheuliche Angelegenheit gemeistert, ohne einen Menschen zu morden, doch mir wurde sogleich klar, daß es keinen Ausweg gab. So habe ich an Ort und Stelle erledigt, was zu tun war, und die ganze Verantwortung übernommen. Ich konnte nicht erlauben, daß die ganze Malergemeinde der Verleumdungen eines Dummkopfs wegen in Gefahr geriet.
Dennoch ist es schwer, sich daran zu gewöhnen, ein Mörder zu sein. Zu Hause halt ich’s nicht aus, gehe hinaus auf die Straße, halt es in der Straße nicht aus, gehe zur nächsten Straße und dann wieder zur nächsten, und wenn ich den Menschen ins Gesicht schaue, sehe ich, daß viele von ihnen sich für schuldlos halten, weil sie noch keine Gelegenheit fanden, einen Mord zu begehen. Es ist kaum anzunehmen, daß die meisten Menschen wegen dieser kleinen Sache des Glücks oder des Schicksals tugendsamer und besser sind als ich. Sie schauen höchstens etwas dümmer drein, weil sie noch keinen Mord begangen haben, und wie alle Dummen scheinen sie gutmütig zu sein. Nachdem ich jenen armen Kerl umgebracht hatte, genügten mir vier Tage, in denen ich durch die Straßen von Istanbul streifte, um zu erkennen, daß jeder, in dessen Auge ein kluges Funkeln erschien, dessen Antlitz den Schatten seines Gemüts widerspiegelte, ein heimlicher Mörder war. Nur die Toren sind ohne Schuld.
Während heute abend zum Beispiel in dem Kaffeehaus hinter dem Sklavenmarkt ein heißer Kaffee mein Inneres wärmte und ich auf das Hundebild im Hintergrund schaute und lachend und ausgelassen mit allen anderen den Erzählungen des Hundes lauschte, wurde ich plötzlich von dem Gefühl überwältigt, der neben mir sitzende Kerl sei irgendein Mörder, genauso wie ich. Der meddah brachte ihn zum Lachen, so wie mich, und ich weiß nicht, wodurch ich zu dem Schluß kam, daß er vom gleichen Schlage war wie ich; mag sein, weil sein Arm so brüderlich neben dem meinen ruhte, oder wegen der Rastlosigkeit seiner flinken Finger, welche die Tasse hielten. Ich wandte mich ihm ganz plötzlich zu und schaute ihm gerade ins Gesicht. Da packte ihn sofort die Angst, und seine Züge verzerrten sich in Panik. Irgendein Bekannter hakte sich ein bei ihm, während man Kaffee herumreichte, und sagte: »Nun werden die Anhänger des Nusret Hodscha auch hier schon bald einen Überfall machen.«
Ein Hochziehen der Augenbrauen brachte den anderen zum Schweigen. Ihre Furcht steckte mich an.Niemand traut niemandem, jeder erwartet jeden Augenblick eine Bosheit von seinem Gegenüber.
Es war noch kälter geworden, in den Straßenwinkeln und am Fuß der Mauern hatte sich der Schnee reichlich gehäuft. Mein Körper sucht seinen Weg in der tiefen Finsternis nur durch Erspüren der engen Gassen. Aus einem der Häuser mit fest geschlossenen Läden, mit Fenstern, die von schwarzen Brettern verdeckt sind, dringt hin und wieder irgendwo der fahle Schimmer einer noch brennenden Lampe und spiegelt sich auf dem Schnee, die meiste Zeit jedoch sehe ich nichts, kein einziges Licht, und horche auf die Stockschläge der Nachtwächter gegen irgendwelche Steine, auf das Geheul der wilden Hundemeuten oder auf ein Wimmern aus einem der Häuser, um meinen Weg zu finden. Manchmal werden die engen, furchterregenden Gassen der mitternächtlichen Stadt durch ein wundersames Licht erhellt, das aus dem Schnee hervorzuschimmern scheint, und ich meine, zwischen Bäumen und Ruinen jene Gespenster zu sehen, die Istanbul seit Hunderten von Jahren bei Dunkelheit so schaurig machen. Manchmal auch dringen Laute des Unheils aus dem Innern der Häuser; entweder hustet einer unentwegt, oder ein anderer zieht schniefend die Nase hoch, wieder andere schreien und weinen im Schlaf, oder Mann und Frau versuchen, einander zu würgen, während die Kinder an ihrer Seite heulen.
Da ich mich aufheitern und an die glückliche Zeit zurückdenken wollte, als ich noch kein Mörder war, bin ich einige Male abends in dieses Kaffeehaus gekommen, um den meddah zu hören. Die meisten meiner Malerbrüder, die mir lebenslang eng vertraut sind, kommen jeden Abend hierher. Doch seit ich einen Dummkopf beseitigt habe, der seit den Kindertagen mit uns allen die Malkunst betrieb, will ich keinen einzigen mehr von ihnen sehen. Im Leben meiner Brüder, die nicht ohne Klatsch auskommen, wenn sie beisammen sind, gibt es vieles, was mir Scham bereitet, wie auch diese schändliche Art der Belustigung hier. Damit sie nicht meinen, ich sei hochnäsig, und mich damit hänseln, habe ich auch ein paar Bilder für den meddah gemalt, doch glaube ich nicht, daß dies ihre Eifersucht beschwichtigen könnte.
Und wie recht sie haben, eifersüchtig zu sein! Wenn’s darum geht, die Farben zu mischen, den Schriftrahmen zu setzen, die Seite zu komponieren, das Thema zu wählen, Gesichter zu zeichnen, vielköpfige Kampf- oder Jagdszenen zu plazieren, Tiere, Sultane, Schiffe, Pferde, Krieger oder Liebende zu malen, die Poesie des Sinngehalts in die Illustration einfließen zu lassen, ja sogar zu vergolden, dann bin ich allen voran der Meister. Das sage ich euch nicht, weil ich gelobt werden will, sondern damit ihr mich versteht. Die Eifersucht wird im Leben eines Meisterillustrators mit der Zeit eine ebenso unverzichtbare Zutat wie die Farbe.
Manchmal begegnet mir auf meinen Spaziergängen, die meiner inneren Unrast wegen immer länger werden, einer meiner ach so reinen und unschuldigen Glaubensbrüder, und unsere Blicke treffen sich. Dann habe ich plötzlich eine seltsame Eingebung: Wenn ich jetzt daran denke, daß ich ein Mörder bin, wird mir das mein Gegenüber an den Augen ablesen!
Also zwinge ich mich, ganz schnell an andere Dinge zu denken, genauso, wie ich mich in meinen jungen Jahren voller Scham dazu zwang, während des Gebets nicht an die Frauen zu denken. Doch im Gegensatz zu damals, als ich unfähig war, in meinen jugendlichen Nöten den Liebesakt aus meinen Gedanken zu treiben, kann ich den Mord, den ich begangen habe, durchaus vergessen.
Ihr versteht, daß ich all dies erzähle, weil es mit meinem jetzigen Zustand zu tun hat. Ihr versteht sogar alles, was ich mir nur eben durch den Kopf gehen lasse. Was dann hieße, daß ich nicht mehr der namenlose Mörder unbekannter Herkunft bin, der gespenstergleich unter euch wandelt, sondern es versetzt mich in die Lage eines gewöhnlichen Verbrechers, den man entdeckt hat, dessen Gesicht man kennt und der den Kopf verlieren wird. Erlaubt mir bitte, daß ich nicht alles in Gedanken fasse, sondern einiges für mich behalte: In der gleichen Weise, wie einfühlsame Leute eures Schlages den Dieb finden, indem sie seine Fußspuren verfolgen, möge man aus meinen Wörtern und meinen Farben entdecken, wer ich bin. Und das führt uns zu dem in diesen Tagen recht viel behandelten Thema des Stils: Gibt es eine ganz persönliche Methode des Illustrators, eine Farbe, einen Ton, die nur ihm eigen sind, sollte es sie geben?
Nehmen wir ein Bild von Behzat, dem Meister der Meister, dem Patron der Bildermalerei, als Beispiel. Auf dieses wunderbare Ding, das so gut zu meiner Lage paßt, weil es einen Mord schildert, bin ich auf den Seiten eines neunzig Jahre alten Buches, einer makellosen Herater Arbeit, gestoßen. Es erzählt die Geschichte von Hüsrev und Şirin und stammt aus der Bibliothek eines persischen Kronprinzen, der selbst im Verlauf eines erbarmungslosen Thronstreites umgebracht wurde. Das Ende von Hüsrev und Şirin ist euch bekannt, wobei ich nicht das von Firdevsi, sondern das von Nizami beschriebene meine:
Nach vielen stürmischen Abenteuern heiraten die Liebenden, Şiruye aber, der Sohn aus Hüsrevs vormaliger Ehe, ist von teuflischer Art und gönnt den beiden keine Ruhe. Er, der Kronprinz, begehrt den Thron und Şirin, die junge Frau seines Vaters. Şiruye, von dem Nizami sagt: »Sein Mund stank wie das Maul der Löwen«, findet einen Weg, den Vater zu entmachten und sich den Thron anzueignen. Dann dringt er eines Nachts in das Gemach Hüsrevs und Şirins ein, ertastet die beiden Schlafenden im Dunkeln und stößt dem Vater seinen Dolch in die Brust. Des Vaters Blut wird bis zum Morgen fließen, und er wird in jenem Bett sterben, das er mit der schönen, friedlich neben ihm schlummernden Şirin teilte.
Das Bild des großen Meisters Behzat beschrieb auch eine echte Furcht, die ich bis zu dieser Geschichte jahrelang mit mir herumgetragen hatte: das Entsetzen darüber, in der mitternächtlichen Dunkelheit zu erwachen und an einem leisen Knistern erkennen zu müssen, daß sich noch ein anderer in dem Raum befindet! Und stellt euch vor, dieser andere hält einen Dolch in einer Hand und greift mit der anderen nach eurer Kehle! All die feinen Ornamente der Wände, Fenster und Rahmen des Gemachs, die Falten und Rundungen des Teppichs in der gleichen roten Farbe wie der lautlose Schrei, der aus eurer zusammengepreßten Kehle dringt, und all die mit unglaublicher Feinheit und Liebe gestickten gelben und purpurnen Blumen der herrlichen Steppdecke, auf die jener, der euch umbringt, erbarmungslos seinen ekligen nackten Fuß setzt – sie alle dienen einem Zweck: Während sie einerseits die Schönheit des Bildes hervorheben, das ihr betrachtet, erinnern sie andererseits daran, wie schön das Gemach ist, in dem ihr gerade am Sterben seid, welch ein schöner Ort die Welt ist, die ihr jetzt verlassen müßt. Der eigentliche Sinn aber, der euch beim Betrachten des Bildes aufgehen wird, liegt in der Bedeutungslosigkeit eures Todes für die Schönheit des Bildes und der Welt, ist die Einsamkeit eures Sterbens, auch wenn euer Eheweib neben euch liegt.
»Es ist Behzats Werk«, hatte der alte Meister zwanzig Jahre zuvor gesagt, während wir das in meinen zitternden Händen liegende Buch gemeinsam betrachteten. Sein Gesicht war erleuchtet gewesen, nicht von der nahen Kerze, sondern von dem freudigen Genuß des Anschauens. »Es ist so sehr Behzat, daß es keiner Signatur bedarf.«
Weil dies auch Behzat bewußt gewesen war, hatte er seine Signatur nicht einmal in ein heimliches Eckchen des Bildes gesetzt. Hier zeigte sich, so meinte der alte Meister, Scham und Schüchternheit Behzats. Wahre Meisterschaft und wahres Talent erschaffen ein unerreichbares Wunderwerk der Illustration, hinterlassen aber keinerlei Spur, welche die Person des Illustrators verraten könnte.
Ich habe mein Opfer in höchster Not auf eine gewöhnliche, grobe Art getötet. Immer wenn ich nachts an diese Brandstätte kam, um zu erforschen, ob von meinem Werk irgendeine verräterische Spur zurückgeblieben war, begannen die Fragen des Stils sich in meinem Kopf zu überstürzen. Diese Stil genannte Sache, auf der man so beharrt, ist nichts als ein Fehler, der uns dazu bringt, einen Hinweis auf unsere Person zu hinterlassen.
Auch ohne die Helligkeit des fallenden Schnees hätte ich hierhergefunden: an diese Brandstätte hier, an der ich einen ermordet habe, der fünfundzwanzig Jahre lang mein Freund gewesen ist. Der Schnee hat alle Spuren zugedeckt, die man als meine Signatur erkennen könnte. Was beweist, daß Allah, wo es um Stil und Signatur geht, mit mir und Behzat einer Meinung ist. Wenn wir Illustratoren vier Nächte zuvor bei der Arbeit an dem Buch wirklich eine unverzeihliche – wenn auch unbewußte – Sünde begangen hätten, wie der Dummkopf behaupten wollte, hätte uns Allah diese Liebe nicht bewiesen.
Als ich in jener Nacht mit Fein Efendi an diese Brandstätte kam, fiel noch kein Schnee. Wir hörten nur aus der Ferne das Echo von Hundegeheul.
»Warum sind wir hierhergekommen?« fragte der Ärmste. »Was wirst du mir zeigen, hier, um diese Zeit?«
»Vorn ist ein Brunnen, und zwei Schritte weiter habe ich seit Jahren gespartes Geld vergraben«, sagte ich. »Wenn du niemandem weitersagst, was ich dir erzählt habe, werden dir der Oheim und ich eine Freude machen.«
»Das heißt also, du gibst zu, von Anfang an gewußt zu haben, was du tust«, erklärte er aufgeregt.
»Ich gebe es zu«, log ich in meiner Ausweglosigkeit.
»Das Bild, das ihr malt, ist eine große Sünde, weißt du das?« meinte er einfältig. »Eine Lästerung, eine Ketzerei, wie sie niemand wagen dürfte! In der tiefsten Hölle werdet ihr brennen, eure Schmerzen und Leiden werden niemals enden! Und ihr habt mich zum Komplizen gemacht!«
Als ich diese Worte hörte, begriff ich voller Entsetzen, daß ihm viele Leute glauben würden. Warum? Weil darin eine solche Kraft, eine solche Anziehung steckte, daß ein Mensch unwillkürlich aufhorchen und wünschen mußte, über andere Schufte die Wahrheit zu erfahren. Wegen der Geheimhaltung des Buches, an dem der Oheim arbeitete, und des Geldes wegen, das er dafür erhielt, war ohnehin sehr viel Geschwätz dieser Art über ihn im Umlauf. Außerdem haßte ihn Meister Osman, der Erste Illustrator. Ich hatte sogar daran gedacht, daß mein Bruder Vergolder damit ganz gerissen seine Verleumdungen untermauerte. In welchem Maße war er aufrichtig?
Ich ließ ihn die Vorwürfe wiederholen, die uns entzweit hatten. Er konnte nicht auf den Worten herumkauen, daran drehen und deuteln. Es war, als wolle er mich auffordern, eine Verfehlung zu vertuschen, um uns vor den Prügeln Meister Osmans zu bewahren, die wir in unseren gemeinsamen Lehrjahren hatten einstecken müssen. In diesem Augenblick glaubte ich an seine Aufrichtigkeit. Auch in der Lehrzeit hatte er die Augen so weit aufgerissen, nur waren sie damals noch nicht schmaler geworden durch die Beschäftigung des Vergoldens. Ich wollte aber keine Liebe mehr für ihn empfinden, war er doch bereit, anderen die ganze Geschichte weiterzuerzählen.
»Schau einmal«, erklärte ich mit falscher Unbekümmertheit, »wir vergolden, erfinden Randverzierungen, ziehen Rahmen, schmükken die Seiten mit bunt glänzendem Gold, machen die schönsten Bilder, beleben Schränke und Truhen. Das tun wir seit Jahren. Es ist unsere Arbeit. Man trägt uns auf, Bilder zu malen, man sagt uns, in jenen Rahmen ein Schiff, eine Antilope, einen Padischah zu setzen, Vögel solcher Art, Männer wie jene dort, und diese Szene der Geschichte soll so eingefügt werden, und wir tun es. Schau, diesmal hat der Oheim gesagt: ›Zeichne dort ein Pferd hin, wie du’s dir vorstellst.‹ Um zu begreifen, was ein Pferdebild nach meiner Vorstellung war, habe ich wie die großen alten Meister drei Tage lang Hunderte von Pferden gezeichnet.« Ich holte eine Reihe von Pferdeskizzen hervor, die ich zur Übung auf grobes Samarkand-Papier gezeichnet hatte, und zeigte sie ihm. Er wurde aufmerksam, nahm den Bogen in die Hand, hielt ihn sich im blassen Mondlicht dicht vor die Augen und begann, die schwarzweißen Pferde zu betrachten. »Die alten Meister aus Schiras und Herat meinten, der Illustrator müsse, um das wahre Bild eines Pferdes, wie Allah es gewollt und gesehen hat, zeichnen zu können, fünfzig Jahre ohne Unterlaß Pferdebilder zeichnen«, sagte ich. »Und sie fügten noch hinzu, das beste Bild eines Pferdes würde ohnehin im Dunkeln gezeichnet. Denn der Illustrator, der unentwegt fünfzig Jahre arbeitet, wird blind, und seine Hand zeichnet das Pferd aus dem Gedächtnis.«
Der Blick voller Unschuld, den ich schon seit unserer Kindheit an ihm kannte, hatte sich in die von mir gezeichneten Pferde vertieft.
»Man gibt uns den Auftrag, und wir bemühen uns, wie es die alten Meister taten, das geheimnisvollste, unerreichbar schwierigste Pferd zu zeichnen, das ist alles. Uns später für das verantwortlich zu machen, was man uns aufgetragen hat, ist einfach ungerecht.«
»Ich weiß nicht, stimmt das?« fragte er. »Wir haben auch eine Verantwortung, eine Willenskraft. Ich fürchte niemanden außer Allah. Und er gab uns den Verstand, damit wir Gut und Böse voneinander trennen können.«
Die Antwort war zutreffend.
»Allah sieht alles, weiß alles …« sagte ich auf arabisch. »Er wird verstehen, daß du und ich, wir alle, diese Arbeit unwissentlich ausführen. Bei wem wirst du den Oheim anzeigen? Glaubst du denn nicht, daß hinter dieser Sache der Wille unseres Herrn, des Padischahs, steht?«
Er schwieg.
Ich überlegte: Besaß er wirklich nur ein Spatzengehirn oder fürchtete er Allah plötzlich so sehr, daß er seine Kaltblütigkeit verloren hatte und Unsinn redete?
Wir standen jetzt neben dem Brunnen. Für einen Augenblick meinte ich, in der Dunkelheit seine Augen zu sehen, und begriff seine Furcht. Er tat mir leid. Doch der Pfeil war abgeschossen. Ich flehte zu Allah, mir einmal mehr zu zeigen, daß der, der vor mir stand, nicht nur ein dummer Feigling war, sondern auch noch ein niederträchtiger Kerl.
»Zehn Schritte von hier gezählt wirst du graben.«
»Was werdet ihr nachher tun?«
»Ich werde es dem Oheim sagen, und er wird die Bilder verbrennen. Was könnten wir denn sonst tun? Wenn der Gemeinde des Nusret Hodscha aus Erzurum ein solches Gerücht zu Ohren kommt, dann bleibt weder von uns noch von der Malerwerkstatt etwas übrig. Kennst du irgendeinen unter ihnen? Nimm jetzt das Geld an, damit wir sichergehen, daß du uns nicht an sie verraten wirst.«
»Worin befindet sich das Geld?«
»Es sind fünfundsiebzig venezianische Goldstücke in einem alten Tonkübel für saure Gurken.«
Die venezianischen Dukaten waren verständlich, aber wie war ich auf den Tonkübel für saure Gurken gekommen? So blödsinnig es war, es klang überzeugend. Auf diese Weise erkannte ich einmal mehr, daß Allah auf meiner Seite stand, denn mein von Jahr zu Jahr geldgieriger werdender Freund hatte bereits eifrig begonnen, in der ihm von mir gewiesenen Richtung die Schritte zu zählen.
In diesem Augenblick gingen mir zwei Dinge durch den Kopf. Keine Spur von venezianischem Gold unter der Erde! Der niederträchtige Dummkopf würde uns ins Elend stürzen, wenn ich ihm kein Geld geben könnte! So dachte ich kurz daran, den dummen Kerl wie manches Mal in den Lehrjahren zu umarmen und zu küssen, aber die seitdem vergangene Zeit hatte uns so weit voneinander entfernt! Dann beschäftigte mich die Frage, wie man denn überhaupt graben sollte! Mit unseren Fingernägeln? All dies zu überlegen, wenn man es überlegen nennen konnte, dauerte kaum einen Lidschlag.
In Panik griff ich mit beiden Händen nach dem Stein, der neben dem Brunnen lag. Mit aller Kraft schlug ich zu, traf den Freund am Hinterkopf, während er noch den siebten, achten Schritt zählte. Der Stein schlug so schnell und hart auf den Schädel auf, daß ich für einen Augenblick glaubte, es sei mein eigener Kopf, und zurückschreckte, ja, es tat mir sogar leid.
Ehe ich jedoch über meine Tat Trauer empfinden würde, wollte ich das Ganze so schnell wie möglich zu Ende bringen. Denn er hatte auf dem Boden auf solche Weise herumzuzappeln begonnen, daß man sich unwillkürlich noch viel mehr entsetzte.
Erst lange nachdem ich ihn in den Brunnen hinuntergeworfen hatte, konnte ich darüber nachdenken, daß meine Tat einen recht groben Zug hatte, der nicht im geringsten der Feinfühligkeit eines Illustrators entsprach.
5Ich bin euer Oheim
Ich bin der Oheim Efendi Karas, aber auch andere nennen mich so. Einst wünschte sich Karas Mutter, daß er mich mit Oheim anredete, aber später wurde es nicht nur für ihn, sondern für alle zur Gewohnheit. Vor dreißig Jahren, als wir uns nicht weit von Aksaray in jener dunklen, feuchten Straße niedergelassen hatten, die von Kastanien und Linden überschattet war, hatte Kara begonnen, bei uns ein und aus zu gehen. Nicht das jetzige, das Haus davor war es gewesen. Wenn ich in der Sommerzeit mit Mahmut Pascha ins Feld zog, dann traf ich bei meiner Rückkehr im Herbst Kara und seine Mutter in unserem Hause an, wo sie Unterschlupf gesucht hatten. Seine selige Mutter ist die ältere Schwester meiner seligen Frau gewesen. An manchen Winterabenden fand ich, wenn ich heimkam, die beiden Schwestern in tränenreicher Umarmung vor, wenn sie ihren Kummer miteinander teilten. Karas Vater, ein Lehrer in kleinen, entlegenen Medresen, wo er nie längere Zeit zu bleiben vermochte, war zornig, launenhaft und dem Trunk ergeben. Kara, damals sechs Jahre alt, weinte mit der Mutter, verstummte mit der Mutter, und mich, seinen Oheim, betrachtete er voller Furcht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!