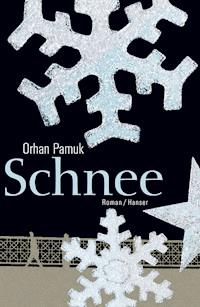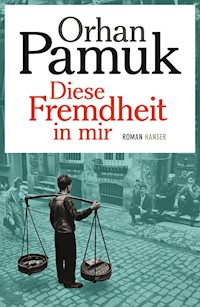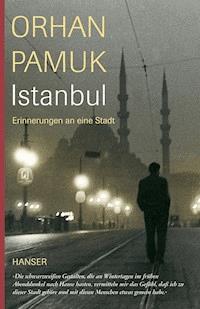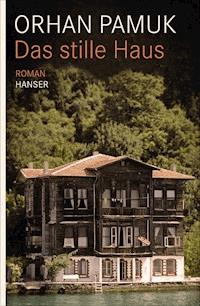Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als er die Schauspielerin zum ersten Mal im Theaterzelt sieht, ist Cem nur der einfache Lehrling des Brunnenbauers Murat. Sie ist schön, ihr rotes Haar leuchtet wie Feuer. Je mehr der Lehrling sich zu der Rothaarigen hingezogen fühlt, desto mehr entfremdet er sich von Meister Murat, der für ihn wie ein Vater geworden war. Als ein schrecklicher Unfall passiert, flieht Cem nach Istanbul. Jahrzehnte später kehrt er an jenen Brunnen zurück, wo er etwas Ungeheures entdeckt. – Orhan Pamuk erzählt mit klassischer Wucht eine Geschichte von Vätern und Söhnen, von Liebe und Verrat, von Schuld und Sühne in der Türkei, einem Land, das noch immer zwischen Tradition und Moderne zerrissen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Als er die Schauspielerin zum ersten Mal sieht, ist Cem nur der einfache Lehrling des Brunnenbauers Murat, der in einem wüstenhaften Vorort von Istanbul endlich auf Wasser stoßen will. Ihr rotes Haar leuchtet wie Feuer, während sie im Theaterzelt in Rostam und Sohrab mitspielt, einem Stück, in dem der Vater, anders als im Ödipus- Mythos, versehentlich den Sohn tötet. Je mehr der Lehrling sich zu der schönen Rothaarigen hingezogen fühlt, desto mehr entfremdet er sich von Meister Murat, der für ihn wie ein Vater geworden ist. Als ein schrecklicher Unfall passiert, flieht Cem in Panik nach Istanbul. Doch wie von einer unwiderstehlichen Kraft angezogen, kehrt er Jahrzehnte später an jenen Brunnen zurück, wo er etwas Ungeheures entdeckt.
Hanser E-Book
Orhan Pamuk
Die rothaarige Frau
Roman
Aus dem Türkischen von Gerhard Meier
Carl Hanser Verlag
Für Asli
Ödipus der Mörder seines Vaters, der Gatte seiner Mutter, Ödipus der Rätsellöser der Sphinx! Was sagt uns die geheimnisvolle Dreiheit dieser Schicksalstaten? Es gibt einen uralten, besonders persischen Volksglauben, daß ein weiser Magier nur aus Inzest geboren werden könne.
Nietzsche, »Die Geburt der Tragödie«
ÖDIPUS. Wo läuft die dunkle Spur so alter Blutschuld?
Sophokles, »König Ödipus«
Einen Vater ohne Sohn drückt man genauso wenig an die Brust wie einen Sohn ohne Vater.
Firdausi, »Schahname«
I. Teil
1
Eigentlich wollte ich Schriftsteller werden, aber nach den Ereignissen, die hier zu schildern sind, wurde ich Geotechniker und Bauunternehmer. Der Leser sollte aber jetzt, da ich zu erzählen beginne, nicht denken, es sei alles längst überwunden. Je mehr ich mich zurückerinnere, umso mehr gerate ich in das Erlebte wieder hinein. So ist mir denn, als würden auch Sie allmählich damit vertraut gemacht, was es bedeutet, Vater zu sein, und was es bedeutet, Sohn zu sein.
1985 lebten wir in einer Wohnung in Beşiktaş, in der Nähe des Ihlamur-Pavillons. Mein Vater, ein hochgewachsener, schlanker, gutaussehender Mann, betrieb eine kleine Apotheke, die einmal in der Woche Notdienst hatte und dann auch die ganze Nacht über geöffnet war. An jenen Tagen brachte ich meinem Vater das Abendessen, das er neben der Kasse zu sich nahm, während ich begierig den Apothekengeruch in mich einsog. Noch heute, mit fünfundvierzig, also knapp dreißig Jahre später, liebe ich den Duft alter Apotheken mit ihren Holzschränken.
Es kamen nicht viele Kunden. Wenn mein Vater Notdienst hatte, vertrieb er sich die Zeit mit einem tragbaren Fernsehgerät, wie sie damals in Mode waren. Manchmal kamen Freunde ihn besuchen, Gesinnungsgenossen, mit denen er sich flüsternd unterhielt. Sobald sie mich sahen, unterbrachen sie ihre Unterhaltung, erwähnten lobend, ich sei ja genauso gutaussehend und nett wie mein Vater, und stellten mir Fragen: In welche Klasse ich denn gehe, ob es mir in der Schule gefalle und was ich mal werden wolle.
Da es meinem Vater dann sichtlich unrecht war, wenn ich dabeistand, packte ich bald den leeren Henkelmann und ging im fahlen Laternenlicht unter den Platanen nach Hause. Von Vaters Genossen erzählte ich daheim lieber nichts, denn meine Mutter hätte sich gleich gesorgt, mein Vater könne wieder in die Bredouille geraten oder sich aus dem Staub machen, wie das schon mehrmals geschehen war.
Der ständig schwelende Streit zwischen meinen Eltern hatte nicht nur mit Politik zu tun. Manchmal waren sie lang aufeinander böse und schwiegen sich an. Vielleicht liebten sie sich einfach nicht. Ich spürte, dass mein Vater anderen Frauen zugetan war, und so manche Frau auch ihm. Auf solche Frauen spielte meine Mutter in einer Art an, die auch ich verstand, doch verdrängte ich das alles nach Kräften, denn unter dem Streit meiner Eltern litt ich.
Zum letzten Mal sah ich meinen Vater an einem solchen Tag, an dem ich ihm das Essen brachte. Ich ging damals in die zehnte Klasse; es war ein ganz normaler Herbstabend. Mein Vater sah sich gerade die Nachrichten an. Während er an der Verkaufstheke aß, bediente ich zwei Kunden, einen mit Aspirin, den anderen mit Vitamin C und einem Antibiotikum, und ich steckte das Geld in die alte Registrierkasse, die beim Aufspringen immer so schön klingelte. Als ich nach Hause ging, drehte ich mich noch kurz zu meinem Vater um, und er winkte mir von der Tür aus nach.
Am folgenden Morgen kam er nicht heim, das erfuhr ich am Mittag von meiner Mutter, die verweinte Augen hatte. Ich dachte mir, er sei wieder zur politischen Polizei geschafft und dort mit Bastonade und Stromstößen gefoltert worden.
Sieben, acht Jahre zuvor war er einmal verschwunden und erst nach etwa zwei Jahren wiederaufgetaucht. Damals hatte meine Mutter sich allerdings nicht so verhalten, als würde ihr Mann in Polizeigewahrsam gefoltert. Sie war wütend auf ihn. »Er muss ja wissen, was er tut!«, rief sie aus.
Als mein Vater dagegen nach dem Militärputsch eines Nachts von Soldaten aus der Apotheke geholt worden war, hatte meine Mutter ihn tieftraurig als einen Helden bezeichnet, auf den ich stolz sein solle, und zusammen mit dem Gehilfen Macit hatte sie die Apotheke alleine geführt. Manchmal legte ich damals Macits weiße Schürze an, doch später sollte ich natürlich nicht Apothekergehilfe werden, sondern Wissenschaftler, wie mein Vater sich das wünschte.
Nach diesem letzten Verschwinden meines Vaters kümmerte meine Mutter sich keineswegs um die Apotheke. Sie erwähnte weder Macit noch sonst einen Gehilfen, ja nicht einmal, was aus der Apotheke überhaupt werden sollte. Das brachte mich auf den Gedanken, dass mein Vater diesmal aus einem anderen Grund verschwunden war. Aber was heißt schon Gedanke?
Bereits damals war mir aufgefallen, dass die Gedanken uns mal über Worte kommen, mal über Bilder. Manchmal konnte ich einen Gedanken mit Worten nicht einmal ausdrücken. Ein Bild davon, etwa wie ich bei einem Wolkenbruch rannte und was ich dabei empfand, war dagegen sogleich zur Stelle. Ein andermal konnte ich etwas in Worten formulieren, brachte aber kein Bild davon zustande: von »schwarzem Licht« etwa, vom Tod meiner Mutter oder von der Unendlichkeit.
Ich war eben noch ein halbes Kind. Manchmal gelang es mir, bestimmte Themen zu verdrängen, und dann wieder ging mir ein Bild oder ein Wort, an das ich nicht denken wollte, partout nicht mehr aus dem Kopf.
Mein Vater meldete sich nie wieder bei uns. Bisweilen konnte ich mir nicht einmal mehr sein Gesicht vorstellen. Ich fühlte mich dann, als wäre der Strom ausgefallen und alles vor meinen Augen verschwunden.
Auf dem Weg zum Ihlamur-Pavillon kam ich eines Abends an unserer Apotheke vorbei und sah ein großes schwarzes Vorhängeschloss daran, als sollte sie nie wieder geöffnet werden. Vom Garten des Pavillons wehten Nebelschwaden herüber.
Bald darauf teilte meine Mutter mir mit, dass weder von meinem Vater noch von der Apotheke Geld zu erwarten und unsere finanzielle Lage daher desolat sei. Ich selbst gab nur für Kino, Döner und Comics etwas aus, und zu meiner Schule in Kabataş konnte ich zu Fuß gehen. Ich hatte Kameraden, die alte Comics weiterverkauften oder sie gegen Geld verliehen, doch hatte ich keine Lust, mir am Wochenende vor Kinos oder in Seitenstraßen die Beine in den Bauch zu stehen.
So begann ich im Sommer 1985 in einer Buchhandlung namens Deniz in Beşiktaş als Verkäufer zu arbeiten. Ein wichtiger Teil meiner Aufgabe bestand darin, Schüler abzuschrecken, die bei uns klauen wollten. Hin und wieder fuhr ich mit dem Inhaber Deniz zum Bücherholen nach Çağaloğlu. Es gefiel Deniz, dass ich mir Autoren- und Verlagsnamen so gut merken konnte, und er ließ mich Bücher zum Lesen mit nach Hause nehmen. So las ich in dem Sommer alles Mögliche: Kinderbücher, Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde, ausgewählte Erzählungen von Edgar Allen Poe, Gedichtbände, historische Romane über osmanische Kriegshelden und schließlich ein Buch über Träume, in dem etwas stand, das mein Leben verändern sollte.
In die Buchhandlung kamen auch mit dem Inhaber befreundete Schriftsteller. Wenn der Chef mich vorstellte, sagte er immer, ich wolle ebenfalls Schriftsteller werden, denn diesen Traum hatte ich mal ausgeplaudert, und je öfter ich den Satz nun von ihm hörte, umso mehr glaubte ich selbst daran.
2
Was ich in der Buchhandlung verdiente, war meiner Mutter zu wenig. Ich sollte wenigstens das Geld für eine Paukschule bezahlen können, um mich auf die Zulassungsprüfung für die Universität vorzubereiten. Seit dem Verschwinden meines Vaters verstand ich mich immer besser mit meiner Mutter. Meinen Entschluss, Schriftsteller zu werden, belächelte sie milde. Erst mal sollte ich an eine gute Universität.
Eines Tages ging ich nach der Schule aus irgendeinem Antrieb zum Kleiderschrank meiner Eltern und stellte fest, dass die Sachen meines Vaters weg waren. Nur sein Geruch nach Tabak und kölnisch Wasser lag noch in der Luft. Wir sprachen nie mehr von meinem Vater, und das Bild, das ich von ihm hatte, löste sich allmählich auf.
Bevor ich ins letzte Schuljahr kam, zogen wir zu Sommeranfang ans Marmarameer, nach Gebze, wo ein Onkel von mir uns umsonst in einem Anbau wohnen ließ. Es war so gedacht, dass ich zunächst bei dem Onkel arbeiten und Geld ansparen sollte, um den Rest der Sommerferien in der Buchhandlung in Beşiktaş und in der Paukschule zu verbringen. Deniz wusste, wie leid es mir tat, aus Beşiktaş wegzumüssen, und er bot mir an, den Sommer über in der Buchhandlung zu übernachten.
Ich wurde von meinem Onkel dazu eingeteilt, in einem größeren Obstgarten über Kirsch- und Pfirsichbäume zu wachen. Ich sah sogleich eine Laube mit einem Tisch darunter und stellte mir schon vor, wie gemütlich ich dort lesen würde, doch da täuschte ich mich gründlich. Es war Kirschenzeit, und immer wieder fielen freche Krähenschwärme lauthals krächzend über die Bäume her, und zudem versuchten Kinder sowie Arbeiter von einer benachbarten Großbaustelle, bei mir Obst zu stehlen.
In einem Garten nebenan wurde ein Brunnen gegraben. Ich ging manchmal hinüber und sah zu, wie der Brunnenbauer unten mit Spitzhacke und Schaufel hantierte und seine beiden Gehilfen den Aushub auf einen Haufen leerten.
Die Gehilfen stemmten sich in die beiden Kurbeln der hölzernen Seilwinde, die dabei lustig quietschte, und wenn der volle Eimer bei ihnen anlangte, schütteten sie die Erde in eine Schubkarre. Während der eine Gehilfe, etwa in meinem Alter, die Schubkarre wegfuhr, rief der andere, ein etwas älterer, großgewachsener Junge, in den Brunnen: »Er kommt!« und ließ den Eimer wieder zu seinem Meister hinab.
Tagsüber kam der Meister nur selten herauf. Zum ersten Mal sah ich ihn, als er in einer Mittagspause rauchte. Er war ähnlich groß, schlank und gutaussehend wie mein Vater, aber nicht so ruhig und freundlich, sondern eher jähzornig. Seine Gehilfen putzte er regelmäßig herunter. Denen war es wohl nicht recht, wenn ich das mitbekam, und so hielt ich mich, wenn der Meister oben war, vom Brunnen lieber fern.
Mitte Juni waren eines Tages vom Brunnen her fröhliche Rufe und Schüsse zu hören. Der Meister war auf Wasser gestoßen, worauf der Grundstücksbesitzer aus Rize herbeigeeilt war und Freudenschüsse abgegeben hatte. Es lag ein angenehmer Pulvergeruch in der Luft. Der Grundstücksbesitzer verteilte an den Meister und die Gehilfen Geld. Den Brunnen brauchte er für die Baustellen, die auf dem Gelände entstehen sollten, denn die Wasserleitung aus Gebze reichte noch nicht bis dorthin.
An den folgenden Tagen hörte ich den Meister nie mehr auf die Gehilfen schimpfen. Mit einem Pferdewagen schaffte er Zementsäcke und Eisen herbei. Eines Nachmittags goss er Beton in den Brunnen und fertigte eine eiserne Abdeckung an. Da es am Brunnen nun fidel zuging, gesellte ich mich öfter zu den dreien.
Eines Nachmittags ging ich zum Brunnen und dachte, es sei niemand dort, doch auf einmal trat zwischen Oliven- und Kirschbäumen Meister Mahmut hervor, mit einem Teil für den Motor in der Hand, den er am Brunnen installieren wollte.
»Du scheinst dich ja wirklich für die Sache zu interessieren, Junge.«
Ich dachte an die Romanhelden bei Jules Verne, die sich durch die ganze Erde gruben und am anderen Ende wieder herauskamen.
»Ich habe einen neuen Auftrag bei Küçükçekmece. Meine Gehilfen kommen nicht mit. Hättest du vielleicht Lust?«
Angesichts meiner zweifelnden Miene versicherte mir der Meister, ein Brunnenbaugehilfe bekomme viermal so viel Tagegeld wie der Wächter eines Obstgartens, und in zehn Tagen sei die Arbeit erledigt und ich könne wieder nach Hause.
Meine Mutter zu Hause sagte kategorisch: »Nein! Du wirst mir kein Brunnenbauer, sondern studierst gefälligst!«
Ich aber hatte mir in den Kopf gesetzt, schnell Geld zu verdienen. Meiner Mutter rechnete ich vor, bei Meister Mahmut könne ich in knapp zwei Wochen so viel Geld bekommen wie bei meinem Onkel in zwei Monaten, und danach werde ich genug Zeit für die Paukschule, die Zulassungsprüfung und meine geliebten Bücher haben. Ich drohte meiner Mutter gar.
»Wenn du es mir nicht erlaubst, haue ich einfach ab.«
Mein Onkel sagte schließlich: »Wenn der Junge arbeiten will, dann lass ihn doch. Ich werde mich mal erkundigen, was der Meister so für einer ist.«
Ohne mich trafen sich meine Mutter und Meister Mahmut im Anwaltsbüro meines Onkels im Rathausgebäude. Es wurde vereinbart, dass nicht ich in den Brunnen hinabsteigen sollte, sondern ein anderer Gehilfe. Mein Onkel sagte mir danach, wie viel Geld ich pro Tag bekommen würde. Zu Hause packte ich in einen kleinen alten Koffer meines Vaters ein paar Hemden und meine Turnschuhe.
Als der Lieferwagen, der mich zur Brunnenstätte bringen sollte, an dem regnerischen Tag auf sich warten ließ, brach meine Mutter in unserer kargen Behausung mit dem lecken Dach ein paar Mal in Tränen aus und sagte, ich solle doch bleiben, denn sie werde mich so sehr vermissen, und vielleicht täten wir da aus unserer Geldnot heraus etwas Falsches.
»Ich steige ja nicht hinab in den Brunnen«, wiederholte ich immer wieder, während ich schon mit dem Köfferchen in der Hand dastand, ganz aufrecht und entschlossen, aber doch auch leicht amüsiert, wie mein Vater damals, wenn er wieder mal vor Gericht musste.
Schließlich kam der Lieferwagen und parkte hinter der Moschee. Als der rauchende Meister Mahmut mich herausstaffiert mit dem Koffer auf sich zugehen sah, musterte er mich lehrerhaft lächelnd.
»Komm, steig ein, wir fahren los«, sagte er. Ich setzte mich zwischen ihn und den Fahrer von Hayri, jenem Geschäftsmann, der den Brunnen bauen ließ. Unterwegs wurde erst einmal eine Stunde lang nicht geredet.
Als wir über die Bosporus-Brücke fuhren, sah ich nach links auf Istanbul hinunter, auf mein Gymnasium in Kabataş, und ich versuchte, in Beşiktaş einzelne Häuser zu erkennen.
»Keine Sorge, der Brunnen ist schnell gebaut«, sagte Meister Mahmut, »und dann kannst du in dein Paukstudio.«
Dass er über meine Sorgen Bescheid wusste, war mir nur recht, und ich fasste Vertrauen zu ihm. Nach der Brücke ging es zäh weiter, sodass wir erst aus der Stadt hinausgelangten, als uns die Abendsonne direkt ins Gesicht stach.
Der Begriff »aus der Stadt hinaus« könnte den Leser in die Irre führen. In Istanbul wohnten damals nicht fünfzehn Millionen Menschen wie heute, sondern ganze fünf Millionen. Sobald man über die Stadtmauer ein wenig hinaus war, wurden die Häuser immer rarer, kleiner und ärmlicher, und man sah Fabriken, Tankstellen, vereinzelte Hotels.
Lange fuhren wir an der Eisenbahnlinie entlang, dann, bei Einbruch der Dunkelheit, bogen wir von der Hauptstraße ab. Den See von Büyükçekmece hatten wir da schon hinter uns. Hin und wieder sah ich ein paar Zypressen, einen Friedhof, eine Betonmauer, einen menschenleeren Platz. Meist aber war gar nichts zu erkennen, und sosehr ich auch zum Fenster hinausstarrte, hatte ich keine Ahnung mehr, wo wir uns befanden. Manchmal sahen wir die Neonlampen einer Fabrik oder eine Familie, die im gelben Lichtschein beim Abendessen saß. Dann ging es eine steile Straße hinauf. In der Ferne wurde der Himmel ab und zu durch Blitze aufgehellt, nie aber in der öden Gegend, durch die wir fuhren. Manchmal tauchte in einem plötzlichen, mir unerklärlichen Lichtschein endloses Brachland ohne Baum noch Mensch auf, das augenblicklich wieder im Dunkel verschwand.
Irgendwann hielten wir mitten in der Einöde. Da weder ein Haus noch irgendein Licht zu sehen waren, dachte ich zunächst, an dem alten Lieferwagen sei etwas kaputtgegangen.
»Hilf mir mal beim Abladen«, sagte Meister Mahmut.
Gemeinsam luden wir Kochgeschirr, zwei zusammengezurrte Decken, in Plastik gewickelte Utensilien, Bretter, die Einzelteile der Winde und Grabgerätschaften ab. Dann verabschiedete sich der Fahrer und fuhr davon. Da merkte ich erst so recht, wie finster es war, und ich fürchtete mich. Irgendwo zuckte ein Blitz, aber der Himmel hinter uns war sternenklar. In noch weiterer Ferne sah ich wie gelben Nebel den Widerschein der Istanbuler Lichter in den Wolken.
Der Boden war feucht und stellenweise sogar völlig durchnässt. Wir brauchten eine Weile, bis wir auf dem ebenen Gelände eine einigermaßen trockene Stelle fanden, zu der wir unsere Sachen tragen konnten.
Mithilfe der Stangen, die wir dabeihatten, versuchte der Meister ein Zelt aufzubauen, was sich allerdings recht mühsam gestaltete. Man sah die Pflöcke nicht richtig, sah die Schnüre nicht richtig, und mir verkrampfte sich in der Finsternis das Herz. »Hier sollst du halten, nicht da«, raunzte Meister Mahmut mich an.
Wir hörten eine Eule rufen. Ich fragte mich, ob wir das Zelt wirklich aufbauen mussten, wo es doch nicht mehr regnete, aber die Entschlossenheit, mit der der Meister zu Werke ging, imponierte mir doch. Die feucht riechende, schwere Zeltplane sackte dennoch immer wieder auf uns herab wie die Nacht.
Erst nach langer Zeit stand das Zelt sicher da, und wir legten uns hinein und wickelten uns in unsere Decken. Die Regenwolken hatten sich verzogen, und die Sterne funkelten. Als ich ganz in der Nähe eine Grille zirpen hörte, beruhigte mich das irgendwie, und gleich danach muss ich eingeschlafen sein.
3
Als ich aufwachte, war ich im Zelt allein. Draußen summte eine Biene. Ich stand auf und ging hinaus. Die Sonne stand schon so hoch am Himmel, dass ich geblendet wurde.
Wir befanden uns auf einem etwas höher gelegenen, sehr flachen Gelände, das sich in südöstlicher Richtung, auf Istanbul zu, sanft absenkte. Weiter unten waren in der Ferne, hellgrün und gelblich, ein paar Mais- und Weizenfelder zu sehen, ansonsten herrschte karges Brachland vor. In der anderen Richtung spitzten hinter einem Hügel Häuser und eine Moschee hervor, doch war nicht abzuschätzen, wie groß die Ortschaft dort sein mochte.
Wo war Meister Mahmut? Aus herübergewehten Trompetenstößen schloss ich, dass die bleifarbenen Gebäude hinter der Ortschaft Kasernen sein mussten. Ganz weit dahinter ragten violette Berge empor. Auf einmal senkte sich auf mich und die ganze Welt eine tiefe Stille, wie aus ferner Erinnerung heraus. Ich war froh, weit weg von Istanbul zu sein, weit weg von allen, und mein eigenes Geld zu verdienen.
Da hörte ich einen Zug pfeifen. Ich blickte hinüber und sah, wie die Waggons, die in Richtung Europa unterwegs waren, zwischen der Ortschaft und der Kaserne hindurch in etwa auf uns zufuhren, dann einen leichten Bogen beschrieben und an einem Bahnhof hielten.
Bald darauf erblickte ich Meister Mahmut, der von der Ortschaft herkam. Erst ging er die Straße entlang, doch an der ersten Kurve nahm er eine Abkürzung durch die Felder.
»Ich habe Wasser gekauft«, sagte er, als er bei mir ankam. »Los, koch mir Tee.«
Während ich mit unserem kleinen Gaskocher hantierte, traf in dem Lieferwagen, mit dem wir gekommen waren, Hayri ein, der Besitzer des Grundstücks. Von der Ladefläche sprang ein Junge herunter, der etwas älter sein mochte als ich. Er hieß Ali, und wie ich erfuhr, arbeitete er für Hayri und sollte statt des Jungen in Gebze, der kurzfristig abgesagt hatte, beim Brunnenbau mithelfen.
Meister Mahmut und Hayri gingen auf dem etwa einen Hektar großen kargen Grundstück lange auf und ab. Da der Wind in unsere Richtung blies, hörten wir auch dann noch, wenn die beiden ganz am anderen Ende standen, dass sie sich nicht einigen konnten, wo der Brunnen gegraben werden sollte. Ich gesellte mich zu ihnen und erfuhr, dass Hayri ein Unternehmer war, der auf dem unfruchtbaren Boden eine Textilfärberei errichten wollte. Für eine solche gab es von großen Konfektionshäusern, die ins Ausland exportierten, viel Nachfrage, doch um sie zu betreiben, brauchte man große Mengen Wasser.
Da das Grundstück unerschlossen war, hatte Hayri es sehr billig erstehen können. Falls wir nun Wasser fanden, würde er uns reichlich entlohnen. Dass er auch einen Stromanschluss bekam, dafür würden dann seine Freunde in der Politik sorgen. Danach würde er die Fabrik bauen, deren Pläne er uns einmal mitbrachte, damit wir uns die Färbe- und Waschhallen, die Lager, das schicke Verwaltungsgebäude und die Kantine besser vorstellen konnten. Aus Meister Mahmuts Blicken las ich heraus, dass er für Hayris Anliegen durchaus Interesse aufbrachte, doch im Grunde genommen dachten wir beide nur an den versprochenen Lohn.
»Möge Gott euch gutes Gelingen, euren Armen Kraft und euren Augen Aufmerksamkeit schenken!«, sagte Hayri, als ob er eine osmanische Streitmacht in den Kampf verabschiedete. Aus dem davonfahrenden Lieferwagen winkte er uns noch mal zu.
Als ich in der Nacht nicht schlafen konnte, weil der Meister schnarchte, streckte ich den Kopf zum Zelt hinaus. Von der Ortschaft her war kein Licht zu sehen. Der Himmel war blau, aber durch die Sterne schien die Welt in gelblichrotes Licht getaucht, als lägen wir im Dunkeln auf einer riesigen Orange. Ob wir wohl recht daran taten, ins Innere der Erde zu streben anstatt zu den leuchtenden Sternen?
4
Maschinen für Probebohrungen gab es damals noch nicht. Wo mit großer Wahrscheinlichkeit Wasser anzutreffen war, mussten Brunnenbauer über Jahrtausende hinweg erahnen. Meister Mahmut wusste natürlich, was manche Kollegen um die Wassersuche für ein Brimborium veranstalteten. Ernst nehmen konnte er aber nicht, wenn jemand mit einer Wünschelrute auf und ab ging und dabei rätselhafte Sprüche murmelte. Er fühlte, dass er zur letzten Generation gehörte, die diesen Beruf auf althergebrachte Weise ausübte, und darum trat er nicht großsprecherisch auf, sondern bescheiden. »Du musst aufpassen, ob der Erdboden dunkel ist, oder feucht«, sagte er zu mir. »Achte auf Steine, auf Unebenheiten, auf schattige Stellen«, meinte er ein andermal belehrend, »dann spürst du irgendwann, wo Wasser sein kann. Feucht und dunkel ist die Erde vor allem da, wo Grünes wächst, aber das allein heißt noch nicht viel, und du musst auf der Hut sein.«
Wie der Himmel mit seinen sieben Sphären sei nämlich auch das Erdreich aus zahlreichen Schichten aufgebaut. (In manchen Nächten starrte ich zu den Sternen hinauf und spürte dabei die dunkle Welt unter mir.) Schon zwei Meter unter dunkler, fast schwarzer Erde konnte eine lehmige, wasserundurchlässige Schicht auftauchen, staubtrockene, unbrauchbare Erde oder ganz einfach Sand. Darum musste ein erfahrener Brunnenbauer imstande sein, auf der Suche nach der richtigen Stelle auf die Sprache des Bodens, der Gräser, der Insekten und sogar der Vögel zu horchen, und beim Schreiten über den Boden musste er tiefliegende Lehm- oder Felsenschichten erfühlen können.
Das führte dazu, dass sich mancher Brunnenbauer wie ein zentralasiatischer Schamane mit übernatürlichen Kräften ausgestattet wähnte oder gar behauptete, er kommuniziere mit unterirdischen Göttern und Geistern. Mein Vater lachte über so etwas immer, doch wer billig zu einem Brunnen kommen wollte, glaubte nur allzu gern daran. Ich weiß noch gut, wie in Beşiktaş in den Gärten von armseligen Gecekondus im Glauben an genau solche Methoden nach günstigen Stellen für Brunnen gesucht wurde. In einem Hinterhof habe ich mal erlebt, wie ein Wünschelrutengänger zwischen gackernden Hühnern den Boden abhorchte und dabei von den Hausbewohnern so ehrfürchtig angesehen wurde wie ein Arzt, der ein krankes Baby untersucht.
»Mit Gottes Hilfe sind wir in höchstens zwei Wochen fertig, und ich finde in zehn oder zwölf Metern Tiefe Wasser«, sagte Meister Mahmut.
Mit mir redete er offener als mit Ali, der ja für den Grundstücksbesitzer arbeitete. Das gefiel mir, denn so kam ich mir vor wie ein Vertrauter.
Am folgenden Tag legte Meister Mahmut fest, wo er graben wollte, und zwar nicht da, wo dies laut den Fabrikplänen geschehen sollte, sondern am entgegengesetzten Ende des Geländes.
Wenn mein Vater etwas Wichtiges unternahm, fragte er mich nie nach meiner Meinung dazu, denn wegen seiner politischen Aktivitäten neigte er zur Geheimniskrämerei. Meister Mahmut dagegen hatte mir immerhin, bevor er die Entscheidung fällte, seine Gedanken dazu mitgeteilt, und dafür war ich ihm dankbar. Dann aber ging er in sich und traf seinen Beschluss ohne weitere Erklärung. Da wurde mir zum ersten Mal so recht bewusst, was für eine Macht er über mich besaß. Ich freute mich über die Zuwendung, wie ich sie bei meinem Vater nie kennengelernt hatte, aber sie hatte auch etwas Irritierendes.
An jenem Tag schlug er an einer bestimmten Stelle einen Pflock in die Erde. Warum nach all dem Herumgehen und Nachdenken ausgerechnet da? Was war dort anders als rundherum? Wenn wir den Pflock nur immer weiter ins Erdreich trieben, würden wir dann gewiss irgendwann auf Wasser stoßen? Das hätte ich Meister Mahmut gern gefragt, wusste aber gut, dass ich das nicht konnte. Ich war noch fast ein Kind und er nicht mein Freund oder gar mein Vater, sondern mein Meister. Das Väterliche fand nur ich an ihm.
Er band an den Pflock eine Schnur und an deren anderes Ende einen Nagel. Die Schnur war einen Meter lang. Für eine steinerne Brunnenwand sei der Untergrund nicht geeignet, sagte der Meister, darum müsse die Wand aus Beton sein, etwa zwanzig bis fünfundzwanzig Zentimeter dick. Er hielt die Schnur gespannt und kratzte mit dem Nagel einen Kreis von zwei Metern Durchmesser in den Boden, oder vielmehr zeichnete er nur einzelne Stellen an, die Ali und ich danach sorgfältig zu verbinden hatten.
»Ein Brunnenkreis muss vollständig regelmäßig sein«, mahnte er. »Hat der Kreis irgendwo einen Fehler oder eine Ausbuchtung, hält die Wand nicht und stürzt ein.«
So hörte ich zum ersten Mal von der Angst des Meisters vor solch einem Einsturz. Wir griffen zu Hacke und Schaufel und begannen zu graben. Der Meister hackte, ich schaufelte die Erde in eine Schubkarre, und Ali fuhr sie weg. Nur mühsam konnten Ali und ich mit dem Meister mithalten. »Mach die Schubkarre nicht so voll, dann bin ich schneller wieder da«, sagte Ali nach einer Weile außer Atem. Während der Meister unermüdlich weiterarbeitete, erlahmten bei Ali und mir so schnell die Kräfte, dass neben dem Brunnenloch bald ein immer höherer Erdhaufen lag. Darauf ließ Meister Mahmut die Hacke sinken, legte sich ein wenig abseits unter einen Olivenbaum und wartete rauchend ab, bis wir fertig waren. Schon in den ersten Stunden des ersten Tages begriffen wir so, dass unsere Aufgabe darin bestand, dem Meister überhaupt hinterherzukommen, ihm abzuschauen, wie wir arbeiten mussten, und so schnell wie möglich seine Anordnungen auszuführen.
Durch die schwere Arbeit unter der Sonne war ich am Abend wie gerädert. Nach Sonnenuntergang rührte ich nicht mal meine Linsensuppe an, sondern legte mich sofort ins Bett. Vom Schaufeln hatte ich Blasen, und im Nacken einen Sonnenbrand.
»Daran gewöhnst du dich schon, junger Herr«, sagte Meister Mahmut, ohne die Augen von dem kleinen Fernseher zu wenden, den er in Gang zu bringen suchte.
Das mit dem »jungen Herrn« spielte stichelnd darauf an, dass ich für körperliche Arbeit zu schwächlich gebaut war, aber ich ließ mir die Anrede gern gefallen, denn zum einen erkannte Meister Mahmut damit an, dass ich aus der Stadt und von gebildeten Eltern abstammte, und so würde er mich vielleicht nicht ganz so hart arbeiten lassen, und zum anderen schloss ich daraus, dass er mich mochte und sich gerne mit mir abgab.
5
Die Ortschaft, zu der es zu Fuß an die fünfzehn Minuten waren, hatte – wie auf dem großen blauen Ortsschild stolz verkündet – 6200 Einwohner und hieß Öngören. Dort mussten wir gleich am Nachmittag des zweiten Arbeitstages hin, da der Brunnenschacht schon zwei Meter tief war und wir Material benötigten.
Zuerst brachte Ali uns zu einem Schreiner. Aus zwei Metern Tiefe ließ sich die Erde nicht mehr aus dem Schacht herausschaufeln, und wir mussten, wie bei jedem Brunnenbau, eine Winde fabrizieren. Dazu aber reichten die mitgebrachten Bretter nicht. Als der Schreiner uns fragte, was wir denn vorhätten, erwiderte Meister Mahmut, wir seien Brunnenbauer. »Ach so, auf der Ebene da droben!«
Wenn wir in den darauffolgenden Tagen von der »Ebene da droben« in den Ort hinuntergingen, schaute Meister Mahmut mal beim Schreiner vorbei, mal beim Krämer, wo er seine Zigaretten kaufte, mal beim Eisenwarenhändler. Ich ging abends gerne mit, spazierte mit dem Meister durch die Straßen und setzte mich in dem kleinen Park mit den Kiefern und Zypressen auf eine Bank oder an einen Tisch vor einem Kaffeehaus oder einem Laden, oder aber ins kühle Bahnhofsgebäude.
Geplagt war Öngören mit den vielen dort kasernierten Soldaten. Um Istanbul vor einem eventuellen Angriff der Deutschen über den Balkan oder der Russen über Bulgarien zu verteidigen, hatte man im Zweiten Weltkrieg in Öngören eine große Infanteriebrigade stationiert und sie danach praktisch dort vergessen. Vierzig Jahre nach dem Krieg waren die Soldaten sowohl die größte Einnahmequelle des Ortes als auch sein größtes Problem.
Die meisten Läden im Ortskern hielten für Soldaten auf Wochenendausgang Dinge wie Ansichtskarten, Telefonjetons, Socken oder Bier feil. Auf die gleiche Kundschaft zugeschnitten war die »Kneipenstraße«, wie sie im Volksmund hieß, in der sich Lokale und Kebab-Stände aneinanderreihten, ständig überwacht von Militärpolizisten. Wenn aus all diesen Wirtschaften, Konditoreien und Kaffeehäusern, die tagsüber und vor allem am Wochenende überfüllt waren, die Soldaten abends abzogen, bekamen wir ein ganz anderes Öngören zu Gesicht. Gegen grölende Soldaten und überhaupt jede Art von Ruhestörern schritt die Militärpolizei sofort ein und erstickte jeden Streit im Keim.
Als früher die Garnison noch größer gewesen war, hatte man für Angehörige der Soldaten Hotels errichtet, doch je besser die Verkehrsanbindung nach Istanbul wurde, umso weniger Geschäft machten diese, und einige davon, so erzählte uns Ali, als er uns am ersten Tag durch den Ort führte, seien zu mehr oder weniger verkappten Bordells verkommen. Die Hotels standen alle am heimelig beleuchteten Bahnhofsplatz, der mir mit seiner kleinen Atatürk-Statue, der gutgehenden Eisdiele, dem Postamt und dem Kaffeehaus auf Anhieb gefiel.
Ali, dessen Vater in Bahnhofsnähe als Nachtwächter auf die Baumaschinen eines Verwandten von Hayri aufpasste, brachte uns in eine Eisenwarenhandlung, in der Meister Mahmut Bretter zuschneiden ließ und Befestigungsschellen aussuchte, mit denen die Einzelteile der Winde zusammengehalten wurden. Außerdem kaufte er vier Säcke Zement, eine Kelle, Nägel und ein Seil. Um sich in den Brunnen hinabzulassen, hatte er allerdings aus Gebze schon ein besonders solides Seil mitgebracht, das um die Windenwelle gewickelt war.
Jemand aus dem Laden ließ einen Pferdewagen kommen, auf den wir unsere Käufe luden. Als die Eisenräder des Wagens über das Kopfsteinpflaster ratterten, dachte ich daran, dass meine Tage hier gezählt waren und ich bald wieder zu meiner Mutter nach Gebze und später nach Istanbul zurückkehren würde. Ich ging neben dem Pferd her, das mit seinen müden schwarzen Augen schon wer weiß wie alt sein mochte.
Am Bahnhofsplatz ging eine Tür auf, und eine Frau mittleren Alters in Jeans kam heraus. Sie drehte sich um und rief in gereiztem Ton: »Wo bleibt ihr denn?«
Als ich mit dem Pferd direkt an der offenen Tür vorbeikam, trat ein junger Mann heraus, vielleicht fünf, sechs Jahre älter als ich, und hinter ihm eine großgewachsene Frau mit roten Haaren, die seine ältere Schwester sein konnte. Sie hatte etwas ganz Besonderes, Reizendes an sich. Die ältere Frau mochte die Mutter der beiden sein.
»Ich finde ihn schon«, rief die schöne rothaarige Frau ihrer Mutter zu und verschwand wieder im Haus.
Vorher aber warf sie mir und dem alten Pferd einen Blick zu, und als sei ihr an mir oder dem Pferd etwas aufgefallen, zeichnete sich auf ihren schönen runden Lippen ein melancholisches Lächeln ab. Lieb sah sie dabei aus.
»Na mach schon!«, rief ihr ungeduldig die Mutter zu, die sich um uns vier, also Meister Mahmut, Ali, das Pferd und mich, nicht weiter kümmerte.
Am Ortsausgang war das Pflaster zu Ende, und das Geratter hörte auf. Wir zockelten die Straße hinauf zu unserer Ebene, und ich kam mir dabei vor, als beträte ich eine andere Welt.
Die Wolken hatten sich verzogen, und unter der Sonne wirkte sogar unser karges Stückchen Erde irgendwie bunt. Aus den Maisfeldern hüpften Krähen auf die Straße und flogen hoch, sobald sie uns sahen. Mir fiel plötzlich auf, dass die Anhöhen in Richtung Schwarzes Meer in seltsames blaues Licht getaucht waren und zwischen den graugelben Böden davor frischgrüne Baumgruppen emporragten. Die Ebene, auf der wir gruben, die blassen Häuser in der Ferne, die zitternden Pappeln, die gewundene Eisenbahnlinie, alles auf der Welt kam mir plötzlich schön vor, und ich ahnte, dass das irgendwie mit der hübschen rothaarigen Frau zu tun hatte.
Dabei hatte ich ihr Gesicht nicht einmal richtig gesehen. Worüber stritt sie wohl mit ihrer Mutter? Mit ihrer ganzen Art hatte sie mich beeindruckt. Die roten Haare hatten in der Sonne geglänzt. Kurz hatte sie mich angeschaut, als sei ich ihr bekannt vorgekommen, als fragte sie mich gleich, was ich hier zu suchen habe, und dabei hatten wir uns in die Augen gesehen, als kramten wir beide in der Erinnerung.
Beim Einschlafen sah ich zu den Sternen empor und versuchte mir das Gesicht der rothaarigen Frau so genau wie möglich vorzustellen.
6
Am nächsten Morgen, unserem fünften Arbeitstag, bauten wir die Winde auf. Sie bestand aus einer Welle mit einem aufgerollten Seil und je einer Kurbel zu beiden Seiten und wurde auf ein Holzgestell aufgebockt. Daneben stand ein Schemel, auf dem man den hochgezogenen Eimer abstellen konnte. Damit wir uns besser vorstellten konnten, wie die Teile zusammenzubauen waren, fertigte Meister Mahmut für uns mit Bleistift eine überraschend gelungene Skizze an:
Ali und ich stellten uns zu beiden Seiten der Winde auf und zogen den vom Meister vollgeschaufelten Eimer hoch, der etwas größer als ein Wasserkübel war. Wenn der Meister ihn randvoll mit Steinen oder Erde füllte, war er so schwer, dass wir unsere liebe Mühe damit hatten. War er endlich ganz oben, erforderte es noch einmal besondere Kraft und Geschicklichkeit, ihn hochzuheben, ohne ihn aus der Halterung zu lösen, und ihn auf den Schemel zu stellen. Wenn uns das unfallfrei gelang, schauten wir uns erleichtert in die Augen und atmeten auf.
Dann schaufelten wir den Eimer erst mal etwas leerer, bis wir ihn hochheben und den Rest in die Schubkarre schütten konnten. Bevor ich den Eimer wieder hinunterließ, rief ich immer: »Er kommt!«, wie Meister Mahmut mir das eingeschärft hatte. Der Meister legte die Hacke beiseite, nahm den Eimer in Empfang und stellte ihn auf den Boden, ohne ihn vom Haken zu nehmen; dann schaufelte er ihn wieder voll. An den ersten Tagen hörte ich noch genau, wie er beim energischen Einsatz von Hacke und Schaufel jeweils ein Stöhnen ausstieß, doch da er Tag für Tag einen Meter weiter in die Tiefe vordrang, war bald kaum noch etwas zu vernehmen.
War der Eimer voll, hob Meister Mahmut meist nicht mal den Kopf, sondern rief nur: »Hochziehen!« Wenn wir oben schon bereitstanden, legten wir uns sofort ins Zeug und hievten den schweren Eimer hoch. Manchmal musste ich auf den Faulpelz Ali warten, denn allein war der Eimer nur sehr schwer hochzubekommen. Arbeitete der Meister unten mal nicht gar so schnell, standen wir beide oben und horchten hinunter.
Das waren unsere einzigen Ruhezeiten, in denen wir auch mal ein paar Worte wechseln konnten. Mir war aber sogleich klar, dass ich Ali nicht nach den Leuten fragen konnte, die wir im Ort gesehen hatten, nach der geheimnisvollen, melancholischen rothaarigen Frau mit den schönen Lippen. Weil ich meinte, er würde sie ja doch nicht kennen? Oder weil ich Angst hatte, seine Antwort könne mir irgendwie wehtun?
Dass mir die rothaarige Frau immer wieder einfiel, wollte ich ja nicht nur vor Ali verbergen, sondern sogar vor mir selbst. Und doch, wenn ich abends vor dem Einschlafen mit einem Auge zu den Sternen und mit dem anderen zu unserem kleinen Fernseher schielte, sah ich wieder, wie die rothaarige Frau mir zulächelte. Ohne dieses liebevolle Lächeln und den fragenden Ausdruck in ihrem Gesicht, als würde sie mich kennen, hätte ich wohl nicht mehr viel an sie gedacht.
Alle drei Tage sah um die Mittagszeit Hayri vorbei und erkundigte sich ungeduldig, wie das Werk denn fortschreite. Wenn wir gerade beim Essen waren, lud Meister Mahmut ihn dazu und bot ihm Tomaten, Brot, Käse, Oliven, Weintrauben und Coca-Cola an. War aber der Meister metertief in der Erde, stellte sich Hayri zu uns an den Brunnenrand und sah stumm und ehrfürchtig hinab.
Sobald der Meister wieder oben war, ging er mit Hayri dorthin, wo Ali den Aushub ablud. Er zerbröckelte eine Scholle zwischen den Händen, verwies auf Farbtöne und felsige Einsprengsel und stellte Mutmaßungen darüber an, wie schnell wir vorankommen und wann wir auf Wasser stoßen würden. Während an den ersten Tagen die Arbeit ziemlich rasche Fortschritte machte, wurden wir am vierten und am fünften Tag von einer Felsschicht gebremst. Meister Mahmut behauptete, nach dieser Schicht würden wir auf feuchte Erde treffen, und Hayri meinte dazu: »Na hoffentlich!« und versprach noch einmal, er werde für uns ein Lamm schlachten, sobald wir fündig würden, und viel Geld würden wir bekommen und Leckereien aus einer der besten Konditoreien Istanbuls.
Sobald Hayri wieder weg war und wir fertig gegessen hatten, ließen wir es ruhiger angehen. Etwas abseits stand ein großer Walnussbaum, unter den ich mich legte. Bevor ich einschlief, schwebte mir ganz von selbst das Bild der rothaarigen Frau vor, in aller Lebendigkeit, mit der verschmitzten Frage im Gesicht, woher sie mich denn kenne. Das machte mich glücklich. Manchmal fiel mir die Frau auch ein, wenn ich in der Mittagshitze schier verkam. Sie musste irgendetwas an sich haben, das mich ans Leben band, mir Zuversicht verlieh.
In der größten Hitze schütteten Ali und ich uns gegenseitig Wasser über den Kopf, das uns alle paar Tage in Plastikkanistern mit Hayris Lieferwagen gebracht wurde, zusammen mit Lebensmitteln wie Tomaten, Paprikaschoten, Margarine, Brot oder Oliven, die wir in der Ortschaft bestellten. Zusätzlich wurden wir von Hayris Frau mit Wasser- und Honigmelonen, mit Zucker, Schokolade und manchmal auch mit hausgemachten Leckerbissen wie gefüllten Paprikaschoten, Reisgerichten oder Schmorbraten versorgt.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: