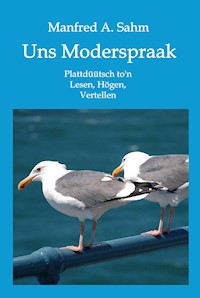3,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist kein Roman, sondern schildert in 18 Fällen die harte Wirklichkeit der kriminalistischen Arbeit bei Aufsehen erregenden Kriminalfällen oder spektakulären Ereignissen. Die Berichterstattungen in den Medien waren gewaltig, egal, ob es sich um Morde an einem Piloten, einem Polizeibeamten, mehreren jungen Frauen oder die »Hinrichtung« einer ganzen Familie handelte. Flugzeugabstürze, von 1971 in Hasloh bei Hamburg bis zu dem Absturz des damaligen Ministerpräsidenten Dr. Dr. Uwe Barschel 1987 in Lübeck, geben Einblicke in die Zusammenarbeit mit dem Luftfahrtbundesamt. Von zeitgeschichtlicher Bedeutung dürften auch heute noch die fremdenfeindlichen Brandanschläge in Mölln und die Brände der Lübecker Synagoge sein. Vielleicht erinnern sich Autofahrer noch an die Anschläge auf der Autobahn A 24, als schwere Gullydeckel von Brücken geworfen oder wahllos Fahrzeuge mit großkalibrigen Waffen beschossen wurden, um das Land SH zu erpressen. Die äußerst seltenen Taten eines Nekrophilen wie auch den Versuch einer DDR-Rockband, ein ehemaliges Bandmitglied aus dem Westen zu entführen, gehören zu den Besonderheiten der Einsätze. Da Manfred A. Sahm in verschiedenen Funktionen, vom Anwärter bis zum Kriminaldirektor, an allen Fällen beteiligt war, versteht es sich, dass es auch gewisse autobiografische Züge enthält, ohne aber nur eine Biografie zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Manfred A. Sahm
Der Krimscher
Spektakuläre Fälle aus Norddeutschland
Erinnerungen eines Kriminalisten
© 2020 Manfred A. Sahm
Umschlag, Illustration: Irmtraut S. Sahm
Lektorat: Michael Sahm, Aachen
Verlag&Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-347-11965-9
Hardcover
978-3-347-11966-6
e-Book
978-3-347-11967-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
Seite Vorwort
Seite Notlandung auf der Autobahn
Seite Erfolg nach 4 Jahrzehnten
Seite Die Leiche auf den Apfelsinen
Seite NATO-Übung »Bold Guard«
Seite Ruhe sanft
Seite Rock-Musik und Kalter Krieg
Seite Botany Bay '87
Seite Delirium tremens
Seite Mord in der Luft
Seite Fremdenfeindliche Brandanschläge
Seite Anschläge auf die Lübecker Synagoge
Seite Ein rätselhafter Tod
Seite Flugzeugabsturz MP Dr. Dr. Uwe Barschel
Seite Absturz eines Hubschraubers
Seite Mord in der Silvesternacht
Seite Der Gullydeckel-Werfer
Seite Der Autobahnschütze
Seite Mord an einem Polizeibeamten
Anhang
»Aller Anfang ist schwer«
Deutsches Sprichwort
Vorwort
Das Wort »Kriminalpolizei« wird meist mit schweren und schwersten Verbrechen, mit Mord, Totschlag, Entführungen, Geiselnahmen bis hin zum Terrorismus in Verbindung gebracht. Dieses in der Gesellschaft vorhandene Bild beruht zu einem großen Teil auf der Darstellung von entsprechenden Straftaten in den Medien, in Spielfilmen und im Fernsehen, aber auch von der Veröffentlichung einer unübersehbaren Zahl belletristischer Schöpfungen.
Auch aus der Werbung kann die Kriminalität – vor allem spektakuläre Straftaten – nicht mehr weggedacht werden, eben: »Crime sells« (genauso wie »Sex sells«). Das Produkt selbst ist dabei Nebensache, es kommt vielmehr darauf an, emotionale oder auch erregende Verbindungen zu schaffen oder mindestens zu suggerieren und damit einen Werbe-/Verkaufserfolg zu erzielen.
Kriminalbeamter – früher wusste ich kaum, wie man das Wort schreibt (wurde immer spaßeshalber gesagt) – und dann war ich selbst einer. Ich war, wie es im norddeutschen Sprachgebrauch heißt, ein »Krimscher«.
Zwar noch als Kriminalanwärter, der eine duale Ausbildung zu durchlaufen hatte, aber immerhin. Ich war stolz, als ich 1969 den Eid ablegen durfte, ich war stolz, als mir eine Kriminaldienstmarke und der Ausweis überreicht wurden.10 Die Aushändigung einer Dienst-Pistole allerdings betrachtete ich mit gemischten Gefühlen! Das erste Mal im Leben eine scharfe Waffe in der Hand zu halten, war zumindest gewöhnungsbedürftig und mit dem Gewehr an der Schießbude auf dem Jahrmarkt nicht zu vergleichen. Obwohl ich in meinem früheren Beruf manchmal Kontakte zu kriminalpolizeilichen Behörden und Dienststellen hatte und dabei die Kriminalisten kennengelernt und festgestellt hatte, dass auch sie nur Menschen »wie Du und ich« waren, war die Berufsbezeichnung für mich doch immer noch faszinierend.
Meine Ausbildung bestand aus »learning by doing«, einem aktiven Mitwirken an der Fallbearbeitung in den Kommissariaten der verschiedenen Deliktsbereiche, die durch theoretischen Unterricht ergänzt wurde. In dieser Form war sie, wie ich ohne falsche Bescheidenheit sagen kann, sehr erfolgreich und hat mir geholfen, die kommenden Fachlehrgänge zu bestehen. Nebenbei bemerkt: Es gab noch keine Computer, Papier und unser Gehirn waren unsere beruflichen Arbeitsmittel. Ich begann in dem Kommissariat, dass sich mit der Aufklärung von Einbruchsdiebstählen befasste, man wusste aber auch , was die Kollegen in den anderen Kommissariaten beschäftigte.
Ich war erst wenige Monate im Dienst, als ich auch schon aus der Ermittlungstätigkeit heraus»gerissen« wurde. Alle Kriminalanwärter gehörten bei einem Tötungsdelikt automatisch zu der neu ins Leben gerufenen Mordkommission. Als absoluter Neuling wurde ich zwar mangels spezieller Fachkenntnisse nicht direkt in der Tatort- und Ermittlungstätigkeit eingesetzt, gehörte aber immerhin zu einer Mordkommission!
Mein Start in einen Beruf, für den ich einen sicheren Job in der freien Wirtschaft aufgegeben hatte, fing ja gut an! Dieser Fall, bei dem ein Täter 5 Personen – eine ganze Familie – wegen einer gescheiterten Beziehung erschoss, hatte nicht nur bei mir einen starken Eindruck hinterlassen.
Ich habe dann fast 30 Jahre meinen Dienst als Kriminalbeamter geleistet, ein norddeutscher »Krimscher« vom Anwärter bis in leitende Funktionen in einem Beruf, den ich aus innerer Überzeugung jederzeit wieder ergreifen würde. Dieser Beruf war eine Berufung im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich im Laufe von 3 Jahrzehnten zusammen »an der Verbrechensfront gekämpft hatte«, zeichneten alle – wie auch mich – eine emotionale Bindung zu dieser Tätigkeit aus. Wir waren mit den Herzen dabei und überzeugt, einen Dienst an unserer Gesellschaft zu leisten. Auch wir haben in bestimmten Fällen selbstverständlich Gefühle entwickelt, ohne aber dabei die gebotene Objektivität zu vernachlässigen! Dafür hatten wir alle einen Eid geschworen, dem wir uns verpflichtet fühlten. Selbst als im Laufe der Zeit sprachlich aus der »Verbrechensbekämpfung« offiziell verordnet und abmildernd eine »Kriminalitätskontrolle« geworden war (wer glaubt schon, dass die Polizei wirklich die Kriminalität kontrollieren kann?!), änderte das nichts an unserer Einstellung und an unserem Engagement. Wie sagte schon der römische Geschichtsschreiber Publius Cornelius Tacitus (55 – 120 n. Chr.):
»Früher litten wir an Verbrechen, heute an Gesetzen!«
Es scheint so, als wenn dieser Spruch immer noch Gültigkeit hat.
Dieses Buch ist weder ein Kriminalroman noch eine erschöpfende Aufzählung der Ereignisse, an deren Bearbeitung oder Aufklärung ich mitgewirkt habe und ist auch nicht chronologisch aufgebaut. Es soll weder ein Tagebuch noch eine Biografie sein, sondern der Unterhaltung dienen. Ich habe mir die (künstlerische) Freiheit genommen, Namen, Orte, Zeiten usw. und auch Einzelheiten oder Zusammenhänge dort wegzulassen oder zu verändern, wo es nicht zum unbedingten Verständnis erforderlich ist oder um auch heute noch Unschuldige oder Zeugen zu schützen.
Und trotz dieser sehr ernsten Thematik gab es auch immer wieder Fälle, die mit ihrem humorigen Inhalt intern für gute Laune sorgten. Das war dann der Ausgleich für erschütternde oder brutale Bilder, der dafür sorgte, dass wir von einem psychischen »Knacks« verschont blieben.
Manfred A. Sahm
Mölln, 2020
Ȇberall lauert Gefahr -
das Glück hält oft nicht lange an.«
Hieron, König von Syrakus,
(269 – 215 v.Chr.)
Notlandung auf der Autobahn
Die Bandbreite der Unfälle von oder im Zusammenhang mit Luftfahrzeugen ist sehr groß. Das reicht von missglückten Starts oder Landungen ohne größere Schäden, über Störungen oder schwere Störungen beim Betrieb des Fluggeräts bis hin zu Abstürzen mit einer großen Anzahl von Getöteten und Verletzten. Im letzteren Fall wird meist von einer »Flugzeugkatastrophe« gesprochen.
In den Kapiteln »NATO-Übung Bold Guard« und »Mord in der Luft« werde ich mich mit einigen Besonderheiten dieser Thematik befassen. Im Laufe meines Berufslebens waren diese beiden Fälle schon etwas Herausragendes. Über andere Ereignisse, die ebenfalls in diese Kategorie eingeordnet werden müssen, lohnt eine ausführliche Darstellung nicht, waren sie doch bei der Bearbeitung im Vergleich zu den wirklich spektakulären Vorfällen weder zeit- noch arbeitsintensiv und interessierten letztlich nur die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.
Dazu gehörten z.B. der missglückte Start eines WESTWIND-Jets vom Lübecker Flughafen Blankensee, der zu militärischen Zieldarstellungen über der Ostsee fliegen sollte. Er bekam zu wenig Schub und konnte nicht abheben, andererseits gelang es den Piloten auch nicht, das Flugzeug noch vor dem Ende der Startbahn abzubremsen. Also rollte er in das angrenzende unbefestigte und mit Büschen bewachsene Gelände und kam erst dort zum Stehen. Auch wenn der Flieger äußerlich kaum Beschädigungen aufwies, war der Sachschaden doch erheblich.
Ein anderer Vorfall an demselben Flughafen, der ebenfalls nur Sachschäden zur Folge hatte, ereignete sich im August 1991. Nach einem Rundflug war für den Piloten der Piper-Sportmaschine und seine beiden Fluggäste der Flughafen schon in Sicht, als plötzlich der Motor stotterte. Durchstarten brachte nichts, der Motor fiel plötzlich ganz aus, kein Wunder bei Benzinmangel. Was folgte, war eine Bruchlandung im hohen Gras einer angrenzenden Wiese. Dabei wurden das Fahrwerk und der Propeller des einmotorigen Flugzeugs zerstört, der Pilot und seine beiden Fluggäste entstiegen dem Wrack unverletzt.
Doch nun zu dem Ereignis 20 Jahre zuvor, das ich mit »Notlandung auf der Autobahn« betitelt habe. Es war der schlimmste Unfall in der Fluggeschichte Schleswig-Holsteins, in Anbetracht der 22 Todesopfer kann man durchaus von einer Flugzeugkatastrophe sprechen (auch, wenn ich mit dem Wort »Katastrophe« stets sehr sparsam umgegangen bin). Der 6. September 1971 war ein Montag, das Wetter durchaus herbstlich, tagsüber manchmal etwas sonnig, aber nachts schon empfindlich kalt. Als der Anruf kam, wollte ich mich gerade auf den Weg zu meinem Friseur machen, um mein damals noch volles Haupthaar etwas stutzen zu lassen. Daraus wurde allerdings nichts! Die Mitteilung: »Flugzeugabsturz in Norderstedt!« veranlasste mich, erst einmal tief durchzuatmen. Ich hatte zwar schon Erfahrungen in der »normalen« Kriminalitätsbekämpfung, aber es war das erste Mal, dass ich mit einem Flugunfall zu tun haben sollte. Was würde die Kollegen und mich erwarten? Ich war noch Sachbearbeiter in dem Kommissariat für Todesermittlungen aller Art und für Kommissionsarbeiten (Mordkommission, Flugunfall-Kommission), hatte demzufolge noch keine Führungsentscheidungen zu treffen, und durfte darauf vertrauen, dass die Führungskräfte der Kriminalpolizei mir schon sagen würden, was ich im Einzelnen zu tun hätte.
Also machte ich mich schnellstens (ich gebe hier zu, unter Missachtung von Geschwindigkeitsregelungen) mit meinem Pkw auf den Weg von meinem Wohnort zur Behörde in die Landeshauptstadt Kiel. Das moderate Überschreiten von erlaubten Geschwindigkeiten konnte ich damals mit der Wichtigkeit des Einsatzes und dem zu heute nicht vergleichbaren geringen Verkehrsaufkommen mir selbst gegenüber rechtfertigen.
Mit zwei anderen Kollegen besetzten wir unseren Tatortwagen, einen blauen Opel-Blitz-Kastenwagen, und fuhren Richtung Süden nach Norderstedt im Kreis Segeberg, das in unserem Zuständigkeitsbereich lag. Heute wäre diese Fahrt einfach gewesen, aber damals gab es die Autobahn A 7 von Kiel nach Hamburg noch nicht. Sie war noch im Bau und erst wenige Kilometer von Hamburg aus in Richtung Norden fertiggestellt. Wir mussten über Bundesstraßen, durch Dörfer und Städte fahren und konnten uns leider wegen fehlender Warneinrichtungen (Blaulicht und Martinshorn) keine Vorfahrt verschaffen. Nachdem wir nach ca. 40 km die Stadt Neumünster passiert hatten, versuchten wir, Funkkontakt zu der Einsatzleitstelle in Bad Segeberg, Rufname »Kalkberg«, herzustellen. Wir wollten uns ordnungsgemäß in ihrem Funkkreis anmelden und das Ziel unserer Fahrt mitteilen.
Aber »Kalkberg« wollte nicht mit uns sprechen sondern wies uns an, uns bei »Rose« anzumelden. Rose?? Wieso Rose? »Rose« war der Rufname der Polizei im Landkreis Pinneberg, für den wir aber nicht zuständig waren. Waren wir evtl. auch für den Flugunfall nicht zuständig? Das klärte sich sofort, als wir uns daraufhin bei der Einsatzleitstelle in Pinneberg meldeten und durchgaben, dass wir auf der Fahrt zum Flugzeugunglück in Norderstedt waren. Wir erhielten die Bestätigung und wurden zugleich dahingehend korrigiert, dass das Geschehen sich nicht in Norderstedt, sondern in Hasloh im Kreis Pinneberg abgespielt hatte! Irgendwie machte sich bei uns Dreien so etwas wie Erleichterung breit! In der Tat war es so, dass sich die Kreisgrenze zwischen Segeberg und Pinneberg auf der Autobahn befand. Die westliche Richtungsfahrbahn nach Hamburg, also nach Süden, befand sich in Pinneberg, der in Richtung Norden führende östliche Autobahnteil gehörte zum Kreis Segeberg. Glück gehabt!! Aber trotzdem fuhren wir weiter, weil wir den Kollegen unsere Unterstützung und unseren Tatortwagen anbieten wollten. Und – ich gebe es gern zu – wir waren auch interessiert, zumal wir noch nie den Ort eines Flugzeugabsturzes (außer im Fernsehen) gesehen hatten. Man konnte ja immer dazulernen!
Wir nutzten zuletzt die fertiggestellte Strecke auf der Autobahn A 7 ab Kaltenkirchen und fuhren direkt »in ein Chaos«. Der Anblick war schlimmer, als wir erwartet hatten! Schon auf der Autobahn lagen Flugzeugtrümmer eines größeren Passagierflugzeugs der Fluggesellschaft »PanInternational«, darunter ein großes Teil des Leitwerks. Der total zerstörte Rumpf der im rechten Seitengraben liegenden Maschine qualmte noch, das abgerissene Cockpit lag auf einer Wiese neben der Autobahn; bis auf die Tatsache, dass es abgerissen war, waren keine Zerstörungen zu erkennen. Nicht nur Rettungsfahrzeuge aller Art von Feuerwehren und Rettungsdiensten waren in sehr großer Anzahl vorhanden, Kraftfahrzeuge einer unzählbaren Menge von Schaulustigen verstopften Straßen und Zufahrtswege, diese Leute standen auf und neben der Autobahn, also unmittelbar am und selbst im Geschehen, und befriedigten ihre Neugier, wobei sie alle Einsatzkräfte behinderten. Gaffer waren und sind auch heute noch ein großes Problem. Es war nicht ganz einfach, von der Autobahn zu einem Ort zu fahren, der nahe genug an der Unfallstelle lag und doch die noch folgenden Arbeiten nicht behinderte. Mehr als einmal hatten wir die Schaulustigen verflucht, die uns die Weiterfahrt versperrten, und nicht bereit waren, uns den Weg freizugeben. Ihre Neugier hatte für sie absolute Priorität!
Es waren Tausende von Katastrophentouristen, die bis in die tiefe Nacht dem Unglücksort zuströmten. Der riesige Rauchpilz und die heulenden Martinshörner der zu dem Ort eilenden Einsatzfahrzeuge waren auch in der nahegelegen Hansestadt Hamburg sehr gut zu vernehmen. Also lohnte sich ein Ausflug mit Kind und Kegel, mit Säuglingen in Tragetaschen und Kindern auf dem Arm oder auf den Schultern. Und nicht nur, dass man interessiert zugeschaut hätte, nein – einige dieser Leute nutzten das Chaos, um sich direkt zwischen den Trümmern, zwischen Flugzeug- und Leichenteilen und verstreutem Gepäck mit »Andenken« zu versorgen! (Ich behaupte, dass Sie es nicht nur auf Andenken abgesehen hatten, sondern auch um zu stehlen, was stehlenswert war!) Sie alle zu vertreiben gelang erst, als die inzwischen durch die Bereitschaftspolizei verstärkten Sicherheitskräfte und herbeigerufene Bundeswehreinheiten das Gelände weiträumig abriegelten. Da die Truppe auch über ein Stromaggregat verfügte, das ich auf Anfrage mitbenutzen durfte, konnte ich unseren Tatortwagen beleuchten und ihn betriebsbereit zur Verfügung stellen.
Wie immer in solchen Fällen, wenn die ganze Szene von Unübersichtlichkeit geprägt ist, vor allem, weil noch niemand der beteiligten Polizei- und Rettungskräfte einen derartigen Einsatz zuvor zu bewältigen hatte, gab es viel Leerlauf im Bereich der Polizei. Zunächst musste geklärt werden, dass die Hamburger Polizei, auch wenn die Beamten wegen der kürzeren Entfernung schneller am Ereignisort waren, außerhalb des »Ersten Angriffs« für die weiteren Maßnahmen nicht zuständig waren und keine Befehlsgewalt über alle eingesetzten Kräfte hatten. So langsam kehrte Ordnung ein. Als der Leiter des schleswig-Holsteinischen Landeskriminalamts dann die Leitung aller kriminalpolizeilichen Tätigkeiten übernahm, ging es zunächst darum festzustellen, wie viele Menschen bei diesem Unfall verletzt und ums Leben gekommen waren. Das war umso notwendiger, als auch noch Stunden nach dem Absturz keine Passagierlisten vom Flughafen zu bekommen waren. Also wurden alle Angehörigen der Kriminalpolizei unseres Landes über den Ereignisort, der wie ein Schlachtfeld aussah, geschickt, um Leichen zu zählen. Das war zum einen eine makabre, psychisch sehr belastende, aber notwendige Aufgabe, die sehr schwer zu bewältigen war. Es lagen ja nicht nur komplette Körper auf dem Boden, sondern auch alle möglichen Leichenteile. Als nach dem dritten »Durchgang« immer noch unterschiedliche Ergebnisse zu verzeichnen waren, kam die Weisung, nur noch Köpfe, einzelne oder noch an den Körpern befindliche, zu zählen. Auf Einzelheiten dieser Tätigkeit will ich hier verzichten. Das Resultat: Es waren 22 Opfer zu beklagen. Um die Erfassung der Verletzten, die in Hamburger Krankenhäuser eingeliefert worden waren, kümmerte sich derweil die Hamburger Polizei. Aber auch das war nicht völlig problemlos. Der Katastrophentourismus mit riesigen Mengen von Fahrzeugen und rücksichtslosem Fahren führte natürlich auch zu Verkehrsunfällen, bei denen Fahrzeuginsassen verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Auch diese wurden zunächst als Opfer des Flugunfalls angesehen und in Obhut genommen (weil sie aus Hasloh kamen) und entsprechend aufgelistet!
Es war schon dunkel und herbstlicher Nebel legte sich über die inzwischen beleuchtete Szene, als die ersten Leichen abtransportiert und in die Leichenhalle des Friedhofs Hamburg-Öjendorf gebracht wurden. Dort war die sog. Leichensammelstelle eingerichtet worden; es war die seinerzeit größte Einrichtung im Norden, die diese Menge von Verstorbenen aufnehmen konnte. Meine und die Arbeit meiner Kieler Kollegen war für diese Nacht beendet, wir fuhren zurück.
Noch am Abend und in der Nacht wurde weltweit von Rundfunk- und Fernsehsendern über den Crash berichtet. Beginnend mit dem nächsten Tag überschlugen sich dann auch die Meldungen in den Printmedien. Und wie immer dauerte es gar nicht lange, bis sich insbesondere die auf den sog. investigativen Journalismus spezialisierten Presseorgane in Vermutungen, Verdächtigungen, Beschuldigungen, kurz in Besserwisserei »vom Feinsten«, tummelten. Es war natürlich für jedermann verständlich – und sollte es eigentlich auch für die Presse gewesen sein – dass die Klärung der Ursachen und der kausalen Zusammenhänge nicht binnen weniger Stunden erfolgen konnte. Aber bevor weder die technischen Fragen geklärt noch mögliche menschliche Faktoren betrachtet wurden, fühlten sich »Fachleute« sogar aus der Fliegerei berufen, ein Endergebnis vorwegzunehmen, die tatsächlich objektiv festgestellten Abläufe in Frage zu stellen, und fanden in bestimmten Medien ihre dankbaren Abnehmer. Selbst amtliche Verlautbarungen wurden angezweifelt und Pressesprecher der Lüge bezichtigt, weil ihr Inhalt nicht zu dem gewünschten Resultat passte. Also: Absolut nichts Neues im Zusammenhang mit Großereignissen, die die Öffentlichkeit stark interessierten!
Die Unfallursache und der gesamte Ablauf, wie es dazu kam, schienen zuerst auf eine Verkettung unglücklicher Umstände zurückzuführen sein, das Verfahren endete dann aber in zwei langwierigen Prozessen vor dem Landgericht Kiel mit Verurteilungen eines Elektrikers und eines Flugzeugmechanikers der PanInternational zu Geldstrafen.
Bevor ich die Chronologie der Ereignisse schildere, zuerst ein paar Fakten zu dem Flugzeug und dem Betreiber – nicht nur für Flugzeuginteressierte. Die BAC 1-11 mit dem Rufnamen D-ALAR war ein zweistrahliges Passagierflugzeug des britischen Herstellers British Aircraft Corporation. Sie hatte ein T-Leitwerk, eine Druckkabine und ein einziehbares Bugradfahrwerk und war ganz aus Metall gebaut. Die beiden Rolls-Royce-Triebwerke waren seitlich am Heck angebracht. In dem Flugzeug, das im April 1965 in Dienst gestellt worden war, fanden bis zu 119 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder Platz. Beim Unglücksflug befanden sich 115 Urlauber und die 6-köpfige Besatzung an Bord. Die 33 Meter lange und knapp 7,50 Meter hohe Maschine hatte eine Flügelspannweite von 28,50 Meter und erreichte eine Reiseflughöhe von ca. 9.000 Metern. Mit einer Tankfüllung konnte sie ca. 2.800 Kilometer weit fliegen. Die Herstellerfirma bot diese Maschinen als äußerst wirtschaftlich im Vergleich zu Konkurrenzmodellen an, weil sie bis zu 15 % weniger Treibstoff verbrauchten. Allerdings ergaben sich dadurch auch Nachteile: das Flugzeug leistete rd. 20 % weniger Schub und hatte demzufolge auch weniger Kraftreserven. Die verschiedenen Typen dieses Fliegers waren weltweit im Einsatz.
Betreiber war die 1968 gegründete Gesellschaft, die ihren Namen nach einem Einspruch der amerikanischen Fluggesellschaft PanAm in »PanInternational« ändern musste. Diese Chartergesellschaft beförderte nicht nur für den eigenen Reiseveranstalter »Paneuropa«, sondern auch für andere Urlauber an ihre Urlaubsziele in Spanien, Griechenland und die Türkei. In den Fernreiseverkehr wollte man damals mit dem Kauf zweier gebrauchter Boeing 707 einsteigen. Wegen geschäftlicher Schwierigkeiten konnten diese beiden Flieger jedoch nicht zugelassen werden und blieben am Boden. Als zu den bisher im Einsatz befindlichen BAC 1-11 noch eine dritte zu der Flotte stieß, verschärften sich die Schwierigkeiten. Der schwere Unfall von Hasloh mit den langwierigen Untersuchungen und Ermittlungen führte dann aber letztlich zur Stilllegung der gesamten Flotte. Verträge konnten nicht mehr erfüllt, die Boeing-Flugzeuge mussten zurückgegeben werden und ab Oktober 1971 stellte man sämtliche geschäftlichen Aktivitäten ein. Einige Jahre später folgte dann der Konkurs der Gesellschaft.
Die Gesellschaft und insbesondere der Unfall standen dann auch im Mittelpunkt innenpolitischer Auseinandersetzungen. Der durch Affären und Skandale bis hin zu seiner Stasi-Tätigkeit bekannt gewordene parlamentarische Geschäftsführer einer der im Bonner Bundestag vertretenen Parteien sollte von der Fluggesellschaft Beraterhonorare im 6- stelligen Bereich erhalten haben. Es wurde vermutet und behauptet, dass er dafür Einfluss auf auf die Wartung – oder besser Nichtwartung – des Flugparks der Gesellschaft genommen hätte. Der mit dieser Sache befasste parlamentarische Untersuchungsausschuss des Bundestages konnte sich damals aber zu keinem gemeinsamen Ergebnis durchringen, Grund dafür: Parteienstreit! Ich lästere jetzt: Das hat sich bis heute nicht geändert!
Aber selbst, wenn das der Fall gewesen sein sollte, auf das Unglück hatten Wartungsmängel oder darauf zurückzuführende technische Unzulänglichkeiten jedenfalls keinen Einfluss gehabt.
Es war bekannt, dass Chartergesellschaften sich bemühten, den Auslastungsgrad möglichst hoch zu halten. Dies bedeutete, die Maschinen so viele Flüge absolvieren zu lassen, wie es eben möglich war. Auch die Unglücksmaschine der Gesellschaft »PanInternational« mit der Kennung D-ALAR war in den Tagen vor der Notlandung sehr viele Stunden in der Luft gewesen. Die Aufenthalte auf dem Boden dauerten meist weniger als eine Stunde. Das bedeutete zugleich enorme Belastungen für das fliegende Personal. Aber auch menschliche Überanstrengung spielte bei dem Unfall keine Rolle, denn die Crew hatte erst in Hamburg das Flugzeug, das gerade aus Düsseldorf gekommen war, übernommen.
Die Untersuchungen ergaben, dass am Flughafen Düsseldorf ein Mitarbeiter der »PanInternational« 100 Liter Kerosin, das als Treibstoff für Triebwerke von Düsenflugzeugen dient, in zwei 60-Liter-Behälter umfüllte, die von einem anderen Mitarbeiter zunächst in das Lager gebracht wurden. Zusammen mit drei weiteren Kanistern demineralisiertem Wasser wurden dann die Kerosin-Behälter am nächsten Tag in den Frachtraum der Unglücksmaschine geladen. Das Wasser wurde benötigt, um leistungsmindernde Wetterbedingungen oder Beladung des Flugzeugs bis an die Obergrenze durch Steigerung der Schubleistung ausgleichen zu können. Die Ermittlungen in Düsseldorf ergaben aber auch, dass sich hier bei dem Wartungspersonal die Schichten überschnitten hatten, ohne dass die Verantwortlichkeiten geregelt waren. So war dann auch die Übersicht über die Kerosin- und die Wasserbehälter nicht mehr vorhanden. Während die Staatsanwaltschaft diese Zustände später als »Kette pflichtwidriger leichtfertiger Handlungen und Unterlassungen« bezeichnete, ist die Bezeichnung »Schlamperei 1. Grades« wohl genauso zutreffend.
In der Tat war es dann in Hamburg erforderlich, das inzwischen in einen Einbautank umgepumpte »Wasser« zu verwenden. Die Chartermaschine war voll beladen, woraufhin sich der Pilot entschloss, einen sogenannten Nassstart durchzuführen, um die Schubkraft kurzfristig zu steigern. Das Wasser sollte dabei zur Kühlung in die Brennstoffkammern gespritzt werden. Stattdessen wurde aber Kerosin eingespritzt! Zwar waren für beide Triebwerke eigene Aggregate vorhanden, die dafür sorgen sollten, dass allenfalls nur ein Motor ausfällt, aber die Einspritzung erfolgte für beide Turbinen aus nur einer Anlage!
Der Flug 112 mit Ziel Malaga / Spanien startete um 18.19 Uhr von der Startbahn 33, doch schon nach knapp 60 Sekunden explodierten kurz nacheinander beide Triebwerke, da der Kühleffekt ausblieb! Der Flieger hatte zu diesem Zeitpunkt eine Höhe von etwa 250 – 300 Metern erreicht. Da eine Umkehr zum Flughafen Hamburg nicht mehr möglich war, entschloss sich die Cockpit-Besatzung zu einer Notlandung. Neben anderen Problemen war vor allem auch die noch an Bord befindliche volle Treibstoffladung ein großes Problem. Bei Notlandungen wird deshalb vor der Landung versucht, das Kerosin bis auf einen kleinen Rest nach draußen abzupumpen. Da die Maschine sich aber nicht lange in der Luft halten ließ, musste diese Maßnahme entfallen. Die Piloten mussten mit der vollgetankten Maschine runter! Was dann der Flugkapitän, übrigens ein ehemaliger Bundeswehrpilot mit Tausenden von Flugstunden, und die Co-Pilotin vollbrachten, war eine absolut fliegerische Meisterleistung. Nach dem Ausfall der Triebwerke blieben nur wenige Sekunden, um den Flieger zu landen.
Als »Notlandepiste« bot sich das genau unter ihnen befindliche, gerade erst fertiggestellte Teilstück der Bundesautobahn A 7, wenige Kilometer nördlich von Hamburg an, die noch wenig befahren war. Es gelang, das Flugzeug nach Unterfliegen einer Hochspannungsleitung unversehrt auf der westlichen Fahrbahn zu landen. Äußerst schwierig aber dürfte es gewesen sein, die Maschine zum Stehen zu bringen. Zwar sind die Scheibenbremsen an den Rädern wesentlich stärker als die bei Autos, aber das weitere Bremssystem, nämlich der Umkehrschub, wobei der Antriebsstrahl der Triebwerke einfach in die entgegengesetzte Richtung umgelenkt wird, funktionierte natürlich nicht! Also schleuderte das Flugzeug unter sehr starkem Abbremsen – wie es Bremsspuren auf der Autobahn zeigten – mit trotzdem noch hoher Geschwindigkeit vorwärts. Doch dann erwies sich eine Autobahnbrücke bei km 45,5 als verhängnisvolles Hindernis. Das Flugzeug prallte schräg auf das Brückenbauwerk, in der Folge wurden beide Tragflächen abgerissen. Ein Brückenpfeiler trennte das Cockpit vom Rumpf, es wirkte wie abgeschnitten oder abgeschlagen. Es drehte sich und landete neben der Autobahn. Auf den vorderen Sitzreihen gab es die ersten toten Passagiere. Das Höhenleitwerk wurde von der Brücke abgetrennt und flog über die Brücke auf die Autobahn. Auch der Rumpf drehte sich nach Aufprall auf einen Baum und kam erst 150 m hinter der Brücke neben der Fahrbahn zum Liegen. Es dauerte noch gut 5 Minuten, bis der Rumpf in Brand geriet. In diesen Minuten gelang es den meisten Fluggästen, sich aus dem Wrack zu retten. Wer das Szenario gesehen hatte, konnte es kaum für möglich halten, dass tatsächlich 99 Menschen diesen Wahnsinns-Crash überlebt haben. Allerdings blieb diese Zahl tagelang nicht verifizierbar – die Schwierigkeiten hatte ich schon angesprochen.
Noch als das Flugzeug in der Luft war, wurde der Notruf abgesetzt. Daraufhin folgten sowohl die Flughafenfeuerwehr vom Airport Hamburg als auch Löschzüge der Hamburger Berufsfeuerwehr der Maschine. Dadurch waren sie relativ schnell an der Unglücksstelle und konnten mit den Rettungsund Löscharbeiten beginnen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Hasloh und den umliegenden Gemeinden sowie Rettungsdienste bis hin zum späteren Einsatz der Bundeswehr ergänzten die umfangreichen Maßnahmen. Bis zu 300 Rettungskräfte waren bis spät in die Nacht im Einsatz. Das Löschwasser musste z.B. mit Tanklöschfahrzeugen herbeigeschafft werden, auch sie wurden von Schaulustigen behindert! Hydranten oder offene Wasserstellen gab es nicht in der Nähe.
Auch wenn hinterher versucht wurde, die Leistung der Cockpitbesatzung, des Flugkapitäns, der Co-Pilotin und des Co-Piloten zu bemäkeln und kleinzureden, ich bleibe dabei, sie haben eine fliegerische Meisterleistung vollbracht. Daran ändern auch die leider zu verzeichnenden 22 Opfer nichts. Und das hat nichts damit zu tun, dass etwa Opfer und Überlebende gegengerechnet wurden.
Für alle Beteiligten bot die Unglücksstelle das Bild eines Schlachtfelds. Bei vielen werden die Bilder auch später immer noch wieder hochgekommen sein. Für jeden galt es, die Erlebnisse zu verarbeiten. Das konnte am besten in der Gruppe erfolgen, gemeinsam mit Kameraden der Feuerwehren oder mit Kollegen in den Dienststellen der Polizei und der Kriminalpolizei. Professionelle Hilfe durch entsprechend ausgebildete Psychologen, Berater oder Seelsorger gab es seinerzeit noch nicht. Jeder musste sehen, wie er selbst für sich damit fertig werden konnte.
Ich will dieses Kapitel nicht abschließen, ohne ein paar Worte der Co-Pilotin zu widmen. Die zum Unglückszeitpunkt 32 Jahre junge Frau war der erste weibliche Flugkapitän in Deutschland. Sie hatte diese Flugkatastrophe überlebt und flog auch nach der Notlandung weiter. Ich hätte nie geglaubt, dass sich nach dem Vorfall in Hasloh noch einmal unsere Wege kreuzen würden. Wer konnte denn in jenem September 1971 ahnen, dass knapp 16 Jahre später, am 31. Mai 1987, sie wiederum als Co-Pilotin ein zweites Mal abstürzen würde. Bei diesem Absturz kam sie dann aber ums Leben.
Darum geht es in dem Kapitel: »Dim the light! – Flugzeugabsturz des MP Dr. Dr. Uwe Barschel in Lübeck«.
Was lange währt, wird endlich gut!
Deutsches Sprichwort
Erfolg nach 4 Jahrzehnten
Wenn eine Mordkommission wegen der Besonderheit eines Falles, eines gewaltigen Arbeitsaufkommens und der schon erwähnten Eilbedürftigkeit nicht mit dem Stammpersonal auskam, mussten schon immer Kräfte von anderen Kommissariaten oder Dienststellen zur personellen Verstärkung zugeordnet werden. Dazu gehörten in schöner Regelmäßigkeit auch sämtliche Kriminalanwärter, die dann, oft zum Unwillen ihrer jeweiligen Ausbildungsleiter, alles stehen und liegen lassen mussten / durften und keiner sagen konnte, wann sie wieder zurück sein würden.
Es war im Juni 1969, als auch mir als Kriminalanwärter diese »Ehre« zuteil wurde. Im Kreis Segeberg, nördlich der Hansestadt Hamburg, war im Vorgarten eines Hauses die Leiche einer 22-jährigen jungen Frau gefunden worden. Ihr Unterleib war entblößt, die Unterwäsche war zerrissen, sie war Opfer eines Sexualmörders geworden! Die Tatortarbeit war den fachkundigen taktischen und technischen Beamten der Mordkommission vorbehalten, wir als »Hilfskräfte« wurden bei der Absuche der näheren Umgebung des Tatortes und bei der Befragung der Anwohner eingesetzt. Auch diese Tätigkeiten waren nicht nur unumgänglich sondern auch dringend geboten. Derartige Befragungen trugen und tragen auch heute noch die treffende Bezeichnung »Klinkenputzen«. Wir gingen von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung, klapperten einen ganzen Ortsteil ab, teilten mit, was der Anlass unseres Besuches war und stellten immer wieder dieselben Fragen: »Haben Sie etwas gesehen? Können Sie sachdienliche Angaben machen? Wer wohnt noch bei Ihnen, den wir auch fragen könnten?«, denn wir konnten uns ja nicht auf die gerade anwesenden Personen beschränken.
Es war wie stets ein mühseliges Unterfangen, nicht immer trifft man jemanden an, weil viele Leute tagsüber zur Arbeit sind. Also – mehrfach versuchen! Überstunden waren vorprogrammiert, da wir oftmals erst am Abend zum Erfolg kamen. Während die Mordkommission weiterhin unermüdlich versuchte, einen Täter zu ermitteln, waren wir Anwärter relativ schnell wieder bei unseren Stammdienststellen. Selbstverständlich aber verfolgte ich den Fortgang der Ermittlungen, schließlich war ich ja auch »stolzes« Mitglied einer Mordkommission gewesen! Und das sogar schon am Anfang meiner Laufbahn.
Eine Erfolgsmeldung blieb leider für Monte aus. Wie hieß es so schön, aber lapidar: die Ermittlungen dauern an. Sie hatten u.a. ergeben, dass der Täter sein Opfer an einer Bushaltestelle traf und in seinem Fahrzeug mitgenommen haben musste. Wo er die junge Frau dann später tötete, blieb unbekannt. Die Rechtsmediziner stellten fest, dass sie vergewaltigt und erwürgt worden war. Hinweise, die auf einen Tatverdächtigen hindeuten könnten: Fehlanzeige! Auch wenn sie seinerzeit noch nicht einem Tatverdächtigen zuzuordnen waren, gab es immerhin eine Reihe von kriminaltechnischen Spuren, die gefunden und gesichert wurden. Sie wurden für den Fall aufbewahrt, dass irgendwann in der Zukunft ein Abgleich möglich sein könnte.
Stattdessen ein neuer Fall: im September 1969 meldeten Angehörige ihre 16 Jahre alte Verwandte als vermisst. In dem gleichen Gebiet des Mordes vom Juni war das Mädchen verschwunden. Da läuteten bei den Kriminalisten sämtlicher Dienststellen alle Glocken!
Dieses Verschwinden der jungen Frau wurde deshalb nicht nur als Vermisstensache bei der örtlich zuständigen Dienststelle bearbeitet, auch wurde sofort wieder eine verstärkte Mordkommission eingesetzt. Und wieder gehörten wir zu den Verstärkungskräften, also sämtliche Kriminalanwärter der Behörde.
Die 16-Jährige wurde zuletzt gesehen, als sie gegen 20.00 Uhr eine Diskothek verließ. Zeugen beobachteten sie zuletzt an einer stark befahrenen Durchgangsstraße, wo sie versuchte, als Anhalterin mitgenommen zu werden. Dass ein derartiges Verhalten sehr gefährlich sein konnte, war allgemein bekannt. Nicht nur die kriminalpolizeilichen Vorbeugungsratschläge, die Medien und auch die Eltern minderjähriger Kinder hatten ständig auf diese Gefahren hingewiesen. Damals war die Motorisierung von Disko-Gängern noch längst nicht auf einem mit heute vergleichbaren Stand. Und das Leistungsangebot des öffentlichen Nahverkehrs mit Bussen, Bahnen oder sogar »Disko-Bussen« ließ doch noch stark zu wünschen übrig! Taxis waren zu teuer.Also, was blieb? Trampen! Und es kam, was kommen musste: in einem der Fahrzeuge, das anhielt, saß ihr Mörder! Davon gingen nicht nur die eingesetzten Polizei- und Kriminalbeamten aus, in der Öffentlichkeit machte sich Unruhe breit!