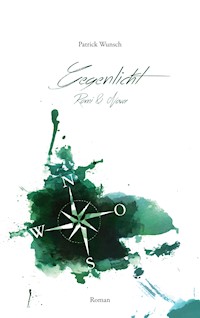0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leon Witt hat es geschafft: Obwohl menschengemachte Kunst eigentlich kaum noch eine Rolle spielt und die meisten Werke von Algorithmen geschaffen werden, ist das 39-jährige Genie zum Superstar aufgestiegen. Die Arbeit bedeutet Leon alles, sodass seine Freundin Valerie ihn geradezu anflehen muss, seine jüngsten Erfolge im Kreise von Freunden gebührend zu feiern. Zur gleichen Zeit plant die Avantgarde, eine Untergrundorganisation, Anschläge auf Wohlhabende – wie Witt. Zum Auftakt soll die abgelegene, idyllische Siedlung Lys, in die sich der mediengejagte Künstler zurückgezogen hat, zerstört werden. Die aufstrebende Zoe nimmt sich der Mission an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
PATRICK WUNSCH
DER KÜNSTLERUNDDIE ASSASSININ
ROMAN
Leon Witt muss sterben. Der Künstler, hoch angesehen, vergiftet das gesellschaftliche Klima. Das findet jedenfalls Mephisto, der Anführer einer Untergrundorganisation, die sich die Avantgarde nennt. Die ambitionierte Zoe erhält die Chance, in der Hierarchie aufzusteigen – wenn sie sich der Aufgabe annimmt. Kein Problem, denkt sie. Aber ist da nicht doch zu viel Gutes in ihr?
1
Es war der zwölfte Juni des Jahres, in dem der Erfolg des Künstlers Leon Witt seinen Höhepunkt erreicht hatte. Gegen achtzehn Uhr lag eine Ahnung von Abend in der Luft. Es kühlte ab. Die Sonne ließ sich träge sinken, wohlverdient am Ende eines Tages, an dem sie sich verausgabt hatte.
In drei Stunden würde ein anderer Stern am Himmel stehen.
»Bitte nicht rasen«, sagte Valerie. »Sterben werden wir alle, aber heute Abend würde es uns besonders schlecht passen.«
Vielleicht hätte der Chauffeur eine verdrießliche Miene gezogen, wäre es nicht Valerie May gewesen, die den Tadel an seinem Fahrstil aussprach. Er warf ein flüchtiges Lächeln in den Rückspiegel. »Sehr wohl, Mademoiselle.«
Mademoiselle, das gefiel Valerie. Zufrieden sank sie ins weiche Polster zurück.
Neben ihr sah Leon auf die Uhr. Leon Witt, der emsige Künstler, sah unablässig auf die Uhr. »Das Leben ist zu kurz für all die Dinge, die wir tun wollen«, sagte er, »wie könnte man da nicht in Eile sein? Man sollte es genießen, wenn man schon einmal gezwungen ist, sich Zeit zu lassen. Zeit ist der größte Luxus.«
Der Chauffeur lächelte erneut.
Valerie war klar, dass Leon das sagte, weil er vor einem öffentlichen Auftritt ohnehin nicht konzentriert arbeiten konnte. Der Abend war für ihn verloren, was das betraf. Nicht ein einziges Mal hatte er sein Notizbuch gezückt, seit sie losgefahren waren.
In der Stadt wurde der Verkehr dichter; der Fahrer bremste ab. Überall Licht und Lichter, Schilder und Warnsignale, kreuz und quer fuhren die Autos – da! Ein Radfahrer, der an Leons Fenster vorbeischoss und knapp den Seitenspiegel verfehlte! Ein Passant mit Einkaufstüten hastete über die Straße, ohne sich umzublicken, ein naives Gottvertrauen an den Tag legend, für das hier und heute keine Rechtfertigung mehr bestehen konnte.
Im Wagen nahm man die Geräusche kaum wahr, man sah das Chaos nur und hatte das Dröhnen und Sausen im Kopf. Alles da draußen wirkte so rau und holprig, die Limousine aber schwebte über den Asphalt.
Die gewaltigen Bildschirme an den Fassaden zeigten Dreisekünder. Models im Bikini grinsten in die Kamera, Männer im Anzug ließen den Blick in die Ferne schweifen. Dann das Produkt: ein Roman, ein Musikalbum, ein Computerspiel, ein Gemälde – das ließ sich so verkaufen –, ein Film. Kommerziell erfolgreiche Kunst bedeutete alles, in dieser Stadt besonders. Als die künstliche Intelligenz die ersten Bestseller schrieb und die Spitze der Charts eroberte, hatten nur Verrückte geglaubt, dass es sich noch zum Guten wenden würde. Doch das hatte es.
Valerie sah die Clips gern. Weil sie so kurz waren, musste jedes Bild, jede Bewegung beeindrucken. Sobald aber Leon erschien, wandte Valerie den Blick ab. Auch wenn er auf den bearbeiteten, dramatisch in Szene gesetzten Fotos und Sequenzen noch besser aussah, sollte sich ihr nicht die Seite ihres Freundes einbrennen, die jeder kannte.
Leon war ein Superstar, der König der Künstler. Schreiben, komponieren, gamedesignen, malen, filmen: Leon beherrschte all das besser als die meisten, die sich auf eine einzige Disziplin fokussierten. Ein renommiertes Magazin hatte ihn den Gott der Kreativität genannt. »Worte wie Blitze«, hatte eine große Zeitung geschrieben, eine andere »die zehn Gebote des Leon Witt« kundgetan.
Von den Metropolen Amerikas bis zu den entlegensten skandinavischen Siedlungen lasen die Menschen seine Geschichten und Gedichte, hörten seine Songs und Kompositionen, spielten seine Spiele, betrachteten seine Gemälde und Zeichnungen und sahen seine Filme und Videos. Sie schwärmten von provokanten Thesen und ewigen Wahrheiten. Sie »verschlangen an einem Stück«, »ließen in Dauerschleife laufen«, »suchteten die ganze Nacht«, »bewunderten ehrfürchtig«, »versanken in Melancholie«. Sie waren »ergriffen«, »inspiriert«.
Es gab Menschen, die sich dafür aussprachen, Leon Witt zum Kanzler oder zum Präsidenten zu wählen, zum Minister wenigstens – für Kunst, scherzten manche, und andere fanden Gefallen an der Idee. Valerie lachte darüber. Jemanden zum wichtigsten Vertreter des Volkes machen, der nichts mehr als seine Ruhe wollte! Solche Stimmen erhoben sich immer, wenn jemand in den Medien ein paarmal etwas Vernünftiges von sich gegeben hatte. Selten aber waren es so viele, und selten war man sich so einig: Das Beste, was dem Land passieren könne, sei die Führung des Künstlerkönigs. »Wer Probleme präzise analysieren und wiedergeben kann, hat sie halb gelöst«, fand man. »Wer das Volk zum Weinen bringen kann, besitzt die Empathie, die gewöhnlichen Politikern fehlt.«
Der Eindruck der Perfektion reichte über Leons eigene Person hinaus, denn er hatte die passende Gefährtin an seiner Seite: Die schöne Valerie begleitete ihn zu allen Veranstaltungen. Val. Immer entzückend auf den Fotos der Paparazzi. Immer witzig in den Interviews der Klatschpresse. Val dichtete keine Sonette, spielte keine Sonaten, entwarf keine Levels, keine Puzzles, keine Quests, malte oder zeichnete nicht und hatte nie einen Camcorder in der Hand gehalten. Für die Öffentlichkeit war sie trotzdem die Seelenverwandte des Künstlers. Sie war genau richtig – fand auch Leons Agent, der penibel darauf achtete, dass Leon nirgendwo allein auftauchte. Und Val ebenso wenig.
Der Wagen hielt auf dem Platz vor dem Gebäude. Leon stieg aus, öffnete Valerie die Tür und reichte ihr die Hand. Valerie ließ sich nicht gern bedienen, Leon aber konnte sie die eine oder andere galante Geste zubilligen.
»Monsieur Witt.« Der Fahrer lehnte sich auf das Dach der Limousine. »Meine besten Wünsche für das Interview. Ich schaue nicht viel fern, aber das werde ich mir ansehen.«
»Ich danke Ihnen.«
Nachdem der Wagen um die Ecke gebogen war, wandte sich Leon um und legte den Arm um Valerie. Nebeneinander stehend, betrachteten sie den Koloss aus Beton und Metall und Glas, der oberhalb der breiten, steinernen Freitreppe aufragte. Die unregelmäßigen Konturen muteten wie Bruchstellen an, als wäre dieser Brocken erst kürzlich mit einer gewaltigen Erschütterung, Staubwolken aufwirbelnd, vom Himmel gefallen. Schwer wie der Mond, ewig wie die Sonne.
Sie stiegen empor und traten ein. Das Abendrot fiel durch die Fensterfront; es hätte das Foyer mit dem spiegelnden Marmorboden dem Eindruck nach zum Glühen gebracht, wäre die Klimaanlage nicht solchermaßen aufgedreht gewesen, dass es Valerie in ihrer kurzärmligen Bluse fröstelte.
Zwei Stockwerke hoch war das Foyer. Treppen führten links und rechts des Empfangstresens hinauf zur Galerie. Wer von dort oben einen Blick in die Mitte der Halle warf, verlangsamte die Schritte, blinzelte, starrte. Einer jungen Frau fiel das Tablet aus der Hand. Ein Mann, der sich über das Geländer beugte, nickte Leon zu wie einem alten Bekannten. Dann kratzte er sich am Hinterkopf, tat einen Schritt nach hinten und verschwand.
Valerie ergriff Leons Arm. »Bist du nervös?«, fragte sie.
Er zuckte die Schulter. »Bin ich ein Mensch?«
Valerie lächelte. »Deshalb sind wir ja hier.«
Zur Linken öffnete sich eine Tür, und eine Frau mit blondem Haar, zum Pferdeschwanz gebunden, eilte herbei. Sie trug eine Brille mit dickem, rotem Rahmen und hatte ein breites, weißes Grinsen im Gesicht. »Entschuldigen Sie bitte!«, rief sie. »Es tut mir ja so leid! Es gab noch einige Details zu klären.« Obwohl sie gewiss viele Prominente willkommen geheißen hatte, schien sie sich über Valeries und Leons Ankunft besonders zu freuen. »Sie wissen ja, wie das ist«, sagte sie. »Man hat alles vorbereitet, geht die Flure auf und ab, weil man nur darauf wartet, dass es losgeht, und dann fällt einem last-minute noch etwas Wichtiges ein.« Sie räusperte sich. »Wie dem auch sei«, sagte sie. »Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt. Rémi kann ein wenig mürrisch sein, aber er ist immer pünktlich. Apropos …« Sie sah auf die Uhr. »Monsieur Witt, Mademoiselle – wenn Sie mir bitte folgen möchten?«
Valerie warf Leon einen konsternierten Blick zu. »Sie hat mich nicht mit Namen angesprochen«, raunte sie ihm auf Deutsch zu.
»Nicht jetzt«, flüsterte er streng, den gutmütigen Ausdruck jedoch wahrend.
Ja, ja, dachte Valerie und verzog den Mund. Haltung.
Die Mitarbeiterin wandte sich im Gehen um, zu Leon, den Kopf geneigt. »Und es soll wirklich Ihr letztes Interview sein?«, fragte sie im Tonfall des Bedauerns.
»Das kann ich Ihnen versichern. Ich brauche Zeit für das nächste Projekt.«
»Ich verstehe. Kann das Publikum von Ihrem aktuellen Werk auch offenkundig nicht genug bekommen, erwartet man mit Spannung, was darauf folgen mag. Man muss auf den Künstler verzichten lernen, wenn man mehr von ihm will.«
»Das hätte ich nicht besser ausdrücken können.«
Die Mitarbeiterin lachte. »Oh, ich bin sicher, das könnten Sie.« Ihr Blick verweilte einen Moment auf Leon. Erwartungsvoll. Womöglich hoffte sie, dass er sich gleich an einer noch treffenderen Formulierung versuchen würde. »Jedenfalls«, nahm sie das Wort zögerlich wieder auf, »fühlen wir uns geehrt, dass Sie das letzte Interview zu Spiegel und Vision in unserer Sendung geben. Wissen Sie, wenn man Ihre Romane aufmerksam liest, kann stellenweise der Eindruck entstehen, dass Sie das Fernsehen nicht besonders schätzen.«
»Das tue ich auch nicht. Doch viele andere tun es. Heute noch führt, wenn man eine große Anzahl Menschen erreichen will, kein Weg an diesem Medium vorbei. Daher bedanke ich mich trotz meiner Vorbehalte herzlich für die Einladung.«
»Sie wollen eine große Anzahl Menschen erreichen«, sagte die bebrillte, grinsende Frau, dass es beinahe wie eine Frage klang.
Valerie wandte sich zum Schmunzeln ab. Ein Interview vor dem Interview!
»Jeder echte Künstler will das«, sagte Leon. »Kunst ist nicht allein die kreative Arbeit, sondern auch eine Mission.«
»Deshalb wünschen Sie das Interview auf Englisch zu führen – obwohl Ihr Französisch wirklich gut ist.«
»Mein Französisch mag nicht schlecht sein«, sagte Leon, »doch auf Englisch fällt es mir leichter. Ich darf nicht riskieren, etwas Falsches zu sagen oder einen Gedanken unklar auszudrücken. Jeder soll exakt das verstehen, was ich meine.«
»Ein unmögliches Ziel!«, lachte die Frau schrill auf, den Eindruck des professionellen Zwiegesprächs zerstreuend.
Leon erwiderte das Lachen nicht. »Nur unmögliche Ziele sind überhaupt eine Anstrengung wert.«
Die Mitarbeiterin des Senders führte den berühmten Gast und seine Begleitung erst in die Garderobe und dann in die Maske. Sie bot Getränke und Canapés an.
»Merci«, sagte Valerie, als sie ihr Glas Champagner nahm.
Sie nippte daran, während sie die Handgriffe der Maskenbildnerin überwachte.
Nachdem das Werk getan war, trafen sich Valeries und Leons Blicke im Spiegel. Sie nickte. Er auch. Das Glas war leer; Valerie fühlte sich ein wenig besser. Die Nervosität, die sie empfunden hatte, war verschwunden.
Und Leon? Sein ruhiges Gemüt wahrte er stets, nun aber war er absolut still geworden. Valerie kannte ihn in diesem Zustand und versuchte nicht, die Konversation wiederzubeleben. Der Missionar bereitete sich vor, indem er schwieg. Auch Valerie lehnte sich zurück. Schloss die Augen. In den Nebenräumen ging es hektisch zu, doch verschwammen die Geräusche, verwässerten mit einer inneren Ruhe, die allmählich beständiger wurde. Die einen zuerst umwand wie warme Wolken und dann umwickelte wie eine weiche Decke.
»Kann es losgehen?« Die Stimme der Mitarbeiterin riss Valerie aus der Trance.
Blinzelnd wandte sie sich zur Uhr. Eine halbe Stunde war vergangen.
»Jawohl«, sagte Leon, der sich erhob. »Fangen wir an.«
»Du wirst das wunderbar machen«, sagte Valerie. »Wie immer.«
Langsamen Schrittes folgte Leon der Mitarbeiterin. Nahe des Ausgangs wandte er sich um. »Ich werde versuchen, dich zum Lachen zu bringen«, rief er.
»Ich würde lieber weinen müssen«, gab Valerie zurück.
»Heute also tiefsinnig?«
»Ich weiß nicht.«
Leon lächelte. »Was denn nun?«
»Ich will beides.«
»Gut«, sagte er. Und verschwand.
Eine Minute verging. Dann war der tosende Applaus bis in die Maske zu hören.
2
Auf der alten Straße wurde der Transporter ordentlich durchgeschüttelt. Er federte schlecht. Oder gar nicht. Über Stein und Wurzel ging es, und das eine ganze Weile. Die Kiefer krachten einem aufeinander, und das Hirn klatschte gegen die Schädeldecke. Dabei hatte Zoe schon dröhnende Kopfschmerzen von der ewigen Schwüle.
»Nimm doch nicht jeden Kiesel mit«, stöhnte Kain.
Babs machte eine verächtliche Grimasse. »Du läufst gleich.«
Don drehte die Musik weiter auf. Hektischer Technobeat, beißende Synthesizer, Rap mit verzerrter Stimme. Es klang genau wie alles andere, was Zoes Freunde hörten. Musik von Maschinen war das, mit der man sich nicht erwischen lassen durfte.
Die Hitze machte träge und gleichgültig. Zoe ließ sich in den Sitz sinken. Presste die Finger auf die Augenlider. Versuchte, regelmäßiger und tiefer zu atmen. Der Stoff des T-Shirts war nass am Rücken und unter den Achseln.
Dann ging es zwischen den Hügeln hinab und in den Wald. Die Steine wurden größer und die Wurzeln dicker. Die Kartons und Kisten im Kofferraum rumpelten und polterten, ab und zu schepperte es.
»Geht da nichts kaputt?«, fragte Zoe.
»Schwachsinn«, antwortete Don.
Babs sagte: »Das wird besser davon.«
Kain lachte.
Zwischen Wald und Moor führte die Straße ein Stück hinauf. Man hatte freie Sicht aufs Tal, das im Abendlicht lag. Es sah aus, als wäre die Sonne runtergestürzt und auf den Bergkamm geschlagen, zerschellt wie ein riesiger Kürbis, blutroten Saft über den Himmel verspritzend. Keiner hatte was gehört, dabei musste es ja einen gewaltigen Rums gegeben haben. Keinen kümmerte es. Die Welt drehte sich weiter, die Menschen gingen ihren Geschäften nach. Das Gesetz der Trägheit galt auch für die Gesellschaft.
»Verdammt«, sagte Don, »seht euch die Sonne an!«
»Wie Feuer«, sagte Babs.
Kain schnaubte. »Die leuchtet nur über Cielterre.«
Cielterre, Himmelserde. Aus der Ferne sahen sie den Ort, in dem reiche Aussteiger sich den Luxus gönnten, nicht mehr Teil der Gesellschaft zu sein. Der »Masse«, wie man sagte, obwohl jeder versuchte, wahnsinnig individuell zu sein.
»Im Schatten«, sagte Zoe, »lebt es sich nicht schlecht, wenn man weiß, wie. Aber bald schnappen wir uns das Licht.«
Von außen sah die Fabrik verlassen aus. Man ahnte, dass hier mal alles voller Arbeiter und voller Maschinen gewesen sein musste. Voller Rohstoffe und voller Produkte und voller Gier nach Profit. Aber jetzt? Der überwucherte Stein und das verrostete Blech, die ganze Ödnis davor und die ganze Wildnis drumherum, das ließ einen glauben, dass hier Jahre und Jahrzehnte lang keine Menschenseele mehr ein- oder ausgegangen war.
Es täuschte den arglosen Betrachter darüber hinweg, dass sich im Inneren dieses grässlichen Gebildes seit einigen Tagen wieder etwas regte. Die ramponierte, kalkverkrustete Muschelschale hatte neue Bewohner, klein und unscheinbar, aber bewaffnet mit spitzen Zähnen und scharfen Giftkrallen, die ohne Vorwarnung jedem ins Fleisch drangen, der einen Blick rein wagte. Die Leichtsinn und Neugier tödlich bestraften, einem den Garaus machten, noch bevor man die glühenden Augen in den Schatten aufblitzen sah.
»Zoe?«
»Huh?«
»Kommst du?«
»Äh, ja, ja!«
Zoe, die jetzt Verantwortung trug, setzte einen skeptischen Blick auf, als sie eintrat. Aber man hatte ihr nicht zu viel versprochen: Die verfallenden Hallen, die sie vor einer Woche zu ihrem Heim erkoren hatten, waren kaum wiederzuerkennen. Sauberer war es nicht, dafür deutlich lebhafter: Überall Jungs, die Hämmer schwangen oder Kisten trugen, und Mädels, die Werkzeuge anreichten oder Regale einräumten. Überall auf den Tischen Leergut, Pizzakartons, Tüten von Fastfood-Ketten und achtlos liegengelassene Handys. Auf dem Boden Pappteller, Plastikbesteck, und, in der Ecke, Rucksäcke, alle auf einen Haufen geworfen. Und was für ein Krach! Die Geräuschkulisse war weit entfernt von der gespenstischen Stille, die einen bei der ersten Besichtigung der Location empfangen hatte.
Babs kam herbei. Sie war mit der Aufgabe betraut gewesen, die Arbeiten zu überwachen. Zoe selbst hatte in der letzten Woche dafür Sorge getragen, dass man den alten Unterschlupf besenrein hinterließ. Dass man alle Spuren beseitigte.
»Und?«, fragte Babs. »Sind wir zufrieden?«
Die Augen richteten sich auf Zoe.
Jemand stöhnte erschöpft. »Ich kann’s nur hoffen. Es war ’ne Heidenarbeit.«
»Eine Heidenarbeit!«, pflichtete jemand anders bei.
»Wir hätten uns ja noch weiter umgesehen …«, meinte der Erste wieder.
»Es ist perfekt«, erwiderte Zoe, »glaub mir.« Nie und nimmer hätten sie auch nur was Vergleichbares in der Nähe gefunden. Eine verlassene Fabrik hinter einem schönen dichten Wald und einem verdammten Moor, besser ging es doch gar nicht.
Zoe nannte den Ort die »Fabrikhölle« und kam sich clever vor. Ein Wortspiel, das nicht einer gewissen Mystik entbehrte, und auf den Punkt brachte, was sich hier bot: Es war düster, es wurde geschrien, es roch nach Schweiß und Schwefel – na, jedenfalls roch es chemisch –, die Hitze war nicht loszuwerden und man hatte aus unerfindlichen Gründen dauernd einen bitteren Geschmack im Mund. In den Ecken kauerten Gestalten, bei deren Anblick sich einem der Magen umdrehte: Das waren die Dämonen. Ein paar Fackeln an die Wände, ein paar Kerzen auf die Tische, dann wäre das Bild komplett.
Zoe hatte diesen Ort geschaffen. Sie hatte ihn gefunden und tatkräftig bei der rudimentären Instandsetzung – kaltes Wasser, schwacher Strom – und der Einrichtung mitgewirkt. Zoe war die erzdämonische Raumgestalterin im Haus des Teufels. Und sie hatte ihre Sache gut gemacht. Hätte man das Zepter jemand anders in die Hand gegeben, Don oder Kain, würden sie jetzt ein Erdloch verstollen oder sich verschlissene Zelte mit Spinnen und Asseln teilen.
Davon abgesehen, hatte Zoe keine Wahl gehabt, als man an sie rangetreten war. Irgendwas mit »vertrauensvolle Aufgabe«, irgendwas mit »Deadline«. Der Auftrag kam von ganz oben. Da fragte man nicht nach. Da zeigte man sich dankbar, fühlte sich geehrt.
»Lasst mal«, sagte Babs zu den Jungs, die ihre Kartons und Kisten wieder auf die Schultern hieven wollten. »Wir gönnen uns jetzt was.«
Das klang gut. Zoe hoffte, der Alkohol würde gegen die Kopfschmerzen helfen. Tabletten hatte sie keine mehr.
Sie setzten sich an einen der abgeranzten Plastiktische, halb beige-, halb moosfarben, die kreuz und quer in der Halle standen. Da öffnete jeder seine Dose mit einem Zischen und begann ohne Umschweife, sich das Bier in die Kehle zu schütten. Don exte seins. Babs brauchte keine Minute für ihrs. Und auch Kain nahm den letzten Schluck, noch bevor so was wie eine Unterhaltung zustande gekommen war. Worüber hätte man sprechen sollen, nüchtern? Erst ab einem gewissen Pegel fing Geselligkeit an, Spaß zu machen. Also gleich das zweite hinterher! Zoe wurde schwindlig, als sie sich nach dem Kasten streckte. Bloß nichts anmerken lassen! Die spöttischen Bemerkungen der Freunde – oder wen man so nannte – konnten einem zusetzen, wenn man einen schwachen Moment hatte. Den Schatten von Stolz zerstreuen, den man empfand, weil man dazugehörte.
Zoe und die anderen lästerten, lachten, rauchten, soffen. Es hatte nicht lange gedauert, bis alle vier voll genug waren, die schelmischen Masken abzulegen und sich kameradschaftlich zu vergnügen. Man tauschte Zigaretten und Komplimente aus und stieß mit jeder Dose an, auch mehrfach. Ein Schleier trunkener Heiterkeit legte sich über die Gruppe, aus dem man den Rest der Fabrikhölle kaum mehr wahrnahm.
»Hey, sagt mal«, lallte Kain, das Kinn reckend, »warum ist denn die Flimmerkiste aus?«
Den Namen hatte sich der pummelige Junge mit dem ordentlich gekämmten Haar, den Knopfaugen und den Wangen, die wie Apfelwachs glänzten, selbst gegeben. Wenn man ihn fragte, wie er früher genannt wurde, bekam man keine Antwort. Zoe hätte geraten, dass er Felix oder Kai oder Kevin hieß. Nur so ein Gefühl.
»Wer sagt denn ›Flimmerkiste‹?«, lachte Babs. Sie kratzte sich den Arm. Die ganze Zeit kratzte sich Babs irgendwo. Zoe konnte sie sich gar nicht in stiller Haltung vorstellen. Das Mädel kratzte sich die Arme, die Taille, die Beine. Sie zupfte an der Haut zwischen ihren Fingern. Sie beugte sich unter den Tisch, um über die Knöchel zu reiben.
Dons Zottel hingen ihm ins Gesicht. Sie waren pechschwarz, aber übersät mit Schuppen. Er griff träge nach der Fernbedienung. »Feierabend!«, rief er mit dröhnender Stimme in die Halle. »Ich mein’s ernst, ihr Dumpfbacken! Hört auf mit dem Krach!« Dann schaltete er ein.
Zwei Personen saßen da. Ein Interview. Ein bekanntes Studio, blau und weiß und golden. Zoe kannte die Sendung. Irgendwas mit »Welt«? »Zeit«?
Schnitt: die Moderatorin. Brünett, seriöser Blick, nur die Bluse zu weit offen. Sie hielt die Karten locker in der Hand. Aufrichtiges Interesse, oder gut gespielt. »Es ist immer wieder die Rede davon, dass Ihre Literatur recht anspruchsvoll sei«, sagte sie, den Kopf geneigt, »und dass Figuren, die aufgrund ihrer Anstrengungen und Leistungen bewundert werden, darin besonders positiv dargestellt würden. Ihre Bücher erfreuen sich größter Beliebtheit, obwohl das theoretisch nicht sein dürfte: Die Leistungsgesellschaft steht in der Kritik, die Menschen sehnen sich nach einem lockeren Umgang miteinander, auch im Beruf, nach einer guten Work-Life-Balance, nach der Erlaubnis zum Müßiggang. Da werden sich einige unserer Zuschauer fragen, was der große Leon Witt denn wirklich über Anstrengung und Leistung denkt. Hat, wer aufgrund seiner harten Arbeit und seines Durchhaltevermögens erfolgreich ist, Bewunderung verdient? Oder schadet es unserer Gesellschaft, dass wir ehrgeizige Ambitionen verherrlichen? Stichwort Burnout, Mr Witt. Depression infolge von Arbeitslosigkeit. Die Schere zwischen Arm und Reich.« Obwohl die Moderatorin in schnellem Englisch sprach, verstand Zoe jedes Wort.
Schnitt zu Witt. Der Anflug eines Lächelns umspielte die grüblerischen Züge, erhellt und geschärft durch die Studioscheinwerfer. Das dunkle Haar, kinnlang, war ordentlich zu den Seiten gekämmt. Eine Strähne bog sich mit goldenem Schimmer über die Wange, eine kleinere folgte dem Beispiel. Mit dem natürlichen, nur gestutzten Bart sah der Kerl nicht übel aus. Wie jemand, der eine Menge erlebt hatte, aber nie in Schwierigkeiten geraten war. Jemand, der bei Wein und Weißbrot endlos von faszinierenden Orten und unterhaltsamen Begegnungen erzählen konnte. Wie ein Künstler eben. »Nun«, begann er, »ich habe diesbezüglich eine Meinung, möchte das Publikum jedoch auffordern, sich eine eigene zu bilden.« Zoe hatte nicht gewusst, dass Witt eine so tiefe Stimme hatte. Eine Stimme von dunkler, warmer Farbe. Wie heiße Schokolade oder so.
»Was ist denn Ihre Meinung, Mr Witt?«, fragte die Moderatorin. Sie beugte sich vor und fixierte ihr Gegenüber mit einem verschwörerischen Schmunzeln.
Der Künstler dachte nach. Eine ganze Weile saß er still da, nur ab und zu blinzelnd. Er hatte grüne Augen. Blassgrün. Wie Klee.
Im Publikum räusperte man sich. Die Kamera zeigte, wie die Herren sich irritiert umsahen und die Frauen miteinander tuschelten. Witt ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen.
Dann endlich sprach er, langsam, aber ohne innezuhalten. »Jeder Mensch soll sein Potenzial ausschöpfen. Dazu benötigt er einen Anreiz, zumindest ein Vorbild. In allen Bereichen des Lebens muss es eine Hierarchie der Kompetenz geben, die Orientierung bietet. Man soll sich die Frage stellen: Was will ich erreichen? Und die Antwort soll lauten: ›Ich will ebenso gut werden wie der Meister meines Fachs – und dann versuchen, ihn zu übertreffen.‹ Wenn hingegen behauptet wird, jeder Ansatz, ein Problem zu lösen, sei auf irgendeine Weise wertvoll, gibt es nur Wege – viele davon –, doch kein Ziel. Die Ambitionen schwinden. Und Ambitionen braucht es, denn ohne jemandes Zutun wendet sich nichts zum Besseren. Wir haben einiges erreicht in den vergangenen Jahrhunderten, vor allem in den vergangenen Jahrzehnten, doch es gibt noch genug zu tun.«
»Das habe ich nicht kapiert«, sagte Kain.
»Ich habe gar nichts kapiert«, lachte Don. »Diese englischen Philosophenbegriffe!«
»Pssst!«, machte Babs.
»Sie klingen fast wie ein politischer Aktivist, Mr Witt«, sagte die Moderatorin. »Oder wie ein Prediger.«
»Man belächelt Aktivisten und Prediger, obwohl man weiß, dass solche Impulse wichtig sind.«
Die Moderatorin nickte bedächtig. Für einen Moment war die professionelle Fassade verschwunden. »Sie arbeiten praktisch rund um die Uhr an neuen Werken«, sagte sie unvermittelt, »zumindest hört man das.«
Der Künstler warf einen kurzen Blick in Richtung Publikum. »Es trifft zu, dass ich viel Zeit für meinen Beruf aufwende, wie es die meisten tun.«
»Tun Sie denn noch etwas anderes?«
»Das kommt selten vor«, gab der Künstler zu. »Meine Freundin ermahnt mich jeden Tag, allerdings …« Wieder der Blick ins Publikum. Dann verstummte er und machte eine hilflose Geste.
Schnitt. Das Gesicht einer jungen Frau in der ersten Reihe. Irgendwo hatte Zoe die doch schon mal gesehen?
Zurück zur Moderatorin. »Mr Witt«, fragte sie mit gespielter Fassungslosigkeit, »was treibt Sie nur an, sich so in die Arbeit zu verbeißen, dass Sie, wie manche sagen würden, das eigentliche Leben vernachlässigen? Sie beherrschen das künstlerische Handwerk, doch könnte es nicht sein, dass die Kunst auch Sie beherrscht?«
Die Frage brachte Witt erneut ins Grübeln. Diesmal schien er keine passende Antwort zu finden. Er schüttelte träge den Kopf, zuckte die Schulter. »Wissen Sie, ich glaube, es ist die Angst vor dem Tod.«
Die Moderatorin wartete auf eine Erklärung, die nicht kam. Sie räusperte sich. »Wie meinen Sie das?« Die Angst vor dem Tod: nicht das beste Thema für die Abendunterhaltung. Doch ihr Interesse schien aufrichtig.
»Kunst schützt natürlich nicht vor dem Sterben«, räumte Witt ein. »Allerdings bietet jede erfolgreiche Veröffentlichung einen gewissen Schutz vor dem Vergessenwerden. Und ist nicht das der eigentliche Tod, wenn man vergessen ist? Wenn man alle Bedeutung verloren hat?«
Die Moderatorin schluckte.
Leon Witt fuhr fort: »Man will Spuren hinterlassen. Für eine Künstlerseele kann das nur ein Werk sein. Das eine Meisterwerk – oder, wenn es einem gelingt, das in sich schlüssige Gesamtwerk. Das Œuvre.« Sein Blick schweifte in die Leere des Raums. »Ich weiß, dass es hochmütig klingt, doch ich glaube, dass es mir gelingen kann, dieses in sich schlüssige Gesamtwerk zu schaffen, von dem jeder Künstler träumt. Ich glaube, es fehlt nicht mehr viel.«
»Gott«, sagte Kain, »was für ein Schwachsinn.«
»Pssst!«, machte Babs.
»Ist doch interessant«, fand Don. »Das mit dem Tod und so.«
»Interessant?« Zoe sog scharf Luft ein. »Lass das nicht den Meister hören.«
»Ach!«, stieß Babs hervor und verdrehte die Augen. »Der Meister!«
»Babs!«, zischte Zoe und starrte ihre Freundin mit offenem Mund an. Aber Babs konnte sich solche Kommentare erlauben. Babs hatte es geschafft, wenn auch nicht auf die anständige Weise. »Was denn?«, fragte sie und sah flüchtig die Treppe hinauf. »Hört doch keiner.«
Die Werbepause zog sich in die Länge. Erst als Kain schon aufstöhnte, ging es weiter. Die Blicke hefteten sich an den Bildschirm. Während der Künstler sprach, vergaß man, zu trinken und zu rauchen. Ab und zu gab es Gespött und Gelächter, aber verhalten, und Zoe hatte keine Zweifel, dass die wortgewandten und klugen Ausführungen die anderen in Wahrheit genauso beeindruckten. Er musste sie sich nach Absprache der Fragen zurechtgelegt haben. Oder konnte dieser Kerl die komplexesten Sachverhalte aus dem Stegreif so treffend beschreiben und erklären? Man sagte über Leon Witt, dass er brillant sei, aber Zoe hatte sich nie für Prominente interessiert. Auf der Straße würde sie den berühmten Künstler nicht erkannt haben.
»Den Tod, das heißt: das Vergessen zu fliehen, ist natürlich die stärkste Motivation«, sagte die Moderatorin. »Doch auch vor diesem Hintergrund leisten Sie ja Erstaunliches, Mr Witt. Ich bin sicher, das Publikum würde mir da zustimmen.«
Das Publikum stimmte zu. Applaus brandete auf.
»Herzlichen Dank«, sagte der Künstler, den Rängen zugewandt. »Wirklich, ich empfinde Ihren Beifall als großes Kompliment. Allerdings …« Seine Züge hatten sich schon aufgehellt, jetzt aber schimmerte ein Schmunzeln darin. Es wirkte fast verlegen. »Allerdings«, setzte er neu an, »ist mir ein unbeschreibliches Glück beschieden, und dieses Glück ist eine gewisse Person, die Sie alle kennen.« Er hatte den Kopf gedreht, sah seine Freundin an. »Wenn die Schicksalsgöttinnen – angenommen, dass es sie gibt – nicht die Güte hatten, sie mir selbst zur Seite zu stellen, so müssen sie rasend sein vor Wut, dass jeder Funke Glück, der einem Menschen gelegentlich zuteilwird, durch die Gegenwart und Wirkung dieser jungen Frau stets verdoppelt und verdreifacht wird, um sich zu rauschender Flamme und anhaltender Glut zu wandeln. Nur so konnte ich werden, wer ich bin, und nur so kann ich es sein.« Die Nüchternheit seiner Stimme war dahin.
Da zeigte man die Freundin, noch gerührter als der Künstler selbst. Mit Tränen in den Augen lächelte sie.
Witt sprach weiter: »Ohne Valeries immerwährende Rücksichtnahme und Unterstützung wäre da gar nicht die Zeit, die für kreative Arbeit, wenn das Werk gut werden soll, unbedingt notwendig ist. Gewiss würde ich mich an den schwierigen Themen verheben, die ich anzugehen pflege. Mit all den hochtrabenden, doch unausgereiften Gedanken stünde ich da wie ein dummer Esel. Was nicht heißen soll«, fügte er rasch hinzu, »dass alle Esel dumm sind, nur wäre ich ein solches Exemplar.«
Wieder die Freundin. Eine Träne rann ihr über die Wange, gleichzeitig aber lachte sie, den Mund hinter der Hand verbergend. Dann blies sie einen Kuss zur Bühne. Es war furchtbar kitschig. Und irgendwie schön anzusehen. Zoe hätte das nie zugeben können, nicht hier. Sie erwartete, dass jemand sich die Fernbedienung krallen und mit einem höhnischen Kommentar ausschalten würde.
Es geschah nicht.
Man hielt der Freundin ein Mikrofon hin. Klar. Die Zuschauer wollten hören, was eine Frau, die vor laufender Kamera mit süßen Komplimenten überschüttet wurde, sagen würde. Sie tat ihr Möglichstes, die Fassung wiederzuerlangen. Natürlich versuchte sie, einen Teil der Lorbeeren zurückzuschieben, erzählte von der »To-do-Liste« des Künstlers, die ihm »heilig« sei. Sie benutzte allen Ernstes diesen Ausdruck, und irgendwie beeindruckte Zoe das. Sie hatte das Bild eines Mönchs in einem Tempel vor Augen, hoch oben auf einem schneebedeckten Gipfel. Er saß da, im goldenen Sonnenaufgang, und betete. Frostböen peitschten über sein Gesicht, Raureif bedeckte die Wangen und die nackten Arme, Eiszapfen hingen in seinem Bart, aber der Mönch zitterte nicht mal. Stählerne Disziplin. Er hätte allem trotzen können. Auch dem Tod.
War Leon Witt so jemand?
Obwohl sie äußerst hübsch war, wirkte die Freundin, solange man sie sprechen ließ, ganz und gar nicht dumm. Aber Sendezeit war kostbar. Man wollte den eloquenten Künstler wieder zu Wort kommen lassen. Wer jetzt erst einschaltete, sollte hängenbleiben.
Eine halbe Stunde später war das Interview zu Ende, und die Moderatorin kündigte die nächste Sendung an. Da schaltete Kain aus. Zoe starrte noch einen Moment auf den schwarzen Bildschirm. Auch die anderen schwiegen. Nippten an ihren Dosen. Drückten ihre niedergebrannten Zigaretten aus. Die Sonne war untergegangen, eine einzige Neonröhre konnte die große Halle kaum erhellen. Es war fast still.
»Der Meister schätzt Künstler nicht besonders«, sagte Babs irgendwann. »Jemanden wie Leon Witt verachtet er bestimmt sogar. Aber … Ich weiß nicht …«
»So dumm kommt er mir nicht vor«, traute sich Don zu sagen.
»Weil du nicht verstehst, wie dieses und jenes zusammenhängt«, brummte Kain. »Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manchmal ist es Scheiße.«
»Ein weiser Spruch!«, höhnte Don. »Und die geschliffene Sprache! Bist du vielleicht heimlich auch ein Künstler?«
»Das nimmst du zurück!«, schrie Kain und schlug die speckige Faust auf den Tisch. Seine Knopfaugen funkelten.
Don erhob ebenfalls die Stimme. »Ich nehme keinen Witz zurück! Lern, damit umzugehen!«
Zoe hasste solches Gebrüll. Man konnte zornig sein, aber nicht wütend.
»Lern du, damit umzugehen, dass ich dir eine reinhaue, wenn du deine verfluchten Witze auf meine Kosten machst!« Plötzlich hielt Kain inne. »Huh?«
Da drehten sich die anderen um, Kains Blick folgend. In dem Moment fiel das Eingangstor mit einem Donnern zu. Zoe kannte jeden in der Gruppe, und diese Frau gehörte nicht dazu. Die Fremde durchschritt die Halle, als hätte sie hier das Sagen. Sie war von der Brust bis zu den Stiefeln in purpurnes Leder gekleidet. Der Schnitt erinnerte Zoe an eine – wenn auch freizügige – Rüstung oder einen Kampfanzug. Die Sohlen der Stiefel mussten hart wie Eisen sein, dass sie trotz des gemächlichen, leichtfüßigen Gangs so einen hämmernden Lärm verursachten. Die mysteriöse Frau würdigte die vier, die am Tisch saßen und sie anstarrten, nur eines kurzen, abschätzigen Blickes, sah die leeren Bierdosen und den vollen Aschenbecher. Dann war sie vorüber. Sie stieg, Eisenstiefel auf Eisenstufen, die Treppe hinauf. Man hörte, wie die Tür zum Thronsaal geöffnet wurde und die Frau eintrat. Geklopft hatte sie nicht.
Don stand der Mund offen.
»Wow«, sagte Kain.
Babs schnaubte verächtlich.
»Das wird eine neue Geschäftspartnerin sein«, bot Zoe als Erklärung an. »Oder eine neue Paladinin. Nummer sieben.«
»Hm-hm«, machte Kain. Er schien was anderes zu denken.
Babs auch. »Wer so rumläuft, ist nur auf eine Art von Geschäft aus«, sagte sie.
»Schwachsinn«, raunte Zoe.
Don stand immer noch der Mund offen.
Gegen Mitternacht war die Stimme des Meisters zu vernehmen. Sein Geschrei und sein Gelächter kamen von oben, hallten durch die Fabrik. »In Cielterre!«, rief er mit dem Dröhnen eines stählernen Drachen. Er lachte und lachte, aus vollem Hals, erst tief und bebend, dann höher. Immer höher. Giftig. Grell. Schrill.
Zoe und die anderen waren am Tisch eingedöst. Sie sahen auf und tauschten irritierte Blicke aus. Zogen dumme Fratzen, weil sie trunken und müde waren und nicht wussten, ob sie träumten.
In diesem dämmrigen Zustand lauschten sie. Erst schienen es nur Laute zu sein, die man aus dem Gemach des Meisters hörte, eine fortwährende Tirade ohne Bedeutung.
»Gott«, glaubte Zoe dann zu verstehen, »töten«. Sie stand auf, ging näher an die Treppe heran.
»In Cielterre!«, rief der Meister. »Ein Zeichen! Das muss ein Zeichen sein!« Ein Lachen flammte auf wie ein Inferno. Der wilde Schrei eines Wendigos erschütterte Zoe bis ins Mark. Und dann brüllte der Meister mit der Stimme eines Wahnsinnigen: »Gott ist nicht tot, er ist hier! Doch wir werden ihn töten!«
3
Die Lagune lag zweihundert Meter von der Villa entfernt. Zwar hatte das geräumige, lichterfüllte Landhaus zwischen antikem Charme und hochmodernem Komfort Leon und Valerie von Anfang an gefallen, doch war in den Wochen zuvor bereits eine Reihe anderer, nicht weniger attraktiver Immobilien in die engere Auswahl gekommen. Die Entscheidung fiel nicht leicht. Die säulengesäumte, schattengeprenkelte Terrasse und der weitläufige Garten, der bis an den Strand reichte, luden auf verlockende Weise zum Trinken und Flanieren ein, doch am Ende war die abgelegene Lagune, in der sich der Himmel türkisblau spiegelte, das ausschlaggebende Argument gewesen. Der Anblick hatte Valerie völlig gebannt, ehe sie sich wandte und in stürmischer Begeisterung Leons Hände ergriff.
Schmunzelnd und schulterzuckend fügte er sich dem Wunsch seiner Freundin. Noch am selben Abend unterzeichnete er den Vertrag.
Auch dieser Morgen begann für Valerie mit einem ausgiebigen Bad. Sie genoss die Wärme des Wassers und die Frische der Luft, die wie mit Zauberkraft die Müdigkeit und die Kopfschmerzen vertrieben.
Mirelle saß gegenüber, die Assistentin der Regie, die sich sowohl vor als auch nach den Sendungen um die Gäste kümmerte. In diesem Fall hatte sie einige freiwillige Überstunden gemacht, die ihr von den Gästen selbst auf unterschiedliche Weise vergütet worden waren. »Berühmt wird«, sagte sie, »wer die Masse anspricht, und die hat keine Ambitionen mehr, ihren Horizont zu erweitern. Die Menschen sind besessen von Selbstoptimierung, aber statt über Kunstwerke und Ideen unterhalten sie sich über Fitness-Gadgets und Trainingserfolge. Sie sind zu oberflächlich und zu einfältig, um zu begreifen, dass sie nicht nur an ihrem Körper, sondern auch an ihrem Geist arbeiten sollten. Deshalb«, sagte sie, »ist es eigentlich unmöglich, als Künstler noch groß und gut zu sein. Eigentlich …«
»Hmmm«, machte Valerie. Sie hatte sich an den Felsen gelehnt und die Augen geschlossen. »Dann hatten wir wohl Glück.«
»Ich will nicht abstreiten, dass Glück im Spiel war. Aber auch eine Menge harter Arbeit, nicht?«
Valerie schmunzelte. »Dann hatte ich wohl Glück.«
Noch immer war sie nicht vollkommen sicher, ob Mirelles Interesse echt war. Vielleicht hoffte sie, mit dem großen Künstler in Kontakt zu bleiben, wenn sie einen Draht zu dessen Freundin hatte. Eine wie Valerie kümmerte das nicht. Eine Frau, die ihren Wert kennt, dachte sie, kann sich ab und zu darunter verkaufen, ohne dass es an ihr nagt.
Außerdem genoss Valerie die Zeit mit Mirelle. Es war ein bisschen wie früher.
Ein kleines bisschen jedenfalls, wenn man es darauf anlegte.
»Ich beneide dich«, sagte Mirelle. »Jeder beneidet dich. Aber mir zerreißt es jetzt, wo ich dein Glück aus der Nähe gesehen habe, das Herz.« Sie seufzte. Einen Moment lang schwieg sie. Schwiegen beide. Dann sagte Mirelle: »Ich hatte mir das alles anders vorgestellt. Den Job. Die Großstadt. Die Möglichkeiten.«
Die Offenheit überraschte Valerie. Sie rang nach den richtigen Worten. »Viele träumen genau von deinem Leben. Und beneiden dich.«
»Aus dem Neid anderer entsteht kein echtes Glück.«
Die frische Luft wehte kühl über die nackten Schultern. Auch an diesem Morgen spiegelte sich der Himmel türkisfarben in dem warmen Wasser der Lagune. Dem Zauberwasser.
Valerie spritzte es Mirelle entgegen. »Hör auf zu jammern, du dummes Ding.«
Mirelle kreischte und lachte.
Eine Stunde später gingen die zwei den Strand entlang Richtung Villa. Mirelle blieb stehen. »Oh«, sagte sie, »meine Sandalen.« Sie machte Anstalten, umzukehren.
»Nächstes Mal«, sagte Valerie. »Wenn es dir beim Fahren nichts ausmacht.«
»Das nicht. Aber …«
»Es wird sie niemand stehlen.« Valerie stand da, eine Hand in die Hüfte gestemmt, und nahm demonstrativ einen tiefen Atemzug. »Hier nicht.«
Das sah Mirelle ein, und sie kam schlendernd wieder gleichauf. »Wenn es nur überall so sein könnte«, sagte sie.
Valerie schnaubte betrübt. »Wenn nur …«
Im Garten verabschiedeten sie sich. Valerie überließ es Mirelle, die Umarmung zu lösen, die aber dachte das Gleiche, und so standen sie lange da, barfuß im Gras. Ein milder Wind wand sich um sie. Fuhr durchs feuchte Haar. Streifte die sonnengeküsste Haut.
»Au revoir«, hauchte Valerie schließlich.
»Au revoir«, antwortete Mirelle.
Dann war Valerie allein. Wie gewohnt.
Nach dem Bad in der Lagune blieb Valerie meist eine Weile am Strand. Nahe der Treppe, die von der Villa hinabführte, befand sich eine kleine Hütte, und in der Ecke der Hütte stand eine hölzerne Truhe, in der Valerie ein Tablet aufbewahrte. Damit setzte sie sich dorthin, wo die Wellen sich auf den Sand warfen und sich nach den Beinen streckten. Sie beantwortete Nachrichten und E-Mails, sah sich die neuen Bilder von Freunden und Prominenten an – oft traf beides zu –, stöberte in Shops und las Artikel in Zeitungen und Magazinen.
Valerie war nicht nur neugierig, sie war wissensdurstig, zumindest in den Morgenstunden. In den sozialen Medien folgte sie einigen Künstlern, auch provokanten, und einigen Wissenschaftlern, auch obskuren. »Oh«, sagte sie manchmal, wenn sie durch ihren Feed scrollte. »Sieh an.« Die klügsten Zitate und die kuriosesten Fakten teilte sie mit Leon, der das meiste bereits zu wissen, sich jedenfalls nie zu wundern schien.
So verging der Vormittag wie viele zuvor. Auch diesmal hatte Valerie nur wenig Interessantes entdeckt. Sie brachte das Tablet zurück an seinen Platz und begab sich Richtung Garten. Abermals lenkte sie ihre Schritte vom feinen, weißgoldenen Sand auf das weiche Gras, das unter dem Sprühnebel der Sprinkler smaragdgrün funkelte. Sie überquerte den Rasen, entkam der prallen Sonne, die auf Stirn und Scheitel brannte, und erschauderte im Schatten, den ihr die Überdachung der Terrasse entgegenwarf. Sie trat auf die kühlen Feinsteinplatten, nickte im Vorbeigehen den lorbeerbekränzten, togagewandeten Alabastermädchen zu – Aphrodite, Athene und Artemis in ihrer Jugend, hatte der Makler erklärt – und begab sich hinein.
Leon war gelungen, was noch vor einigen Jahren undenkbar schien. In einer Welt der ausgefeilten Algorithmen, die innerhalb von Sekunden und am laufenden Band perfekt auf psychologische Mechanismen abgestimmte und dem Zeitgeist entsprechende Kunst erzeugten, hatte die Unvollkommenheit des menschlichen Künstlers tatsächlich eine Glorifizierung erfahren. Agenturen machten Designer, Entwickler, Fotografen, Maler, Musiker, Regisseure und Schriftsteller bekannt, die es – so fand man – beinahe so gut hinbekamen wie die Maschinen, aber authentisch waren, eben Menschen wie man selbst. Das war, wie auch die zynischsten Zeitgenossen zugaben, durchaus etwas wert.