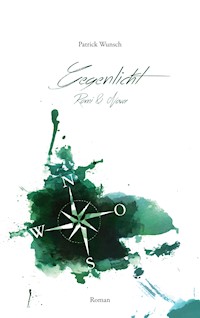0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
September. Eine Gruppe von Künstlern und Kunstinteressierten findet sich halb geplant, halb zufällig in einem abgeschiedenen, wohlkonstruierten Anwesen wieder, um ein Leben voll Wonne und künstlerischer Inspiration zu führen. Eine verzweifelte Flucht für die einen, nicht viel mehr als ein interessantes Experiment für die anderen, und für alle die Gelegenheit, etwas Entscheidendes zu lernen: Warum das Elysium der Tod des Künstlers ist und warum man am besten mit einem Bein in Glück und Ordnung und mit dem anderen in Passion und Chaos stehen bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
September. Eine Gruppe von Künstlern und Kunstinteressierten findet sich halb geplant, halb zufällig in einem abgeschiedenen, wohlkonstruierten Anwesen wieder, um ein Leben voll Wonne und künstlerischer Inspiration zu führen. Eine verzweifelte Flucht für die einen, nicht viel mehr als ein interessantes Experiment für die anderen, und für alle die Gelegenheit, etwas Entscheidendes zu lernen: Warum das Elysium der Tod des Künstlers ist und warum man am besten mit einem Bein in Glück und Ordnung und mit dem anderen in Passion und Chaos stehen bleibt.
Patrick Wunsch
Roman
© 2020 Patrick Wunsch
Illustration Umschlag: Isabel Zeuge (Drowned Orange)
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
ISBN Taschenbuch: 978-3-7497-9380-8
ISBN Hardcover: 978-3-7497-9381-5
ISBN E-Book: 978-3-7497-9382-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Marja.
1
Je nachdem, wie man die Welt betrachtete, wimmelte sie entweder vor gewöhnlichen oder vor merkwürdigen Menschen. Betrachtete man die Welt aber mit den Augen eines Weisen, hütete man sich vor einem Urteil. Dann blieben es Menschen wie du und ich, mit Gründen und Zielen, die sie selbst nicht immer kannten, auf der Suche nach etwas, das sie Glück nannten.
Das Glück war schwerlich zu definieren, ohne Beispiele zu nennen. Beispiele, bei denen die einen mit größter Begeisterung zustimmten und die anderen die Hände über dem Kopf zusammenschlugen. Das Leben war, wie hingegen ein jeder früher oder später lernte, die Beschwerlichkeit auf dem Weg zum Glück. Ob wir es erreichten – und es, einmal erreicht, festhalten konnten –, hing mit vielem zusammen, auf das wir keinen Einfluss hatten und mit vielem, das wir nicht verstanden.
Aber konnte es nicht so etwas wie eine Abkürzung dorthin geben?
Es war der erste September, ein Donnerstag, der kühl begonnen hatte, doch sonnig, nicht ungleich einem Frühlingstag. Eine siebzehneinhalbjährige Gymnasiastin namens Aske saß auf einer kleinen, bachumflossenen Insel, die vom Gehweg aus über eine Holzbrücke mit Metallgeländer zu erreichen war. Es war ein ruhiges Plätzchen, vor allem in den Morgenstunden. Dort verweilte sie, ohne einen Gedanken an die Zeit, inmitten der Schattenmuster, die eine gewaltige, sich träge wiegende Trauerweide hinabwarf.
Sie hatte sich mit dem Rücken an die raue Schrägfläche eines dickwanstigen Steins gelehnt und nippte an einer Flasche günstigen Bieres. In einiger Entfernung lag ein Spielplatz, seelenleer und umgeben von der Aura eines verwaisten Ortes; dahinter glühte ein maroder, schief stehender Bauzaun im staubigen Sonnenlicht. Der gebrechliche Herr, der auf der Parkbank saß, schlug die Zeitung auf.
Aske nahm, mit der Hand ins taubenetzte Gras gestützt, einen tiefen Atemzug, wie in einem Versuch, den Morgen mit all seiner Ruhe und Kraft in sich aufzusaugen, und obwohl dieser Versuch ein absurder war, schien er nur knapp zu misslingen. Die Sonne lächelte darüber nicht mehr als zuvor; in wohlwollender Heiterkeit bedachte sie den Park unterdessen mit der erquickenden Wärme wie an einem Aprilvormittag, und dazu streifte eine milde Brise Askes Wange. Ihr Kopf ruhte auf dem Stein, die Härte vergessen, während ihre Augen den roten Kometen folgten, die über den Himmel zogen und lange Schweife hinterließen wie Spuren aus glühendem Larimar.
Den Anflug eines Katers hatte Aske verwunden dank zweier Flaschen Bier, die Kaori als Konterbiere bezeichnet hätte. Im Großen und Ganzen war das Leben wohl angenehm, fand Aske – doch mehr nicht. Sie hatte wenig zu beklagen, und doch: Irgendetwas fehlte ihr, und der Drang, danach zu suchen, herauszufinden, was es war, wurde mit jedem Tag stärker. An diesem Morgen die Ruhe wiederzufinden, die ihr vor nicht allzu langer Zeit innegewohnt hatte, war ihr nicht ansatzweise gelungen. Alles um Aske herum stimmte; alles war, wie es früher hätte sein müssen, um sich in Einklang mit sich selbst zu bringen. Nur geschah es nicht. Die Wirkung blieb aus, abermals.
Qualität der Zeit, dachte sie, nur die zählt. War es das Höchste, in Ruhe ein Bier zu trinken? Nutze den Moment! Was ist das Verrückteste, das du tun könntest?
Ihr kam nicht die leiseste Idee. Die dritte Flasche leicht geneigt in die Höhe gehalten, betrachtete Aske das Zittern der kristallenen Reflexionen. Sie betrachtete ihre Finger, die sich um das Glas schlossen. Die Nägel, den schwarzen Lack – und den Silberring mit dem Efeumuster, ein Geschenk wie aus einer anderen Welt, das noch weit mehr Bedeutung hatte, als es Aske lieb war, und von dem sie sich dennoch zu trennen nicht imstande sah.
War dieser dumme Ring der Schlüssel? Eine seltsame, schwer zu begreifende symbolische Kraft ging von ihm aus, als wäre der Geist, der sie so lange verfolgte, an dieses Kleinod, an dieses Stück geschmiedeten Metalls gebunden; den Ring abzulegen, würde die Befreiung von diesem Teil ihrer Vergangenheit vielleicht besiegeln. Doch der richtige Moment war noch nicht gekommen, das war ihr deutlich klar.
Aske seufzte. Von dort aus, wo sie saß, war das Ende der Einkaufsstraße zu sehen, die ihr vertraut war wie keine andere Straße. In den Schatten der Altstadtbauten lagen drei unscheinbare Läden nebeneinander, in denen sich Aske aufzuhalten beliebte: Ein Buchladen, in dem es nach altem Papier roch, ein Schallplattengeschäft mit einem redseligen, jedoch äußerst zuvorkommendem Verkäufer, in dem sie bereits manchen Schatz gefunden hatte, und ein Spezialist für Lederwaren.
Zufluchten mochte man sie nennen, diese Läden, schüchterne Örtchen, an denen sich Aske freier fühlte als in der weiten Welt. Zuletzt hatte sie ihre Hoffnungen in Norwegen gesetzt, den langersehnten Urlaub in vertrauter Ferne – vergeblich: Dem Alltag für eine Weile zu entrinnen, reichte nicht aus. Doch was hatte gefehlt? Die richtige Gesellschaft? Annehmlichkeiten, die eine Hütte in den nordischen Wäldern nicht bieten konnte? An Aske selbst hatte es nicht gelegen. Sie hatte sich alle Mühe gegeben, dem Ganzen etwas abzugewinnen, Neues und Aufregendes zu sehen, wo nichts Neues und Aufregendes war – nur um festzustellen, dass die Fremde die gewohntesten Orte des Alltags kaum überbot, was irgendeine unerwartete Wirkung auf die Seele betraf. Die Nadelwälder Norwegens mit den klaren Quellen, dem Blick in die Täler, vom Sommer gemalt, und den Bergketten, die im Blau der Ferne lagen, waren doch im Grunde nichts im Vergleich zu dieser Einkaufsstraße, und genauso wenig hatte die Wildnis in ihr irgendeinen Drang ausgelöst, sich hinauszuwagen, loszuziehen ins Unbekannte und zu sehen, wohin der Weg sie führte. Ihre Flucht hatte sie in sieben Wochen ohne Bedeutung geführt. Schlimmer noch: Der Drang nach – zur gleichen Zeit – mehr Leben und weniger Leben war, so schien es, nach ihrer Rückkehr noch stärker geworden. Der Drang zum Neuen und der Drang vom Alten fort, der sich nicht abschütteln ließ.
Die Straße, die Aske noch immer im Blick hatte, betrat oder verließ an diesem Morgen kaum eine Seele – doch wie viele Leute stiefelten auf den gepflasterten Wegen jenseits des Baches vorbei, der Askes Insel umfloss! Sie redeten über Gott und die Welt – mehr die Welt –, über Nichtigkeiten und Dinge, die Aske nicht einzuordnen wissen konnte, und oft über sich selbst. Die meisten waren in Eile, auf dem Weg zur Arbeit vielleicht oder zu einem Rendezvous, in das sie große Hoffnung setzten.
Das geschäftige Treiben spielte sich gleich jenseits des Baches ab und schien doch weit entfernt von der Insel, auf der Aske in sich selbst die tiefste Ruhe fand. Sie gab sich der flüchtigen Fantasie hin, nie dorthin zurückkehren zu müssen, wo sich uninteressante Leute mit uninteressanten Dingen beschäftigten. Solche Momente der Ungezwungenheit, solche Momente abseits der starren Strukturen waren es, für die es sich überhaupt zu leben lohnte, oder nicht? Wofür sonst?
Der gebrechliche Herr faltete die Zeitung zusammen, mühte sich auf die wackligen Beine und schleppte sich, auf den Gehstock gestützt, davon. Als Aske, an den Stein gelehnt, die rauchummalten Augen schloss, das Haar, die Haut und die Kleidung gewärmt von einer Erinnerung des Sommers und mit dem Gefühl, dass mit jedem Herzschlag eine Ahnung von Freiheit ihren Körper bis ins Kleinste durchströmte, fragte sie sich nur mehr eines: Ob es nicht möglich war, einen ganzen Tag lang das Gefühl zu haben, alles wäre richtig, alles entspräche einem großen Plan. Zwei Tage lang. Eine Woche. Die Essenz des Lebens – diese lungen- und herz- und geisterfüllende Freiheit – zu extrahieren und zu komprimieren.
Ernst legte sich in Askes Blick, Finsternis. Ach, dachte sie, Freiheit! Was bedeutete das anderen Menschen? Oft war ihr, als wäre sie die Einzige, die sich an dieser Art von Freiheit erfreute: der Freiheit, sich eine Weile der Träumerei hinzugeben, die Zeit zu vergessen.
Die westliche Gesellschaft, fand sie, die sie eine äußerst intelligente Gymnasiastin war und gerade solche Aussagen zu formulieren gelernt hatte, war durch und durch einer unverständlichen, sich durch alle Schichten ziehenden Absurdität anheimgefallen. Sie hatte sich, wie Askes jüngste Schlussfolgerung lautete, mit der Zeit in eine Glorifizierung der Ideenfreiheit verrannt – wenngleich diese im Rahmen der politischen Korrektheit abgenommen hatte –, während die meisten Leute selbst große und gesundheitsschädliche Beschränkungen der Beschäftigungsfreiheit, der Freiheit, mit seiner Zeit anzufangen, was man wollte, stillschweigend hinnahmen aufgrund, nein, unter der Ideologie des Wachstums, von dem die wenigsten profitieren konnten. Trotzdem wurde die Ideologie von der Allgemeinheit vehement verteidigt; kluge, hochqualifizierte Menschen verbrachten den Großteil ihrer Lebenszeit damit, Geld zu verdienen mit Arbeit, die ihnen keine Freude bereitete, um sich eine Urlaubsreise zur Erholung von ebenjener Arbeit leisten zu können. Es war eine Einstellung, die sich ohne den Glauben an ein paradiesisches Jenseits, welches das diesseitige Leben mitsamt all der Zeitverschwendung in den Schatten stellte und ihm die wesentliche Bedeutung absprach, kaum erklären ließ. Was die westliche Welt kennzeichnete, war alles andere als die Freiheit, die sie als ihren zentralen Wert proklamierte, vielleicht das Gegenteil.
Das nahe Krächzen eines Raben durchdrang Askes Gedanken wie ein Pfeil das Wild. Es war das vertraute Krächzen des Raben, dem sie den Namen Herr Gram gegeben hatte. Aske mochte den gefiederten Gesellen. Mit den ergrauten Schwungfedern an beiden Flügeln, manche beinahe weiß, erkannte man ihn von Weitem. Wie sich das begründete, ließ sich für den Laien schwer sagen; Aske schob es auf das Alter, denn dem Namen entsprechend machte Herr Gram, stoischen Wesens und selten in Bewegung, seltener noch flatternd oder fliegend, durchaus den Eindruck eines Greises in Vogelgestalt. Sie pflegte mit ihm zu sprechen – wie mit einem Alten –, und zuweilen schien er sie zu verstehen. Wenn sie etwas zu essen bei sich hatte, warf sie ihm eine kleine Belohnung zu für die ruhige und ernste Aufmerksamkeit, die er dem Überschwang oder dem Kummer ihrer Worte hatte zuteilwerden lassen.
Ein Lächeln, das von einer gewissen Traurigkeit durchsetzt war, umspielte Askes Züge. Einmal, so erinnerte sie sich, hatte sie den Raben zu belehren versucht, wie sinnlos das Leben war, wenn man gründlich darüber nachdachte. Es war ein eigenartiger Tag gewesen; Aske hatte zuvor bitterlich geweint. Es war aus heiterem Himmel dazu gekommen (wie sie im Nachhinein glaubte; in Wahrheit hatte eine Reihe unerfreulicher Ereignisse und mehrere Flaschen billigen Bieres entscheidende Beiträge zu dem beispiellosen Verlust ihrer Kontenance in aller Öffentlichkeit geleistet, dazu, dass der sonst ruhig dahinziehende, geradezu idyllisch wirkende Fluss ihres Seelenlebens unvermittelt und in reißendem Strom über die Ufer getreten war). Erst hatte sie allein geweint, dann in Kaoris Armen und später unter den neugierigen, vielleicht mitleidigen Blicken Herrn Grams. Als sie dem Vogel, der die Klauen um das gleißende Brückengeländer geschlossen und den Kopf tief zu ihr hinabgesenkt hatte, schließlich schluchzend und schniefend ihre herangewachsene Verzweiflung darlegte und ihm klagte, dass nichts von alledem, was sie tat, sie nur einen Hauch glücklicher werden ließ und man ihres Erachtens nur froh sein konnte, zumindest den Status quo des Glücks zu erhalten, sobald der Zauber der Kindheit vorüber war, ob nun verweht von einer plötzlichen Böe oder stetem Rückenwind, hatte der einfältige Vogel unentwegt seine Einwände vorgebracht – zumindest hätte er es, der Sprache mächtig, mit Sicherheit getan –, und Aske binnen eines kurzen Moments auf den rechten Weg zurückgeführt, als er sich mit dem seltsamsten Zutrauen näherte und dem Mädchen, wenngleich ihr Tränen die Augen benetzten, auch an diesem Tag den Anflug eines Lächelns entlockte.
Heute aber befand sich Herr Gram, wie Aske gewahr wurde, selbst nicht auf der Höhe: Er legte eine eigenartige Trägheit an den Tag, die er zuvor noch nie gezeigt hatte. Irgendetwas stimmte nicht, doch was konnte eine siebzehnjährige, leicht angetrunkene Schülerin tun, um einen Raben aufzuheitern? Das weise Tier mochte den Umstand einsehen, denn er machte keinerlei Anstalten, um seelischen Beistand zu bitten. Er verharrte in einiger Entfernung auf dem anderen Stein, rührte sich kaum und gab kein weiteres Krächzen von sich. Er schien, wie Aske zunächst, sich entschlossen zu haben, seufzerlos und mit Gedanken aus Luft der etwas besseren Zeiten zu harren.
Wie Aske. Genau wie sie. Die Augen geschlossen, versuchte sie sich auszumalen, was sie in diesem Moment am liebsten täte. Die Ideen kamen und gingen in losen Formen, in Schemen und Schatten, waren nicht zu fassen, nicht zu untersuchen, nicht zu ergründen, und irgendetwas fehlte darin – nur was? Aske dachte darüber nach, und schließlich meinte sie, darauf gekommen zu sein: Es mochte angenehm sein herumzusitzen, den Wind auf dem Gesicht zu spüren, ein wenig betrunken zu werden, doch wo blieb das Abenteuer? Wo blieben Gefahren und Entdeckungen? »Und worin könnte denn eigentlich«, murmelte Aske, nachdem sie der Idee ein Stückchen gefolgt war, »in dieser geordneten, gezähmten Welt noch ein wirkliches Abenteuer bestehen?«
2
Das Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite des Parkplatzes stand in Flammen, ein fünfstöckiger Koloss aus Aluminium und Glas. Der Brand hatte die untere Hälfte bereits erobert, ein Inferno aus grollender Feuersbrunst und grellem Licht drängte sich zwischen den Mauern, verwandelte das Mobiliar zu Asche, und ein Sturm von Lohen schlug beständig aus den zerborstenen Fenstern heraus in die Höhe. Rauch in allen Grauschattierungen suchte die kühlere Luft darüber, stieg empor, löste sich hoch am Himmel auf. In schwarzen Fetzen schwirrte durch die Luft, was eben noch Arbeitsdokumente waren, Bau-, Dämmmaterial – oder vielleicht die Kleidung eines Mitarbeiters.
Die Hitze war bis hierher zu spüren, durch das Glas der Fenster hindurch, das sich mit Ruß bedeckte. Ein Zittern und Beben ging durch die Streben, als es einen ohrenbetäubenden Lärm gab; die Explosion warf eine brennende Woge auf, die sich mit einer solchen Macht, mit einer solchen Höllengewalt durch die Fenster presste, dass sie alles mit sich riss, was von den Wänden noch übrig war, und in einer merkwürdigen Ruhe nachklang, die ein erdrückendes Gefühl von Endgültigkeit heraufbeschwor. Der Ausbruch hatte den oberen Teil des Gebäudes nur mehr als glutdurchsetzten Trümmerhaufen zurückgelassen, der ringsumher von wilden Flammen umzüngelt wurde.
Das wäre ein Anblick! Es stand außer Frage, dass man sich solcher Gedanken zu schämen hatte, und ein wenig tat er das. Und doch: Was wäre das für ein Erlebnis! Welch sonderbare, welch seltene Art von Glück war es, einem Ereignis dieser Art einmal beigewohnt zu haben! Wie die Wahrscheinlichkeiten standen, würde nichts dergleichen je in Anwesenheit Miroirs geschehen. Man wünschte sich vieles, von dem man wusste, dass es nie eintreten würde, und arrangierte sich für gewöhnlich damit. Mehr noch: Die unerfüllten Sehnsüchte waren es, die einen Menschen am stärksten definierten, sein Handeln begründeten. War daran nichts zu ändern, dass man solche Sehnsüchte in sich trug und sich davon beherrschen ließ? Zurückgelehnt in den Bürostuhl, legte Miroir ein einfaches Textdokument auf dem Desktop an, in das er hineinschrieb:
Jene, die ihre Sehnsucht zu zügeln wissen, können das nur, weil ihre Sehnsucht schwach genug ist, beherrscht zu werden.
Enter, Klammer auf. Es war dreizehn Uhr drei.
Vier.
Fünf. Er starrte auf die weiße Fläche und überlegte. Von wem stammte das Zitat? Hemingway? Twain? Er hatte es vergessen. Nun, wenn sich Miroir nicht an den Namen erinnern konnte, war der Verfasser wohl ohne große Bedeutung. Es wurde dreizehn Uhr sechs.
Sieben. Vielleicht siebeneinhalb. Die Worte waren ihm wie aus dem Nichts in den Sinn gekommen, und er hatte geglaubt, sich inspirieren zu lassen, davon ausgehend etwas von Bedeutung schreiben zu können, wie es ihm früher mit Leichtigkeit gelungen war.
Acht. Wie einfach es früher gewesen war, die Bedeutung zum Fließen zu bringen!
Neun. Nun, eigentlich war es nur manchmal einfach gewesen, und von Bedeutung konnte nicht uneingeschränkt die Rede sein – doch sicher von etwas in der Nähe davon, einer Art Wahrheit mit Substanz. Hatte er sich seitdem verändert? Miroir ertrug den Gedanken einer charakterlichen Entwicklung nur schwer, implizierte der Begriff der Entwicklung doch einen vorherigen Zustand, der nicht wünschenswert gewesen war. Er gab sich, wie wohl die meisten Menschen, gern der Vorstellung hin, immer schon gute Gedanken gehabt zu haben, andersartige vielleicht, doch keineswegs schlechtere als die heutigen.
Zehn. Über das Kontextmenü löschte er das Dokument, leerte den Papierkorb und blickte hinüber zu den Fenstern. Draußen herrschten Sturm und Gewitter, Gewalten der Natur, deren Getöse im Schutz des Büros kaum zu vernehmen war. Melancholie füllte sich in Miroirs Gedanken wie Regen ins Fass. Sie war nicht unerträglich, die Melancholie, eine vertraute Freundin, mit der man ein ungezwungenes Schweigen teilte, nahm ihm jedoch den letzten Rest Arbeitsmotivation.
Als er sich von seinem Platz erhob und ans Fenster trat, spürte er deutlich, gleichsam physisch, wie die Blicke der Kollegen ihm folgten. Er sah hinaus: Der Himmel bot einen trostlosen Anblick, ein schmutziges Grau, verfinstert von wuchernden Wolkengebilden aus Dunst und Donner. Aus der Ferne war ein mächtiges Grollen zu hören, ein Rumoren von wütender Gewalt. Nichts erinnerte mehr an den Morgenhimmel, dessen Pastellfarben Miroir auf dem Weg hierher mit Entschlossenheit erfüllt hatten.
Der Blick des Werkstudenten, zu dem Miroir durchaus nicht versuchte, einen guten Draht zu finden, klebte hartnäckig in seinem Kreuz. Auch den Blick des Abteilungsleiters spürte er, der sich mit seinem halb offenen Hemd und der spröden Lederhalskette als Personifizierung eines entspannten Lebensstils betrachtete. Er geizte nicht mit Lob und Kritik, hielt Feedback zu den kleinsten Arbeitsschritten für das Alpha und Omega eines Teams kreativer Köpfe. Und schließlich war da der dümmlich grinsende, vorlaute Grafiker, der in auffälliger Regelmäßigkeit Herrenwitze zum Besten gab, obwohl niemand je wirklich darüber gelacht hatte.
Miroirs Interesse an seinem sozialen Umfeld hielt sich in engen Grenzen. Es kam vor, dass er sich nach jemandes privaten oder beruflichen Angelegenheiten erkundigte, doch bedurfte es immer eines besonderen Impulses, einer bewussten Entscheidung und einer gewissen Überwindung. Im Grunde, dachte er, unterschied er sich jedoch nicht von den anderen, die doch aus reiner Höflichkeit vorgaben, am Gegenüber interessiert zu sein; er hielt sich also schlicht für ehrlicher.
Dreizehn Uhr dreizehn. Die Kollegen hatten sich ihrer Arbeit zugewandt; sie interpretierten Miroirs Verhalten wohl als eine Art inspirative Pause. Bei Kreativen hinterfragte man es nicht, wenn sie sich sonderbar benahmen. Je sonderbarer, desto kreativer. Es waren die ungewöhnlichen Ideen ungewöhnlicher Menschen, auf die man hier setzte, um sich von der technisch wie handwerklich überlegenen Konkurrenz abzuheben. Anders ausgedrückt, hatte man es sich in den Kopf gesetzt, so etwas wie Kunst kommerziell zu verwerten, und dementsprechend ausgefallen waren die Ansätze im Marketing, auf die man sich geeinigt hatte. Im Grunde gefiel Miroir dieser Ansatz, und er hatte in seiner zweijährigen Tätigkeit in diesem Unternehmen etliche Konzepte und Texte beigesteuert, auf die man durchaus stolz sein mochte. Derzeit aber umfasste seine Beschäftigung nichts, was ihn auch nur im Geringsten zu begeistern vermochte. Er lauschte dem Donnergrollen und ließ seine Gedanken hierhin und dorthin schweifen.
»Leben ist, wenn man mich fragt, ein inflationär gebrauchter Begriff«, sagte er schließlich, ohne einen Gedanken daran, welche Wirkung die Worte entfalten mochten. Tatsächlich entfalteten sie kaum eine.
Miroir war ein nachdenklicher Mensch, den mangelnde Nachdenklichkeit anderer in Verdruss bringen konnte. Sein Persönlichkeitsprofil entsprach dem des Architekten, eines analytischen und planvollen Kreativen – und eines zynischen Träumers. Nicht immer war er ein nachdenklicher Mensch gewesen. Früher hatte sich Miroir über die Tiefe des Lebens weniger Gedanken gemacht. Er hatte sich für philosophische Themen interessiert, doch ein Feuer hatte er nicht gefunden.
Dann aber, Anfang zwanzig, hatte eine plötzliche Inspiration entfacht, was seitdem nicht mehr erloschen war. Er nahm sich mehr und mehr die Zeit, insbesondere gesellschaftliche und zwischenmenschliche Zusammenhänge gründlich zu durchdenken. Verbindungen zu sehen. Er grübelte und grübelte, zuweilen stundenlang. Um die Theorien zu ordnen, schrieb er innerhalb eines Dreivierteljahres einen Roman: Glut auf Silber spielte in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der Maschinen die meisten Arbeiter und viele Künstler ersetzt hatten und die künstlerische Darstellung menschlicher Emotionen als Kontrast zur rationalen und effizienzorientierten Maschinenwelt eine beispiellose Glorifizierung erfuhr. Im ersten Akt handelte sie von der Konkurrenz zweier äußerst talentierter Studentinnen der Analogfotografie, einer Kunstform, die eine erstaunliche Renaissance erlebt hatte. Die beiden versuchten, einander hinsichtlich der Ablichtung besonders bewegten Konzert- und Theaterpublikums zu übertrumpfen. Der zweite Akt handelte von der Liebesbeziehung, die sich zwischen den Mädchen anbahnte, der dritte von der Realität derselben. Auf jegliches dramaturgisches Konfliktpotenzial verzichtend, wich die Geschichte wesentlich von der etablierten narrativen Struktur ab. Entgegen der gutgemeinten Ratschläge der Lektorin, das bewährte Konzept des Spannungsbogens nicht völlig außer Acht zu lassen, blieb Miroir seiner Linie mit tiefster Überzeugung treu. Die Herangehensweise wurde sowohl von Lesern als auch von Kritikern positiv aufgenommen; es verkauften sich in den ersten sechs Monaten einige tausend Exemplare.
Er hatte zu dieser Zeit begonnen, sich als Künstler zu verstehen – und stets einigermaßen fehl am Platz zu fühlen –, im Großen und Ganzen jedoch konnte er behaupten, mit seiner Situation zufrieden zu sein. Es hatte keinerlei Anlass gegeben, sich dem Leben noch eingehender in künstlerischer oder philosophischer Hinsicht zu widmen. Dann aber lernte Miroir, unabhängig voneinander, zwei Menschen kennen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Art und Weise nahmen, wie er über einige der grundlegenden Themen dachte.
Einer dieser Menschen war eine junge Frau namens Fleur. Sie kennenzulernen war, wie sich im Nachhinein herausstellte, das größte Glück und das größte Unglück zugleich. An Miroirs Aussehen war nicht viel auszusetzen, und sein Charakter durfte als einnehmend bezeichnet werden, weshalb er eine Reihe an Freundinnen gehabt hatte und noch viel mehr Bekannte; Fleur mochte nur die Zweithübscheste unter ihnen gewesen sein, passte jedoch – intelligent, kunstinteressiert und verständnisvoll – mit unüberwindlichem Abstand als Freundin am besten zu ihm. Was sie und er ineinander fanden, war, wenn man Miroir fragte, wirkliches Leben, und es wäre vielleicht besser gewesen, sie hätten diese Erfahrung nicht gemacht. Fleur wurde für Miroir zur Lebensessenz, und umgekehrt mochte es kaum anders sein. Wie es in Beziehungen dieser Intensität unausweichlich war, brachten sie einander Freude und Leid, nicht vermischt zum grauen Rinnsal, wie es beim durchschnittlichen Paar zu entstehen neigte, sondern säuberlich geteilt in die tosenden Brandungen von Euphorie und Gram, in zwei Seiten einer unentwegt sich drehenden Medaille. Aus der Asche der permanenten Konflikte aber erhob sich schließlich eine Beziehung von höchster Stabilität, ein adamantener Bund zweier Leben, der, wie es schien, durch nichts mehr entzweizureißen war.
Richard, auf der anderen Seite, verkörperte auf den ersten Blick die Lösung dessen, was Miroirs und Fleurs Beziehung von Zeit zu Zeit noch ein wenig zu trüben vermochte: Es war das Bewusstsein ob der Vergänglichkeit des Glücks, die ihnen die Freude daran nahm, besonders wenn das Glück am größten war, die Vergänglichkeit sowohl des akuten als auch des chronischen Glücks, der sie früher oder später – oft unvermittelt – gewahr wurden. In einer Sekunde waren sie erfüllt von Erregung und Enthusiasmus, in der nächsten bereits waren sie der Zermürbung der Wirklichkeit anheimgefallen. Eine falsche Note in einer perfekten Komposition hat gewaltiges Gewicht. Richards gesellschaftliche Position verhieß die Möglichkeit, das Glück länger als gewöhnlich aufrechtzuerhalten, und auch wenn es keine permanente Lösung darstellte, sich den edlen Genüssen der Wohlhabenden hinzugeben, ließ es das Paar das Unvermeidliche zumindest für kurze Momente wieder vergessen.
Das sogenannte Projekt des Freundes war eine Vision, eine Versprechung, an die sich Fleur und Miroir klammerten. Es war die Hoffnung, die Gedanken an Vergänglichkeit hinter sich zu lassen, das temporäre Verdrängen des Unausweichlichen in der Stabilität einer außergewöhnlichen Lebenssituation aufrechtzuerhalten. Die kontinuierliche Erfahrung umfassender Pläsier barg eine aufrichtige Zuversicht, dem Auf und Ab von höchster Wonne und tiefster Verzagtheit endgültig zu entrinnen. Sie hatten, seitdem ihr gemeinsamer Freund sie über seine Pläne in Kenntnis gesetzt hatte, nicht ein Wort darüber gesprochen, sich in hoffnungsvolles Schweigen gehüllt, doch Miroir wusste, dass Fleur wie er fühlte, und Fleur konnte der neue Funke in Miroirs Temperament ebenso wenig entgangen sein.
Von den Einzelheiten des Plans ahnten sie nichts – niemand tat das –, und doch dachte Miroir seitdem an kaum etwas anderes als an Richards Projekt. An die Möglichkeiten des Palais. Die Konzentration, die seine Arbeit erforderte, war nicht mehr aufzubringen, und so hatte er beschlossen, dieser Phase seines Lebens so bald wie möglich ein Ende zu setzen. Auch davon ahnte Fleur nichts; Miroir nahm jedoch an, dass die Verwunderung seiner Verlobten kaum einen Augenblick andauern würde, wenn sie es erfuhr. Es war der konsequente Schritt.
Als der Regenschauer vorüber war und es nur mehr vom Dach des Gebäudes tröpfelte, stand Miroir noch immer am Fenster. Er genoss die Stille, die eingekehrt war, und dachte nicht eine Sekunde mehr über das nach, was er im Begriff zu tun war. Er war wie erstarrt angesichts der herbstlichen Düsternis dieses Tages, obwohl alles in ihm hätte Frühling beschwören, obwohl er sich, der Freiheit endlich nahe, wie ein Gott hätte fühlen müssen.
»He, Miroir?« Der Abteilungsleiter riss ihn aus den Gedanken.
Miroir gab keine Antwort.
»Ist alles okay?«, fragte der andere. »Du machst irgendwie so einen betrübten Eindruck, finde ich.«
Miroir räusperte sich. »Alles in bester Ordnung«, sagte er, doch in seiner Stimme lag der Herbst, wie er diesen frühen Nachmittag durchdrungen hatte. Ohne irgendeine halbherzig gespielte Gelassenheit kehrte Miroir zurück an seinen Schreibtisch. Zum letzten Mal, dachte er. Heute würde er sein Vorhaben in die Tat umsetzen: Die Flucht aus dem Gefängnis eines geregelten Arbeitslebens. Alles auf eine Karte zu setzen, das war nicht Miroirs Art, doch er spürte, dass sich der Mut nur auszahlen konnte. Und welche Alternative blieb ihm denn, realistisch betrachtet?
Miroir ließ den Blick über den Schreibtisch schweifen: Links und rechts sowie hinter den Monitoren stapelten sich Konzeptmappen und Prozessdiagramme, Skizzen und Ausdrucke der Illustrationen, zu redigierende Textbausteine und alte, mit unleserlichen Kommentaren versehene Fassungen von Pressemitteilungen. Nichts lag vollständig in seiner Hand, alles war mehr oder weniger in Teamarbeit entstanden. Vielleicht war es die fehlende Identifikation mit diesen Materialien, die Miroirs momentane Arbeit trotz des seines Erachtens ästhetisch ansprechenden und hinsichtlich des Gameplays gelungenen Computer- und Videospiels uninteressant und demotivierend wirken ließ. Zerknitterte Notizzettel waren verschiedenfarbig vollgekritzelt – Ideen aus Brainstormings und Anforderungen anderer Abteilungen –, doch vieles sagte ihm bereits jetzt, wenige Wochen später, nichts mehr.
Der Grafiker räusperte sich. »Hey, sag mal, Miroir: Wie sieht's denn eigentlich aus mit dem Promo-Artwork? Gibt's da schon 'n Outline?«
»Über welches Artwork sprechen wir?«
»Das mit der, äh … Hab' den Namen nicht parat. Nicht spielbarer Charakter, weiblich, 'n bisschen mysteriös, Doppelschwerter. Hat Fleur schon damit angefangen?« Er kratzte sich am Hinterkopf. »Weißte, wenn wir's 'nem anderen Freelancer übergeben müssen, sollten wir's bald tun.«
Es war dreizehn Uhr einundzwanzig. Miroir legte die Hände in den Schoß und blickte hinauf an die Decke. »Ach, mach dir keine Sorgen«, antwortete er mit einem leicht entrückt wirkenden Lächeln. »Wird schon alles gut. Sie gibt sich Mühe mit solchen Auftragsarbeiten, das weißt du doch. Nur höchste Qualität. Sie will sich damit einen Namen machen.«
»Tja, okay«, sagte der Grafiker. Die Sorge war kaum aus seiner Stimme gewichen, als er sagte: »Ich glaub' ja gar nicht, dass Fleur uns hängen lässt; hat sie ja noch nie.«
»So ist es«, sagte Miroir. Fleur nahm ihre Arbeit als Künstlerin ernst. Nichts war für sie lediglich ein Auftrag. Zu viele Gedanken machte sie sich über jede persönliche Note, die sie einbrachte, und zu sehr liebte sie es, ihre Werke veröffentlicht zu sehen. »Selbst wenn ich sie darum bitten würde, die Arbeit an diesem Werk abzubrechen, könnte sie es nicht.«
Der Grafiker lachte nervös. »Warum sollteste das tun?«, fragte er.
Miroir zuckte die Schultern. Er drehte den Stuhl in die Raummitte und räusperte sich. »Der Mensch ist nur eine Maschine, und Glück der Treibstoff«, sagte er, weil es ihm gerade in den Sinn kam.
»Hä?« Der Grafiker verbarg sich hinter einem weiteren nervösen Lachen. »Was meinste denn damit?«
Miroir blickte aus dem Fenster. »Ein spontaner Gedanke«, sagte er. »Was meinst du dazu?«
Der Grafiker kratzte sich abermals am Kopf. »Tja, äh, ich weiß nicht«, murmelte er, als hielte er die Frage für eine Art Prüfung. »Es klingt ja erst mal nicht falsch.«
Miroir seufzte. Ach, was soll's, dachte er. So war das eben.
Das Prasseln dicker Regentropfen, das sich in diesem Moment aufs Fensterglas ergoss, eroberte den Raum und erstickte das Gespräch. Blitze erhellten die schwarzen Schreibtische und die Regale an den Wänden. Der Grafiker starrte in die Leere und regte sich nicht mehr. Der Abteilungsleiter und der Werkstudent hatten ihre Konzentration wiedergefunden und widmeten sich der Arbeit. Es war dreizehn Uhr dreiundzwanzig.
Tatsächlich gelang es Miroir, sich bis zum Feierabend mit keiner seiner Aufgaben ernsthaft zu befassen. Dann endlich war es vorüber; ach, was freute er sich auf ein kühles Bier! Er verließ das Gebäude, diesen gewaltigen Glaskasten zum letzten Mal, an dem in großen Lettern SECRET TREASURE GAMES geschrieben stand, und schritt gemächlich die weißen Treppen hinab. Er ließ sie hinter sich, die Isolation von der Natur und die Überpräsenz zähflüssiger Zeit. Den Abteilungsleiter, den Grafiker, den Werkstudenten und alle anderen, mit denen er viele Stunden, viele Ideen geteilt hatte, ohne dass sie nur die geringste Bedeutung für ihn erlangt hatten. Der Baum, der in der Mitte des Vorplatzes stand und dessen Äste und Zweige, so blieb zu hoffen, sich eines Tages majestätisch darüber ausbreiten und die Pflastersteine mit gesprenkelten Schatten bedecken würden, schien ihm zum ersten Mal aufzufallen. Natürlich hatte er ihn viele Male zuvor gesehen, doch es kam ihm vor, als hätte ihn jemand heute erst dorthingepflanzt.
Wenngleich die Arbeit ihm zuweilen auch Freude bereitet hatte, lagen ihm seine eigenen Projekte zu sehr am Herzen, als dass er eine berufliche Position im Vergleich dazu nicht als Zeitverschwendung betrachten musste. Viele Menschen definierten sich über ihre Arbeit; fragte man einen Menschen danach, was er machte, antwortete er mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er seinen Beruf oder das Unternehmen nannte, in dem er tätig war. Miroir konnte darüber nur den Kopf schütteln. »Was macht die Kunst?«, musste man fragen! »Was macht die Liebe?«
Die Arbeit! Wie kam man dazu, sich über Tätigkeiten zu identifizieren, die zum größten Teil von anderen vorgegeben wurden? Zur Wehr setzen müsste man sich gegen jeglichen Fron! Eine Welt wie für Ameisen war das, in der die meisten lebten und nichts hatten als das Diktat der Leistung, das sie jedem anderen aufzuzwingen versuchten, um den Wert ihres eigenen Lebens geltend zu machen.
Und nun also war es vorbei mit dem tristen Arbeitsalltag und der begrenzten Zeit für die bedeutsameren Dinge des Lebens. Nach der Arbeit war für Miroir, der weit mehr Zeit für seine Kunst benötigte, als ihm zur Verfügung stand, vor der Arbeit gewesen. Die Uhr wurde umgedreht; der Sand rieselte in die andere Richtung, doch nichtsdestotrotz rieselte er. Nie hatte Miroir einfach nur den Feierabend genießen können, hatte sich stattdessen bemüht, die Zeit, die ihm blieb, mit höchster Effizienz zu nutzen. Zeit stellte für ihn das größte Geschenk dar: Wollte man ihm etwas Gutes tun, verschaffte man Miroir in irgendeiner Weise mehr davon. Den meisten allerdings ging es darum, Zeit komfortabel zu verbringen, mehr zu erhalten, darauf durfte man im Allgemeinen nicht hoffen.
Freiheit!, dachte Miroir und nahm einen tiefen Atemzug, als atmete er zum ersten Mal eine Luft von solcher Reinheit. Endlich war es so weit! Es begann die lange herbeigesehnte Zeit, in der die Kunst den Alltag überwiegen, in der er mehr Künstler als Arbeiter sein sollte, produktiv für sich selbst und nicht für andere.
Welches seiner Projekte würde er in den nächsten Tagen als Erstes angehen? Es gab viele Möglichkeiten der künstlerischen Betätigung und ein beträchtlicher Ausschnitt stand auf seiner Liste:
Er konnte die Zeit nutzen, um ein Orchesterstück um diese eine Melodie zu komponieren, die ihn, wann immer er sie auf der Gitarre spielte, von Neuem ergriff, ihm also derart gelungen schien, dass er nie eine angemessene Verwendung für sie gefunden hatte.
Er konnte einen der Romane zu schreiben beginnen, zu denen er seit Jahren einzelne Ideen in einem kleinen Büchlein und diversen Dokumenten notierte, ohne die Gelegenheit zu finden, eine grobe Struktur für die Handlung festzulegen.
Ein kurzes Computerspiel programmieren, es über verschiedene Plattformen zu veröffentlichen und regelmäßige Erweiterungen zur Verfügung zu stellen. Er hatte die Software auf dem neuesten Stand gehalten – Editoren, Engines, Grafikprogramme –, doch war noch nicht dazu gekommen, die aktuellen Versionen auszuprobieren.
Eine Idee verlockender als die andere! Die Bedenken der Verfechter geregerelter Arbeit waren berechtigt: Nicht jeder wusste mit Zeit etwas anzufangen – oder überhaupt damit umzugehen –, Miroir jedoch zweifelsohne. Und wenn erst das Projekt des Palais beginnen würde, fände er nicht nur genügend Zeit, sondern die wildeste Inspiration zu großartigsten Werken – das war gewiss.
Der Weg führte Miroir, während er über all das nachdachte, an einem Teich vorüber, dann in ein kleines Wäldchen – kaum war es ein solches – und wieder hinaus. Es war eine Welt, die nicht weit vom städtischen Treiben entfernt und doch in tiefer Ruhe lag, eine Welt, die beinahe ursprünglich wirkte: Hier ein gepflasterter Weg, dort eine hölzerne Bank; im Großen und Ganzen ein Arrangement, mit dem sowohl Natur als auch Stadtmensch einverstanden sein konnten.
Trotz der nassen Wiesen erstaunlich belebt war hingegen der Stadtpark an diesem Nachmittag. Angeregte Gespräche über Nichtigkeiten vermischten sich mit dem Gezwitscher der Vögel und dem Rauschen des Windes, der sich durch das Blätterwerk von Bäumen und Büschen trug. Pfützen säumten den Gehweg und den Asphalt wie Spiegelscherben, nein, vielmehr wie herniedergefallene Fragmente des Himmels selbst, die nun im friedlichen Blau erstrahlten. Eine schwache Brise, die Miroir von der Seite her streifte, beschwor die Atmosphäre von Erneuerung heraus, hüllte den Übergang des Jetzt in ein besseres Gleich in einen Glorienschein der Gewissheit.
Nach einiger Zeit begann sich der Weg über eine abgeschiedene Wiese zu schlängeln, auf der Jugendliche neben Rucksäcken saßen, Limonade oder Mischbier in der Hand. Ein älteres Paar führte einen Hund an der Leine, um den Miroir einen großen Bogen machte. Eine Gruppe Kinder spielte Fußball, ihr einziges Tor zwischen zwei kleineren Bäumen. Eine andere Gruppe verteilte sich auf eine Reihe Sitzbänke, aß Pommes frites oder Eis und lachte über Lehrer und Mitschüler, über Witzeleien und Gerüchte. Die Mädchen lachten über die Albernheiten der Jungen.
Er flanierte den schmalen Pfad entlang, der aus dem Park hinausführte. In den drei Jahren, die er hier gearbeitet hatte, war er auf diesem Pfad nicht ein einziges Mal jemand anderem begegnet. Der Pfad schien im wahrsten Sinne des Wortes wie für ihn geschaffen. Er war Miroirs morgendliches und feierabendliches Sanktuarium, eine Zeitspanne beflügelnden Alleinseins.
Auf der schmalen Brücke, die über den Bach führte, blieb er einen Moment stehen. Der Himmel war beinahe klar; es wehte ein angenehm kühler, frühlingshafter Wind, der vergessen ließ, dass es dem Herbst entgegenging. Allein durch das erkahlende Geäst der Bäume zog eine leise Vorahnung, eine wortlose Prophezeiung des Jahreszeitenwechsels. Miroir war, als würde etwas Unerklärliches geschehen. Vielleicht jetzt, vielleicht gleich.
Er senkte seinen Blick hinab zum Wasser, das parkwärts floss. Er beobachtete das vergoldete, rastlose Strömen, das über die Steine jagte, als er das Smartphone vibrieren spürte. Er griff reflexartig in die Hosentasche. Das leuchtende Gerät mit zwei Fingern und voller Argwohn emporhaltend, dachte Miroir nur das eine, das mächtigste aller Wörter: Nein. (Gleich darauf dachte er im Übrigen eine Phrase, die ebenso eine der mächtigsten gewesen sein mochte, ehe es sich abgenutzt hatte: Fickt euch doch einfach, dachte er. In diesem Wortlaut dachte er das nicht oft.)
An einer lichtverwabten Wasseroberfläche brach sich das weiße Licht eines hochauflösenden Displays, auf dem das Logo eines dreieinhalbjährigen Startups der Spielebranche angezeigt wurde. Nachdem es zwanzig Sekunden später erloschen war, erkannte Miroir das elegante Aluminiumgehäuse kaum mehr zwischen den Steinen im Bachbett. Einem zweiten Blick entging es ganz und gar.
Blake, dachte er. Von dem hatte das Zitat gestammt.
Als er dastand und innehielt, meinte er die Nacht hinabströmen zu hören wie feinen Sand in einer Sanduhr, hinab auf ihn, auf Bäume und Sträucher, auf Wege, die Wälder und Hage durchmaßen. In einigen Stunden würden Laternen den Stadtpark und diese Brücke mit einer kalten, gespenstischen Stille bescheinen, sie mit Geheimnissen und poetischen Bedeutungen füllen. Mit den letzten Sonnenstrahlen würde gestorben sein, was der Abend unter seinem Frühlingsschleier an hoffnungsvollen Gedanken mit sich gebracht hatte. Etwas erfasste Miroir; er riss sich los, beschleunigte seine Schritte, rannte für einen Moment. Er ergriff vor nichts die Flucht, er verlor sich Hast nur um des Pulses willen.
Miroir rannte, bis er zum Aufzug der U-Bahn-Station kam. Er betätigte den verschlissenen, klebrigen Knopf und versuchte, seinen Atem wiederzufinden. Die Momente verstrichen jung, einer für jeden Herzschlag vielleicht, und ihm war beinahe, als hätte er etwas lange Vermisstes wiedergefunden, die Idee eines Lichtblicks, den Schimmer von Orientierung. Für wenige Sekunden fühlte er sich, gen Himmel blickend, wie losgelöst von der Gravitation. Er fühlte sich, als befände sich die Welt einige Zentimeter unter ihm.
Das Gefühl verflüchtigte sich wie der dünne Hauch eines betörenden Parfüms, als sich mit einem hellen Signal die Fahrstuhltür öffnete, träge und mit einem leisen Surren. Miroir stieg ein und betätigte einen weiteren verschlissenen, klebrigen Knopf. Wer den Fahrstuhl nahm, hinterließ draußen wie drinnen die gleichen Spuren in diesem winzigen Kosmos der U-Bahn-Station. Die Türen schlossen sich und der Fahrstuhl setzte sich bebend in Bewegung. Hinter dem zerkratzten Glas zog der Schacht vorüber.
U1.
U2.
Es war eine alte Station, von der Stadtverwaltung vergessen, mit Graffiti an den Wänden, sepiabraunen Verfärbungen auf den Fliesen und Fahrplänen, die hinter dem zerkratzten Plexiglas vergilbten. Den blässlichen Mischmasch von Gestank, der in der Halle hing, würde man nie vertreiben können.
An diesem Nachmittag nahm Miroir die U-Bahn in die andere Richtung. Es war ein spontaner Entschluss, wie er ihn sich nun leisten mochte. Wenn man seiner Zeit Herr war, stand es einem frei, sich zu diesem oder jenem hinreißen zu lassen, ohne fortwährend voller Reue auf die Uhr sehen zu müssen.
An der Endstation angekommen, stieg er die Treppen hinauf ins Freie. Er ging langsamen Schrittes, doch mit dem Wind im Rücken die Straße entlang, die geradlinig in die Ferne führte, entlang des Asphalts, der vom Schauer des Nachmittags in der Sonne gleißte. Der Himmel war ein Gemälde von graublauer Wasserfarbe auf goldenem Papier. Miroir begegnete kaum einer Menschenseele auf diesem Weg, den er eingeschlagen hatte, und nur ein paarmal fuhr ein Auto vorüber, das seine blassen Spuren auf der Straße hinterließ.
Nach einer guten Dreiviertelstunde hatte Miroir sein neues Ziel erreicht. Er betätigte die Klingel, lehnte sich mit dem Unterarm gegen die Wand und wartete. Dann klingelte er noch einmal.
»Ha!«, sagte Edgar, die grauen Augen weit aufgerissen, als er die massive Holztür öffnete. »Du bist das.« Er schob den Kopf vor wie ein neugieriger Ochse. »Mann, immer mal rein in die gute Stube«, sagte er, ohne es zu meinen.
Das Dunkelblond des zerzausten Haars schien noch graudurchwirkter als bei der letzten Begegnung. Je länger man einen Menschen kannte, fand Miroir, desto jünger wirkte er im Allgemeinen: Die Fassade bröckelte, fiel Schicht um Schicht, und offenbarte die Eigenheiten, die Fehler – und oft genug den albernsten Humor. Bei Edgar war es anders. Edgar hatte viele Eigenheiten, viele Fehler und einen in gewisser Weise albernen Humor, und doch hatte er immer schon uralt gewirkt.
Miroir bemühte sich nicht, den Besuch zu erklären – hätte er es denn gekonnt? Er folgte Edgars Alkoholfahne und dem schwachen Licht der letzten intakten Glühbirne die staubigen Stufen der Kellertreppe hinab. Unten angekommen, betraten sie durch eine Eisentür das Tonstudio. Die Technik, die Edgar sich angeschafft hatte, war beeindruckend, doch was die räumliche Gestaltung anbelangte, wirkte es auch nach mehreren Jahren noch provisorisch. An großen, halb zerfetzten Umzugskartons lehnten die Gitarren – teure und günstige, schwarze und farbige, unterschiedlich weit fortgeschrittene Selbstbauten –, und Bretter von Regalen stapelten sich in den Ecken. Verstärker und anderes Equipment, das an den Wänden aufgereiht war, diente als Ablage für vollgekritzelte Zettel, Musikmagazine und gebrauchtes Geschirr. Vom Teppich war vor lauter zerkratzter CDs, Kabelgewirr, Bierkästen, buntem Leergut und Tabakresten nicht viel zu sehen.
Eine Zigarette im Mundwinkel, sagte Edgar: »Wie unschwer zu erkennen, hab' ich hier 'n bisschen aufgeräumt. Gefällt's dir?«
Miroir lachte; es bestand kein Grund zur ehrlichen Antwort.
»War halt besoffen«, sagte Edgar, »aber frag nicht, wie! Hatte so 'ne Art Existenzkrise, oder wie man's nennen soll, und da hab' ich nichts Besseres gewusst, als meine Bude aufzuräumen.« Er nahm einen tiefen Zug und blies den Rauch zur Decke. »Na ja, 'n Großteil des vorherigen Zustands mag sich bestimmt schon zurückgestohlen zu haben, aber für den Moment war's echt 'n angenehmes Gefühl, für'n gewisses Maß an Ordnung gesorgt zu haben.« Er schüttelte den zotteligen Kopf und schnaubte. »Hätt' ich nie gedacht!«
Miroir wusste nicht, was er erwidern sollte. Edgar war tatsächlich der mit Abstand unordentlichste Mensch, den er kannte. Es musste viel Alkohol im Spiel gewesen sein, diese Seite an ihm hervorzubringen. Doch handelte es sich um einen einmaligen Ausrutscher seines alten Freundes oder um den ersten Schritt in eine neue Richtung? Charakter war nie in Stein gemeißelt; auch Edgar würde nicht ewig dieser Edgar sein, auch seine Chaotik mochte nicht ewig bestehen bleiben, wenngleich von allen Eigenheiten, die Edgar ausmachten, diese die hartnäckigste sein musste. An all das dachte Miroir und sagte doch nichts. Erwartungsvollen Blickes harrte er stattdessen weiterer Ausführung.
»Es wird wohl nicht lange so ordentlich bleiben«, sagte Edgar. »Wie könnte es auch?« Er blickte sich um und fuhr sich durchs wirre Haar. Die Behäbigkeit der Bewegung ließ ihn trotz der breiten Schultern und der mächtigen Oberarme schwach erscheinen. Wie viel mochte dem Alkohol geschuldet sein? Bestand Grund zur Sorge? »Als ich wieder nüchtern war«, fuhr Edgar fort, »so um die Mittagszeit 'rum, und mich hier mit brummendem Schädel umgeguckt hab', konnte ich das Studio nicht wiedererkennen. Ich dachte im ersten Moment, ich wär' ganz woanders! Auf 'ner Party eingenickt. Ob du's glaubst oder nicht, ich hab' nach Spuren gesucht, nach Anhaltspunkten, wo zur Hölle ich sein könnte, bis ich dann doch einige Dinge wiedererkannt habe und es mir nach und nach dämmerte, was ich getan hatte.« Er lachte. »Was ich sagen will, ist, dass man manchmal nicht nur 'n etwas anderer Mensch ist, wenn man gesoffen hat. Ich war das komplette Gegenteil meines nüchternen Selbst, und ich glaube, das geht nicht wenigen ab und zu so. Der Alkohol kehrt deinen Charakter um. Verwandelt dich in deinen Schatten.« Er seufzte. »Aber weißt du, ich hab' gerade, wenn ich's recht bedenke, kein Interesse daran, noch weiter über so tiefgründiges Zeug zu sprechen. Und du kannst dir doch sicher auch was Besseres vorstellen – zum Beispiel ein kühles Getränk?« Er griff hinter sich. Mit etwas Groteskem im Gesicht, das ein Grinsen sein mochte, hielt er die Flaschen mit orangefarbenen, halb abgerissenen Etiketten hoch und sagte: »Ich hab' dich echt gern hier im Studio, aber was hältste also davon, wenn wir jetzt einen trinken und du dann wieder verschwindest? Hab' noch 'n Termin.«
»Das ist Limonade«, sagte Miroir mit der angebrachten Skepsis.
Edgar räusperte sich. »Der Termin«, erklärte er, »steht in 'nem Terminplaner, so scheißwichtig isser. Höchste Prioritätsstufe, was auch heißt: keinen Tropfen Alkohol.« Edgar wiegte den Kopf hin und her und fügte hinzu: »Ab jetzt.«
Miroir gab ein Grummeln von sich. Wenn er ehrlich war, hatte er in der Hoffnung auf einen letzten Feierabendumtrunk den Weg zu Edgar eingeschlagen. Ob des wichtigen Termins seines alten Freundes, der wenige wichtige Termine hatte, wollte er jedoch den löblichen Vorsatz nicht untergraben. »Meinetwegen«, sagte er.
»Bestens«, sagte Edgar mit seiner gewohnt halbherzigen Zufriedenheit, als er seinem Gegenüber eine der Plastikflaschen entgegenstreckte. »Wir haben eine Stunde. Zum Wohl!«, grölte er.
»Zum Wohl«, antwortete Miroir, öffnete die Flasche mit einem Zischen und nahm den ersten Schluck. »Ich habe übrigens gekündigt«, sagte er. Nicht ohne Mühe brachte er einen optimistischen Ausdruck zustande. »Wegen des Palais, oder besser: fürs Palais. – Schau nicht so grantig, Mann! Ich weiß, wie du dazu stehst, aber du weißt, dass es sein musste. Die Kollegen haben es auch nicht besonders gut aufgenommen; nein, das kann man wirklich nicht behaupten. Aber wie hätte ich es ihnen verständlich im Detail erklären sollen? – Tja, was soll's. Wenn alles gut läuft«, sagte er und glaubte fest daran, »spielt es sowieso keine Rolle.«
Edgar schwieg eisern, starrte nur, dass es einem unangenehm wurde.
»Wie dem auch sei«, sagte Miroir. Er sagte: »Ich habe einen ziemlichen Hunger. Hast du was zu essen da?«
»So Grillfleisch«, antwortete Edgar. »Aber halt dich ran, ja? Der Termin.«
Miroir begab sich in die Küche, die nicht nur ebenso unordentlich wie der Rest, sondern auch unappetitlich anzusehen war. Der Magen knurrte ihm dennoch. Er fand marinierte Nackensteaks im Kühlschrank, die nur knapp das Haltbarkeitsdatum überschritten, und spülte eine der Pfannen mit heißem Wasser aus.
»Hör mal, Miroir«, dröhnte Edgars Stimme herüber, »diese Sache mit dem Aufräumen, behalt das mal für dich. Ich will nicht als unberechenbar gelten.« Er lachte. »Ich will in den Augen der anderen bleiben, wer ich bin. Der gute alte, 'n bisschen chaotische Edgar.«
Miroir, der in eine Welt aus Gebrutzel und dem Geruch von gebratenem Fleisch eingetaucht war, nickte, wohl wissend, dass es keine brauchbare Antwort darstellte. Er trauerte der Anekdote, die er nicht erzählen durfte, kaum einen Gedanken lang hinterher.
Als Miroir das Fleisch wendete, hatte Edgar seine Gitarre zur Hand genommen, spielte Akkorde, die nicht wiederzuerkennen waren. Da Edgar nie Ambitionen an den Tag gelegt hatte, Stücke anderer Musiker zu lernen, nahm Miroir an, dass es sich um neues Material für die Band handelte. Material, das wahrscheinlich nicht über dieses erste Vorspielen hinaus Verwendung finden würde. Ein früherer Miroir hätte das, was Edgar vor sich hin spielte, mit Komplimenten überschüttet. Es war wirklich gut und traf Miroirs Geschmack. Nun aber folgte Miroir der Ansicht, dass Material, das es wert war, aufgegriffen und verarbeitet zu werden, ohnehin noch einmal auftauchen würde. Ein Album hatte eine begrenzte Spielzeit, sodass man genau überlegen musste, welchen Materials man sich annahm. Die besten Ideen, solche mit der richtigen Balance aus Wiedererkennungswert und Überraschungseffekt, hatten die Tendenz, wieder und wieder aufzutauchen, sich mit einer Hartnäckigkeit in Stimmphasen und Jamsessions einzuschleichen, die es schier unmöglich machte, sie letzten Endes nicht in irgendeiner Form in die Komposition einzuflechten. Miroir ignorierte das Gitarrenspiel selbst dann noch, als Edgar es, so bekam man unweigerlich den Eindruck, mit wachsender Verzweiflung darauf anlegte, seinen Gast mit merkwürdigen Akkordfolgen und ungewöhnlichen Rhythmen und Strukturen zu beeindrucken. Ihm eine positive Äußerung zu entlocken.
Miroir kehrte zurück und nahm auf einem der Verstärker Platz. Während er aß – vielmehr sein halbgares Fleisch hinunterschlang –, sprach Edgar, die Gitarre noch auf dem Schoß, über Nichtigkeiten und lachte über die eigenen Witze. Es war eine typische Situation: Außerhalb des musikalischen Bereichs war Edgar für Miroirs Leben so gut wie bedeutungslos. Das hieß nicht, dass er Edgar nicht leiden konnte, im Gegenteil: Bei Edgar handelte es sich um einen der wenigen Menschen, die Miroir nicht nur als Musiker, sondern auch als Persönlichkeit, als Denker respektierte, sofern Respekt eine adäquate Bezeichnung für diese wohlwollende Akzeptanz war, die Miroir ihm gegenüber empfand. Respekt war es nicht, was einen dazu veranlasste, Zeit miteinander zu verbringen, und doch verbrachte Miroir nicht ungern die seine mit Edgar. Ihm war klar, dass die Begegnungen außerhalb des Proberaums nie besonders fruchtbar waren, was den Gedankenaustausch oder eine Vertiefung der seltsamen freundschaftlichen Beziehung anbelangte. Sich mit Edgar zu treffen, war nicht mehr und nicht weniger als ein netter Zeitvertreib; umso enttäuschender war es folglich – und damit benannte Miroir schließlich den Grund für seinen Unmut –, dass es mangels alkoholischer Getränke und zeitlichen Spielraums ein gewöhnlicher Zeitvertreib bleiben würde. Miroir steckte das letzte Stück Fleisch in den Mund – das erste und das letzte sind immer die köstlichsten, dachte er – und stellte den Teller zu den anderen.
»Die Sache ist die, Miroir«, sagte Edgar, »am Ende sind's doch die unerwarteten und erschütternden Rückschläge«, sagte er, »angesichts derer ich als Künstler paradoxerweise bester Laune sein müsste.« Er lachte mit maßlos übertriebener Intensität, nervös, auf diese Weise, die einen glauben ließ, das Lachen würde jeden Moment ins Gegenteil umschlagen. Er kauerte in seinem staubigen, mit Kaffeeflecken übersäten Sessel, dessen olivgrünes Muster eines der altmodischsten war, das man sich nur vorstellen konnte. Er kauerte dort weit vornübergebeugt, den Kopf in die knochigen Hände gelegt. Er krallte sich in die Haut seines Gesichts und verzerrte es zu einer gespenstischen Grimasse, zu einer Fratze ohne bestimmbaren Ausdruck. »Glückliche Menschen«, knurrte er, »schaffen keine echte Kunst, und sie interessieren sich auch nicht dafür. Das ist nicht das, was ich sein will, und es ist auch kein Umgang, den ich pflegen sollte, wenn ich es zu was bringen will.« Er leerte den Rest der Limonade in einem Zug und stieß auf. »Und du auch nicht«, sagte er. »Du erst recht nicht. Na ja.« Er blickte auf sein haariges Handgelenk, als trage er eine Armbanduhr, und sagte: »Scheiße, guck mal, wie spät es geworden ist. Ich muss dich jetzt rausschmeißen, mein Freund. Hab' ja noch 'n bisschen aufzuräumen hier, nicht wahr?« Edgar klang, wenn man Miroir fragte, beim Lachen selten so, wie ein Lachender klingen sollte.
Widerwillig und mit einem langen Seufzer erhob sich Miroir. Noch lachend, nun zugleich hustend, packte Edgar ihn an der Schulter und geleitete ihn langsam, aber bestimmt Richtung Treppe. »Wir sehen uns morgen«, sagte Miroir.
»Morgen?«, fragte Edgar.
»Das Konzert.«
Es dauerte eine Sekunde, da fiel es Edgar wieder ein. »Oh ja«, sagte er, »ja, dann sehen wir uns also morgen.«
Miroir seufzte. »Sei bitte pünktlich.«
In einem Anfall von Husten und Röcheln stützte sich Edgar in den Türrahmen und vermochte es gerade noch, den Daumen nach oben zu zeigen.
Miroir machte sich gemächlich auf den Weg. Nachdem er ein Stück die Straße entlang gegangen war, kam ihm ein Mädchen entgegen, das um die achtzehn Jahre sein mochte, eine nicht gerade dezent geschminkte Blondine in Windjacke und Leggings. Sie senkte den Blick, während sie mit einigem Abstand an Miroir vorüberging. Als er sich umwandte, sah Miroir, dass das Mädchen an Edgars Tür klingelte. Er blieb stehen und lauschte.
Aus der Entfernung hörte er Edgar sagen: »Baby, hör zu.« Es war gewiss nicht das erste Mal, dass er sagte: »Ich hab' gestern Abend noch mal über dich und die Kohle nachgedacht, und mir kam da so 'ne verrückte Idee …«
Miroir kaufte sich eine Dose Bier an einem Kiosk und später eine weitere an einem anderen. Als es gegen neunzehn Uhr ging, begab er sich langsam auf den Weg zu seinem nächsten Ziel. Der Abendwind ging ihm kühl durchs Haar und drang in den dünnen Stoff seines T-Shirts. Trotz der Freiheit, die er zurückgewonnen hatte, und obwohl Gold und Glut auf allem lag und die Dämmerung Miroir für gewöhnlich mit einer beflügelnden Melancholie erfüllte, verspürte er an diesem Abend vielmehr den Anflug von Abscheu, als er die Straßen hinabblickte, die gesäumt waren von ästhetischen Brüchen, Unvollkommenheiten und einer allgemeinen Bedeutungslosigkeit, von Schrunden in Fassaden, zerrissenen Plastikverpackungen und anderen, immateriellen Spuren menschlichen Lebens. Mitten in der Dämmerung, dieser Umkehrbewegung der Sanduhr alles Irdenen, stand er vor der alten Taverne und trank den Rest des Dosenbieres, eines trostlosen Trunks, der seine Frische, seinen Esprit an die Zeit verloren hatte.
Da sah er sie. Was ihn eben noch in monochromer Tristesse umgeben hatte, nahm Farbe an. Sie näherte sich langsamen Schrittes in einer hellgrauen Hose und Stiefeln aus schwarzem Leder mit Schnallen, die im Sonnenlicht glänzten. Eine Hand steckte in der Tasche ihres taillierten Mantels, dessen Bordeaux in beinahe surrealem Kontrast über den grauen Bordstein schwebte und den Blick fesselte wie der Vorhang einer Zauberin. Mit der anderen Hand hielt sie das Smartphone ans Ohr. Sie trug dünne Stoffhandschuhe, die ihre schmalen Finger unbedeckt ließen, und eine eng anliegende Mütze, unter der die Strähnen ihres Haars in rotblonden Wellen hinabfielen. Wenn Miroir ihre Präsenz mit einem Wort hätte beschreiben wollen, wäre es »elegant« gewesen – oder »anmutig«. Betrachtete man das Gesicht, handelte es sich um ein Mädchen von etwa siebzehn Jahren, und auch der filigrane Körper erweckte nicht mehr oder, je nach Sichtweise, nicht weniger als diesen Eindruck – sie aber in ihrer gesamten Erscheinung als Mädchen zu bezeichnen, wäre dem Charisma nicht gerecht geworden, das vielleicht das Charisma einer jungen Schauspielerin sein mochte, überzeugend und betörend.
Eine Armlänge entfernt blieb sie stehen. Sie trug Lippenstift, der einmal vom gleichen Bordeaux wie der Mantel gewesen sein mochte, und lächelte Miroir an. Die Hand, die das Bier hielt, wurde ihm schwach: Das Lächeln hatte etwas Professionelles, auch etwas Gekünsteltes, das sich für Bruchteile von Sekunden in Schimmern offenbarte, doch man war gewillt, es ihr abzunehmen. Es war, als wäre das, was Miroir sah, nicht Teil der Wirklichkeit, nur auf eine Leinwand gemalt oder Teil eines Schauspiels.
Leise, beinahe flüsternd sprach das Mädchen: »Oui, isch denke, das muss er sein. Dunkles 'aar, schulterlang, und grüne Augen mit einem Funken Traurigkeit darin?« Sie lachte ins Smartphone: »Tu me connais à fond!« Ihre Stimme war verhalten und sanft, und wenn in ihr auch nicht die Weichheit lag, die solchen Stimmen meist zueigen war, ließ sie diese in ihren Zügen nicht vermissen. Das heisere Hauchen, das sich stattdessen um ihre Worte schmiegte wie flüchtiger Nebel an die Oberfläche eines ruhenden Sees, beschwor die Vorstellung einer naiven, wohlwollenden Weisheit.
Miroir wurde von oben bis unten gemustert. Mit den blauen Augen analysierte sie seine Erscheinung in Sakkaden, ehe ihr Blick den seinen traf und wie gefesselt darin verharrte, bis er Stück für Stück in die Seele vorgedrungen zu sein schien. Einige Sekunden verstrichen, vielleicht zehn, fünfzehn, und Miroir war – einen Herzschlag lang –, als würde er sich dem Bann der saphirenen Iriden nie wieder entziehen können. Eine kleine, nicht unwillkommene Illusion zwischen ihm und ihr, die er keineswegs zu durchbrechen versuchte.
Sie war es also, die abließ und sich räusperte. »Euh, oui«, stieß sie hervor. Wer am anderen Ende der Leitung war, hatte ihre Konzentration jäh zerschellen lassen. »Alors«, begann sie, »er trägt eine Lederjacke, offen, ein 'ellgraues T-Shirt darunter, dunkelgraue Jeans, schwarze Schuhe. Ein Rocker, glaube isch.«
Ihr Lächeln blich. Miroir wurde klar, dass die Wangen nicht kälte-, sondern rougerot waren; es war zwar kühl, doch zu mild für rote Wangen, und nur die herbstliche Kleidung des Mädchens hatte ihn glauben machen, es herrschte die Abendluft des Novembers.
»Non«, sagte sie, das Entsetzen in solcher Vollkommenheit gespielt, dass es Miroir das Herz gefrieren ließ, »das kann isch nischt tun. Je ne suis pas une …!« Sie zögerte. Skepsis legte sich in ihren Blick. »Quoi? – Ja, glaubst du wirklisch?«
Zögerlich – auch das war nicht echt – tat sie einen weiteren, den letzten Schritt. Das Mädchen legte einen Arm um Miroirs Hals und küsste ihn. Ein Duft von Vanille und Zimt und warmer Baumwolle stieg aus ihrem Schal empor. Eine Flut aus Erinnerungen brandete gegen Miroirs erstarrtes Selbst.
Es war ein langer, inniger Kuss, und als sich ihre Lippen trennten, hatte Miroir die benetzten Hände beherzt an die schmale Taille des Mädchens gelegt.
Mit einer Stimme, die um ihr Gleichgewicht rang, flüsterte sie ins Smartphone: »Chérie, isch glaube, wir müssen jetzt auflegen. À plus!« Nachdem sie das Gerät in die Manteltasche gesteckt hat, lächelte sie Miroir erneut an, erwartungsvoll. Fleur hatte viele Arten, zu lächeln, und alle waren sie gleichermaßen überwältigend.
Sie umarmte Miroir aufs Neue, nun mit beiden Armen, und drückte ihn an sich. Der Mantel war von hohem Wert, das fühlte man, und in gewisser Weise ähnlich fühlte auch Fleur sich an, als Miroir sie hielt. Es war eine Nähe, die an Reichtum denken ließ; selbst die Körperwärme Fleurs, diese besondere, diese unvergleichliche Wärme, schien wertvoller als die Wärme anderer Körper. Golden. Hehr.
»Wow«, sagte Miroir, dem es noch an Atem fehlte. »Gar nicht schlecht, meine Liebe. Das muss eines deiner besten Spiele gewesen sein, und der Akzent hat mir heute besonders gut gefallen.« Sie lösten sich voneinander, ein Grinsen zwischen ihnen, das voller Liebe war und Fäden zog wie süßer Honig. »Fast schade eigentlich, dass wir einander schon kennen.«
Die holzvertäfelten Räumlichkeiten des Tjenemit lagen in dimmem Licht und leicht staubiger Luft, doch so gehörte es zum Flair des Lokals. Der einzige andere Gast war ein älterer Herr mit Cordhut, der sich bucklig über den Tresen lehnte und aufs Weizenbier starrte. Er saß dort ohne Regung, ohne Ausdruck. Man mochte meinen, er hätte in diesem Leben nichts mehr vor, als dort zu sitzen und an seinem Glas zu nippen.
Fleur wählte eine der erhöhten Sitznischen, und sie und Miroir nahmen nebeneinander auf der Sitzbank Platz, sodass sie das gesamte Lokal, wenngleich es nicht viel zu sehen gab, im Blick behalten konnten.
»Wie war dein Tag, Chéri?«
Miroir zuckte die Schultern. »Es war immerhin der letzte.«
Fleur lächelte. »Der letzte, ja?« Sie hob die Arme. »Liberté totale?« Sie sprach ein ausgezeichnetes Französisch; ihre Mutter stammte aus den Weinbergen der Loire, ihr Vater war Deutscher, und so hatte sie das Glück, zweisprachig aufgewachsen zu sein. Sie mochte die französische Sprache lieber, und wenn man darauf achtete, glaubte man zuweilen, einen leichten Akzent in ihrem Deutsch auszumachen – der mehr oder weniger gespielt sein mochte.
Miroir nickte. »Liberté totale«, bestätigte er. »Du kannst dir sicher vorstellen, wie sehr ich mich auf die kommende Zeit freue. Ich bin voller Ideen und Tatendrang! Es ist fast, als ob …«
»… comme si on commençait enfin à vivre!«, beendete Fleur den Satz mit unverhohlener Passion. »En vérité! Ich freue mich für dich, Miro, und wie.« So nannte sie ihn, und nicht selten ließ sie sich dazu hinreißen, die Betonung auf die zweite Silbe zu legen. »Auch für mich übrigens«, fügte sie hinzu. Ihr Lächeln, umrahmt vom Abendrot, das durch die Fenster hinter ihr fiel, ließ Miroirs letzte Zweifel zu Asche niederbrennen wie einen Dämon in den Strahlen der Morgendämmerung. »Es wird schön sein, zu sehen, wie sich deine vielen Werke, für die du jetzt die Zeit finden wirst, entwickeln. Wie sie von Tag zu Tag neue Formen annehmen. Ich bin schon gespannt, sehr gespannt, was da alles entsteht.« Sie grinste, strahlte beinahe. »Mein Künstler!«
Miroir wandte sich leicht ab, den Blick gesenkt; wenn Fleur so über ihn sprach, brachte es ihn in Verlegenheit. Und außerdem: Was, wenn es nicht so kam? Wenn es sich am Ende als Fehler herausstellen würde, gekündigt zu haben, wenn er zurückkehren müsste, sich auf die Suche nach Arbeit begeben und andere Probleme lösen, statt sich seinen Werken widmen, statt nur einen Gedanken an die Kunst verschwenden zu können? Ein schlechtes Künstlerleben war besser als keins. Und was, schoss es ihm plötzlich in den Sinn, würde aus Fleur und ihm, wo sie in ihm zweifelsohne vor allem den Künstler sah?
Fleur schien zu bemerken, dass Miroir etwas betrübte. »Ich verstehe, dass es Gefahren birgt«, sagte sie, »aber lass uns optimistisch sein, ja? Es ist absolut notwendig, die Sache mit freiem Kopf zu beginnen, sonst tritt die rechte Wirkung gar nicht ein.«
Miroir nickte. »Du hast recht, mein Schatz. Ich muss einfach weiter ans Projekt glauben, wie ich es immer getan habe.«
Fleur lächelte zufrieden. »D'ailleurs«, sagte sie, »das Artwork, um das ihr … um das sie mich gebeten haben, ist fertig. Ich werde es ihnen noch zukommen lassen, gleich morgen früh. Es ist mir ganz gut gelungen, finde ich«, sagte sie in bescheidener Verlegenheit, »also möchte ich es veröffentlicht sehen.«
Ehe Miroir seine Zustimmung zum Ausdruck bringen konnte, näherten sich Stiefel harten Schrittes über die knarrenden Holzdielen. Das aufgesetzte Kellnerinnenlächeln, das Miroir aus der Entfernung sah, wandelte sich unterwegs zum ehrlichen, breiten Grinsen einer Schwester, die man nach langer Reise wiedertraf. Niéve Ventada – Niv –, die mit Abstand fähigste und langjährigste Kellnerin des Tjenemit und die beste Freundin von Fleur und Miroir,