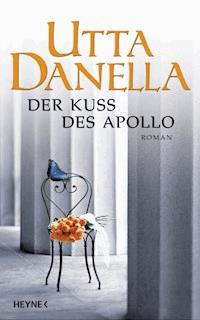
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Acht Jahre nach ihrem letzten Roman erzählt sie nun die bewegende Geschichte einer unscheinbaren jungen Frau, für die der Kuss eines geheimnisvollen Unbekannten alles verändert.
Geraldine Bansa ist eine von vielen jungen Schauspielerinnen, die sich Hoffnung auf die ganz große Karriere machen. Die kleinen Rollen, die sie spielen darf, verdankt sie nur ihrer Affäre mit dem arroganten, aber aufstrebenden Regisseur Sebastian Klose. Doch auch er nimmt die unauffällige Geraldine nicht ernst. Trotzdem darf sie bei seinem ehrgeizigsten Projekt, einer opulenten Verfilmung des Amphitryon-Themas an Originalschauplätzen, wieder mitspielen. Und dann geschieht das Wunder: Gerade als das Projekt an den Eitelkeiten im Filmteam zu scheitern droht, wird Geraldine von einem geheimnisvollen jungen Griechen geküsst – und aus der hässlichen Raupe wird ein wunderschöner Schmetterling. Geraldine blüht auf, sprüht mit einem Mal vor Charme und Einfallsreichtum und rettet als Hauptdarstellerin den Film. Über Nacht wird sie zum Star, wird gelobt und geliebt. Geraldine ahnt, dass dieses Glück nur geliehen ist, und in ihren Tagträumen sieht sie immer wieder den geheimnisvollen jungen Griechen. Doch in ihrem Herzen weiß sie, dass nur der Glaube an sich selbst Berge versetzen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Utta Danella
Der Kuss des Apollo
Roman
Copyright
PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © 2006 by Autor und Autoren- und Verlagsagentur GmbH, München-Breitbrunn
Copyright Deutsche Erstausgabe im Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
ISBN 3-89480-982-5
www.pep-ebooks.de
Die Sache mit dem GeldGäste im Hause FrobeniusAmphitryon, Zeus und AlkmeneEin erster AnlaufBeginn einer Freundschaft Das Drehbuch Eine Entscheidung wird vertagt Das Lachen des Zeus La Divina Die Agraffe Dreharbeiten in München Der Vater Die Zeit danach Nachtgedanken Eine Einladung aus dem Hause Frobenius Unerwartete Begegnung Oskar Alexander Im Grunewald Der zweite Film Dreharbeiten in Paris Eifersucht Rosen Hamburg Rückkehr nach Sylt Über den Wolken Mascha Sebastian Nachtgedanken II Familienleben Prinz Hamlet Über das Buch Über den Autor Copyright
Die Sache mit dem Geld
Irgendwoher wird das Geld schon kommen.
Eine Weile blieb der Satz im Raum stehen, klang seltsam. Jana, die damit beschäftigt war, die Weingläser aus dem Schrank zu nehmen, warf einen Blick auf ihren Mann, der am Fenster stand und in den Garten hinaussah, wo die Herbstblätter von den Bäumen sanken.
Sie konnte ihm von hinten ansehen, wie schlecht gelaunt er war, außerdem hörte man es seiner Stimme an.
»Das ist ja ein schreckliches Wort«, sagte sie.
»Was?«, knurrte er.
»Irgendwoher.« Sie sprach das Wort gedehnt aus und versuchte das R dramatisch zu rollen, was ihr nicht so gut gelang wie ihm mit seiner baltischen Herkunft.
Er drehte sich um.
»So! Das Wort gefällt dir nicht. Was würdest du denn sagen?«
»Geld kommt nicht von irgendwoher oder von irgendwo, man muss es beschaffen.«
»Darum geht es ja. Wie immer.«
Er sah ihr zu, wie sie die hellen Gläser neben die Gedecke stellte und dann die rötlich getönten Rotweingläser aus dem Schrank nahm und leicht versetzt hinter die Weißweingläser auf dem Tisch platzierte. Sie hatte eine Vorliebe für hübsche Gläser.
»Ich habe dich gar nicht gefragt«, sagte er, um bessere Stimmung bemüht, »was du gekocht hast.«
»Das wirst du dann schon sehen. Außerdem weiß ich ja, was Will gern isst.«
»Wie er immer sagt, am liebsten das, was du gekocht hast.«
»So ist es. Und deinem Genie wird es sowieso egal sein, was es isst.«
»Ich habe nie behauptet, dass er ein Genie ist. Ein begabter Junge, das ist meine Meinung. Leider hat er seinen letzten Film in den Sand gesetzt.«
»Was dich nicht daran hindern kann, Geld für ihn aufzutreiben. Irgendwoher.«
»Verdammt, hör auf mit dem Irgendwoher. Ich möchte diesen Film gern produzieren. Wir werden Will den verrückten Plan erläutern. Ob er mir finanziell beispringen wird, das ist die Frage.«
»Du kannst dieses Projekt jedenfalls nicht finanzieren. Und Fördermittel wirst du dafür nicht bekommen. Richtig?«
»Gewiss nicht. Und ich gebe zu …« Dr. Herbert Frobenius nahm sich eine Olive aus der Schale und steckte sie in den Mund.
»Dass dir die Geschichte anfangs recht gut gefallen hat …«
»Stimmt. Der Stoff und was Sebastian daraus machen will. Mittlerweile habe ich allerhand Bedenken.«
»Das gehört zu deinem Job als Produzent. Anfangs Begeisterung, dann Bedenken.«
»Immerhin habe ich in diesem Jahr zwei gute Filme abgeliefert.«
»Nicht von Sebastian. Und außerdem vom Fernsehen finanziert.«
»Ich habe genug von dem Fernsehmist. Ich möchte wieder mal einen richtigen Film machen.«
Jana seufzte. »Das wünsche ich mir auch. Aber deutsche Filme sind ein Risiko und selten ein Erfolg. Auch hierzulande beherrschen die Amerikaner den Markt. Und mit den alten Griechen wirst du kaum Gewinn erwirtschaften.«
»Du bringst mich in die richtige Stimmung.«
Jana lachte, trat zu ihrem Mann und legte ihm den Arm um die Schulter.
»Warten wir ab, und essen wir erst mal. Ich habe ein Tässchen Hühnerbrühe, eine kleine Scheibe Lachs für jeden und dann ein Viertel Ente pro Person, weil ich eben weiß, was Will am liebsten mag.«
Er legte beide Arme um seine Frau und küsste sie auf die Wange.
»Das gab es auch, die Ente, meine ich, als Will das letzte Mal hier war.«
»Das ist über ein Jahr her und war zu deinem Geburtstag. Wenn er wirklich das am liebsten isst, was ich koche, dann hat er lange darauf warten müssen.«
»Seine Frau mag ja nicht kochen.«
»Tja, das bedauert er immer. Dafür ist sie eine erfolgreiche Anwältin. Alles kann der Mensch nicht haben.«
»Du hast dir wieder einmal viel Arbeit gemacht.«
»Kaum der Rede wert. Mir macht das Kochen ja Spaß. Außerdem hat Evi mir geholfen. Und sie freut sich besonders, dass wir für Will gekocht haben.«
»Gutes Trinkgeld?«
»Das ist es nicht allein. Er gefällt ihr. Sie sagt, es ist doch prima, wenn ein Mann so reich ist und trotzdem so viel lachen kann.«
»Gar nicht so dumm. Siehst du, das könnte man in einem Film unterbringen. Wo gibt es das denn? Ein Mann ist vielfacher Millionär, macht auch kein Hehl daraus, freut sich über das Geld und lacht dazu noch.«
»Und wer schreibt dir so ein Drehbuch?«
»Keiner«, erwiderte Dr. Frobenius grimmig.
»Außerdem weiß ich, was dich ärgert.«
»Dass das dämliche Frauenzimmer dabei ist.«
»Womit wir beim Thema wären. Das Genie hat dich angerufen und gefragt, ob er sie mitbringen darf. Bitte, warum hast du nicht Nein gesagt?«
»Das ist meine Dämlichkeit. Wenn jemand anruft und fragt, ob er diesen oder jenen mitbringen darf, ist es schwierig, einfach abzulehnen.«
»Wenn ich am Telefon gewesen wäre, hätte ich es getan.«
»Du machst es dir leicht. Wie hättest du es denn formuliert?«
»Du denkst doch nicht, dass mir das schwergefallen wäre? Ich hätte gesagt, ich will mit meinem Freund ein Gespräch über die Finanzierung dieses Films führen, und Sie als Drehbuchautor und Regisseur müssen dabei sein, um alles zu erklären. Vom Fernsehen können wir für dieses Projekt nichts erwarten. Aber Ihre Freundin können wir bei diesem Gespräch nicht brauchen.«
»Ja, du hast recht. Vom Fernsehen können wir nichts erwarten.«
»Warum eigentlich nicht? Du hast es gar nicht versucht. Irgendwie könnten die doch auch wieder einmal zur Bildung der Menschheit beitragen. Jeden Abend, den Gott werden lässt, erleben wir Schwachsinn auf dem Bildschirm. Sind die Menschen wirklich so blöd, wie die meinen? Die alten Griechen sind doch immer noch aktuell. Ich habe erst neulich eine Dokumentation über Schliemanns Ausgrabungen gesehen. Im Fernsehen. Fand ich ungemein spannend.«
»Ja, eine Dokumentation. Keinen Spielfilm.«
»Überleg doch mal, wie viele Filme und Theaterstücke es über Odysseus und Orest und Elektra gegeben hat. Die Amerikaner waren da ganz groß. Wie hieß damals das Stück? Mourning Becomes Electra, nicht? Trauer muss Elektra tragen. Und dann, das war doch ganz toll: Der Trojanische Krieg findet nicht statt, so ähnlich hieß das doch? Das war Giraudoux.«
»Das ist eine ganze Weile her.«
»Damals gab es eben noch gutes Theater, nicht so ein selbstverliebtes Regietheater wie heute. Und Richard Strauss, er hat auch eine Elektra geschrieben, die gehört bis heute in jedes bessere Repertoire. Und Iphigenie…«
»Bitte, fang nicht noch mit Goethe an.«
»Gut, reden wir von Kleist. Diese Amphitryon-Geschichte ist nun mal ein dolles Ding. Ich hoffe nur, dein Genie will seine Freundin nicht die Alkmene spielen lassen.«
»Sie ist nicht seine Freundin.«
»Was denn dann?«
»Oder gerade doch. Sie ist jedenfalls nicht seine Geliebte.«
»Ja, was denn dann?«
»Sagen wir mal, sie war es.«
»Wenn ich mir die bescheidene Frage erlauben darf, wer oder was ist sie nun?«
»Ein grässliches Frauenzimmer.«
»Du nennst sie ein grässliches Frauenzimmer, ein dämliches Frauenzimmer, was findet er eigentlich an ihr?«
»Sie ist weder hübsch noch klug, schon gar nicht begabt, sie ist …«
»Halt, halt, du sollst sie mir nicht beschreiben. Sie ist heute Abend unser Gast, und ich will mir selbst ein Urteil bilden. Was ist sie für ihn?«
»Ich glaube er hat ein schlechtes Gewissen. Anfangs war es wohl eine Affäre. Seine erste Anstellung als Dramaturg, ihr erstes Engagement als Schauspielerin, irgendwo in der Provinz. Er hat sie verlassen …«
»Ich weiß. Ist er jetzt wieder mit ihr zusammen? Sind die beiden ein Paar?«
»Keineswegs. Ich kenne seine derzeitige Freundin, sehr attraktiv, sehr erfolgreich. Sie ist Sängerin hier an der Deutschen Oper. Sie singt zwar noch nicht die Elektra, um bei deinem Beispiel zu bleiben, aber die Musette.«
»Auch keine leichte Partie. Also, wie verhält es sich mit der Frau, die Eisenstein heute mitbringt?«
»Du sollst ihn nicht immerzu veralbern. Erst Genie, jetzt auch noch Eisenstein.«
»Ist eben der berühmteste Regisseur, der mir auf die Schnelle einfällt. Also, was bindet Sebastian Klose an diese Frau?«
»Wie gesagt, vermutlich sein schlechtes Gewissen. Sie hat ihn geliebt, er hat sie verlassen, sie war sehr jung damals, hatte gerade die Schauspielschule besucht und kam beim Publikum überhaupt nicht an. Er nennt sie unbegabt. Unter uns natürlich nur.«
»Darum beschäftigt er sie um jeden Preis. Sehr logisch.«
»Sie hatte lange kein Engagement mehr, es ging ihr gesundheitlich nicht gut.«
»Eine Abtreibung«, sagte Jana. Es war keine Frage.
»Wie kommst du darauf?«
»Wenn er ein schlechtes Gewissen hat, liegt die Vermutung nahe.«
»Davon hat er nie gesprochen.«
»Wie sollte er. Vielleicht hat er es erst erfahren, nachdem er sie verlassen hatte. Sie war krank, vielleicht auch sehr unglücklich, und nun hat er ständig das Bedürfnis, ihr zu helfen.«
»Seit er Filme macht und für das Fernsehen arbeitet, hat er es immer verstanden, ihr einen Job zu verschaffen, aber nur kleine Rollen, mehr ist nie drin.«
»Und jetzt will er sie eben auch in diesem Film unterbringen. Falls er denn je gedreht wird. Und darum schleppt er sie heute Abend an. Was soll sich denn Will dabei denken?«
»Du bringst mich wirklich in die richtige Stimmung«, wiederholte er.
»Ist gut, Liebling, ich bin ja schon still. Erst werden wir schön essen, und Will wird uns zum Lachen bringen, das kann er ja gut. Iss noch eine Olive, ich bringe dir gleich einen Drink. Was möchtest du?«
»Will mag keinen Champagner und keinen Campari. Am liebsten trinkt er nach guter amerikanischer Sitte einen trockenen Martini. Wie damals, als wir uns kennen gelernt haben. Nur nehmen wir jetzt Wodka statt Gin.«
»Aye, aye, Sir, wird sofort serviert. Und wenn ich Evis Lachen richtig deute, dann steht das Taxi mit Will schon vor der Tür.«
Gäste im Hause Frobenius
Sebastian Klose war deutlich anzumerken, dass er am liebsten gleich von seinen Plänen, seinem Stoff und seinen Ideen gesprochen hätte, aber über ein paar Ansätze kam er nicht hinaus, das wusste Jana geschickt zu steuern.
Wilhelm Loske war die wichtigste Person an diesem Abend, auf ihn und seine Bereitschaft, Geld in das Filmprojekt zu stecken, kam es an. Aber er wollte erst einmal seine Freude über das Wiedersehen äußern, dann erzählte er mit viel Witz von seiner letzten Amerikareise, und schließlich war das Essen Thema Nummer eins.
Jana hatte sich die Tischordnung genau überlegt. Will saß an der Stirnseite des Tisches. Sie saß rechts neben ihm, und rechts neben sich hatte sie Sebastian seinen Platz angewiesen. Ihr gegenüber saß die Frau, die Sebastian mitgebracht hatte, sodass sie Gelegenheit hatte, sie zu betrachten. Links von ihr hatte sie ihren Mann platziert. Das Beste von allem aber war, dass Evi am anderen Tischende saß. Alle Teller, alle Schüsseln standen griffbereit in ihrer Nähe, auch die Flaschen. Sie konnte genau sehen, was jeder auf dem Teller hatte, und so konnte sie servieren und nachservieren, wie es ihr nötig erschien.
Als sie fragte: »Noch einen Knödel, Herr Loske?«, seufzte er.
»Das kannst du gar nicht verantworten, Evi. Keine Frau wird mich mehr anschauen, wenn ich immer dicker werde.«
»Sie sind überhaupt nicht dick, Herr Loske. Sie haben eine prima Figur. Welche Frau will denn ein Gerippe im im …«
»Im Bett haben, willst du sagen.«
Evi kicherte. »Im Arm haben, wollte ich sagen.«
»Na gut, dann nehme ich noch einen Knödel. Es ist ja nur, weil die Soße so gut ist. Ach, und diese Ente, einzigartig.«
Er machte die Augen weit auf und blickte an die Decke.
»Bekomme ich nirgends in dieser Vollendung.«
»Wo versuchst du es denn?«, fragte Jana und nickte Evi zu, worauf diese noch ein Stück knusprige Entenbrust folgen ließ.
Da eine Ente für fünf Personen zu knapp bemessen gewesen wäre, beziehungsweise für sechs Personen, denn Evi musste schließlich auch essen, hatte Jana zwei Enten gebraten, und es war nicht einzusehen, warum ein kläglicher Rest übrig bleiben sollte.
Dieser Meinung schien auch Evi zu sein. Sie ließ ein Entenbein folgen und legte dann, ungefragt, dem Künstler auch noch ein beachtliches Stück auf den Teller. Zwar redete Sebastian nicht so viel über das, was er aß, aber zu schmecken schien es ihm auch.
Dann ging Evi mit der Platte zu der Frau, die Jana gegenüber saß. Die Frau schüttelte den Kopf, aber Evi bat beharrlich: »Bitte, gnädige Frau, noch ein kleines Stück«, und das wurde sie dann auch los.
»Ich versuche es hier und da immer wieder«, antwortete Will auf Janas Frage, »in guten, vornehmen Restaurants, in bürgerlichen, in ländlichen Lokalen, entweder ist der Vogel nicht richtig ausgebraten, das Fett sitzt noch unter der Haut, sodass die gar nicht richtig knusprig sein kann, oder kross, wie das heute heißt, das Fleisch löst sich nicht vom Knochen, wie hier zum Beispiel«, wobei er geschickt das Entenbein entblößte und den Knochen befriedigt auf den daneben stehenden Teller legte. »Die Soße ist zu fett oder mit einer Mehlschwitze vermurkst, die Knödel, wenn es überhaupt welche gibt, sind zu hart oder zu weich, das Rotkraut wird auf dem Teller serviert und verhunzt mir die Soße.«
Evi nickte zu jedem Wort, Herbert Frobenius grinste, und Sebastian sagte: »Ich habe noch nie erlebt, dass man so viel über Essen reden kann.«
»Ich denke, Sie schreiben Drehbücher«, sagte Will.
»Doch nicht über Essen.« Sebastian blickte ihn verwirrt an.
»Versuchen Sie es doch mal. So wie wir hier sitzen, mit Appetit essen und darüber auch noch reden, das wäre eine hübsche Szene.«
»Ein komischer Film müsste das sein«, murmelte Sebastian.
»Ja, genau. Komisch und unterhaltsam. Ich weiß, ich weiß, Unterhaltung ist immer noch ein Schimpfwort. Es gibt so genannte E-Musik und U-Musik. E-Literatur und U-Literatur. Kategorisch getrennt. Eine deutsche Besonderheit. Das Publikum und die Leser sollen sich gefälligst langweilen und sich nicht unterhalten fühlen.« Will nahm sich einen kleinen Löffel von dem Rotkraut, das sich in einer kleinen Schüssel neben seinem Teller befand. Das war eine Spezialität von Jana: lieber eine Schüssel zu viel auf dem Tisch als eine zu wenig.
Sie sagte: »Wenn du bestellst, musst du verlangen, dass man dir das Kraut und die Soße jeweils in einem Schüsselchen extra serviert. Dann kannst du mischen, wie du willst, und hast nicht von vornherein eine unüberschaubare Pampe auf dem Teller.«
Hier nun lachte Herbert. Sie aßen gut; und wie immer, wenn Will bei ihnen am Tisch saß, war es unterhaltsam. Er schickte einen liebevollen Blick über den Tisch zu seiner Frau. Sie spürte das und lächelte ihm zu.
»Kann ich ja mal versuchen«, sagte Will. »Aber heutzutage ist dieser Tellerservice überall in Mode. Spart wohl Personal.«
Jana war versucht zu fragen: Und wie serviert deine Frau das Essen? Aber das wäre boshaft gewesen, sie wusste, dass Elfriede Loske nicht gern kochte, am liebsten gar nicht. Ente gab es bei ihr jedenfalls nie.
»Ich kann dir einen Rat geben«, sagte Jana. »Du bist doch gern auf Sylt.«
»Sehr gern, das wisst ihr ja. Anfang September habe ich mir eine Woche gegönnt. Ehe ich nach Amerika musste. Da drüben kann man das Essen komplett vergessen.«
»Es gibt in Keitum ein Lokal, das heißt Karsten Wulff. Kennst du das?«
»Nee, kenne ich nicht.«
»Dort bestellst du dir das nächste Mal Ente. Sie ist kross gebraten, der Knödel kommt extra, das Rotkraut und die Soße auch.«
»Darf nicht wahr sein.«
Jana blickte befriedigt in die Runde, alle waren sie nun satt und machten zufriedene Gesichter.
Und was war mit dem Gesicht, das ihr gegenüber saß?
Jana lächelte. »Ich hoffe, Geri, es hat Ihnen auch geschmeckt.«
Die Frau lächelte zurück.
»Es war sehr gut«, sagte sie leise.
Ihre Stimme klang heiser, wie verraucht. Und sehr ansehnlich war sie wirklich nicht. Das Haar fiel ihr lang und strähnig auf die Schultern, das Gesicht war zu stark geschminkt, wirkte verlebt, ihre Haltung war schlecht.
Aber die Augen! Ihre Augen waren schön, das entdeckte Jana jetzt, denn bisher hatte diese Geri sie kaum angesehen. Sie schien zu spüren, dass sie nicht willkommen war.
Ihre Augen waren groß, wirkten dunkel, obwohl sie graugrün waren, sie standen ziemlich weit auseinander; ein Zeichen von mangelnder Intelligenz, wie Jana wusste.
Diese Weisheit hatte sie von ihrem Hausarzt. Der machte immer solche Beobachtungen und beurteilte die Menschen danach.
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie einfach Geri nenne. Aber so nennt Herr Klose Sie, nicht wahr?«
Sebastian hatte sich nicht die Mühe gemacht, seine Begleiterin richtig vorzustellen, er hatte nur gesagt: »Das ist Geri.«
Mit heiserer Stimme antwortete sie nun: »Mein Name ist vielleicht etwas umständlich. Ich heiße Geraldine.«
»Habe ich damals gleich gesagt, dass das unpraktisch ist«, mischte sich Sebastian ein. »Als wir zusammen am Theater waren, habe ich ihr sofort einen neuen Namen verpasst. Geralda Bansa. Kommt besser an.«
Jana empfand plötzlich Widerwillen gegen das Genie. Was maßte der sich eigentlich an?
Doch ehe ihr eine passende Antwort einfiel, ergriff Will das Wort und bewies wieder einmal, wie klug und gebildet er war.
»Geraldine«, sagte er, und es klang zärtlich, wie er den Namen aussprach. »Na, da hatte Ihre Mutter doch eine ganz bestimmte Person im Sinn, als sie Ihnen diesen Namen gab, Geraldine.«
»Meine Mutter nicht. Mein Vater. Er ist Schauspieler. Genauso erfolglos wie ich. Und er bewundert Charlie Chaplin.«
»Wer nicht«, sagte Will. »Er war einmalig. Geraldine heißt eine seiner Töchter. Erinnert ihr euch an Dr. Schiwago, die Verfilmung von Pasternaks Roman? Da hat sie mitgespielt.«
Daraufhin entstand ein Schweigen am Tisch. Herbert nickte Jana zu, also erinnerte er sich an den Film. Jana dachte nach, das war in den Fünfziger- oder Sechzigerjahren gewesen, sie war mit ihrer Mutter in Hamburg in dem Film gewesen, ein Breitwandfilm, das Meer aus gelben Blumen fiel ihr plötzlich ein. Lara hieß die eine der Frauen im Film, den Namen der Schauspielerin hatte sie vergessen. Geraldine Chaplin gab ihre Kontrahentin. Auf Anhieb hätte Jana es nicht mehr gewusst, das musste sie zugeben. Sie musste Herbert später unbedingt fragen, was er noch alles über diesen Film in Erinnerung hatte.
»Pasternak bekam den Nobelpreis«, erzählte Will. »Aber er durfte nicht ausreisen, um ihn entgegenzunehmen. Gott, waren das beschissene Zeiten.«
Erstaunlicherweise sagte Evi: »Ich habe den Film gesehen. Er war einfach toll.«
»Aber, Evi, dazu bist du noch viel zu jung. Und du hast den Film doch wohl kaum in der DDR gesehen.«
Darauf ging Evi nicht näher ein, sie sprach selten über ihre Jugend hinter der Mauer.
»Ich war mal zur Kur. In Bad Wörishofen, und da lief der Film in einem Kino. Er war wirklich wunderbar.«
»Du warst zur Kur, Evi?«, fragte Will.
»Es ist mir ja nicht immer so gut gegangen wie in diesem Haus. Ich habe damals als Serviererin in einer Raststätte gearbeitet. Ich hatte immer so dicke, geschwollene Beine. Damals. Heute nicht mehr.«
Sie streifte ihren Rock hoch und zeigte ihre Beine, die schlank und sogar ziemlich schön waren.
»Man war sehr freundlich zu den Flüchtlingen von drüben. Und da bekam ich eben die Kur. Im kalten Wasser waten und so. Hat mir sehr gut getan.«
Evi war Ende der Siebzigerjahre auf abenteuerliche Weise über Bulgarien in die Bundesrepublik geflohen. Aber sie sprach nicht darüber, wie es dazu gekommen war.
Jana warf einen flüchtigen Blick in die Runde. Der Regisseur machte ein ziemlich dummes Gesicht. Zu Dr. Schiwago fiel ihm offenbar nichts ein. Herbert nickte ihr zu. Will lächelte.
Ihr Gegenüber, Geri, Geraldine, blickte verständnislos. Sie ist eben dumm, dachte Jana.
»Zum Dessert gibt es nicht viel«, sagte sie. »Obstsalat. Oder Ananas mit Eis.«
»Ananas ohne Eis«, sagte Will.
»Gut. Und den Kaffee oder Espresso trinken wir im Gartenzimmer.«
Amphitryon, Zeus und Alkmene
Als sie im Gartenzimmer saßen, kam Will gleich zum Anlass des Abends.
»Sie wollen also einen neuen Amphitryon-Film drehen«, sagte er zu Sebastian.
»Ich will keinen neuen Amphitryon-Film drehen, ich will einen Film über den Amphitryon-Stoff machen«, sagte Sebastian bestimmt.
»Soviel ich weiß, gab es darüber schon einen Film.«
»Das ist lange her, irgendwann in den Dreißigerjahren.«
Jana und Herbert tauschten einen Blick. Sie hatten sich zur Vorbereitung auf diesen Abend das Video besorgt. Es war ein alter UFA-Film, der junge Willy Fritsch spielte mit und daneben die sehr junge, noch ganz unbekannte Käthe Gold. Der Film war bezaubernd, aber sie würden sich hüten, jetzt davon zu sprechen.
»Der Amphitryon-Stoff ist immer wieder aufgegriffen worden«, fuhr Sebastian eifrig fort. »Es ist ja auch eine ungeheure Geschichte. An die vierzig Stücke und Bücher gibt es darüber. Heißt es. Giraudoux nannte sein Stück Amphitryon 38, weil es angeblich die achtunddreißigste Version ist. Auch ihm ist es nicht besonders gut gelungen. Das Stück, von dem es heißt, es sei das erste, ist von Plautus. Ich habe es gelesen, es ist schrecklich, eine einzige Sauerei. Wir kennen Molière und Kleist, und beide werden dem Stoff nicht gerecht. Auch Kleist nennt es ein Lustspiel. Ich frage, was ist lustig daran? Es ist die Geschichte eines Betruges, und auch wenn ein Gott der Betrüger ist, kann ich es nicht lustig finden. Trotz des ganzen Drumherums, der Streit, die Schlägereien, die Verwirrung aller Beteiligten, zum Lachen ist das alles nicht. Jedenfalls nicht für mich.
Geri und ich, wir haben es damals anders gesehen und darüber gesprochen. Darum habe ich Geri mitgebracht, als meine Zeugin gewissermaßen.«
Alle schwiegen und blickten Geraldine an, aber die schwieg auch. Evi, die den Kaffee serviert hatte und nun mit der Cognacflasche die Runde machte, blickte verständnislos von einem zum anderen.
»Ich habe auch Kirschwasser. Und eine alte Pflaume …« Sie stockte. »Vieille Prune, meine ich.« Mit solchen Wörtern tat sie sich immer noch etwas schwer. »Und Marillengeist«, fügte sie hinzu.
»Dann für mich eine Marille«, bat Will. »Ich hoffe, sie kommt aus Österreich.«
»Wenn wir hier auch in Berlin sind«, sagte Herbert Frobenius heiter, »wissen wir doch, was sich gehört. Marille nur aus Österreich.«
Jana blickte hinaus in den Garten. Es war inzwischen dunkel, nur die Laterne, die an der Hausecke hing und ein wenig im Wind schaukelte, warf flüchtiges Licht auf die Bäume. Der Wind hatte auf West gedreht, es würde vermutlich morgen regnen. Sie hatte ein Gespür für Wetter, sie stammte von der Insel Sylt und erkannte jede Windrichtung und was daraus folgen würde, sogar hier in Dahlem.
Sie ließ sich einen Cognac von Evi einschenken und beschloss, etwas Tempo in das Gespräch zu bringen.
»Wenn ich das richtig verstanden habe, wart ihr beide«, Blick zu Geraldine, Blick zu Sebastian, »damals zusammen am Theater, und wenn ich es weiter richtig verstanden habe, spielten sie an diesem Theater den Amphitryon. Den von Kleist?«
Sebastian nickte. »Natürlich hatte ich das Stück früher mal gelesen, es hatte mich nicht weiter beeindruckt, aber auf der Bühne ärgerte es mich.«
»Und Sie haben die Alkmene gespielt, Geraldine?«
»Gott bewahre«, sagte sie mit heiserer Stimme. »Nicht mal die Charis. Ich war eine von den Mägden, die im Hof herumsaßen. Vier waren wir im Ganzen, das Ensemble war klein. Auch wenn man für richtige Rollen engagiert war, musste man Statisterie machen, das ging gar nicht anders.«
Immerhin, dachte Jana, so viel auf einmal hat sie bisher nicht gesprochen.
»Und die Aufführung gefiel euch nicht.«
»Die Aufführung war mittelmäßig, klar«, sagte Sebastian. »Aber es ist vor allem das Stück, das mir nicht gefällt. Wenn Kleist sich schon darüber hermacht und es Molière nachschreibt, dann hätte er sich etwas Neues und vor allem Besseres dazu einfallen lassen können. Wenn Zeus vom Olymp herabsteigt, um wieder einmal eine Erdenfrau zu vernaschen, diesmal nicht als Schwan oder als Stier oder in welchen Verkleidungen er sich die Frauen sonst noch nimmt, die ihm gefallen, warum kommt er zu der Frau in der Gestalt ihres Mannes? Warum sieht er aus wie Amphitryon, warum benimmt er sich wie Amphitryon, warum redet er wie Amphitryon, obwohl er nicht Amphitryon ist? Das nenne ich eben Betrug. Wenn er dann wenigstens stillschweigend wieder verschwinden würde, wenn er seine Liebesnacht mit Alkmene aus ihrem Gedächtnis löschen würde, mit einem Kuss oder wie auch immer, schließlich ist er ja ein Gott, dann hätte man das noch verzeihen können. Aber nein. Er muss unbedingt in der Figur des Amphitryon auftreten. Und das klappt auf der Bühne sowieso nicht.«
»Das kann ja auch nicht klappen«, sagte Frobenius. »Man müsste dazu ein Zwillingspaar im Ensemble haben. Es klappt auch an großen Bühnen nicht. Darum hat ein Film seine Reize, weil da beide Rollen vom selben Mann gespielt werden können.«
»Hm, das ist wahr, ich bin da ganz Ihrer Meinung, Herr Klose«, sagte Will. »Warum lässt Kleist ihn nicht einfach stillschweigend verschwinden? Und Alkmene könnte es vergessen haben, wenn ihr Mann dann wirklich vom Schlachtfeld nach Hause kommt.«
»Das kann ich euch genau erklären«, sagte Jana. »Weil dann der große Knall ausfallen würde samt der Wolke, in der Zeus auf den Olymp verschwindet.«
Evi, die wie angenagelt mit der Cognacflasche hinter Jana stand, sagte traurig: »Ich kenne die Geschichte nicht. Wir haben das in der Schule nicht gelernt. Aber ich bin ja auch nur in eine einfache Schule gegangen.«
Jana lachte, drehte sich um und nahm ihr die Flasche aus der Hand.
»Bestimmt habt ihr das in der DDR nicht in der Schule gelernt, und ich bezweifle, ob es heute in unseren Schulen auf dem Lehrplan steht. Setz dich, Evi. Ich erzähle dir die Geschichte kurz.«
Frobenius nickte. Jana war wie immer die Klügste. So kam man ganz klar auf den Stoff, ohne sich noch länger damit aufzuhalten, was die verschiedenen Dichter falsch gemacht hatten. »Das ist griechische Mythologie«, erklärte Jana. »Und die ist bei den alten Griechen mit der Historie vermischt. Möglicherweise hat es einen Amphitryon gegeben, er war König von Theben, Herrscher von Theben, vielleicht auch nur der Feldherr, der in den Krieg zog, in einen der vielen Kriege, die sie ununterbrochen führten, und in diesem, um den es hier geht, war er der Sieger. In den Lexika jedenfalls steht sein Name. Das ist wie mit dem Trojanischen Krieg. Wir wissen, dass er stattgefunden hat, das beweisen die Ausgrabungen. Aber er hat bestimmt nicht auf die Weise angefangen, wie Homer es beschreibt, genau wie sich die lange Heimreise des Odysseus nicht so abgespielt hat, wie er es erzählt.«
Jana unterbrach sich, trank von ihrem Cognac. Das war das Verteufelte mit diesen griechischen Sagen, man geriet immer von einem ins andere. »Also, die Sache war so, Amphitryon war ein Feldherr, der in den Krieg gezogen war, und zu Hause im Palast in Theben wartete seine Frau Alkmene, umgeben von ihrem Hofstaat. Sie liebten sich und führten eine glückliche Ehe.«
Frobenius nickte seiner Frau zu. Das genügte. Es gab verschiedene Versionen über diesen Krieg, es gab sogar genaue Angaben, gegen wen er ihn führte, auch dazu gab es widersprüchliche Meinungen, und ob und wie diese Ehe zwischen Alkmene und Amphitryon zustande gekommen war, dazu gab es auch verschiedene Aussagen, so war das nun mal bei den alten Griechen.
Nischt Jenaues weeß man nich sagen die Berliner in solchen Fällen. Frobenius unterdrückte ein Lächeln.
»Alkmene muss eine sehr schöne Frau gewesen sein«, fuhr Jana fort, »sie war Zeus, dem Gott der Götter, aufgefallen, und weil er Gefallen daran fand, seine Frau Hera zu betrügen, war es diesmal Alkmene, die er besitzen wollte.«
Evi kicherte. »Das ist wie bei den Menschen auch.«
»Muss wohl so sein.« Jana warf ihrem Mann einen Blick zu. Jetzt grinste er unverhohlen.
Er hatte sie auch betrogen, das wusste sie. Vielleicht nicht so oft wie Zeus seine Hera. Genau wusste sie es nur von einem Mal, und sie hatte großzügig darüber hinweggesehen. Sein Beruf brachte ihn mit attraktiven Frauen zusammen und natürlich auch mit solchen, die sich von dem Verhältnis mit einem Produzenten Protektion erhofften.
»In diesem Fall«, fuhr sie fort, »tut Zeus das, was Herr Klose einen Betrug nennt. Er nähert sich Alkmene in der Gestalt ihres Mannes, verbringt die Nacht mit ihr und …«
»Und diese Alkmene hat das nicht gemerkt?«
»Nein.«
»Eigentlich sind es drei Nächte«, flocht Sebastian ein, »denn Zeus veranlasst Helios, den Sonnenwagen anzuhalten, sodass die Nacht sehr lange dauert.«
Jana schüttelte den Kopf. Gar zu kompliziert durfte man es auch nicht machen.
»Unglücklicherweise kommt Amphitryon am nächsten Morgen nach gewonnener Schlacht aus dem Krieg zurück, und plötzlich gibt es am Hof zu Theben Amphitryon zwei Mal. Das ist für alle sehr verwirrend, besonders für den echten Amphitryon, und für Alkmene selbstverständlich auch, doch dann gibt sich Zeus schließlich zu erkennen und kehrt in einer Wolke auf den Olymp zurück.«
»Vielleicht sollte man hinzufügen«, sagte Will, »dass diese Nacht nicht ohne Folgen bleibt. Alkmene bringt einen Sohn zur Welt, Herakles. Und Herakles wird der größte Held aller Zeiten. Nachdem er große Taten vollbracht hat, darf er als Halbgott zu seinem Vater auf den Olymp. Alkmene allerdings erleidet das Schicksal aller Sterblichen.«
»Sie starb?«, fragte Evi fassungslos.
»Irgendwann sicher. Über ihr weiteres Leben weiß man nichts. Das war den alten Griechen nicht so wichtig.«
»Wer will noch Kaffee?«, fragte Jana nach einer Weile, als keiner ein Wort sagte. Draußen schüttelte der Wind den Ahorn im Garten. Der Regen kam vielleicht noch in dieser Nacht.
»Kleist beendet das Stück mit dem ›Ach!‹ der Alkmene. Ein schöner Schluss, das muss man zugeben. Sofern eine Schauspielerin diesen Laut aus Erkenntnis, Entsetzen und Entzücken richtig bringen kann. Die damals konnte es nicht«, sagte Sebastian.
»Und Betrug war es eben doch«, beharrte Geraldine. »Zeus oder nicht Zeus.«
»Am Schluss wussten sie ja Bescheid. Und weil es sich um Zeus handelte, gaben sich alle zufrieden. Auch Amphitryon«, sagte Will.
»Woher wollen Sie dass wissen?«, widersprach Geraldine. »Vielleicht mochte er nicht mehr mit Alkmene schlafen. Vielleicht auch sie nicht mehr mit ihm, weil Zeus der bessere Liebhaber war.«
Sebastian fuhr sich mit beiden Händen durchs Haar.
»Nun macht die Sache nicht noch komplizierter, als sie es ohnehin schon ist. Dann müssten wir ja eine Fortsetzung schreiben.«
»Du musst dir schon etwas einfallen lassen, wenn du einen neuen Amphitryon-Film drehen willst«, sagte Geraldine, die nun gar nicht mehr schüchtern wirkte. Sie sagte jetzt auch: einen neuen Film, was ihn ärgerte.
Damals, als sie über den Amphitryon-Stoff endlos geredet hatten, waren sie ein Liebespaar gewesen. Geraldine war neunzehn und liebte ihn sehr. Zuvor hatte es nur ein einziges Erlebnis mit einem Mann gegeben, ein älterer Kollege ihres Vaters hatte sie verführt, als sie siebzehn war. Das hatte ihr nicht gefallen.
Aber nun war es Liebe, bei ihr mehr als bei ihm.
Er wusste jedoch noch genau, was sie damals über Amphitryon gesagt hatte.
Sie hatte gesagt: »Ich würde es spüren, wenn ein anderer in mir ist. Wenn es du nicht bist. Ich würde es spüren. Und wenn es zehnmal ein Gott wäre.«
Daran dachte er jetzt, aber das konnte man nicht aussprechen. Amphitryon und Alkmene waren gegenwärtig im Gartenzimmer des Dahlemer Hauses, das dem Filmproduzenten Dr. Herbert Frobenius und seiner Frau Jana gehörte. Draußen schüttelte der Wind inzwischen alle Bäume.
»Es wird heute Nacht regnen«, sagte Jana.
Das brachte Evi zurück in diese Welt und diese Zeit.
Sie sprang auf. »Die Gartenmöbel sind noch draußen. Ich stell sie schnell rein.« Und weg war sie.
»Haben Sie denn schon ein Drehbuch, Herr Klose?«, fragte Will.
»Davon kann noch keine Rede sein«, sagte Sebastian. »Ich habe keine Ahnung, was ich schreiben werde. Ich weiß nur, dass ich den Amphitryon machen will. Das ist wie eine fixe Idee bei mir.«
»Dann eilt es ja nicht so«, stellte Will befriedigt fest. »Mit dem Drehbuch haben Sie noch eine Weile zu tun. Wenn es fertig ist, werden wir darüber reden. Falls Sie bei dem Stoff bleiben. Sicher könnte man einiges verändern. Und vor allem müssten Sie tolle Schauspieler haben.« Er sah Frobenius an. »Das wäre dann deine Aufgabe. Nicht solche Sternchen, wie sie uns das Fernsehen heutzutage vorsetzt. Und nicht solche halbgaren Sporttypen mit einem Kräuselbart im Gesicht. Na, warten wir mal ab. Dann könnte ich ja eigentlich bald zu Bett gehen. Morgen habe ich noch zwei Termine. Wenn ich schon in Berlin bin, will ich das ausnutzen.«
»Du wohnst wieder im Kempinski?«, fragte Frobenius.
»Klar, wo sonst.«
Blieb die Frage, wo die beiden anderen wohnten. Das heißt, Frobenius wusste, dass Sebastian bei seiner Freundin, der Sängerin, wohnte.
Er hatte keinen festen Wohnsitz, mal war er in Hamburg, mal in München, am liebsten aber in Paris, wo er angeblich ein kleines Appartement besaß. Und war er wie jetzt in Berlin, kampierte er bei seiner Freundin. Frobenius fragte sich, wie lange die das noch mitmachen würde. Wo Geraldine wohnte, mochte er nicht fragen, aber sie war mit Sebastian in seinem Wagen gekommen, also würde er es wohl wissen.
Sebastians Taktgefühl war nicht so ausgeprägt, sie erfuhren es gleich darauf.
Zunächst fragte er Will höflich: »Darf ich Sie ins Hotel bringen, Herr Loske?«
»Danke, nein. Wir bestellen dann ein Taxi. In Berlin fahre ich immer Taxi. Berliner Taxifahrer sind einfach immer höchst unterhaltsam. Und wie Sie wissen, habe ich für gute Unterhaltung viel übrig.«
»Geri wohnt bei ihrem Vater. Da bringe ich sie erst mal nach Hause.«
Keiner widersprach, denn es war offensichtlich, dass Will noch eine Weile mit Jana und Frobenius allein sprechen wollte.
»Geris Vater ist zurzeit auch ohne Engagement, und da hat sich die Familie wieder zusammengefunden. Sie leben drüben, vor drei Jahren war es noch der Osten, aber jetzt …«
»Ksch!«, machte Geraldine. Ihre Augen waren jetzt wirklich grün und funkelten vor Wut.
Jana machte ein Ende, sie stand auf.
»Ich bringe euch hinaus. Seht ihr, was habe ich gesagt, es fängt gerade an zu regnen.«
Frobenius ging mit, brachte die beiden zu ihrem Wagen, einem altersschwachen VW.
Will blieb sitzen, und als die beiden wieder ins Zimmer kamen, sagte er: »Die Kleine kann einem leidtun. Sie war sicher mal ein ganz hübsches Mädchen.«
»Sie ist nicht dumm«, sagte Jana. »Aber total verbittert. Und unglücklich.«
»Ein hoffnungsloser Fall«, sagte Frobenius. Worin er sich täuschen sollte.
Ein erster Anlauf
Herbst und Winter gingen vorbei. Sebastian ließ lange nichts von sich hören, was Frobenius aber nicht störte, hatte er doch immer genug zu tun. Noch im November beendete er die Produktion einer höchst amüsanten Kriminalgeschichte, und gleich im neuen Jahr begann die Arbeit an einem Roman, den eine junge Autorin geschrieben hatte, ein ziemlich armseliger Stoff, aber die Dame hatte eine gute Presse. Beide Filme waren Auftragsarbeiten fürs Fernsehen.
Ende Februar brachte Sebastian ein Drehbuch, das Frobenius rundweg ablehnte.
»Das ist unmöglich. Du hast den Giraudoux noch hineingewurschtelt, dazu diese flapsige Sprache, das passt einfach nicht. Freche Sprüche allein reichen nicht aus, um die Story in der Gegenwart spielen zu lassen. Es ist nun mal ein Gott, der eine Menschenfrau liebt. Ein gewisser Zauber muss schon dabei sein.«
»Gott! Wer glaubt denn heute noch so einen Blödsinn. Und freche Sprüche, da müssen Sie mal den Plautus lesen.«
»Wenn du nicht daran glaubst, dass es Zeus war, dann lass es bleiben.«
»Das werde ich auch. Warum soll ich mir wegen der alten Griechen das Hirn zermartern.«
Dann wieder Schweigen.
»Inzwischen bin ich richtig verliebt in den Stoff. Wen könnten wir denn das Drehbuch schreiben lassen?«
»Das würde er dir nie verzeihen«, sagte Jana.
Bei einem Empfang des Kultursenators trafen sie die junge Sängerin, die Frobenius flüchtig kannte.
»Ich habe auch lange nichts von ihm gehört. Zurzeit ist er in Griechenland, er macht so eine Art Inselhopping.«
»Dann hat er den Plan noch nicht aufgegeben«, sagte Jana.
»Nein. Er ist besessen von diesem Amphitryon. Das heißt, noch mehr von Zeus und der schönen Alkmene. Er sagt, der Witz bei einem Film ist es eben, dass Zeus und Amphitryon vom gleichen Mann gespielt werden können.«
»So schlau sind wir schon lange«, sagte Frobenius.
»Und er will den größten Schauspieler aller Zeiten haben. Am liebsten den Gregor, aber der hat sich ja aus dem Filmgeschäft zurückgezogen.«
»Bisschen zu alt ist er inzwischen auch«, sagte Frobenius trocken.
»So, an die Schauspieler denkt er also auch schon! Und ich dachte, er hätte die Idee begraben.«
»Hat er nicht und wird er auch nicht, so gut kenne ich ihn. Es hat ihn sehr verärgert, dass Sie sein Buch abgelehnt haben. Dann wird er sich eben einen anderen Produzenten suchen, hat er gesagt.«
»Da denkt er ähnlich wie ich. Mir erschien es auch besser, einen anderen Autor und Regisseur zu finden.«
Die Sängerin lachte. »Das kann ja spannend werden. Jetzt treibt er sich in Griechenland herum und hat überhaupt kein Geld mehr. Er hat mich schon zwei Mal angepumpt. Saß irgendwo in einer Pension herum, eine ganz bescheidene Bleibe, wie er am Telefon gesagt hat, aber er konnte nicht mal die Rechnung bezahlen.«
»Zeus wird ihm auch nicht helfen.«
»Kann man’s wissen?«
Kurz darauf erreichte Frobenius ein Brief, in dem Sebastian um einen größeren Vorschuss bat. Das Buch sei jetzt fertig, oder fast fertig, er müsse nach Paris, um dort in Ruhe weiterzuarbeiten. Der Brief kam von der Insel Rhodos.
Ohne Geld komme er nicht von dort weg, schrieb er.
»Und wovon lebt er, wenn er kein Geld hat?«, sagte Frobenius kopfschüttelnd zu Jana.
»Vielleicht hat er sich eine wohlhabende Griechin angelacht, und nun braucht er das Geld, um zu flüchten.«
Zu dieser Zeit rief Will wieder einmal an, fragte unter anderem, wie es mit der Produktion des Amphitryon stehe. Er habe gerade einen unerwarteten Gewinn gemacht, einen Teil des Geldes in die Schweiz transferiert – so was sagte er ohne Hemmung –, und er wolle sich jetzt an der Produktion beteiligen. Nachdem er alle Neuigkeiten kannte, sagte er: »Ich brauche frische Luft, ich will in die Berge. Schick dem Jungen Geld, er soll schleunigst das Buch fertig schreiben, was ihm bis jetzt nicht eingefallen ist, fällt ihm sowieso nicht mehr ein. Und es wird nicht besser, wenn er so lange daran rumbastelt. Wir treffen uns – das heißt Jana, du und ich –, und zwar um Ostern herum in Bad Reichenhall. Dort soll er das Buch hinschicken. Aber kommen darf er erst, wenn es uns gefällt. Wir wohnen im Axel, wie immer. Ich werde gleich die Zimmer bestellen.«
»Und deine Frau? Kommt sie nicht mit?«
»Ich kann sie ja fragen. Aber sie will Ostern lieber an die Côte d’Azur, da gefällt es ihr besser.«
Frobenius hatte auch eine Frage auf den Lippen, aber er stellte sie nicht, das tat er erst, als er Jana von dem Gespräch erzählte.
»Ob sie einen Liebhaber hat?«
»Kann sein. Auf jeden Fall hat sie eine beste Freundin, mit der war sie schon öfter verreist.«
»Willst du damit sagen, dass sie lesbisch ist?«
»Du hast eine blühende Fantasie. Man kann doch eine Freundin haben, ohne dass es auf so eine Art abläuft. Will ist schließlich auch dein Freund, und ihr seid nicht schwul.«
»Auch wieder wahr.«
»Übrigens war sie schon einige Male in Griechenland, das hat er uns erzählt, kannst du dich erinnern? Und als ich ihn gefragt habe, warum er nicht mitgefahren ist, hat er gesagt, es ist ihm dort zu warm. Schade, dass sie nicht mitkommt, sie könnte sicher einiges von den Griechen erzählen.«
»Die Griechen von heute nützen uns nichts. Sie könnte vermutlich nichts über Zeus erzählen, und außerdem kannst du sie nicht leiden.«
»Geht so. Wir haben uns nicht viel zu sagen, die Frau Dr. Loske und ich.«
Der Ton, in dem Jana das sagte, und die Miene, die sie dazu aufsetzte, brachten ihren Mann zum Lachen.
»Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich auf Reichenhall freue«, sagte er dann.
»Ich weiß«, sagte Jana und küsste ihn.
Beginn einer Freundschaft
In Bad Reichenhall, im Jahr 1946, hatten sie sich kennen gelernt, Herbert Frobenius und Wilhelm Loske.
Ein Jahr nach Kriegsende, Deutschland lag in Trümmern, doch der Kurort war unbeschädigt vom Bombenkrieg und verschont vom Terror der Roten Armee. Hier regierten die Amerikaner, und zwar mit Wohlbehagen, die Hotels und das Kurhaus standen ihnen zur Verfügung, sie bekamen gut zu essen und fuhren in großen Autos oder Jeeps durch das Tal.
Neben ihnen waren die Displaced Persons, wie das auf Amerikanisch hieß, im Ort tonangebend. Das waren Versprengte, Vertriebene, aus Lagern Befreite und Zwangsarbeiter, die zumeist aus dem Osten stammten, wohin sie auf keinen Fall zurückwollten. Bei den Amerikanern ließ es sich besser leben. Man hatte sie untergebracht, und sie erhielten ausreichend Lebensmittelkarten.
Bei der einheimischen Bevölkerung waren sie höchst unbeliebt, es gab Einbruch und Diebstahl, alle Arten von Belästigung, denn die Displaced Persons waren der Meinung, wenn sie schon von den Nazis verschleppt und zur Arbeit gezwungen worden waren, konnten sie sich jetzt an den Deutschen schadlos halten. Sie wurden schließlich von den Siegern beschützt.
Man hatte in Reichenhall zwar kein Eigentum verloren, Flüchtlinge und Ausgebombte hatte man sehr wohl aufnehmen müssen, aber auf keinen Fall wollte man nun noch von irgendwelchen Fremden bestohlen werden.
Es gab also verschiedene Gruppen im Ort; die Einheimischen, die Amerikaner, die Displaced Persons, deutsche Flüchtlinge und endlich, genau wie früher auch, Kranke oder Leidende, die kuren wollten.
Das war auch zu dieser Zeit möglich. Die Ärzte praktizierten, die Kureinrichtungen waren geöffnet, man musste nur von zu Hause ein Attest mitbringen und für Bad Reichenhall eine Aufenthaltsgenehmigung ergattern. Und dann musste man sehen, wo man unterkam. Die Kurheime gab es noch, zum Teil waren sie jedoch beschlagnahmt für amerikanische Soldaten, für Displaced Persons und auch für deutsche Verwundete.
Hervorragend wie in Friedenszeiten war das Kurorchester, es gab erstklassige Konzerte, die auch von den musikbegeisterten Amerikanern besucht wurden. Selbstverständlich interessierten sich die Amis auch für einigermaßen hübsche Mädchen. Der Weg nach Berchtesgaden war nicht weit, dort stand ihnen der Berchtesgadener Hof zur Verfügung, Hitlers einstiges Prachthotel, da gab es Theateraufführungen, man konnte essen, trinken und tanzen.
Das alles gab es für die beiden Jungen, die nach langen Umwegen hier gelandet waren, natürlich nicht. Es war schwierig genug, bis Wilhelm Loske Lebensmittelkarten bezog, denn er hatte keine Aufenthaltsgenehmigung. Er war bei seiner Tante Kitty untergekommen, die allerdings über ein paar gute Verbindungen verfügte, die sie sich im Laufe der Jahre geschaffen hatte. Als sie sich dann noch einen fröhlichen amerikanischen Sergeant zulegte, ging es ihnen recht gut. Kitty, die eigentlich Käthe hieß und sich selbst umbenannt hatte, war immer recht geschickt mit ihrem Leben umgegangen.
Herbert Frobenius hingegen war der einsamste Mensch auf der Welt, auch der hungrigste, bis zu dem Tag, an dem er Wilhelm Loske traf.
Er saß auf dem erhöhten Ufer über der Saalach, blickte in das schnell dahinrauschende Wasser und dachte, ob es nicht besser wäre, sich da hineinfallen zu lassen. Er hatte kein Dach über dem Kopf, die amerikanische Militärpolizei hatte ihn schon mal in der Nacht aufgegriffen, als er auf einer Parkbank schlief, und für ein paar Tage eingesperrt. Nachts ging er zum Schlafen tief in die Wälder, noch war es Sommer, aber er schlief trotzdem nicht, gequält von den Gedanken an das vergangene Leben, zutiefst traurig, dass er seine Mutter verloren hatte. Er war am Ende.
Er hatte einen weiten Weg hinter sich, aus Danzig kommend, war er nun auf endlosen Irrwegen im südlichen Bayern gelandet, wo kein Mensch etwas von ihm wissen wollte. Seine Mutter hatte ihn auf die Reise geschickt, um sein Leben zu retten. Er war siebzehn, als er loszog, ohne zu wissen, wohin. Er sollte den Russen entkommen, die schon begannen, Danzig zu beschießen, man würde ihn in eine Uniform stecken, an ein Flakgeschütz setzen. Du musst fort, weit fort, hatte sie gesagt.
Angekommen war er nirgends.
Bis zu diesem Tag im Juli 1946.
Will kam auf dem Uferweg herangeschlendert, er führte den Hund seiner Tante spazieren, und der Hund, ein brauner Setter, entdeckte die Gestalt hinter den Büschen, lief hin und beschnupperte sie.
»Na, du«, sagte Herbert und streckte dem Hund die Hand hin.
Will, schon damals einer, der es genau wissen wollte, schob die Büsche auseinander, blickte auf die magere, ausgemergelte Gestalt und fragte: »Wo kommst du denn her?«
»Aus Reval«, kam es mürrisch.
»Aus was sagste da? Willst du mich veräppeln? Das ist doch in Russland.«
Herbert ersparte sich die Antwort. Russland war es nicht und war es eben doch. Unnötig, das so einem doofen Bayern zu erklären. Er streichelte den Hundekopf.
Aber Will war nicht doof und ein Bayer sowieso nicht.
»Warte mal, das ist doch, das ist doch Lettland, nicht?«
»Estland«, kam ein kurzer Bescheid. Aufgesehen hatte der Junge noch nicht.
»Du bist doch nicht heute aus Reval gekommen. Ist doch ein ziemlich weiter Weg.«
Nun blickte Herbert doch zu dem Fremden auf.
»Ich bin schon lange unterwegs«, sagte er müde.
Aber Will hatte schon erkannt, was mit dem anderen los war.
Er zog ein Candy aus der Hosentasche, dank dem Sergeant hatte er jetzt so was.





























