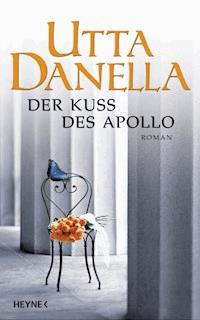6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1964, Dornburg, ein kleines Städtchen zwischen Bodensee und Schwarzwald. An einem sonnigen Oktobertag taucht im besten Hotel am Platz die schöne Amerikanerin Cornelia Grant auf. Niemand ahnt, dass sie in Deutschland geboren und aufgewachsen ist und auf der Suche nach dem Mörder ihrer großen Liebe ist. Simon, der Vater ihrer Tochter Simone, wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Ostpreußen auf der Flucht von einem SS-Mann, der auf ihn eifersüchtig war, erschlagen. Ein Zeitungsausschnitt, den sie in Berlin von einem alten Freund erhielt, legt nahe, dass der Mörder eine Verbindung zu Dornburg hat. Cornelia ahnt nicht, dass sie sich in große Gefahr begibt … ebenso wenig wie ihre Tochter Simone, die ein halbes Jahr später das Schicksal ihrer Mutter aufklären will …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Utta Danella
Vergiss, wenn du leben willst
Roman
hockebooks
Besuchen Sie uns im Internet: www.hockebooks.de
Utta Danella: Vergiss, wenn du leben willst. Roman
Copyright ©2016 by Erbengemeinschaft Utta Danella vertreten durch AVA international GmbH, Germany
Die Originalausgabe ist 1966 im Schneekluth Verlag, Darmstadt erschienen.
Überarbeitete Neuausgabe ©2020 by hockebooks gmbh
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Erlaubnis des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: Joachim Luetke (www.luetke.com) unter Verwendung eines Motivs von Netfalls Remy Musser/shutterstock.com
ISBN: 978-3-957-51344-1
www.uttadanella.de
www.ava-international.de
Cornelia
Josef, der Hausdiener vom »Schwarzen Bären«, ist der Erste in Dornburg, der die Fremde zu sehen bekommt. Am frühen Nachmittag ist es, so gegen drei; er steht vor dem Portal des Hotels, die letzten Mittagsgäste haben das Haus verlassen, und nun ist es still auf dem Marktplatz, ein paar Wagen parken da, alles Einheimische, keine Fremden darunter. Die Dornburger sind wieder unter sich, keine Urlaubsgäste mehr. Und ein schöner Herbst ist dieses Jahr, windstill ist es, südlich weich die Luft. Der Josef lässt sich die milde Oktobersonne auf den Kopf scheinen, unterdrückt ein Gähnen und blinzelt schläfrig.
Da sieht er den Wagen kommen. Er kommt von Norden her, rollt langsam über den Marktplatz, biegt in eine Parklücke ein und hält.
Eine Weile rührt sich nichts. Der Josef späht hinüber. Ein heller, fast weißer Wagen ist es, ein französischer, wie ihm scheint, so genau kennt er sich mit Automarken nicht aus. Schließlich öffnet sich die Tür, und der Fahrer steigt aus. Oder vielmehr die Fahrerin. Josef richtet sich auf und nimmt die Schultern nach hinten. Ein Gast! Ein Gast für den »Schwarzen Bären«, das erkennt er sofort.
Die Frau bleibt einen Moment, wie unschlüssig, neben dem Wagen stehen; sie betrachtet die mittelalterlichen Fassaden der Häuser, die den Marktplatz umgeben, zuletzt haftet ihr Blick auf dem »Schwarzen Bären«.
Während sie auf ihn zukommt, hat Josef Zeit genug, sie zu betrachten. Eine große, gut gewachsene Frau. Sie hält sich gerade, geht gelockert und diszipliniert zugleich; alles an ihr beweist die Frau von Geschmack, das Tweedkostüm, die Schuhe, die Tasche unter dem Arm; eine teure, unauffällige Eleganz, die Kleidung, Haltung und Auftreten gemeinsam schaffen. Josef ist durchaus in der Lage, das zu beurteilen, vielleicht nicht im Einzelnen, aber als Gesamteindruck. Er hat lange Erfahrung, denn der »Schwarze Bär« ist ein erstklassiges Hotel, eins mit drei Sternen, und sein Besitzer ein Mann von Kultur und Haltung, der seine Mannschaft gut geschult hat. Das Gesicht der Fremden ist genauso, wie Josef es erwartet hat. Klar geformt, schmal, die Brauen hochgebogen, der Blick ernst, fast abweisend; ein kühler, ein wenig hochmütiger Mund, eine hohe Stirn, glattes dunkelblondes Haar. Sie ist nicht mehr jung, diese Frau, aber von jener Art, der das Älterwerden nicht viel anhaben kann.
Sie bleibt vor ihm stehen, und Josef macht eine kleine Verbeugung.
»Haben Sie ein Zimmer frei?«, fragt sie.
»Bitte sehr«, erwidert Josef. »Selbstverständlich, gnädige Frau. Wir haben Zimmer frei.«
Sie reicht ihm ihren Wagenschlüssel. »Holen Sie bitte mein Gepäck, und bringen Sie den Wagen in die Garage.« Und dann tritt sie an ihm vorbei durch die offene Tür in das alte Gewölbe, das dem »Schwarzen Bären« als Halle dient. Beeindruckt blickt Josef ihr nach. Was für eine Frau!! Gibt ihm den Schlüssel, gibt ihm kurz ihre Anweisungen und verschwindet. Offenbar hält sie es für selbstverständlich, dass er Auto fahren kann. Er kann es nicht. Er ist seit dreißig Jahren im »Schwarzen Bären«, und es war niemals notwendig, dass er ein Auto lenkte. Jetzt wird er es auch nicht mehr lernen. Muss er also diesen frechen Burschen, diesen Charly, zu Hilfe holen. Der kann natürlich fahren, obwohl er gerade neunzehn Jahre alt ist und außer einem großen Mundwerk nicht viel zu bieten hat. Charly! Das sagt alles, eigentlich heißt er Karl. Aber ein so normaler Name ist dem Grünzeug heutzutage nicht mehr fein genug.
Er trabt hinüber zu dem weißen Auto und holt das Gepäck der Dame, es ist nicht viel, zwei helle Lederkoffer, eine große Tasche.
Beim »Empfang« angekommen, sieht er, dass der Chef selber da ist. Eigentlich ist jetzt die Stunde seiner Siesta, aber der Josef wundert sich trotzdem nicht über seine Anwesenheit. Es ist komisch – aber irgendein sechster Sinn scheint ihm jedes Mal zu verraten, wenn interessante Gäste kommen; da ist er immer zur Stelle.
In seiner typischen Haltung, ein wenig vorgebeugt, was sehr verbindlich wirkt, ein diskretes Wohlwollen im Gesicht, so steht er vor der schönen Fremden, und Josef hört ihn sagen: »Ich werde Ihnen die Zimmer zeigen, gnädige Frau.« Also ein besonderer Gast! Wenn der Chef die Zimmer selber zeigt, bedeutet das eine Auszeichnung, wie das Personal des Hauses sehr wohl weiß.
Clementine, die junge Hotelsekretärin, steht hinter dem Pult und gibt sich wie immer Mühe, Würde und Überlegenheit auszustrahlen. Wie meist gelingt es ihr nur unvollkommen. In ihrem zarten, noch unbeschriebenen Mädchengesicht mischen sich Neugier und Bewunderung. Sie schiebt den Meldezettel näher, doch der Chef winkt kurz ab. »Das hat Zeit. Die gnädige Frau kann sich später eintragen.« Er weist mit der Hand zu der breiten Treppe im Hintergrund. »Darf ich bitten, gnädige Frau? Leider haben wir keinen Fahrstuhl. Aber wir gehen nur in den ersten Stock. Ich darf vorangehen?«
Die Fremde dankt mit einem kleinen Nicken und folgt ihm zur Treppe.
Clementine beugt sich weit über das Pult und sieht ihr nach. Tolle Beine! Lang und schlank und gerade. Und eine fabelhafte Figur!
»Na, na«, meint der Josef, »fall nicht vornüber. Kennst du sie denn?«
Clementine löst den Blick von der Treppe und sieht den Hausdiener böse an. Sie ärgert sich immer, wenn er sie duzt. Es verträgt sich nicht mit ihrer Würde als Sekretärin und zeitweiligem Empfangschef eines Hotels vom Range des »Schwarzen Bären«. Bei solch einer Gelegenheit beschließt sie dann immer, Dornburg zu verlassen und sich anderswo eine Stelle zu suchen. Hier wird man sie nie respektieren. Wenn schon der Hausdiener es wagt, sie zu duzen.
Sicher, der Josef hat sie schon gekannt, als sie noch ein kleines Mädchen war und mit dem Schulranzen auf dem Rücken Samstagmittags kam, um ihren Vater vom Frühschoppen abzuholen. Dann durfte sie am Weinglas nippen, der Apotheker zog sie an ihren blonden Zöpfchen und fragte: »Nun, Tinchen, hast du heute nicht nachsitzen müssen?«, und der Josef, der am Eingang stand, wenn die Herren gingen, lächelte sie an, und sie machte einen tiefen Knicks vor ihm. Jetzt soll sie eine Autorität für ihn darstellen. Manchmal tut er ja so, als ob sie eine wäre. Aber sie ist nie ganz sicher, ob er es ernst meint. Nun macht sie also eine hochmütige Miene oder das, was sie dafür hält, und sagt: »Woher soll ich sie denn kennen? Sie hat sich ja nicht eingetragen. Sie haben ja gehört, was der Chef gesagt hat.« Und dann, ihren Ärger vergessend, nur noch neugierig: »Vielleicht ist es eine berühmte Schauspielerin? Eine Filmschauspielerin aus Frankreich? Sie hat so ein bisschen Akzent, nicht?«
Josef schüttelt nachdrücklich den Kopf. »Das ist keine Filmschauspielerin. Das ist eine Dame. Eine Frau von Welt, Tinchen. So viel solltest du inzwischen hier gelernt haben, dass du das erkennst.«
»Ich heiße Clementine«, sagt sie ärgerlich. »Und für Sie bin ich Fräulein Münk. Merken Sie sich das endlich, Josef.« Josef grinst ungekränkt. »Ist schon gut, Fräulein Münk. Reg dich nicht auf, Fräulein Münk. Ich muss halt immer noch dran denken, wie du das kleine Tinchen warst und immer herkamst und pieptest: ›Ist Vati da?‹« Er piept es wirklich, mit hoher Kinderstimme, und es klingt sehr komisch. Clementine findet es nicht komisch. Sie runzelt zornig die runde Jungmädchenstirn. »Das ist schließlich lange her.«
»So lange auch wieder nicht. Und viel größer bist du inzwischen nicht geworden, Fräulein Münk.«
Da hat er sie an ihrer empfindlichsten Stelle getroffen. Sie wäre so gern ein langbeiniges, hochgewachsenes Mädchen geworden, sie hätte so gern eine Figur gehabt wie die Fremde, die eben das Haus betreten hat.
»Tragen Sie lieber das Gepäck hinauf, anstatt zu schwatzen«, weist sie Josef zurecht und wendet sich wieder ihrer Schreibmaschine zu.
»Bin schon unterwegs«, sagt der Josef und bückt sich nach den Koffern. Da fällt ihm noch etwas ein. »Wo ist denn der Lausbub, der Charly? Hier sind die Autoschlüssel von der Dame. Er soll den Wagen in die Garage fahren.«
»Charly hat heute Nachmittag frei.«
»Schon wieder? Er war doch erst vor zwei Tagen weg.«
»Nicht mal Auto fahren können Sie«, meint Clementine spöttisch. »Ein schöner Hausdiener für ein Hotel wie unseres.«
»Ich bin so alt geworden ohne Auto, da wird’s die paar Jahre auch noch gehen.« Er nimmt das Gepäck, bewegt sich auf die Treppe zu, aber dann stellt er die Koffer noch einmal ab. »Wieso war er denn da? Schläft er denn heute nicht?«
»Weiß ich auch nicht. Plötzlich stand er da, gerade als die Dame hereinkam.«
Josef nickt befriedigt. »Er merkt’s eben immer.«
»Was?«
»Wenn jemand Besonderer kommt. Wenn jemand kommt, der jemand ist. Das merkt er. Darum sind wir auch ein Hotel mit drei Sternen.«
»Ja«, sagt Clementine mokant, »nur, dass die Gäste bei uns ihr Gepäck erst eine Stunde nach ihrer Ankunft ins Zimmer bekommen.«
Mit übertriebener Geschäftigkeit steigt der Josef die Treppe hinauf. »Bin schon oben, Tinchen. Ah, Verzeihung, Fräulein Münk.«
Im ersten Stock hat der Chef inzwischen die beiden Zimmer aufgeschlossen, die ihm für den eleganten Gast angemessen erscheinen. Das große Mittelzimmer, das auf den Marktplatz hinausgeht und von dem aus man einen direkten Blick auf die gotische Fassade des »Bürgerhauses« hat, jenen alten Bau an der Stirnseite des Marktplatzes.
Das Zimmer gegenüber geht auf den Garten hinaus. Es sind die besten Zimmer des Hotels, sie sind mit wertvollen Möbeln eingerichtet und haben ein Badezimmer. Die Fremde entscheidet sich für das Zimmer zum Garten. Es wird ruhiger sein, meint sie. Der Chef bestätigt es. »Außerdem ist der Blick sehr hübsch«, fügt sie hinzu. Das stimmt. Die alten Bäume im Garten, Kastanien und Ahorn, leuchten in bunten Herbstfarben. Über ihre Gipfel erblickt man fern eine majestätische Silhouette vor dem blassblauen Himmel. »Was ist das für eine Burg?«
»Die Dornburg. Sie gab der Stadt den Namen.« Ihr Blick wird weich, bekommt etwas Verträumtes. »Ich habe so etwas lange nicht mehr gesehen«, sagt sie leise, mehr zu sich selbst.
»Es ist nur noch eine Ruine«, sagt der Hotelier. »Aber man hat von oben einen schönen Blick über das Land. Ein Teil der alten Festungsanlagen ist noch gut erhalten. Ebenso der Turm. Falls es Ihre Zeit erlaubt, gnädige Frau, sollten Sie einmal einen Spaziergang hinauf machen.« Sie wendet sich um und lächelt. »Das werde ich tun.« Ihr Blick wandert durch das Zimmer, es ist sonnendurchflutet. »Sie haben ein schönes Hotel, Herr …« Der Hotelier verbeugt sich dankend. »… Gruber. Vielen Dank, gnädige Frau.«
In der offenen Tür erscheint Josef mit dem Gepäck. »Haben Sie einen Wunsch, gnädige Frau?«, fragt Gruber. »Wünschen Sie noch zu speisen?«
»Nein, danke. Wenn Sie mir einen Mokka heraufschicken ließen …«
»Selbstverständlich, gern.«
Herr Gruber verlässt das Zimmer. Josef legt die Koffer behutsam auf die Kofferständer, öffnet die Schranktür und hängt den leichten Kamelhaarmantel auf einen Bügel. »Der Wagen wird sogleich besorgt«, sagt er dann, nur um etwas zu sagen. Er hat sich das schon überlegt, er wird einfach den Tankwart holen von der Tankstelle aus der Kirchengasse. »Ich bringe den Schlüssel dann herauf.«
»Nicht nötig. Lassen Sie ihn beim Portier.« Josef schweigt verwirrt. Einen Portier besitzt der »Schwarze Bär« nicht. Aber es ist wohl unnötig, das zu erklären. Die Fremde kommt auf ihn zu, greift in die Tasche ihres Kostüms und reicht ihm ein Zweimarkstück. Josef nimmt es mit einer tiefen Verbeugung und entfernt sich, die Tür leise hinter sich schließend.
Cornelia blickt einen Moment lang abwesend auf die geschlossene Tür. Die Frage, die schon eine Weile hinter ihr herläuft, hat sie eingeholt. Was tue ich eigentlich hier?
Sie greift nach ihrer Handtasche, sucht den Kamm, tritt zum Spiegel. Dort trifft sie auf ihren Blick.
Was tust du hier?
Du bist verrückt. Du suchst ein Gespenst. Und wenn es wirklich hier umgeht, was ich nicht glaube, dann geht es dich nichts an. Dich nicht mehr. Nein. Dich nicht.
Sie hält ihren Blick im Spiegel fest. Blaugraue Augen, die sie starr ansehen.
Wen sonst? Wen – wenn nicht mich?
Diese Stadt, dieses Land ist voll von Gespenstern. Vergangenheit, die nicht leben darf und nicht sterben kann. Oder vielleicht auch sehr gut lebt, was weiß man denn? Willst du auf Gespensterjagd gehen? Geht es dich etwas an?
Du lebst ein anderes Leben. Mit anderen Menschen. In einer anderen Zeit. Was früher war, geht dich nichts mehr an. Du hast es vergessen. Vergessen, hörst du!
Ich habe es nicht vergessen. Und all die Gespenster in diesem Land – ach, was heißt in diesem Land, all die Gespenster in jedem Land, in jeder Zeit, sie gehen mich nichts an. Aber dieses eine, dieses eine ist mein Gespenst. Wen ginge es etwas an, wenn nicht mich.
Sie fährt sich mit einigen heftigen Strichen durchs Haar, zieht die Kostümjacke von den Schultern und wirft sie mit der gleichen heftigen Gebärde aufs Bett.
Ein breites französisches Bett. Zwei können darin schlafen. Gewöhnlich findet man in Deutschland solche Betten nicht, es ist eine französische Sitte. Vielleicht aber hat man hier in dieser südwestlichen Ecke ein wenig französische Bräuche angenommen. Was für ein hübsches Zimmer! Wie kultiviert eingerichtet! Darin gleicht es keineswegs einem französischen Hotelzimmer.
Sie geht wieder zum Fenster und blickt hinaus. Dieser Garten mit seinen herbstlich bunten Bäumen! Rot und Gold und Braun, dazwischen das grüne Gras. Was für Farben! Und da draußen auf dem Hügel die Burg.
Deutschland! Sie wollte nie wieder hierherkommen. Und nun ist sie da. – Sie ist in Deutschland.
Sie hat es nicht auf den Flugplätzen gedacht, nicht in Frankfurt, nicht in Berlin, nicht in anderen Hotelzimmern, nicht einmal, als sie bei Thomasin am Bett saß, als sie deutsch mit ihm sprach – mit ihm übrigens als Einzigem –, in Hotels, im Flugzeug, überall sonst hat sie englisch gesprochen, ach ja, mit seiner Wirtin noch, kurz nur, gerade das Nötigste. Komisch war das, in Deutschland wieder deutsch zu sprechen. Zu Hause spricht sie es oft mit ihrer Tochter. Aber hier – hier ist das anders.
Ein fremdes Land ist es. Fremder als jedes fremde Land, in dem sie je gewesen ist.
Aber hier nun auf einmal – hier denkt sie: Ich bin in Deutschland. Ich bin – zu Hause.
Eine dumme kleine Stadt. Ein Nest, das keiner kennt. Dornburg – nie gehört. Eine typische deutsche Kleinstadt. Hügeliges Land ringsherum, viel Wald, bunte Bäume, diese komischen alten Häuser da unten und natürlich – eine Burg. Gehört wohl dazu. Ebenso wie die Leute, die hier leben. Kleine Spießbürger. Kleinstädter. Der deutsche Kleinstädter, man kennt ihn. Sie sprechen hier einen anderen Dialekt als den, den sie kennt. Aber sie sind vermutlich genauso, wie sie zu Hause waren. Sie sind in der ganzen Welt so, in Frankreich, in England, in Amerika. Überall ein bisschen anders und im Grunde einander sehr ähnlich.
Die hier also leben mit ihren alten Häusern, ihrem Hügelland, Berge und See nicht weit entfernt, sie haben da oben eine Burg, und sie haben ein sehr hübsches gepflegtes Hotel, der Hotelier ist ein Gentleman, man merkt das, sie trinken Wein – jedenfalls anzunehmen, dass sie hier Wein trinken –, ihre Frauen sind dick und engstirnig, die Männer sind es meistens auch, sie können sehr kleinlich sein und sehr giftig blicken – aber ansonsten ist alles friedlich und freundlich und freundlich und friedlich, oder jedenfalls scheint es das zu sein, und dazwischen haben sie ein paar Gespenster herumlaufen, aber keiner weiß es oder will es wissen, es stört auch keinen, und vielleicht sind es gar keine Gespenster und sie … »Das Gespenst bin ich«, sagt Cornelia laut gegen die Fensterscheibe. »Das Gespenst bin ich.«
Natürlich. Sie ist es, die nicht vergessen kann. Sie ist es, die immer daran denken muss. Wie eine Närrin, die nur einen Gedanken in ihrem Kopf behalten kann. Eine gefangene Maus, die ewig im Kreis in ihrem Käfig umherrennt. Ausgerechnet sie, die gar keinen Grund hat, sich über ihr Leben zu beklagen. Alles ist da, was man sich wünschen kann. Geld, ein schönes, geräumiges Haus mit Blick über die blaue Bucht von San Francisco, viel schöner als in einer so miesen kleinen Stadt. Sie hat ein Auto für sich allein, sie kann reisen, wohin sie will. Da ist Freiheit und Wohlstand und – einfach alles ist da. Ein Mann, der sie liebt, eine Tochter, ein – nun ja, eine Art Aufgabenkreis, nichts Wichtiges, aber was ist schon wichtig. Ja eben! Was ist wichtig? Gewiss nicht, dass sie hier in diesem Nest Dornburg auf Gespensterjagd geht. Das ist bestimmt nicht wichtig. Nur weil Thomasin ihr dieses Bild gezeigt hat? Ein Zeitungsbild, undeutlich wie alle Zeitungsbilder. Lächerlich, auf so etwas hereinzufallen.
»Eine Nacht«, sagt sie laut. Eine Nacht wird sie in diesem französischen Bett schlafen. Und wenn morgen die Sonne noch scheint, wird sie zu dieser alten Burg hinaufspazieren, just for fun. Und dann wieder abreisen. Zurück nach Paris und mit der nächsten Maschine nach Hause.
Sie wird es Philip gar nicht erzählen, dass sie in Deutschland war. Er weiß ja, dass sie niemals wieder dahin wollte. Nach Frankreich, nach Spanien, nach Italien – sehr gern, aber nicht nach Deutschland. Irgendwie tut es ihm leid, er hat sich damals sehr wohl gefühlt in Berlin. 1945, 1946, 1947 – feine Sache, ein Sieger zu sein, auch wenn ringsum Trümmer liegen und die Menschen hungern.
»Und dann, Darling, habe ich dich kennengelernt, vergiss das nicht. That was top of all. Schönste Zeit meines Lebens. My little Corny, all lost in that awful time. All alone. Just waiting for Daddy to help her.«
Ja – die kleine Cornelia, so einsam, so allein, so verzweifelt, und der gute Philip, der einen Krieg gewinnen musste, um sie zu finden und ihr zu helfen. Und das war dann die schönste Zeit seines Lebens.
Er hat sie gefunden, er hat ihr geholfen, hielt ein wunderbares Leben für sie bereit, hatte es in der Tasche, zog es heraus, und bums – da war es! Ein herrliches Leben. Und sie kann tun, was sie will in diesem Leben. Warum hasst sie ihn dann manchmal?
Nein – nein – sie hasst ihn nicht. Das ist Unsinn. Sie ist ihm dankbar, sie hat ihn gern, sie tut für ihn, was eine Frau für ihren Mann tun muss. Sie kann ihn nicht lieben, nein, das nicht. Aber das darf er nicht merken. Er kann nichts dafür, dass er ist, wie er ist. Ein Amerikaner eben, gesund und selbstsicher, unbelastet, so – so robust. So anders, so ganz anders als der Mann, den sie geliebt hat.
Aber das versteht er sowieso nicht. Gott sei Dank versteht er es nicht. Und sie ist ihm dankbar. Schon wegen Simone. Denn alles, was sie hat, hat Simone auch. Und das ist das Einzige, was zählt.
Mein Leben? Mein Leben ist lange vorbei. Ich bin selbst ein Gespenst. Gespenster können nicht lieben, Gespenster können nicht leben. Ach, Phil! Du hast nie gemerkt, dass ich ein Gespenst bin. Ich habe es selbst nicht gemerkt. Aber jetzt – heute – seit ich hier bin – seit ich in Deutschland bin! Es klopft. Sie fährt zusammen und blickt starr zur Tür. »Ja?« Ein älterer Ober kommt herein. »Der Mokka, gnädige Frau.«
»Ach ja, – danke.«
Sie bleibt unbeweglich stehen, sieht zu, wie der Ober die Tasse und das Kännchen sorgfältig auf den runden Tisch setzt, einen Teller mit Gebäck danebenstellt, einladend den Sessel zurechtrückt.
»Bitte sehr, gnädige Frau.«
»Danke. Vielen Dank.«
Wieder allein, öffnet sie das Fenster. Ein sonniger Oktobertag. Die Sonne scheint, die Leute hier im Hotel sind nett und höflich und gutartig, sie würden niemals Gespenster unter sich dulden. Philip ist ihr Mann und wird sich freuen, wenn sie wiederkommt. Simone ist ins College zurückgekehrt, und Allan, ihr blonder, schlaksiger Boyfriend, wird sich wieder um sie bemühen, leicht verzweifelt um sie bemühen, denn Simone – was hatte sie erst kürzlich gesagt? »Weißt du, Mum, irgendwie ist es ja komisch mit mir. Ich bin so anders als die anderen. Ich will es gar nicht – ich will sein wie sie. Aber dann will ich auch wieder nicht. Ich bin einfach anders. Ob es daher kommt, dass ich in Europa geboren bin? Aber davon weiß ich doch gar nichts mehr. Ich bin ja immer hier gewesen. Oder ist es, weil du anders bist?«
Sie hatte erst einmal schlucken müssen. »Bin ich anders, Simone?«
Und dann, nach einem kleinen Schweigen – sie hatte ihre Tochter währenddessen angesehen, dieses junge Gesicht, so vertraut, die dunklen Augen, das kurze dunkle Haar, dieser Mund, ach, dieser Mund, der sie immer an ihn erinnerte –, sagte Simone: »Wenn ich nur wüsste, wie er gewesen ist, mein Vater. Wann wirst du mir von ihm erzählen?« Und als sie schwieg, sich stumm abwandte, fuhr Simone fort: »Du hast immer gesagt: später – wenn ich älter bin. Ich bin doch jetzt alt genug. Andere, die mit mir in der Schule waren, sind schon verheiratet. Haben schon Kinder. Wann bin ich denn alt genug, um von ihm etwas zu hören?« Wann würde Simone alt genug sein, um zu hören, wer ihr Vater war, wie sehr ihre Mutter ihn geliebt hatte, was mit ihm geschehen war? Wann würde Simone dazu alt genug sein? Wenn ich alt genug sein werde, um von ihm sprechen zu können.
»Dein Vater ist tot.«
»Das weiß ich ja. Phil sagt …«
»Was sagt Phil?«
»Er weiß ja auch nicht viel. Er sagt, die Nazis haben ihn umgebracht. Aber das ist so lange her. Und Phil sagt, du liebst ihn immer noch.«
»Phil sagt … Man kann Tote nicht lieben.«
Schweigen. Sie sahen einander an. Die Frau, die Simon liebte.
Und Simons Tochter.
»Und es ist wahr«, sagte Simone schließlich leise, »du liebst ihn noch!«
»Nein. Man kann einen Toten nicht mehr lieben.« Aber man kann seinen Mörder hassen.
Das denkt sie jetzt. In Deutschland. Im »Schwarzen Bären« zu Dornburg.
Kann man einen Toten lieben, noch zwanzig Jahre später? Man kann den Mörder hassen, noch hundert Jahre danach. Und wenn sie Simon je geliebt hat, dann muss sie seinen Mörder finden. Sie hat zwanzig Jahre nicht nach ihm gesucht. Thomasin hat ihn für sie gesucht. Und hat ihn gefunden. Weil auch er ihn hasst. – Hat er ihn wirklich gefunden?
Das weiß sie noch nicht. Bis jetzt hat sie nichts als sein Bild, einen Zeitungsausschnitt.
Sie zieht es aus der Tasche und sieht es an. Hundertmal hat sie es angesehen. Ein Bild von einer Ausstellung. Mehrere Männer sind auf diesem Bild zu sehen. Ein Minister besucht die Ausstellung. Neben ihm geht die Frau Minister und trägt einen Blumenstrauß. Um beide herum viele Leute. Im Hintergrund ein Messestand. Der Minister will ihn gerade besichtigen – oder hat ihn gerade besichtigt. Zwei Männer sind an diesem Stand zu sehen, sie lächeln, sie sind offensichtlich angetan von dem Ministerbesuch.
Es steht nicht dabei, wie diese Männer heißen, noch was für ein Stand das ist.
»Aber das kann man bei der Messeleitung erfahren«, erklärte Thomasin eifrig. »Das Bild ist allerdings schon zwei Jahre alt, aber das lässt sich bestimmt feststellen.«
»Und Sie denken wirklich, das ist er?«
»Ja. Sehen Sie das denn nicht, Cornelia? Wenn sogar meine alten Augen das sehen. Das ist er ganz sicher.«
»Das Bild ist so undeutlich«, hatte sie gemurmelt. »Man könnte bei der Redaktion ein besseres Bild bekommen. Sie haben sicher so etwas im Archiv.«
Das war in Berlin, vor einer Woche. Sie hatte das Bild angestarrt. Hatte gelesen, was darunter stand, immer wieder. »Vergessen Sie nicht«, sagte Thomasin, »ich bin Maler. Oder – ich war es. Das Typische in einem Menschen, in seiner Haltung, seinen Kopf – wenn ich es einmal gesehen habe, erkenne ich es immer wieder. Er ist es bestimmt.« Wenn Thomasin recht hat. Wenn er es ist. Ein Minister schüttelt ihm die Hand. Die Mörderhand.
»Vielleicht kann man in diesem Ort da etwas herausbringen«, meinte Thomasin. »Das wäre das Einfachste. Sehen Sie, der Name ist deutlich zu lesen. Dornburg. Ich habe auf der Karte nachgesehen. Es ist ein kleines Städtchen im Süden unten, zwischen dem Bodensee und dem Schwarzwald. Hübsche Gegend muss es sein. Falls der Mann zu dem Messestand gehört, gehört er auch zu Dornburg. Der Name der Firma ist leider nicht mehr mit draufgekommen. Aber das würde sich wohl dort feststellen lassen. Falls er etwas mit dieser Firma zu tun hat. Vielleicht arbeitet er dort. Er hat bei einem Schmied gelernt, nicht?«
»Es sieht nicht so aus, als ob er als Schmied auf diesen Messestand gekommen ist.«
»Na ja, in diesen Zeiten. Heute haben die komischsten Subjekte Chancen gehabt. Nach diesem Krieg. Kann ja sein, er hat dort eine Position. Irgendetwas.«
Das interessiert Thomasin nicht sonderlich. Er ist Künstler – was Leute in einer Fabrik oder in einer Firma tun, bedeutet ihm nicht viel. Ob sie da Schmied sind oder Ingenieur – er versteht das eine und das andere nicht. »Sie meinen, ich soll da hinfahren. Nach Dornburg?«
»Das wäre das Einfachste. Dann wüssten Sie gleich, ob er es ist oder nicht … Ich wäre selbst gefahren. Aber Sie sehen ja, mit mir ist nichts mehr los. Ich mache nur noch eine Fahrt. Die letzte. Und das bald, Cornelia.«
»Bitte«, sagt sie und legt ihre Hand auf seine kalte, knochige Greisenhand. Sie sitzt bei ihm am Bett, in der Klinik, sie hat dafür gesorgt, dass er ein Einzelzimmer bekommen hat, sie hat Geld hinterlegt, sie weiß nun, dass er wenig Geld hatte in all den Jahren, und sie schämt sich, dass sie seinen Briefen geglaubt hat, als er schrieb, es ginge ihm gut. Und jahrelang hat sie sich überhaupt nicht mehr um ihn gekümmert, um Simons alten Lehrer. War es, weil sie eben doch vergessen wollte? »Ich weiß es, Cornelia. Es macht mir nichts aus. Aber dies hier, das hat mich belastet. Aus der Welt zu verschwinden, und der soll weiterleben, nein. Das darf nicht sein. Und es kann doch kein Zufall sein, Cornelia, dass Sie gerade jetzt gekommen sind. Gerade jetzt. Neunundvierzig haben wir uns das letzte Mal gesehen, wissen Sie noch. Sie haben Grant geheiratet und gingen nach Amerika. Und sind nie wiedergekommen. Und jetzt – jetzt sind Sie auf einmal da. Seit drei Wochen habe ich dieses Bild. Ich wollte Ihnen schreiben. Und dann hatte ich den Herzanfall – aber ich bin nicht gestorben. Ich konnte nicht sterben, ehe ich Sie nicht gesprochen habe.« Der alte Mann spricht keuchend und stockend, er regt sich auf dabei, er sieht schon aus wie gestorben, seine Hände zucken, seine Lippen zittern.
Cornelia klingelt nach der Schwester, bekommt von ihr einen vorwurfsvollen Blick; der alte Mann erhält eine Spritze. Cornelia geht.
Am nächsten Tag kommt sie wieder. Und am Tag darauf noch einmal. Und dann verspricht sie Thomasin, dass sie in diesen kleinen Ort, in dieses Dornburg fahren wird. Keine Ahnung, wie das ist und wo das ist. Aber sie wird hinfahren und sehen, ob der Mann auf dem Zeitungsbild dort zu finden ist. Und ob es der Mann ist, den sie suchen, Thomasin und sie. Der Mann, der Simon getötet hat. Simon und vielleicht andere auch. Der Mörder.
»Ich muss zurück nach Paris«, sagt sie, »und von dort fahre ich in dieses Dornburg. Ich werde Ihnen berichten, Herr Thomasin.«
»Bald, Cornelia, bald. Ich kann nicht lange darauf warten.«
»Sie haben Zeit genug. Sie werden jetzt hier gut versorgt. Sie werden bald wieder gesund sein. Und dann fahren Sie zur Kur. Ich werde mich jetzt immer um Sie kümmern. Ich werde …«
Er hebt die Hand. »Schon gut, mein Kind. Ich brauche nicht mehr viel. Ich will bloß noch wissen, ob Sie ihn gefunden haben.«
Nun also ist sie in Dornburg. Ein Zeitungsbild in der Tasche. Und weiter? Sie kann das Bild nicht jedem zeigen und fragen: Kennen Sie diesen Mann?
Doch. Das kann sie natürlich. Diesen freundlichen Hotelier zum Beispiel – Herrn Gruber. Er kennt sicher die meisten Leute hier. Sie kann sich auch erst einmal umsehen in Dornburg. Es eilt ja nicht. So sehr eilt es nicht – es hat zwanzig Jahre Zeit gehabt. Es kommt auf ein paar Tage nicht an. Aber vielleicht tut sie auch gar nichts. Fährt zurück nach Paris und nimmt das nächste Flugzeug, das sie nach Hause bringt. So geht es natürlich auch.
Sie kommt nach Hause, geht zu Phil, legt die Arme um seinen Hals und küsst ihn. Und sagt zu ihm: »Mein lieber Phil, ich bin dir so dankbar. Und ich liebe dich. Und ich bin gern bei dir. Ich war in Deutschland, es ist ein schönes Land, und es geht ihnen gut dort, wir können einmal wieder hinfahren, wenn du willst, es gibt keine Gespenster mehr dort, jedenfalls keine für mich, ich habe Thomasin wiedergesehen, der bald sterben wird – du erinnerst dich an Thomasin? – es ging ihm schlecht, wir hätten ihm Geld schicken sollen, aber das war natürlich meine Schuld, ich war feige, ich wollte von Deutschland nichts sehen und hören, ich dachte immer, Thomasin würde … Aber er weiß nichts, und er stirbt bald. Keine Gespenster mehr in Deutschland, Phil. Nicht eines. Nicht für mich.«
Das könnte sie sagen, wenn sie heimkam.
Vom Fluss steigt feuchter Nebel auf und hüllt die Brücke in einen silbernen Schleier. Verschwommen zittert das Licht der Laternen über dem Weg. Unter den Bäumen in den Anlagen am Ufer des Flusses ist es dunkel. Clementine schiebt ihre Schulter leicht an seine. Ihre Füße streifen durch raschelndes Laub.
»So viele Blätter sind schon gefallen«, sagt sie. »Wenn jetzt mal ein richtiger Wind kommt, sind die Bäume kahl.«
»Das Ganze nennt sich Herbst«, erwidert er mit leichtem Spott.
»Schon mal davon gehört, Tinchen?«
»Ich bin traurig, dass du wieder weggehst. Traurigsein passt gut zum Herbst, nicht?«
»Man sagt so.«
»Gerade jetzt, wo ich mehr Zeit hätte.«
»Zum Traurigsein?«
»Ach, sei nicht albern. Zeit für dich natürlich.«
»Kann ja wohl nicht wahr sein. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet.«
Sie richtet sich etwas auf im Gehen und verkündet mit geschäftiger Wichtigkeit: »Wir hatten eine gute Saison.«
»Freut mich. Aber so ist das Leben nun mal. Jedenfalls bei uns beiden. Wenn ihr Saison habt, habe ich Ferien. Und wenn mein Semester beginnt, habt ihr ruhige Zeit. Wohnt denn überhaupt noch ein Mensch in eurem Luxusladen?«
»So das Übliche um diese Zeit. Hauptsächlich Vertreter. Heute ist allerdings eine tolle Frau gekommen. Eine Amerikanerin.«
»Muss es auch geben«, sagt Jochen mäßig interessiert. »Du«, sagt Clementine eifrig, »das ist wirklich eine tolle Frau. Sieht fabelhaft aus. So etwas – etwas Besonderes hat sie, weißt du. Eine Frau von Welt.«
»Na, das ist ja etwas für den guten Gruber. Solche Gäste liebt er.«
»Er hat sie selber auf ihr Zimmer geführt, sie hat das große Zimmer mit Bad, das auf den Garten hinaus. Sie ist mit dem Auto da, einen Citroën hat sie, einen weißen. Sogar der Josef war ganz erschlagen.«
»Du offensichtlich auch.«
»Mhm. Weißt du, das ist so eine Frau, wie ich eine sein möchte.«
Jochen lacht, bleibt stehen und zieht sie zärtlich an sich. »Ach, Tinchen, mein Hühnchen, das fehlt mir gerade noch, dass du dich aufführst wie so eine überdrehte Amerikanerin.« Clementine macht sich energisch frei. »So ist die nicht! Eine wirkliche Dame. Sehr ernst ist sie und sehr zurückhaltend. Cornelia heißt sie. Cornelia Grant. Und sag nicht immer Tinchen zu mir, das klingt grässlich.«
»Mir gefällt es. Es passt zu dir.«
Sie seufzt. »Das ist es ja eben. Das ist ja das Unglück.« Er lacht wieder, nimmt ihr Gesicht in seine Hände und küsst sie auf die Nasenspitze. Dann gehen sie weiter. Sie verlassen den Weg, der am Ufer weiterführt, und gehen hinaus auf die Brücke.
»Nebel«, sagt Jochen, »Herbstnebel. Schau, das Pflaster ist ganz feucht.«
Sie bleiben stehen und blicken in das dunkle Wasser.
»Ich wünschte, sie würde länger bleiben«, sagt Clementine nach einer Weile.
»Wer?«
»Na, die Amerikanerin. Wir haben solche Gäste gern. Sie passen in unser Hotel.«
»Weißt du, Tine«, sagt Jochen ein wenig ungeduldig, »es freut mich ja, dass dir dein Beruf Spaß macht. Aber nachgerade kann man mit dir über nichts anderes mehr reden als über das Hotel. Unser Hotel. Wie sich das anhört. Ich bin schon eifersüchtig auf den alten Laden.«
Sie lacht übermütig und schiebt ihren Arm unter seinen. »Wenn du weiter keinen Grund zur Eifersucht hast …«
»Das möchte ich dir nicht geraten haben. Mit eurem alten Kasten werde ich es wohl noch aufnehmen können. Außerdem denke ich mir, dass sich deine Begeisterung legen wird, wenn du den Job erst länger hast.«
Clementine legt den Kopf in den Nacken und schaut in den schwarzen Himmel hinauf. Kein Stern, kein Mond, nichts. Und wie still es ist. So still ist es in Dornburg immer, wenn der Winter kommt. Auch im Hotel würde es still sein. Keine Fremden, nur die bessere Gesellschaft von Dornburg, die gelegentlich ihre Feste und Familienfeiern im »Schwarzen Bären« abhält. Die Herren, die abends ihren Schoppen trinken. Wie viel Spaß hat ihr der Sommer mit seinem lebhaften Betrieb gemacht. Viel Arbeit, sicher – aber das war gerade schön. »Ich bin jetzt schon ein halbes Jahr im ›Schwarzen Bären‹«, meint sie versonnen. »Weißt du, ich glaube, Herr Gruber ist ganz zufrieden mit mir. Gestern hat er gesagt …«
»Schluss jetzt«, unterbricht Jochen sie energisch, nimmt sie bei den Schultern und dreht sie zu sich herum. »Kein Wort mehr von Herrn Gruber und dem ›Schwarzen Bären‹. Morgen reise ich ab. Wann ich wieder nach Hause komme, steht in den Sternen. Ich muss fürs Examen büffeln.«
»Aber Weihnachten doch?«
»Vermutlich. Aber da habe ich ja Familie. Und es sind auch nur ein paar Tage. Ich hab’ in diesem Sommer sehr wenig von dir gehabt, Tinchen.«
Clementine neigt sich zu ihm und legt sanft ihre Wange an seine. »Ich weiß. Aber wir hatten wirklich eine große Saison. Und ich muss einfach immer da sein. Weißt du, ein Hotel, das ist nicht wie ein gewöhnliches Büro …«
»Okay, okay, und eine Hotelsekretärin ist keine gewöhnliche Sekretärin. Das hast du mir oft genug erklärt. Aber wenn ich jetzt noch einmal das Wort Hotel höre, springe ich in die Dorn.«
Clementine lacht. Wie ein kleiner froher Vogel fliegt ihr helles Lachen über den Fluss, verfängt sich drüben in den Zweigen der Bäume, und die Frau, die in den Anlagen am Ufer steht, blickt hinüber zur Brücke und sieht vage die zwei Gestalten im Nebel.
»In die Dorn«, wiederholt Clementine. »Die ist schon ziemlich kalt.« Sie reibt ihre Wange an seiner. »Wir werden uns noch lange genug haben.«
»Hoffentlich. Und dann ohne Hotel.«
»Spring!«, ruft sie übermütig. »Spring in den Fluss! Du hast Hotel gesagt.«
»Freche Biene!« Jochen nimmt sie fest in die Arme, zieht sie an sich und küsst sie auf den Mund. »Keinen Respekt vor einem zukünftigen Doctor JURIS.«
»Das ist noch lange hin. Erst mal abwarten, ob du nicht durchs Examen fällst.«
»Das wäre ein Schlager. Dann würde mich mein alter Herr wohl höchstpersönlich hier im Fluss ersäufen.«
»Aber dann hätte er vielleicht nichts mehr dagegen, dass du mich heiratest.«
»Erst recht. Dann würde er umso energischer auf einer guten Partie bestehen.«
Clementine seufzt. »Wenn er bei uns im Restaurant isst oder wenn er zum Stammtisch kommt, das tut er ja manchmal, dann guckt er durch mich hindurch, als sei ich Luft.«
»Ärgere dich nicht«, sagt Jochen fröhlich. »Er wird sich schon an dich gewöhnen.«
»Ich ärgere mich nicht«, ein wenig Hochmut schwingt in ihrer Stimme. »So etwas gibt es anscheinend immer. Vater sollte Mutti auch nicht heiraten. Und dann sind sie so glücklich geworden.«
»Das machen wir ihnen nach. Ja?«
Sie legt die Arme um seinen Hals, und versunken küssen sie sich eine Zeit lang. In Clementines blondem Haar schimmern Nebeltropfen. Herbstnebel über dem Fluss. Doch Frühling für die beiden, die jung sind und sich lieben. Am Ende der Brücke, an den Stamm eines Ahorns gelehnt, steht Cornelia. Sie hat die Hände in die Taschen ihres Mantels vergraben und blickt hinüber zu dem Liebespaar, das mitten auf der Brücke steht und sich selbstvergessen küsst. Und es ist, als spräche aus den Zweigen des Baumes eine leise Stimme zu ihr. »Nun beginnt das Leben. Du und ich. Nichts sonst gibt es auf der Welt. Ich will dich so glücklich machen, wie keine Frau es je gewesen ist. Wenn erst der Krieg vorbei ist …«
Und sie hat geantwortet: »Es genügt mir, wenn ich immer so glücklich sein werde, wie ich heute bin.«
Und er: »Warte doch. Warte ein paar Jahre. Sagen wir zehn, ja? Zehn Jahre? Dann wirst du um zehnmal 365 Tage glücklicher sein. Und in zwanzig Jahren …«
Die beiden von der Brücke kommen auf sie zu, sie gehen eng nebeneinander, Hand in Hand, sie sprechen leise und eifrig, sie sehen nichts und niemand auf der Welt, auch nicht die Frau, die unter dem Baum steht.
Als sie unter der Laterne am Ende der Brücke sind, sieht Cornelia das Gesicht des Mädchens. Es ist die Kleine aus dem Hotel. Und er ist ein großer Blonder, breitschultrig, jung – dann sind sie vorbei.
Cornelia lauscht ihren Schritten nach, bis sie nicht mehr zu hören sind. So fängt es an. Liebe – Hoffnung – Träume! Alles nur Träume. Es wird immer schöner, in zehn Jahren, in zwanzig Jahren. Gibt es das wirklich?
Doch. Ich weiß, dass es das gibt. Ich hätte Simon immer geliebt. In zehn Jahren, in zwanzig Jahren, bis zu meinem letzten Tag. Ich liebe ihn heute noch. Auch wenn er mir die zehnmal dreihundertfünfundsechzig Tage schuldig geblieben ist. Sie geht langsam auf die Brücke hinaus, bleibt an der gleichen Stelle stehen, wo das Liebespaar stand. Eine einsame schmale Gestalt, allein im Nebel.
Und es kommt ihr vor, als sei sie immer allein gewesen.
Später, in ihrem Zimmer, kann sie sich nicht entschließen, ins Bett zu gehen. Sie sitzt im Sessel, die Stehlampe neben ihr wirft einen runden Kreis auf den Teppich. Sie hat die Lampe etwas beiseitegedreht, sodass ihr Gesicht im Schatten liegt. Als hätte sie Angst, dass einer ihr Gesicht sehen könnte. Ein Gesicht, das niemand kennt. Nicht das lächelnde, wohlgepflegte Amerikagesicht, das alle kennen: Philip, ihr Mann; die Freunde und Bekannten. Die Geschäftsleute, der Couturier, bei dem sie arbeiten lässt, der Mann, der ihren Wagen wäscht, das Personal. Ihre Tochter …
Simone? »Du bist anders als die anderen«, hat Simone gesagt. Sieht sie das Gesicht hinter dem Gesicht? Und Philip? Sieht er es auch? Kaum. Er hat es nie gekannt. Oder doch? Er sieht sie ja mit den Augen der Liebe. Damals. Und heute immer noch.
Ich bin ihm so viel schuldig geblieben. Ich weiß es. Und er weiß es auch. Oh nein, er darf es nicht wissen. Er soll es nie wissen. Wenn ich zurückkomme, werde ich ihn lieben. So wie er es verdient. Ich will ihn lieben.
Sie hebt langsam das Glas, trinkt, ein herber, frischer Wein, jung und lebendig. Wein aus diesem Land, wie sie ihn nie getrunken hat. Zu Hause, früher, tranken sie selten Wein. Nur bei Festen, an Geburtstagen, bei Hochzeiten, bei Taufen, und dann war es ein anderer Wein. Rheinweine, Moselweine, schwere Rotweine. Ihr Vater liebte schwere Rotweine. Er trank nicht viel davon, zwei oder drei Glas, die aber mit Genuss. Sie trinkt noch einmal. Sie hat sich eine Flasche auf ihr Zimmer bringen lassen, nachdem sie unten im Restaurant gegessen hatte.
Die Leute von den Nachbartischen hatten sie angesehen. Nicht aufdringlich, gewiss nicht. Aber sie hatte es gespürt. Herr Gruber war vorbeigekommen, hatte gefragt, ob sie zufrieden sei. Ein Lächeln von ihr. »Danke! Es schmeckt ausgezeichnet.« Und jetzt wird sie die ganze Flasche Wein austrinken, damit sie schlafen kann. Und morgen wird sie abreisen. Direkt nach Paris, den geliehenen Wagen abgeben und mit der nächsten Maschine über den Atlantik zurückfliegen. Noch ein Schluck Wein. Eine ungeheure Anstrengung: Aufstehen, sich ausziehen, ins Bett gehen.
Bis in alle Ewigkeit könnte sie hier so sitzen bleiben. In der Behaglichkeit dieses Raumes, der im Dunkel liegt, in der Stille, die sie umgibt. Sie kann sich nicht erinnern, dass es in all den vergangenen Jahren eine Stunde gegeben hat wie diese. Eine Stunde, in der sie so ganz allein mit sich war. Versunken die Welt, in der sie jetzt lebt. Nicht mehr Mrs. Grant. Cornelia, Cornelia von Elten, die Tochter auf Gut Eltenstein. Das Haar weht über ihre Schultern, wenn sie im Herbst über die Stoppeln reitet. Wie ein dunkelgoldener Schleier sieht es aus. Das sagt jedenfalls Simon, der immer ein paar Meter zurückbleibt, denn sein brauner Wallach kann nur schwer mit Tessa, ihrer Fuchsstute, Schritt halten. Tessa, edelstes Trakehnerblut, hart und schnell, und klüger als die meisten Menschen, die sie je gekannt hat. Tessas rotblonde Mähne weht im Wind, genau wie ihr eigenes Haar, sie streckt sich in weiten Galoppsprüngen, setzt ohne zu zögern über die Einfassung der Koppel und steht dann auf einen leisen Zuruf. Nie ist Tessa mit ihr durchgegangen, nie war sie ungehorsam. Sie vertraut ihrer Reiterin wie diese dem Pferd. Sagt Cornelia leise: Komm!, dann geht die Stute voran, durch Gestrüpp, durch Wasser, durch fremden Lärm.
Und Tessa kommt auch vertrauensvoll mit in jener Nacht, als ihre Herrin sie stumm und langsam vom Hof wegführt, ein Stück in den Wald hinein. Sie bleibt stehen, spürt verwundert die nasse Wange der Herrin an ihrem Hals, sie schnaubt leise, versteht nicht, was geschieht. Bis der Schuss fällt. Cornelia tut es selbst. Sie zielt sicher, und wenn Tessa noch Zeit hat, sich zu wundern, was dies bedeuten soll, so kann es nur der Bruchteil einer Sekunde gewesen sein. Aber weiß man, wie lange eine Sekunde währt, im Augenblick des Todes? Man weiß es nicht, bevor man es nicht selbst erfährt.
Tessa würde später verstehen, warum es sein musste, da, wo sie dann sein würde. Denn dass sie irgendwo – irgendwo! – sein würde, daran glaubte Cornelia fest. Dort, wo auch Simon war. Wohin auch sie am liebsten gegangen wäre. Gleich – im selben Augenblick. Tessa würde begreifen, warum es geschehen war. Weil ihr nichts Böses geschehen sollte auf dieser Erde. Weil die Herrin sie nicht mehr beschützen, sie nicht mitnehmen konnte, war der Tod der beste Schutz, die größte Tat der Liebe.
Es war kalt in jener Nacht, der Boden hart gefroren. Eine Weile kniete Cornelia neben dem toten Pferd, sie konnte nicht mehr weinen. Die Verzweiflung, die sie erfüllte, hatte ihr Herz so hart und trocken gemacht wie die Erde, auf der sie kniete. Die Erde ihrer Heimat, die sie so liebte. Und die zu locken schien: Bleib doch hier! Bleib auch hier! Du musst mich nicht verlassen.
Sie hatte schon oft daran gedacht, nicht erst in dieser Stunde. Sollte sie allein zurückbleiben in dieser unverständlich gewordenen Welt? Ihr Vater tot, ihr Bruder gefallen in Russland. Simon erschlagen.
Aber da war das Kind. Vor einem halben Jahr hatte sie es zur Welt gebracht. Simons Kind. Sollte sie es töten, wie sie das Pferd getötet hatte? Es ging über ihre Kraft. Dann ihre Mutter.
So elend und verzweifelt. Und so stolz und still dabei. Durfte sie sie im Stich lassen?
Die Waffe in der Hand, ging sie zurück zum Haus, lebend und doch gestorben. Und dann gab es so viel zu tun. Die Flucht aus dem toten Land. Nach Westen! In ein neues Leben? Eine Zukunft? Oh nein. Daran dachte sie nicht. Sie sah nur die Aufgaben, die jetzt und heute zu erfüllen waren. Das Kind und die Mutter zu retten, sie irgendwo an einen sicheren Ort zu bringen. Und noch eine Aufgabe war da, nicht klar erkannt, aber dunkel gefühlt und nie vergessen: Simons Tod zu rächen. Dafür zu sorgen, dass sein Mörder bestraft würde. Die Mutter starb im letzten Monat des Krieges in Berlin. Im Luftschutzkeller, als die Bomben auf die Stadt herniederschlugen.
»Du musst fort, du musst fort, Cornelia. Ihr müsst beide fort von hier. Das Leben geht weiter. Für dich und das Kind.« Daran glaubte sie damals nicht. Die nächste Bombe würde sie treffen, sie beide. Und dann war alles ausgelöscht. Sie überlebten doch. Und die Verantwortung für das Kind, die Aufgabe, für sein Leben, für sein Wohl zu sorgen, band auch sie wieder an das Leben. Was für ein kümmerliches Leben!
Bis Philip kam. Sie konnte ihn nicht lieben. Aber sie duldete seine Umarmung. Sie wurde später seine Frau. Sie tat es für Simone, für das Kind des Mannes, den sie so unbeschreiblich geliebt hatte.
Cornelia sitzt im Sessel, das Weinglas in der Hand, sie starrt in das dunkle Zimmer, das ihr so vertraut ist, als kenne sie es seit Jahren. Dort stehen sie alle, die sie verloren hat. Der Vater, die Mutter, der Bruder. Simon. Er ist so nahe, sie braucht nur die Hand auszustrecken, um ihn zu berühren. Sie sieht das schmale ernste Gesicht mit den schwermütigen dunklen Augen. Ach, diese Augen! Wie glücklich konnten sie leuchten. Sein zärtlicher, liebender Mund. Er hat die Geige in der Hand. Gleich wird er spielen.
Sie hebt langsam die Hand, streckt sie ihm entgegen. Und dann verlischt der Spuk.
Cornelia richtet sich auf, streicht sich über die Stirn, gießt den letzten Wein in ihr Glas und zündet eine Zigarette an. Die ganze Flasche Wein? Sie ist das nicht gewöhnt. Aber sie wird schlafen können.
Und morgen wird sie überlegen, was zu tun ist. Ob sie abreist oder bleibt. Denn hier in dieser romantischen kleinen Stadt mit der Burgruine und den hübschen alten Häusern lebt sein Mörder. Vielleicht.
Vielleicht lebt er hier. Sie weiß es noch nicht. Viele Jahre sind vergangen. Aber was bedeutet Zeit im Angesicht der Schuld. Schuld verjährt nicht. Die Jahre können ihr nichts anhaben.
Durch die Stille der Nacht hört sie das Schlagen einer Kirchturmuhr. Zwei Uhr in der Nacht. Eine späte Stunde. Oder eine frühe Stunde. Nicht zu spät für sie. Und Zeit für ihn, der Simon getötet hat. Höchste Zeit.
Clementine hat viel zu tun am nächsten Morgen. Sie beeilt sich mit der Arbeit. Wenn sie rechtzeitig fertig wird, kann sie den Chef vielleicht um eine freie Stunde bitten. Herr Gruber kommt gegen halb zwölf von der Stadtratssitzung zurück, er scheint gut aufgelegt, trägt den Hut in der Hand, und wie stets betrachtet Clementine seine elegante, aufrechte Gestalt mit heimlicher Bewunderung. Sie ist ein wenig verliebt in ihren Chef, gerade so viel, dass es ihrer Arbeit im Hotel, die sie ohnehin gern tut, den letzten Reiz gibt. Sie ist klug genug, beide Gefühle voneinander zu trennen und der Schwärmerei für ihren Chef keine törichte Sentimentalität beizumischen.
Sie lächelt zu ihm auf, als er in ihr kleines Büro tritt, das direkt hinter dem Empfang liegt. »Die Bestellungen sind alle draußen«, sagt sie. »Gut. Gibt es sonst etwas Neues?«
»Nummer 27 ist plötzlich abgereist, er hatte einen Anruf. Sonst alles in Ordnung. Wird’s klappen mit dem Golfplatz?«
»Es sieht so aus. Die Mehrheit war heute durchaus dafür. Und wir haben Unterstützung von privater Seite bekommen. Unsere Herren Unternehmer scheinen ebenfalls das Bedürfnis nach ein wenig Bewegung in frischer Luft zu haben. Auch Ihr Schwiegervater in spe hat sich sehr lebhaft für das Projekt eingesetzt.«
Clementine zieht eine kleine Grimasse. »Na, den kann ich mir als Golfspieler kaum vorstellen. Aber wenn der seinen Segen gibt, wird es bestimmt was. Auf ihn hören sie ja alle.« Gruber lacht. »Er ist eben eine dynamische Persönlichkeit, wie man zu sagen pflegt. Ist das Verhältnis immer noch so kühl?«
»Das wäre zu viel gesagt. Es existiert überhaupt nicht.«
»Trösten Sie sich, Clementine. Ich glaube, Jochen ist durchaus Manns genug, sich gegen seinen Vater durchzusetzen. Das hat er ja mit seinem Studienwechsel bewiesen. Ihr seid sowieso noch zu jung zum Heiraten. Ich bin sehr froh, wenn ich Sie noch eine Weile behalten kann.«
Clementine strahlt. »Ja? Ich bleibe auch noch gern. Ich würde furchtbar ungern von Ihnen fortgehen.«
»Klingt nicht gerade nach einer Braut, die es nicht erwarten kann.«
»Ach«, meint sie, »verheiratet ist man lange genug.«
Gruber nickt mit ernster Miene. »Das ist wahr.«
»Und von Braut kann sowieso keine Rede sein. Wir sind nicht richtig verlobt. Nicht offiziell, meine ich. Aber das ist ja auch nicht nötig. Ich finde so was spießig. Und Jochen auch.«
»Sehr schön, wenn ihr euch darüber einig seid.«
»Darf ich …«
»Nun?«
»Darf ich dann schnell mal weggehen? Ich würde Jochen gern zur Bahn bringen.«
»Fährt er heute? Ah ja, das Semester beginnt wohl bald. Na, dann laufen Sie mal. Und grüßen Sie ihn von mir.«
»Danke, Herr Gruber.«
»Aber Clementine – was machen Sie, wenn der Herr Papa am Bahnhof ist?«
»Der ist bestimmt nicht da. Das tut er nie. Außerdem ist er heute nach Zürich gefahren. Jochens Mutter kam früher immer mit an die Bahn. Aber seit sie krank ist … Sie hat nichts gegen mich. Ich meine, nichts dagegen, wenn Jochen und ich …«
»Das kann ich mir denken. Sie tut bestimmt niemand etwas Böses. Wie geht es ihr denn?«
»Nicht gut. Jochen fällt es schwer, sie wieder allein zu lassen. Er sagte, wenn er da ist, ist es für sie – besser. Sie ist dann nicht so.«
Clementine verstummt. »Nicht so bedrückt«, fügt sie hinzu. »Unglücklich« hat sie sagen wollen. So hat Jochen es genannt. »Hm,« macht Gruber und sagt auch nichts mehr. Er weiß ohnedies, wie es um Jochens Mutter bestellt ist. In einer kleinen Stadt bleibt nichts verborgen. Obwohl – was weiß man wirklich über diese Frau? Sie stand von jeher im Schatten ihres Mannes. Kaum, dass man sie in der Stadt zu sehen bekam, auch früher nicht, als sie noch nicht krank war. Ihr Mann spielt eine große Rolle. Ein tüchtiger Mann, hoch angesehen. Er hat viel getan für Dornburg, für den Aufbau und die Entwicklung der Stadt. Seine Ehe – nun ja, manchmal passen eben zwei Menschen nicht zueinander. Ein dynamischer Mann, wie schon gesagt, ein tatkräftiger Unternehmer, der das größte Werk im weiten Umkreis leitet. Und eine kleinbürgerliche, scheue Frau, die ewig vor etwas Angst zu haben scheint. Die hier so fremd geblieben ist wie am ersten Tag ihres Hierseins.
Ihr Mann kommt allein. Oder mit der anderen Frau. Der Junge studiert in München. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist kühl geworden. Ob Clementine der Grund ist? Herr Gruber betrachtet seine anmutige kleine Sekretärin, die emsig auf ihrem Schreibtisch Ordnung macht. Nicht unbedingt. Das Verhältnis zwischen Vätern und heranwachsenden Söhnen kühlt sich sehr leicht ab, er hat das oft genug erlebt. Das ist wohl ein ganz natürlicher Vorgang. »Na, dann sausen Sie mal los«, sagt er. »Fährt er mit dem zwölf Uhr dreißig?«
»Ja.«
»Höchste Zeit! Und, Clementine, gehen Sie auf dem Rückweg mal bei der Gärtnerei vorbei, und lassen Sie sich zeigen, was wir am Samstag für das Stiftungsfest der Schützengilde für Blumen bekommen können. Und sagen Sie dem alten Halunken, wenn er mir wieder so welke Blumen liefert, haben wir das letzte Mal von ihm bezogen. Es gibt schließlich noch andere Gärtnereien in Dornburg.«
»Mach ich«, verspricht Clementine. Sie lässt ihren Schreibtisch im Stich, wirft einen flüchtigen Blick in den Spiegel. Ihre Nase glänzt ein wenig, macht auch nichts. Jochen ist daran gewöhnt.
»Da müssen wir aber neue Prospekte machen lassen«, sagt sie, »wenn wir wirklich den Golfplatz kriegen.«
»Machen wir sowieso im nächsten Frühjahr. Ich habe da eine großartige Idee.«
Es ist überhaupt Herrn Grubers Idee und sein ganzer Ehrgeiz, nicht nur durchreisende Touristen, sondern bleibende Feriengäste nach Dornburg zu bekommen. Seiner Meinung nach haben es die Leute langsam satt, kostbare Urlaubstage auf langen Fahrtstrecken zu verplempern und sich im Ausland über alles Mögliche zu ärgern. Ist Dornburg nicht wunderbar geeignet für erholsame Ferientage? Es hat ein mildes, bekannt gutes Klima, viel Sonne und wenig Regen. Ein hübsches altes Städtchen, romantisch und gepflegt, eine liebliche Umgebung, grün und friedlich, mehrere gute Hotels und ein erstklassiges Haus, sein eigenes. Darum auch sein Bemühen um den Golfplatz. Den hat er den Herren im Stadtrat schon lange in leuchtenden Farben geschildert. Wenn man gutes Publikum herbekommen will, muss man etwas bieten. Dornburg besitzt ein modernes Schwimmbad und nicht weit entfernt einen kleinen See, in dem man herrlich baden kann. Es gibt ausreichend Tennisplätze. Herr Gruber spielt selbst und ist im Vorstand des Tennisklubs; er hat dafür gesorgt, dass neue Plätze angelegt wurden.
Seine vorletzte Idee waren die Reitpferde. Dazu hatte er sich mit einem Gut in der Nähe des Städtchens in Verbindung gesetzt, dort wurde ohnedies geritten, und man hatte noch ein paar Pferde dazugekauft. Nun haben die Sommergäste die Möglichkeit zu Ausritten.
Angler können weiter flussaufwärts in der Dorn nach Forellen fischen.
All das liest man in den Prospekten des »Schwarzen Bären« und in den Anzeigen, die laufend in den großen Tageszeitungen erscheinen. Im kommenden Jahr oder schlimmstenfalls im übernächsten Jahr kommt dann der Golfplatz dazu, das Gelände hat er schon ausgesucht, der Kampf im Stadtrat ist so gut wie gewonnen. Dann kommen bestimmt gute Gäste, auch Ausländer, zu einem längeren Aufenthalt nach Dornburg. Amerikaner zum Beispiel.
Sein derzeitiger amerikanischer Gast fällt ihm ein. »Haben Sie Mrs. Grant heute schon gesehen?«, fragt er Clementine, die schon unter der Tür steht. »Nein. Sie hat sich das Frühstück hinaufbringen lassen.« Er tritt mit Clementine hinaus zum Empfang, und im gleichen Augenblick kommt Cornelia Grant langsam die Treppe herab. Herr Gruber begrüßt sie und begleitet sie vor das Portal. Ehe Clementine eilig über den Marktplatz zur Bushaltestelle läuft, hört sie noch, wie der Chef der Amerikanerin einiges über die Geschichte der Stadt erzählt. Das ist, neben seinen Bestrebungen, Dornburg zu einem modernen Erholungsort zu machen, seine zweite Leidenschaft.
Kurze Zeit darauf überquert auch Cornelia den Marktplatz. Sie läuft nicht eilig und erwartungsvoll wie Clementine, die ein Ziel hat, sie geht langsam, zögernd und unentschlossen, denn sie hat kein Ziel. Bestenfalls eine Aufgabe; aber diese scheint ihr jetzt im hellen Tageslicht, nachdem die düsteren Nachtgedanken verflogen sind, reichlich absurd. Sie soll feststellen, ob ein bestimmter Mann in dieser Stadt lebt. Und wenn es so wäre? Wenn sie es feststellte? Was dann? Sie ist kein angriffslustiger Mensch, eher das Gegenteil, sie schreckt zurück vor spektakulären Taten, ja, fast könnte man sagen, vor Taten überhaupt. Sie ist ein Mensch, der froh ist, wenn man ihn in Ruhe lässt. Daran hat auch das Leben in den Vereinigten Staaten, in diesem tatenfrohen, unternehmungslustigen Land nichts ändern können. Ebenso wenig wie das gegenwartsbewusste Leben drüben sie nicht von ihrer eigenen unglücklichen Vergangenheit lösen konnte. Sie ist klug genug, das selbst zu wissen. Im Grunde ist es so, dass sie sich immer mehr in sich selbst zurückgezogen hat, auch wenn es ein flüchtiger Beobachter nicht merken konnte. Wie oft hat sie gedacht: Was wisst ihr denn? Auf welchem Stern lebt ihr denn?
Hochmütig hat sie es gedacht, aus einem Gefühl der Überlegenheit heraus, und auch davon weiß sie, dass es töricht ist. Gibt es einen Grund, stolz darauf zu sein, dass Europas ewige Zwietracht auch ihr Leben zerstört hat? Ist es ein Anlass zu Überheblichkeit, weil eine der Grenzen durch ihr Herz und durch ihr Leben gegangen ist? Dass das Kämpfen und Sterben von Jahrhunderten auch ihrer Generation nicht erspart geblieben ist?
Ihre Tochter ist in Amerika aufgewachsen, und sie hat ihr bewusst nicht viel erzählt von der Vergangenheit. Nichts von jener Grenze, die am Anfang allen Übels stand, kaum von ihrer Jugend, nur wenig vom Krieg und nichts – fast nichts – von Simon. Es war ihre Überzeugung, dies wäre der beste Weg, um Simone wirklich ein besseres und freieres Leben zu verschaffen.
Jetzt, wie sie hier geht, im hellen Sonnenschein zwischen den schönen alten Häusern, denkt sie: aber Simone muss Deutschland dennoch kennenlernen. Ich werde mit ihr wieder herkommen. Nicht gerade hierher nach Dornburg, es gibt viele alte Städtchen wie dieses, es gibt das schöne grüne Land. Sie soll es sehen. Mit mir. Sie wird es sehen, unbelastet von den trüben Gedanken an eine Vergangenheit, die für mich so schrecklich ist. Und auch ich – ich muss endlich von der Vergangenheit frei werden. Nicht durch eine Tat der Rache und des Hasses. Durch Vergessen.
Am Ende des Marktplatzes bleibt Cornelia stehen und blickt um sich. Also doch abreisen. Und zwar sofort. Nun – sagen wir morgen. Warum nicht einen Tag hier vertrödeln, ansehen, was der Hotelier ihr empfohlen hat, den Spaziergang hinauf zur Burg machen. Morgen dann abreisen, vielleicht mit kleinen Umwegen durch das Elsass zurück nach Paris und den geliehenen Wagen wieder abliefern. Er gehört einem jungen Franzosen, dessen Namen sie vergessen hat. Aber er steht in ihrem Notizbuch. Ein charmanter dunkelhaariger Junge, ein kleiner Playboy, wie Ethel lachend sagte, immer bereit, einer schönen Frau zu Diensten zu sein.
»Ich kann mir ja einen Wagen in einem Verleih mieten«, hatte sie gesagt. Und Ethel darauf: »What for? Jules hat drei Wagen. Er kann leicht einen entbehren. Ich frag’ ihn gleich.« Und damit war Ethel auf den hübschen Jungen zugesteuert, der mit zwei Mädchen an der Bar saß, die in einer Scheune aufgebaut war. Sehr originell, wie alle fanden. Jules kam gleich darauf mit Ethel herangeschlendert und erklärte eifrig, dass er ihr sein Herz oder, falls ihr das lieber wäre, selbstverständlich auch seinen Wagen zu Füßen legte. So war sie zu dem weißen Citroën gekommen.
Das war vor einigen Tagen gewesen, auf einem Landsitz in der Nähe von Paris, wo Ethel ihre Hochzeit feierte. Ethel hatte immer originelle Einfälle. Es war ihre vierte Heirat, ein reicher belgischer Industrieller war diesmal der Glückliche, und die Idee, die Hochzeit auf dem Lande zu feiern, stammte natürlich von Ethel. Sie hatte Freunde in der ganzen Welt, und gelegentlich fand sich darunter immer wieder ein Ehemann für sie.
Ihre Heirat war auch der Anlass für Cornelias Europareise gewesen. Ethel war Phils Schwester, attraktiv, exzentrisch, sehr amüsant und eine große Lebenskünstlerin. »Niemals hat sich ein Mensch aus meiner Familie darum gekümmert, wenn ich heirate«, hatte sie vorwurfsvoll am Telefon erklärt. »Diesmal bestehe ich darauf, dass ihr dabei seid.« Phil hatte trocken darauf erwidert, um ihre erste Heirat habe sich die ganze Familie sehr intensiv bemüht, allen voran Momy, die alte Mrs. Grant, aber Ethel habe es darauf angelegt, gerade diese so sorgfältig arrangierte Ehe zu einem riesigen Fiasko werden zu lassen. Drum sei es wohl besser, sie besorge sich ihre Ehemänner nun allein.
»Das tue ich ja auch, du kannst mir keinen Vorwurf machen. Aber du könntest mir wenigstens Glück wünschen, als mein einziger Bruder«, antwortete Ethel.
»Alles Glück der Welt, Baby«, rief Phil über den Ozean hinüber. »Und besonders deinem armen Opfer. Aber leider ist es mir unmöglich, ihn selbst in Augenschein zu nehmen.« Phil hatte immer so viel zu tun. Diesmal war gerade ein wichtiger Prozess vorzubereiten, und seine politischen Ambitionen erforderten außerdem gerade zu dieser Zeit eine dringende Reise. Cornelia begriff nie so ganz, was das alles für dringende Dinge waren, die ihn jahraus, jahrein beschäftigten. Es interessierte sie auch nicht sonderlich. Phils Betriebsamkeit auf so vielen Gebieten war ihr immer ein wenig unheimlich. Die Vehemenz, mit der sich amerikanische Frauen oft in das Berufsleben und vor allem in die politischen Pläne ihrer Männer einschalteten, war ihr fremd. Phil erwartete es wohl auch nicht von ihr.
So war sie also nach Paris gekommen. Und da bei Ethel niemals etwas planmäßig ablief, wunderte es sie nicht weiter, dass die Hochzeit um eine Woche verschoben werden musste. Damit hatte es angefangen. Denn Cornelia beschloss von einer Minute auf die andere, nach Berlin zu fliegen. »Nach Berlin?«, hatte Ethel maßlos erstaunt gefragt. »Warum denn das? Du wolltest doch nie …«
»Nein. Ich wollte nie.«
»Und warum jetzt?«
»Ach – weißt du, ich …«
»Sentimental journey?«, fragte Ethel spielerisch, aber sie sah ihre Schwägerin prüfend dabei an. Sie kannte Cornelia nicht sehr gut, aber immerhin gut genug, um zu wissen, dass diese es nie lernen würde, schwere Dinge leichtzunehmen. Und sie wusste, dass alles, was mit Cornelias Vergangenheit zusammenhing, tabu war im Hause ihres Bruders. Keiner wusste viel darüber. Cornelia schwieg, und die anderen schwiegen auch. Dazu kam – Ethel mochte die Frau ihres Bruders, auch wenn sie ganz anders war als sie selbst. »Hast du eigentlich noch Bekannte dort?«, fragte sie. Cornelia zögerte mit der Antwort. »Nein.« Und nach einem kleinen Überlegen fügte sie hinzu: »Das heißt, ich weiß es nicht.«
»Du weißt es nicht?«
»Ich habe mich nicht mehr darum gekümmert.«
»Du musst doch Verwandte haben, Familie. Da, wo du herstammst, I guess, it would be a kind of clan.«