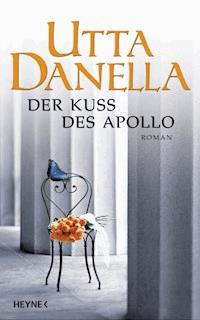6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
November 1923. Jacob Goltz kehrt in seine Heimat zurück. An der Seite der schönen Belgierin Madlon hat er im 1. Weltkrieg an der Front in Deutsch-Ostafrika gekämpft. Die aufregenden Nachkriegsjahre verbringen die beiden im lebendigen Berlin, doch die Währungsreform frisst alle Mittel auf und so suchen sie Zuflucht bei der wohlhabenden Familie Jacobs am Ufer des Bodensees. Die Rückkehr nach Konstanz fällt Jacob schwer. Der Enge dieser von fest gefügten Traditionen geprägten Welt war er vor 15 Jahren entflohen. Während Madlon auf ein geordnetes Leben hofft, findet Jacob sich im Zivilleben nicht zurecht, ist rastlos, ohne Ziel. Weder die Anwaltskanzlei, die sein Vater und sein Onkel führen, noch der Bauernhof, den seine unabhängige Mutter Jona bewirtschaftet, interessieren ihn. Die blutjunge, zauberhafte Clarissa, die ihn anhimmelt, dafür umso mehr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 919
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Jacobs Frauen
Roman
hockebooks
Besuchen Sie uns im Internet: www.hockebooks.de
Utta Danella: Jacobs Frauen. Roman
Copyright ©2016 by Erbengemeinschaft Utta Danella vertreten durch AVA international GmbH, Germany
Die Originalausgabe ist 1983 im Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg erschienen.
Überarbeitete Neuausgabe ©2020 by hockebooks gmbh
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Erlaubnis des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: Joachim Luetke (www.luetke.com) unter Verwendung eines Motivs von 1074460184/shutterstock.com
ISBN: 978-3-957-51361-8
www.ava-international.de
www.uttadanella.de
Madlon
Die Heimkehr
Im November 1923 kam Carl Jacob Goltz zurück in sein Elternhaus am See, in die wohlgeordnete, festgefügte Welt, die ihm in seiner Jugend so eng vorgekommen war. Die Ferne hatte er gesucht, die große Weite, das Abenteuer auch; das alles hatte er gefunden, doch nun kam er zurück. Nicht mit hängenden Flügeln, das hätte seinem Wesen nicht entsprochen, dazu gab es auch keinen Grund. Er war, wie so viele, ein Opfer der Zeit, ein Opfer des großen Krieges, der hinter ihnen lag.
Wild und bewegt war sein Leben gewesen, die Lust an der fremden Welt ging unter in dem langen, erbarmungslosen Kampf, in dem er Hunger und Durst, Not und Krankheit ertragen musste, Attacke und Flucht, Siege und Niederlagen erlebte und schließlich die bittere Enttäuschung des Endes.
Doch wenn auch Deutschland den Krieg verloren hatte, er hatte an der einzigen Front gekämpft, an der die Deutschen nicht besiegt wurden. Das blieb in all den Jahren, die noch vor ihm lagen, sein stolzer Ausspruch, dem sich nicht widersprechen ließ.
Dennoch hatte er nichts und besaß er nichts, als er kam, nicht einmal einen Beruf, nur die Malaria in seinem Blut und ein lahmes Bein.
Und eine Frau brachte er mit.
Von seiner Ehe hatte die Familie nichts gewusst. Im Frühjahr 1919 erst erfuhren sie, dass er lebte. Er schrieb aus Berlin, wo er nach der Gefangenschaft und der Rückverschiffung nach Europa gelandet war. Zunächst war es nur eine kurze Nachricht, es gehe ihm gut, und er werde bald zu einem Besuch nach Hause kommen. Doch dann kam ein Brief aus Pommern.
»Ich erhole mich auf dem Gut eines Kameraden von den Strapazen der vergangenen Jahre. Und hier gibt es auch mehr zu essen als in Berlin.«
Von einer Frau war nicht die Rede, und auf die Idee, dass er sich auch zu Hause erholen könnte und dass es da ganz sicherlich mehr zu essen gab als in Berlin, schien er nicht gekommen zu sein.
Eine Weile riss die Verbindung nicht ab; seine Mutter schrieb ihm, auch sein Vater, sie mahnten ihn ungeduldig zur Heimkehr, er antwortete, später wieder aus Berlin, mit vagen Ausflüchten. Wie er eigentlich lebte, wovon, was er tat, davon schrieb er nichts, und seine Mutter entnahm daraus, dass es ihm schlecht ging.
Sie schrieb nicht gern Briefe, aber eines Tages wurde es ein langer Brief, mit vielen Fragen, mit energischen Worten, mit dem Satz: »Komm endlich! Ich brauche dich hier.«
Dieser Brief kam als unzustellbar zurück. Sie hatte ihn an das Hotel adressiert, das er als Absender angegeben hatte, doch dort wohnte er nicht mehr.
Wieder einmal war Carl Jacob Goltz verschollen, und seine Familie hielt es durchaus für möglich, dass er Deutschland abermals verlassen hatte und ins Ausland gegangen war. Zurück nach Afrika oder, wie sein Onkel Carl Eugen Goltz vermutete, nun vielleicht nach Amerika.
»Er wird erst zurückkommen, wenn er Millionär geworden ist, das ist ihm zuzutrauen«, fügte er hinzu, und Jacobs Schwester Agathe meinte spöttisch: »Millionär war er schon immer. Eine Million Flausen im Kopf, daran hat sich bestimmt nichts geändert.«
Aber Jacob war in Berlin geblieben, und Millionär wurde er gleichzeitig mit allen anderen Deutschen, als die Inflation ihrem Höhepunkt zustrebte. Von dem Hotel war er in eine Pension umgezogen, dann bewohnte er mit seiner Frau ein möbliertes Zimmer im Westen, eine Zeit lang wohnten sie geradezu fürstlich, sie verfügten über eine große Wohnung in Schöneberg, altmodisch, aber gemütlich eingerichtet, sie gehörte den Eltern eines Kameraden, die sich in ihr Haus im Riesengebirge zurückgezogen hatten, weil ihnen das Berlin der Nachkriegszeit widerwärtig sei, wie sie sagten. Ihr Sohn, der Aufnahme fand in das neue Heer der Republik, heiratete jedoch nach einiger Zeit und beanspruchte die Wohnung dann für sich.
Sie logierten nun wieder in billigen Pensionen und lebten wie die meisten Menschen in dieser Zeit von heute auf morgen, von der Hand in den Mund.
Und dennoch, so wechselvoll ihr Leben war, sie genossen beide, Madlon und Jacob, die Jahre im turbulenten Berlin der Nachkriegszeit.
Abenteuerlich war ihr Leben immer gewesen, wenn auch auf andere Art, doch das Triumphgefühl des Lebens, des Überlebthabens, war stärker als die Sorgen des Alltags, jedenfalls so lange, bis das immer wertloser werdende Geld sie in nackte Not brachte. Zuvor waren die Jahre wie ein einziger Rausch gewesen. Sie hatten alte Freunde in Berlin wiedergetroffen und noch mehr neue gefunden, sie saßen lange Nächte in den Bars und Kneipen, es waren Vergnügungen, die einer Betäubung gleichkamen. Wie so viele dieser Kriegsgeneration hatten sie noch nicht in ein normales Leben zurückgefunden, sie versuchten es auch gar nicht, wieder ordentliche Bürger zu werden. Das heißt, nur Jacob hätte es versuchen können, Madlon war es nie gewesen.
Am liebsten wäre Jacob in das 100 000-Mann-Heer eingetreten, das der Versailler Vertrag der deutschen Republik zubilligte, aber dafür bestand nicht die geringste Aussicht, sein Gesundheitszustand machte es unmöglich. Einmal erwog er, sich einem der Freikorps anzuschließen, die viel von sich reden machten, aber dem widersprach Madlon energisch.
»Wir haben glücklich überlebt, und ich habe dich behalten. In solch einen sinnlosen Kampf ziehst du nicht.«
»Aber wir müssen uns wehren gegen die Roten.«
»Lass es andere tun, du hast genug gekämpft. Deutschland hat den Krieg verloren. Wer auf diese Weise noch Selbstmord begehen will, soll es meinetwegen tun. Du nicht. Es ist töricht, für eine verlorene Sache zu kämpfen.«
»Haben wir nicht jahrelang für eine verlorene Sache gekämpft?«
»O nein«, widersprach sie entschieden, »gerade das haben wir nicht getan. Und wir haben nicht verloren. Gerade wir nicht.«
Eine Zeit lang hoffte er, Lettow-Vorbeck, der eine Brigade in Schwerin befehligte, werde sich für ihn verwenden und einen Posten für ihn finden, doch bereits im Sommer 1920 bekam Lettow sehr abrupt den Abschied, im Anschluss an den missglückten Kapp-Putsch.
Für ein Berliner Boulevardblatt schrieb Jacob dann, auf Anforderung, seine Erlebnisse aus der afrikanischen Dienstzeit nieder, auch hierin seinem General nacheifernd, aber Jacob hatte kein Talent zum Schreiben, es wurde nur ein kahler Bericht, dem die Journalisten erst Form und Farbe geben mussten, was einer Fälschung nahekam und dem, was sie erlebt hatten, nicht gerecht wurde. Die Stimmung in Berlin war antimilitaristisch, pazifistisch, und gerade in bestimmten Zeitungskreisen redete man übel von den besiegten Helden und nahm jede Gelegenheit wahr, ihnen etwas am Zeug zu flicken.
Der General ließ Jacob wissen, dass er diese blödsinnige Schreiberei unterlassen solle.
Eine Zeit lang spielte Jacob Chauffeur bei einem reichen Schieber, eine relativ angenehme Stellung, die er jedoch verlor, als ihn wieder einmal die Malaria packte. Einige Monate lang stand er als Portier vor einer Nachtbar, während Madlon drinnen hinter dem Tresen saß. Nach einer nächtlichen Prügelei mit Spartakisten, die ihn angepflaumt hatten, warf man ihn hinaus; ein hünenhafter russischer Emigrant mit Vollbart und dekorativem eisgrauem Lockenhaupt nahm seinen Posten ein.
Seine ehrbare und wohlhabende Familie daheim hätte fassungslos vor diesen Tatsachen gestanden. Natürlich hätten sie ihm Geld geschickt, wenn er es angefordert, wenn er sie nur hätte wissen lassen, wo er sich befand und wie es ihm erging. Aber ein lächerlicher Stolz hinderte ihn daran, sie um etwas zu bitten, und da er nicht wusste, was er ihnen schreiben sollte, schrieb er gar nicht. Zwar faselte er immer wieder einmal von dem Besuch, den er nun bald zu Hause machen wollte, Madlon hörte sich das mit skeptischer Miene an, und so sehr sie seine Familie fürchtete, war es am Ende ihr vorbehalten, ihn zur Vernunft zu bringen.
Am besten ging es ihnen, als Madlon für eine Konfektionsfirma fantastisch farbige Gewänder mit exotischem Touch entwarf, die für eine Weile Mode wurden, sodass sie gutes Geld damit verdiente. Außerdem besaß sie eine geniale Hand für Schwarzmarktgeschäfte, die in dieser Zeit üppig gediehen. Doch die wachsende Inflation machte ihr Leben zunehmend schwieriger.
Sie wohnten in einer Pension am Wittelsbacher Platz, als Jacob wieder einmal von einem heftigen Malariaanfall geschüttelt wurde. Madlon beschloss, ihren Ring mit dem großen Diamanten, von dem sie sich nie hatte trennen wollen, nun doch zu verkaufen. Während der Kämpfe hatte sie ihn in einem Beutelchen unter dem Buschhemd getragen, dann ließ sie ihn blitzen im Licht der vergnügten Nächte, nun suchte sie einen, der ihr Geld dafür gab.
»Merde!«, sagte sie, als sie in das düstere Pensionszimmer zurückkam, schmiss den Haufen Papier, den der Ring ihr eingebracht hatte, auf Jacobs Bettdecke und streckte ihm die entblößte Hand entgegen.
»Ich hätte es nicht tun sollen. Das Geld ist doch nichts wert.« Aber ehe er noch ein Trostwort finden konnte, raffte sie die Scheine wieder zusammen, stopfte sie in ihre Tasche und rief: »Ich hole ihn mir wieder. Mir ist etwas Besseres eingefallen.« Sie war aus dem Zimmer, ehe er eine Frage stellen konnte. Das war so ihre Art; impulsiv in allem, was sie tat, kaufte sie den Ring zurück, bereits mit Verlust, und fuhr unverzüglich in den Grunewald.
Kosarcz war ihr eingefallen, dessen dunkle Geschäfte über alle Grenzen reichten. Sie hatte ihn kennengelernt, als sie in der Bar arbeitete; er kam jeden Abend und ließ sie wissen, dass er verrückt nach ihr sei. Was zu verstehen war, denn die harten Jahre hatten ihrer Schönheit nicht geschadet, erst recht nicht ihrem Temperament und ihrem Sex-Appeal, wie man seit Neuestem in Berlin die erotische Ausstrahlung einer Frau nannte.
Kosarcz war der Einzige, mit dem sie Jacob je betrogen hatte, was Jacob niemals erfahren durfte. Er war jähzornig, er besaß eine Waffe, und das Töten war eine jahrelange Gewohnheit. Gewiss hätte er sie beide umgebracht, ohne mit der Wimper zu zucken.
Kosarcz sei in New York, erfuhr Madlon von dessen Sekretär, als sie unangemeldet in der Grunewaldvilla vorsprach. Sie kannte den jungen Mann, auch er war Offizier gewesen und hatte früher ebenfalls oft bei ihr an der Bar gesessen. Dort hatte er wohl auch Kosarcz kennengelernt.
Madlon beglückwünschte ihn zu der angenehmen Position, die er gefunden hatte.
»Allein schon der Rahmen hier«, sagte sie neidvoll und wies mit einer ausladenden Geste über das geräumige Terrassenzimmer mit dem riesigen Schreibtisch. »Sie sagen es, gnädige Frau«, entgegnete Kosarczs Sekretär. »Es ist eine wohltuende Abwechslung nach den Jahren im Schützengraben. Dort war es ziemlich eng.«
Wann Kosarcz zurückkomme? Man erwarte ihn jeden Tag, denn er neige zur Seekrankheit und fürchte die Herbststürme auf dem Atlantik.
Bei dieser Gelegenheit sah sie die Frau, mit der Kosarcz zurzeit zusammenlebte, sehr jung, sie konnte kaum über zwanzig sein, eine schmale Knabenfigur, das blonde Haar zu einem kurzen Pagenkopf gestutzt. Alles so, wie es die derzeitige Mode vorschrieb.
Madlon lächelte dem Mädchen zu; Grund zur Eifersucht bestand für sie nicht, und sie war niemals biestig zu anderen Frauen, selbst wenn sie um so viele Jahre jünger waren. Auch war sie sich ihrer eigenen Wirkung auf Männer vollkommen sicher. Sie wunderte sich nur, dass die Blonde Kosarcz nicht zu dünn war, aus eigener Erfahrung kannte sie seine Freude an weiblichen Formen.
Nachdenklich fuhr sie mit der S-Bahn in die Stadt zurück. Den Ring trug sie wieder im Lederbeutelchen unter der Bluse. Sie würde Jacob nichts von ihrer vergeblichen Fahrt in den Grunewald erzählen, aber sie war mittlerweile entschlossen, den Ring nicht gegen wertloses Papier einzutauschen. Wenn, dann nur gegen Dollars.
Wer kam infrage? Sie ging in Gedanken die Gesichter der Freunde und Bekannten durch, die in den letzten Jahren ihr Leben begleitet hatten – es war keiner dabei, der ausreichend Geld, geschweige denn Dollars hatte. Dann fiel ihr Blumenauer ein, der Inhaber der Konfektionsfirma, für die sie die bunten Kleidchen entworfen hatte.
Sie traf ihn noch an in seiner Etage in der Mohrenstraße, er ging selten abends vor neun Uhr nach Hause.
»Nett, Kindel, dich mal wiederzusehen.«
Den Ring wollte er nicht, er drückte ihr einfach so ein paar Millionen in die Hand.
»Mit dem Kram kann man sowieso nichts mehr anfangen. Behalt den Ring, vielleicht brauchst du ihn eines Tages. Es wird sich bald ändern, und dann ist Geld teuer. Wie geht’s euch denn? Grüß deinen Mann. Malaria, so. Na, wird auch vorübergehen.«
Am nächsten Tag ging es Jacob besser, das Fieber war gesunken, sein Gesicht nicht mehr so hohlwangig und eingefallen. »Wenn ich wieder auf den Beinen bin, suche ich mir Arbeit.«
»Du findest keine.«
Sie hatte den Arzt bezahlt und zu essen eingekauft, das Geld war schon wieder weniger wert als am Tag zuvor.
»Ich werde noch mal an General von Seeckt schreiben. Vielleicht nehmen sie mich doch. Irgendein Posten wird sich für mich in diesem Heer doch finden.«
Madlon blickte von ihrer Strickerei auf und lächelte mitleidig.
»Hör auf damit, dich zu quälen. Sie nehmen dich nicht«
»Ich weiß. Ich bin ein Krüppel.«
»Übertreibe nicht, mon ami. Aber du weißt doch genau, wie viele Männer in diesem Land, allein in dieser Stadt hier, herumlaufen, ohne Arbeit und ohne Aussichten, und die nichts lieber wären als wieder Offizier.«
Es waren nicht nur die Malariaanfälle, von einer Patrouille auf die Uganda-Bahn war sein kaputtes Bein zurückgeblieben. Ein Durchschuss oberhalb des Knies, der Knochen war verletzt, und die Wunde wollte nicht heilen. Sie entzündete sich, verfärbte sich, und er hatte höllische Angst, das Bein zu verlieren. Es war während der Regenzeit, sie lagen im Sumpf, geplagt von Moskitos. Lettow-Vorbeck besah sich das Bein eines Tages und sagte:
»Das sieht schlimm aus, mein Junge. Ehe du den Brand bekommst, müssen wir dir das Bein absägen.«
»Lieber verrecke ich«, stieß Jacob hervor, vom Fieber geschüttelt. Lettows gesundes Auge blitzte zornig, aber er sagte nichts darauf. Vielleicht weil er sich dachte, dass der Verletzte so oder so sterben würde, ob man ihm das Bein nun amputierte oder nicht. Was er brauchte, waren Männer, die kämpfen konnten, keine Kranken, keine Verletzten, keine Sterbenden. Davon hatte er sowieso genug.
Madlon wich Tag und Nacht nicht von Jacobs Lager, und Numba brachte Kräuter, die sie in die Wunde legte, worauf die Entzündung wirklich zurückging. Dann behandelte ihn endlich ein weißer Arzt, ein gefangener Engländer, der sein Bestes tat, des Feindes Bein zu heilen. Schließlich wusste er, dass in diesem Krieg selten Gefangene gemacht wurden. Wenn sie ihn also am Leben ließen, musste er etwas dafür tun. Der Engländer war Pragmatiker, das kam erstens von seiner Nationalität, zweitens von seinem Beruf. Zudem machte der Krieg aus jedem Idealisten einen Pragmatiker, erst recht der Krieg im Busch.
Jacob hinkte, manchmal mehr, manchmal weniger. Seit der Prügelei nachts auf dem Kurfürstendamm mit den Spartakisten wieder mehr. Er hatte einen Tritt gegen das Bein abbekommen, fiel zu Boden und konnte nicht wieder aufstehen.
»Du hast recht, sie nehmen mich nicht«, wiederholte er bitter. »Hunderttausend Mann, ein Witz. Gesunde und kräftige Männer können sie haben, Männer mit hervorragender militärischer Qualifikation, soviel sie nur wollen. Spitzenleute. Wir Schutztruppler sind ihnen sowieso dubios. Unser Krieg wurde nicht nach hergebrachten Regeln geführt, das macht uns verdächtig.«
Madlon saß beim letzten Tageslicht am Fenster und strickte. Stricken war ihre Leidenschaft – Schals, Pullover, Kleider. Sie besaß etwa ein Dutzend selbstgestrickter Kleider, kühn in den Farben, schick in der Form, die nichts von ihrer makellosen Figur verbargen.
»Es wird uns etwas einfallen«, sagte sie mechanisch, legte das Strickzeug beiseite und fuhr sich durch die kurze, kupferbraune Mähne. Sie hatte ihr Haar schon während der Kämpfe abgeschnitten, es war einfach praktischer, auch wenn es schade gewesen war um ihre Haarpracht, die bis zu den Hüften reichte. Alle Männer, die um sie waren, trauerten um ihr Haar, aber sie lachte nur. »Es wächst ja wieder.«
Aber nun war kurzes Haar Mode, also blieb sie dabei.
Sie setzte sich auf den Bettrand, küsste Jacob und sagte: »Blumenauer meint, es wird bald etwas geschehen. Dann wird Geld teuer, sagt er. Aber es muss verdient werden.«
»Nicht mal Eintänzer kann ich werden mit dem verdammten Bein.«
»Non, chéri; aber auch mit zwei gesunden Beinen würdest du dich nicht zum Gigolo eignen. Dazu bist du viel zu überheblich.«
»Ich? Überheblich? Nach allem, was ich erlebt habe?«
»Bien sûr. Die Überheblichkeit des Provinzlers, das kenne ich, das verliert sich nie.«
Ihre Worte machten ihn sprachlos. Er hätte es nie für möglich gehalten, dass sie ihn in irgendeine Rubrik einordnete. Sie hatte ihn immer so genommen, wie er war, sie kannte ihn als Soldaten, als Kämpfer, triumphierend oder geschlagen, und nun in den letzten Jahren – was war er da eigentlich? Ein Versager, Strandgut der Zeit. Aber auf jeden Fall hatte er sich als Großstädter gefühlt, heimisch geworden in Berlin. Wie kam sie auf die Idee, ihn einen Provinzler zu nennen? Er starrte in ihr schönes, so vertrautes Gesicht. Die dunkelbraunen Augen blickten in eine unbekannte Ferne. Sie schien weit weg von ihm zu sein, und plötzlich hatte er Angst, sie zu verlieren. Sie war alles, was er noch besaß – ihr warmer, lebendiger Körper, ihr zärtlicher Mund, ihre Fürsorge, ihre Liebe – er konnte sich nicht vorstellen, jemals ohne sie zu sein.
»Ich war früher ein guter Tänzer«, sagte er heiser. »Sehr begehrt bei den jungen Damen. Warum nennst du mich einen Provinzler?«
Ihr Blick kehrte zurück, sie lachte und küsste ihn wieder. »Das bist du doch. Keine Großstadtpflanze, wie sie hier in Berlin sagen. Ein Mensch, der irgendwo Wurzeln hat, und vielleicht auch ein wenig …« Sie verstummte, wieder ihr suchender Blick ins Weite.
»Ein wenig was?«
»Nun, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Bourgeois, n’est-ce pas? Bürgerlich. Das ist es, was du bist.«
»Das bin ich ganz gewiss nicht. Das war ich nie.«
»Aber doch. So etwas ist man und bleibt man. Du hast lange nicht mehr an deine Eltern geschrieben.«
»Nein. Was sollte ich ihnen schreiben?«
»Du könntest fragen, wie es ihnen geht. Du weißt nicht einmal, ob sie noch leben. Du könntest berichten, wie es dir geht. Nicht genau, aber ein bisschen davon. Und dann könntest du schreiben, dass du sie nun einmal besuchen wirst. Dass wir sie besuchen werden. Sie wissen immer noch nicht, dass du verheiratet bist, nein?«
Er war so erstaunt, dass ihm keine Antwort einfiel. Früher, wenn er nur davon gesprochen hatte, einen Besuch bei seinen Leuten zu machen, hatte sie heftig abgewehrt: »Ich werde auf keinen Fall mitfahren. Was soll ich da? Ich kenne sie nicht. Sie werden mich nicht mögen. Und du hast immer gesagt, du könntest dort nie mehr leben.«
Sie hatte Angst vor den feinen und reichen Leuten, die seine Familie waren. Sie, die niemals im Leben, nicht in der gefährlichsten Situation, Angst gefühlt hatte, konnte sich ein normales, bürgerliches Leben nicht vorstellen.
Aber an diesem Abend auf einmal, es war schon fast dunkel im Zimmer, sie schmiegte sich an ihn und legte ihre Wange an seine, an diesem Abend sprach sie ganz gelassen, in größter Selbstverständlichkeit folgende Worte aus: »Warum willst du dir Arbeit suchen? Du bist ein Sohn, ein Erbe. Der einzige Sohn. Die Häuser und den Hof frisst die Inflation nicht auf.« Ganz plötzlich erwog sie den Gedanken, unterzukriechen bei den fremden Leuten, von denen sie annahm, dass sie ihnen nicht willkommen sein würde. Kam es davon, dass sie langsam ein wenig müde wurde?
Im August war sie vierzig Jahre alt geworden, vierzig, die magische Zahl im Leben einer Frau. Einen Beruf würde sie sich nicht mehr aufbauen können in dieser schweren Zeit, genauso wenig, wie sie noch ein Kind bekommen würde.
Es war der größte Kummer ihres Lebens, dass sie keine Kinder hatte. Zwei Ehemänner und eine Reihe von Liebhabern – es musste wohl an ihr liegen. Numba hatte es mehrmals mit einem geheimnisvollen Trank versucht, doch es hatte nichts genützt.
Für eine Vollblutfrau wie Madlon war es schwer, sich mit ihrer Unfruchtbarkeit abzufinden. Immer war ein Mann da gewesen, der sie wollte, der sie liebte; der erste verführte sie mit sechzehn, dort in dem Bergarbeiternest, in dem sie aufgewachsen war, dann holte sie der Mann ihrer älteren Schwester in sein Bett. Daraufhin lief sie von zu Hause fort. Nüchtern betrachtet war es in der derzeitigen Situation nur ein Vorteil, dass sie keine Kinder zu versorgen hatten. Aber nüchtern konnte sie in diesem Punkt nicht denken. Sie war ein Mensch, der nur aus dem Gefühl heraus lebte; keine Kinder zu haben machte sie arm.
Nachdem sie es ausgesprochen hatte, und da es nun ihr Einfall war heimzukehren, war es Jacob, der Abwehr und Angst verspürte; er war einem normalen, bürgerlichen Leben ganz und gar entfremdet. Gleich nach seiner Rückkehr nach Deutschland hätte er nach Hause fahren müssen, da wäre es ihm leichter gefallen, und er hatte seinerzeit auch durchaus die Absicht gehabt.
Wie oft hatte er in den Jahren des Krieges an daheim gedacht. In den glutheißen Tagen im afrikanischen Urwald, im Sumpf der Regenzeit, in den eisigen Nächten am Kilimandscharo träumte er von der milden Luft, roch den Duft des Obstes, sah den Glanz über See und Bergen und tauchte sein fieberndes Gesicht in die Kühle des Nebels über dem herbstlichen See.
In den letzten Jahren hatte er Gedanken dieser Art immer rasch beiseitegeschoben. Wie konnte er heimkommen, so wie sein Leben jetzt aussah, er war ein Nichts und ein Niemand, und sein Stolz würde immer stärker sein als das Heimweh, und Heimweh war es, auch wenn er ein so sentimentales Wort nie in den Mund genommen hätte.
Nachdem er seinen Dienst bei der Schutztruppe quittiert hatte, war er zwei Jahre lang in gutbezahlter Position auf der Baumwollplantage einer Hamburger Compagnie tätig gewesen, und es bestanden Pläne, zusammen mit einem Freund, eigenes Land zu erwerben und es mit Kaffee zu versuchen. Doch da begann der Krieg, und es gab nur noch Kampf.
»Du meinst, wir sollten sie besuchen?«, fragte er unsicher.
»Pourquoi pas?«, meinte Madlon leichthin, doch sie hatte sich bereits entschlossen. Ein bewegtes Auf und Ab war ihr Leben gewesen, viel abenteuerlicher als das seine, denn er kannte schließlich die Geborgenheit einer sorglosen Jugend. Das hatte sie nicht gehabt. Sehnte sie sich nun nach Geborgenheit?
Dieser Begriff kam ihr nicht in den Sinn, weil er für sie nicht vorhanden war. Sie dachte nur an Geld, an Besitz, an finanzielle Sicherheit. Weniger für sich selbst als für ihn. Er brauchte gutes Essen, ärztliche Behandlung und Ruhe.
Das alles erklärte sie unumwunden Kosarcz, den sie wenige Tage später traf. Sie hatte angerufen, um zu erfragen, ob er zurück sei, und er bestellte sie in den Reitstall im Grunewald, wo er sein Pferd stehen hatte. Sie vermutete, es sei wegen der dünnen Blonden, dass er sie nicht bei sich zu Hause empfangen wollte.
Er sah blendend aus, als er von seinem Ausritt zurückkam, die frische Herbstluft hatte seine Wangen gerötet, seine Augen leuchteten auf, als er sie sah. Er küsste sie auf beide Wangen, dann auf den Mund. Sie strich dem Schimmel über den Hals und legte für einen Augenblick ihre Stirn an das seidige Fell.
Viele Jahre ihres Lebens hatte sie im Sattel verbracht, und sie hatte die Pferde oft mehr geliebt als die Menschen. Und wie viel Kummer hatten die Pferde ihr bereitet! Es war schwer, sie in Ostafrika heimisch zu machen, das Klima bekam ihnen schlecht, die Stiche der Tsetsefliegen kosteten sie Gesundheit und oft das Leben, ihre Beine gingen kaputt bei den mörderischen Ritten. Wie waren sie geschunden worden während des Krieges, ausgepumpt bis zum letzten bei den endlosen Märschen durch die Steppe und durch den Busch. Wenn sie zusammenbrachen, wurden sie geschlachtet und aufgefressen. Daran konnte sie sich nie gewöhnen. Und wenn jemals einer sie weinen sah, dann geschah es, wenn das Tier getötet wurde, das sie zuvor geritten hatte.
Nachdem das Pferd im Stall versorgt war, führte Kosarcz seinen Gast in das Lokal, das sich neben dem Reitstall befand. »Wir werden jetzt ausführlich frühstücken. Champagner, Madlon? Ein Tellerchen mit Kaviar?«
»Hört sich gut an.«
»Du bist dünner geworden«, stellte er fest.
Sie unterdrückte die Bemerkung, dass er doch offenbar seit Neuestem die Dünnen bevorzuge, nahm jedoch das Stichwort auf. »Es geht uns nicht besonders gut.«
»Den meisten Menschen geht es dreckig in dieser Zeit«, entgegnete er kühl.
»Nur dir nicht.«
»Nein, mir nicht. Mir ist es lange nicht mehr schlecht gegangen, und mir wird es nie mehr schlecht gehen. Dafür habe ich gesorgt.«
»Du wirst reich vom Elend der anderen«, sagte sie bitter.
»Man kann es so nennen. Und das ist keine Neuheit in der Menschheitsgeschichte. Das Elend wird für die meisten Menschen in diesem Land noch größer werden. Deutschland hat den Krieg verloren, und der Versailler Vertrag drückt ihm schön langsam den Hals zu.«
»Dieses verdammte Geld ist schuld!«
Er wischte die Billionen mit einer Handbewegung vom Tisch. »Die Währung wird sich bald normalisieren. Die einen haben dann alles verloren, und die anderen werden sehen, wie hart es ist, Geld zu verdienen.«
»Das habe ich oft gehört in letzter Zeit«, sagte Madlon und versuchte, genauso kühl und sachlich wie er zu reden. »Deswegen habe ich darüber nachgedacht, was aus uns werden soll, aus Jacob und mir.«
Sie berichtete von ihrem Plan und bediente sich dabei reichlich von dem Kaviar.
»Als Hungerleider dürfen wir dort nicht ankommen. Es darf nicht so aussehen, als wollten wir unterkriechen, verstehst du? Jacob könnte das nicht ertragen.«
»Du auch nicht. Ein Versuch mit seiner Familie also. Glaubst du, dass du das aushalten wirst?«
Sie lachte unsicher. »Ich kenne sie ja noch nicht.«
Sie legte die Hand mit dem Ring, den sie heute wieder trug, auf den Tisch.
»Ich möchte ihn verkaufen. Aber nur gegen Dollar.«
Er streifte den Ring mit einem kurzen Blick.
»Ich kenne ihn, ich habe ihn oft genug an deiner Hand bewundert. Ein selten schönes Stück, fünf Karat mindestens. Lupenrein. River, würde ich sagen. Aus den Kongominen, nicht wahr? Es wäre schade, wenn du ihn verkaufst.«
Sie zog den Ring ab und legte ihn neben sein Glas.
»Ich nehme kein Papier dafür.«
»Das solltest du auch nicht tun. Von mir bekommst du so viele Dollars dafür, dass du dich überall sehen lassen kannst. Aber die bekommst du nur von mir, denn Schmuck kannst du heute an jeder Straßenecke kaufen.«
Sie warf hochmütig den Kopf in den Nacken.
»Den letzten Satz hättest du dir sparen können.«
Er lachte und legte seine Hand auf die ihre.
»Ich bin ein Emporkömmling. Ein Herr Neureich, wie man heute sagt. Ich muss immer ein wenig prahlen.«
»Du kannst den Ring ja deiner Freundin schenken.« Diese Bemerkung konnte sie sich nun doch nicht verkneifen.
»Das werde ich nicht tun. Ich werde ihn erst einmal behalten. Ich werde ihn aufheben für dich, du Rotfuchs. Vielleicht willst du ihn später einlösen.« Er umfasste ihre Hand fester. »Meine Freundin ist kein Thema zwischen uns. Ich würde lieber etwas anderes mit dir besprechen.«
»Und was?«
»Vermutlich werde ich ganz nach drüben gehen. In die Vereinigten Staaten. Möchtest du nicht mitkommen?«
»Wir?«
»Nein. Du.«
Sie schwieg überrascht. An seiner Seite würde sie nicht mehr arm sein. Wahrscheinlich nie mehr. Und im Alter passte er besser zu ihr als Jacob. Ein Kind allerdings hatte er ihr auch nicht gemacht.
»Ich liebe meinen Mann.«
»Gewiss.« Er lächelte. Den Hinweis darauf, dass sie ihn betrogen hatte, ersparte er sich.
»Überlege es dir. Ich nehme den Ring als Pfand. Und ich werde dich wissen lassen, so in einem Jahr etwa, wo ich mich befinde. Bis dahin wirst du wissen, ob du dort leben magst, wo du hingehst.«
»Und wie wirst du es mich wissen lassen?«
»Ganz einfach, Madlon, du gibst mir die Adresse.«
»Die Stadt heißt Konstanz«, sagte sie langsam. »Und sie liegt an einem See, irgendwo im Süden. Jacob sagt, für deutsche Begriffe ist es ein großer See.«
»Man nennt ihn Bodensee, Madlon.«
»Ja, so heißt er.«
Von den Dollars kaufte Madlon als Erstes ein Auto. Es würde sich gut machen, mit einem Auto anzukommen, fand sie. Sie erstand einen gebrauchten, doch noch höchst ansehnlichen Studebaker, und mit dem fuhren sie, beide neu eingekleidet, südwärts. Sie ließen sich Zeit, übernachteten zweimal in guten Hotels, denn jeder von ihnen, jeder mit seinen eigenen Gedanken beschwert, fürchtete die Ankunft. »Wenn sie unfreundlich zu mir sind, nehme ich den Wagen und fahre gleich wieder weg. Du kannst ja dortbleiben.«
Sie rief es laut und heftig, es war in einem Dorf in Württemberg, und überfuhr im selben Moment ein Huhn, das ihnen gackernd vor die Räder flatterte. Laut schimpfend kam ein Bauer auf sie zugelaufen.
Madlon hielt ihm schweigend auf der offenen Hand einen Dollar hin, den er ebenso schweigend nahm. Dann blickte er mit aufgesperrtem Mund dem Wagen nach.
»Dafür hätte er dir seinen ganzen Hühnerhof vor die Räder getrieben«, sagte Jacob. »Armes Vaterland.«
»Die Bauern sind nicht zu bedauern. Sie haben einen guten Reibach gemacht in der Kriegs- und Nachkriegszeit.«
Über der Konstanzer Bucht lag dichter, silberner Nebel, als sie sich, von Radolfzell kommend, der Stadt näherten.
Madlon stoppte den Wagen.
»Wo ist der See?«
»Du würdest ihn erst sehen, wenn du schon darin bist. Das ist in dieser Jahreszeit hier oft so.«
»Es ist so still. Und nun?«, fragte sie nervös. »Wie geht es jetzt weiter?«
Er blickte, genauso nervös, auf seine Uhr. »Noch nicht zwei. Wir fahren über die Brücke in die Stadt hinein. Es ist zu früh. Um diese Zeit hat mein Vater seinen Nachmittagsschlaf noch nicht beendet. Es wird immer erst um ein Uhr gegessen.«
Das wusste sie bereits. Er hatte ihr während der Fahrt alles über die heimatlichen Bräuche erzählt. Sie wusste, wann sein Vater das Haus verließ, wann er es wieder betrat; was er am liebsten aß, nämlich zart in Butter gebratene Felchen aus dem See; was er am liebsten tat, nämlich im Ried sitzen und die Vögel beobachten. Sie kannte die Ansichten und Gewohnheiten von Carl Eugen, Vaters Bruder, der von anderer Art war, ein Weltmann, charmant und witzig, der die Frauen liebte und über dessen Aktivitäten auf diesem Gebiet die tollsten Geschichten im Umlauf waren.
»Toll für unsere Verhältnisse jedenfalls«, schränkte Jacob ein. »Immerhin, als ich ein Bub war, gab es kein Jahr, in dem er nicht einige Wochen in Paris verbrachte. Das hat enormes Aufsehen in unserer Stadt erregt. Ein Teufelskerl, der Carl Eugen Goltz, so hieß es immer. Na, die Parisreisen wird der Krieg ihm vermasselt haben. Und zu alt ist er inzwischen auch.«
Carl Eugen war der ältere der beiden Brüder, mittlerweile zweiundsiebzig. Carl Ludwig, Jacobs Vater, war zwei Jahre jünger. Sie waren beide Juristen, führten gemeinsam die Kanzlei und das Notariat, wie es zuvor auch ihr Vater getan hatte und wie man es in der Folge von Carl Jacob ebenfalls erwartet hatte.
Geheiratet hatte Onkel Carl Eugen, der Schwerenöter, nie, so blieb wenigstens von seiner Seite aus Familienanhang erspart. Trotzdem war die Verwandtschaft immer noch groß genug, und Madlon befürchtete, sie werde Jahre brauchen, bis sie sich darin auskannte.
Die Großeltern waren schon lange tot, an seine Großmutter hatte Jacob kaum mehr eine Erinnerung, sie starb, als er noch ein kleiner Junge war. Der Großvater dagegen wurde alt und überlebte sie um viele Jahre.
An das letzte längere Gespräch mit seinem Großvater erinnerte sich Jacob noch ganz genau. Es fand statt, als Jacob seine Dienstzeit beim 6. Badischen Infanterieregiment antreten musste. Für das Militär hatte die Familie im Ganzen nicht allzu viel übrig, abgesehen davon, dass Jacobs Schwestern gern mit den jungen Leutnants tanzten und dass Jacobs Tante Lydia mit einem Offizier verheiratet war. Der Großvater gab Jacob einige gute Ratschläge mit auf den Weg, dazu eine großzügige Summe, was erstaunlich war, denn im Allgemeinen war er sehr sparsam.
»Das Jahr geht schnell vorbei, Bub«, sagte er am Ende tröstend, aber der Trost wäre gar nicht nötig gewesen, denn Jacob gefiel es ausgezeichnet bei der Truppe, er blieb über das Einjährig-Freiwillige Jahr hinaus, wurde aktiv, was keiner in der Familie verstand, und später, als er sich zur Schutztruppe meldete, wurde es erst recht von jedermann missbilligt. Denn man erwartete von ihm, dass er studierte und in die Kanzlei eintrat. Was bewies, dass keiner in der Familie ein guter Menschenkenner war, noch beobachtet hatte, wie der Junge sich entwickelte. Tollkühn und abenteuerlustig war er immer gewesen, und wenn er etwas verabscheute, war es irgendeine Art von geistiger Arbeit, was sich während seiner Schulzeit bereits gezeigt hatte.
Eine Enttäuschung also für die Familie war dieser einzige Sohn, der in die Ferne entschwand und selten von den regelmäßig verkehrenden Postdampfern Gebrauch machte. Sehr spärlich gelangten Nachrichten von ihm nach Konstanz, und es stand auch nicht viel Gescheites in diesen Briefen, die er in seiner steilen Handschrift mühsam aufsetzte, weil er eigentlich nie wusste, was er denen zu Hause schreiben sollte. Sie hatten alle von ihm etwas erwartet, was er nicht gewollt hatte, und nun tat er, was ihm gefiel, und das verstanden sie sowieso nicht.
Nachdem der Großvater gestorben war, blieb seine Wohnung im Parterre des Hauses unberührt, nur Staub wurde dort täglich gewischt und im Frühjahr und Herbst die Fenster geputzt. Das besorgte Balthasar, der gleichzeitig Großvaters Kutscher und Diener gewesen war.
Diese Kunde übermittelte Tante Lydia, von der fast immer ein Brief dabei war, wenn ein Reichspostdampfer in Daressalam anlegte. Sie und ihr Mann mochten den Neffen, und da sie selbst keine Kinder hatten, nahmen sie regen Anteil an seinem Schicksal. Erst recht natürlich später, als der Krieg ausbrach und die Verbindung abriss. »Und ich habe ihr so selten geantwortet«, meinte Jacob reuevoll.
Madlon hörte sich all diese Erzählungen, die sie zum Teil schon kannte, geduldig an.
So viel Familie. Am meisten interessierte sie sich natürlich für Jacobs Schwestern, beide älter als er, die eine schon verheiratet, ehe er nach Afrika ging, die andere verlobt. Neidvoll dachte Madlon, dass sie sicher viele Kinder haben würden. Und weil das nun einmal ihr wunder Punkt war, dachte sie auch: Sie werden mich verachten, weil ich kinderlos bin. Kinderlos und sechs Jahre älter als er.
Sie beschloss im selben Augenblick zu lügen. Das war am letzten Tag der Fahrt.
Sie würde einfach erzählen, sie hätte zwei Kinder in ihrer ersten Ehe gehabt, und sie seien beide bei einem Buschbrand ums Leben gekommen. Als das Farmhaus abbrannte. So etwas hatte sie einmal miterlebt, im belgischen Kongo noch, als sie erst kurze Zeit dort lebte. Sie hörte die Frau noch schreien, sie schrie die ganze Nacht. Die anderen Frauen weinten, auch Madlon, und Père Jérôme, von der Missionsstation in der Nähe, war gekommen und hatte mit den Frauen gebetet. Als sie daran dachte, wurde die Geschichte so lebendig, als sei sie gestern passiert, und es gelang ihr ohne Mühe, sich in die Frau zu verwandeln, die ihre Kinder verloren hatte.
Das würde sie der Familie erzählen – keiner sollte ihr nachsagen, sie sei unfruchtbar. Und wenn Jacob sich wunderte über das ihm unbekannte Geschehen aus ihrem Leben, so würde sie einfach sagen, sie hätte nie darüber sprechen können.
Genau informiert war Madlon über die Qualitäten und den Eigensinn der Köchin Berta. Die Hausmädchen hießen Marie und Ida, der Kutscher Balthasar, Carl Eugens Diener Mucki. Nur über seine Mutter sprach Jacob während der ganzen Fahrt kein Wort, genauso wenig wie früher.
Und als Madlon ihn schließlich fragte, lautete seine Antwort: »Über Mutter kann man nichts erzählen. Sie ist ganz anders. Sie ist …«, er stockte, suchte nach den richtigen Worten … »sie ist ein sehr selbstständiger Mensch. Manche sagen, sie sei eine Egoistin. Das trifft es nicht. Sie ist nur nicht zu beeinflussen. Sie tut nur das, was sie will und was sie für richtig hält.« Und nach einem kurzen Schweigen fügte er hinzu, selbst erstaunt: »Sie ist eigentlich wie du.«
Madlon hörte das mit Unbehagen. Wenn das heißen sollte, dass seine Mutter stark und unabhängig war, eigenwillig wohl auch, genau wie Madlon, so ließ das Schwierigkeiten befürchten. Zwei starke Persönlichkeiten kamen selten gut miteinander aus.
Allerdings fiel es ihr schwer, Jacobs Worten zu glauben. Wo konnte es eine Parallele geben zwischen ihr, der heimatlosen Abenteuerin aus armseligen Verhältnissen stammend, und seiner Mutter, der wohlversorgten Frau mit Geld und Besitz, mit Haus und Hof, mit Mann und Kindern.
Was kann es für Ähnlichkeiten geben zwischen uns, dachte Madlon. Sie wird alt sein und dick und satt und wird auf mich herabblicken. Nichts, was ich sage oder tue, wird ihr gefallen. Kann ihr gar nicht gefallen, und das verstehe ich. Es würde mir auch nicht passen, wenn mein Sohn mit solch einer Frau nach Hause käme, mit einer Frau, die sechs Jahre älter ist und nicht einmal Kinder hat.
Nun waren sie angelangt, und Madlon wäre am liebsten auf der Stelle umgekehrt. Was für eine törichte Idee von ihr, ihm einzureden, er müsse nach Hause zurückkehren. Und wenn, dann hätte er allein fahren müssen. Dann hätte immer noch die Möglichkeit bestanden, dass er wieder zu ihr kam. Hier, das wusste sie auf einmal ganz sicher, hier würde sie ihn verlieren.
Als der Wagen auf die Rheinbrücke rollte, fuhr gleichzeitig mit ihnen ein Zug über die Brücke, ebenfalls nach Konstanz hinein. »Wie seltsam!«, rief sie ihm durch den Lärm hindurch zu. »Der Zug fährt über dieselbe Brücke wie wir.«
»Wir haben nur die eine. Was glaubst du, was sich schon abgespielt hat auf dieser Brücke. Die Pferde scheuen jedes Mal, wenn ein Zug kommt. Da – sieh da vorn. Fahr langsam. Da scheuen die beiden Braunen vor dem Fuhrwerk. Halt lieber an, uns entgegen kommt auch ein Gespann, Zug und Auto, das ist zu viel für ein normales Pferd. Wir haben uns als Kinder nie über die Brücke getraut, wenn gerade die Eisenbahn darüberfuhr.«
Das Auto scheute nicht, sie kamen glücklich über die Brücke, und Jacob wies nach links.
»Das alte Dominikanerkloster. Ein wunderschöner Bau. Jetzt ist ein Hotel darin. Und nun musst du nach rechts abbiegen.«
Am Münsterplatz hielten sie an und stiegen aus. Gleichzeitig schlug es vom Turm die zweite Stunde des Nachmittags.
Sie blickten beide hinauf zu dem seltsam geformten Turm, der eckig wirkte und den man, da man ihm offenbar die volle Höhe verwehrt hatte, mit vielen kleinen Türmchen und Spitzen versehen hatte.
»Ist er nicht originell?«, fragte Jacob. »Solch einen Turm wirst du bestimmt kein zweites Mal sehen.«
Madlon musste daran denken, dass seine Familie nicht einmal wusste, dass er verheiratet war. Warum hatte er es verschwiegen? Aus Feigheit? Weil er der Meinung war, sie sei nicht gut genug für seine Leute, und im Stillen hoffte, sie würden diese Frau, die er da aufgelesen hatte an einem feuchtfröhlichen Abend in Daressalam, nie zu Gesicht bekommen? Dass er eines Tages mit ihr in seine Heimatstadt kommen würde, war von ihm aus nie geplant gewesen. Also schämte er sich ihrer. Zorn und Schmerz stiegen gleichzeitig in ihr auf, und sie hatte Mühe, an sich zu halten und ihm nicht ins Gesicht zu schreien, was sie dachte.
Wenn sie überhaupt richtig verheiratet waren! Wer weiß, ob das hier galt. Eine rasche Zeremonie, von einem Missionar im Busch vorgenommen, kurz bevor ein Überfall sie aus dem Lager vertrieb. Der Missionar kam dabei ums Leben, ebenso Numbas Mann, und Madlon hatte das als böses Omen angesehen. Numba, ihr so treu ergeben, lag nachts weinend vor dem Zelt, in dem Madlon und Jacob schliefen.
»Früher haben wir hier auf dem Münsterplatz gewohnt. Da drüben, siehst du, in dem Haus. Jetzt ist nur noch die Kanzlei im ersten Stock, das übrige haben wir vermietet.«
Mit welcher Selbstverständlichkeit er auf einmal wir sagte.
»Lass uns mal schnell hinübergehen.«
Sie gingen an dem Haus vorbei, rasch, offenbar mochte er hier nicht stehen bleiben und gesehen werden. Nur das Schild fasste er ins Auge.
»Goltz, Goltz und Bornemann – wer ist das denn, Bornemann? Da haben sie doch wirklich einen Wildfremden in die Kanzlei aufgenommen. Wie findest du das denn?« Madlon ersparte sich die Antwort, sie kämpfte immer noch mit den Tränen und ihrer Wut.
»Na ja, mussten sie ja wohl. Vater und Onkel Eugen sind ja schon ziemlich alt. Ich bin geboren in diesem Haus, und ich habe meine Kindheit darin verbracht. Als wir hinunterzogen an den See, war ich schon fast vierzehn.« Er wandte sich und ging wieder auf das Münster zu.
»Das Münster hatte ich ständig vor Augen, seine Glockenschläge begleiteten jede Stunde meines Lebens. Ist es nicht ein schöner Bau? Stammt aus dem 11. Jahrhundert, wenn ich mich richtig erinnere. Vorher gab es natürlich auch schon eine Kirche hier, die alte eben. Und noch viel früher war es ein Römerkastell. So wie du das Münster hier vor dir siehst, ist immer wieder an ihm um- und angebaut worden. Du wirst sowohl romanische wie gotische Formen darin finden.«
Madlon sah nicht das Münster an, sondern ihren Mann. Groß und hager, das Gesicht gelblich getönt, die Augen leicht zusammengekniffen, starrte er zum Turm des Münsters hinauf.
Bisher hatte er ihr allein gehört, und nun würde sie ihn verlieren. Jetzt gehörte er dieser Stadt und dem Münster und der Familie und dem nebligen See und was sonst noch sein mochte, das sie nicht kannte und nie mit seinen Augen sehen konnte. Was für ihn ein Teil seines Lebens war, würde für sie nur wieder eine andere Fremde sein. Was konnte stärker sein als die Erinnerung an eine glückliche Kindheit? In so einem Haus wie dem da drüben aufzuwachsen, welch eine Geborgenheit musste das geben. Wenn sie nach Hause zurückkehrte, da gäbe es nur die Erinnerung an Schmutz und Armut und Prügel. In keinem Traum konnte sie nachempfinden, wie seine Kindheit gewesen war.
Ihr wurde warm, die Luft war weich und mild, in der Stadt war vom Nebel nichts zu bemerken. Sie knöpfte die Jacke ihres Tweedkostüms auf und bog den Kopf zurück, um gehorsam den Münsterturm zu betrachten. Doch seine Spitzen verschwammen, denn ihre Augen standen voll Tränen.
Ich werde dich verlieren. Du bist nicht mehr der Mann, der mir gehört. Ich habe dich schon verloren. Komm, lass uns wegfahren, damit du wieder mir gehörst. Damit du mich brauchst, wie nichts sonst auf der Welt. Weil niemand sonst auf der Welt da ist, der für dich sorgt, der für dich denkt und handelt, der dich liebt.
»Das größte Ereignis, das diese Stadt erlebte, war das Konzil. Du hast sicher vom Konstanzer Konzil gehört.«
»Nein«, sagte Madlon abweisend, »nicht dass ich wüsste.«
»Irgendwann bist du ja wohl mal in die Schule gegangen, oder?«, fragte er ungeduldig. »Und eine Katholikin bist du auch.«
Mit dem Zorn, der jetzt noch heftiger in ihr aufstieg, besiegte sie die Tränen. »Ich bin im Kohlenpott von Liège in die Schule gegangen. Drei Jahre lang, in eine Dorfschule, wenn du es genau wissen willst. Wir waren sehr arme Leute, und mit zehn Jahren musste ich schon mitverdienen. Habe ich dir das nicht erzählt? O doch, ich habe. In unserer Schule jedenfalls habe ich nichts von einem – wie heißt es? – Konzil gehört.«
Sie sprach das Wort französisch aus. Obwohl sie genauso gut Deutsch wie Englisch sprach, verfiel sie stets in den Tonfall ihrer Muttersprache, wenn sie ein Wort nicht kannte.
Er ließ sich nicht beirren. Alles, was er gelernt hatte, war nun wieder da.
»Das Konstanzer Konzil begann 1414 und dauerte vier Jahre. Die Einwohnerzahl von Konstanz betrug damals etwa 6000. Das war für die Begriffe jener Zeit eine höchst ansehnliche Stadt. Es wird berichtet, mehr als 60 000 Menschen hätten sich während des Konzils in der Stadt versammelt. Der Kaiser kam, viele Bischöfe und Herzöge und Fürsten. Auch einer von den Päpsten.«
»Und so einen Unsinn glaubst du?«, fragte sie verächtlich. »Wo sollen diese 60 000 denn gewohnt haben? Wer soll sie verpflegt haben? Und was heißt, einer von den Päpsten. Es gibt nur einen Papst.«
»O nein, mein kleines Dummerle. Es war nach dem Schisma, und es gab damals deren drei. Einen haben sie dann hier gefangen genommen, soweit ich mich erinnere. Wir haben das zwar gründlich in der Schule gepaukt, aber ich werde es zur Sicherheit noch einmal nachlesen und dir dann genau erklären. Jedenfalls war das Konzil ein weltgeschichtliches Ereignis. Außerdem war es …«
»Jacques«, unterbrach ihn Madlon mit Nachdruck, »ich denke, wir haben im Moment über wichtigere Dinge zu sprechen als über den alten Kram.«
»Johan Hus wurde damals hier verbrannt«, fuhr er beharrlich fort. »Du weißt natürlich nicht, wer das ist.«
»Nein, zum Teufel, ich weiß es nicht, und ich will es auch nicht wissen.«
»Er war gewissermaßen ein Vorläufer der Reformatoren, und er …«
»Jacques, lass uns wieder wegfahren.«
»Wegfahren? Was soll das heißen? Wohin?«
»Egal, wohin. Zurück nach Berlin.«
»Bist du verrückt?«
»Dann lass uns hier in ein Hotel gehen. Wir können sie doch nicht einfach so überfallen. Jahrelang lässt du nichts von dir hören, und plötzlich stehst du vor der Tür. Das … das ist barbarisch. Deine Eltern sind alt, sie könnten tot umfallen.«
Er starrte sie eine Weile stumm an, und in seinen Augen, grau wie der Himmel, lag eine Kälte, die sie nie darin gesehen hatte. »Es war deine Idee hierherzufahren.«
»Wenn wir sie wenigstens vorher anrufen könnten«, sagte sie verzweifelt.
»Gut, rufen wir an.«
»Meinst du, sie haben Telefon?«
»Mein liebes Kind, wir haben schon Telefon gehabt, als ich noch ein kleiner Bub war.«
Sie ergab sich in ihr Schicksal.
»Also gut.«
Eine halbe Stunde später fuhren sie zurück über die Brücke, bogen nach rechts ab und hielten vor einem der Häuser in der Seestraße. Anfang des Jahrhunderts waren diese feudalen Häuser erbaut worden, mit Front zur Konstanzer Bucht, mit dem Blick auf die Insel, auf Stadt und Münster, und weiter auf das Schweizer Ufer. Eines dieser Häuser hatte Jacobs Großvater erworben, und vornehmer konnte man zu jener Zeit in dieser Stadt nicht wohnen.
Madlon schwieg eingeschüchtert, als sie aus dem Wagen stieg, und seufzte, als sie an der verspielten Jugendstilfassade emporblickte. Es erschien unvorstellbar, dass sie jemals in diesem Haus wohnen würde.
Noch während sie die Stufen hinaufstiegen, die zur Haustür führten, wurde die Tür weit geöffnet, eine kleine, alte Frau im schwarzen Kleid stand auf der Schwelle. Ihre Augen schwammen in Tränen.
»’s Jacöbele! ’s Jacöbele!«, stammelte sie, und dann, mit einem tiefen Knicks, der ein wenig missglückte, denn ihre Knie waren nicht mehr die gelenkigsten, fügte sie feierlich hinzu: »Der Herr Jacob!«
Madlon musste laut herauslachen, und zum Teil geschah es aus reiner Nervosität, doch dieses unpassende Lachen trug ihr vom ersten Augenblick an die Abneigung Bertas ein.
Jacob legte beide Arme um die kleine Frau, beugte sich herab und küsste sie auf die Backe. Auch er war gerührt und bewegt.
»Berta! Meine gute Berta!«
Es war Heimkehr und Begrüßung, wie man sich so etwas vorstellte nach fünfzehn Jahren Abwesenheit.
Das war aber auch schon alles, was in dieser Art geboten wurde. Jacobs Vater, der beim Nachmittagskaffee saß, war weder gerührt noch bewegt, es schien, als fühle er sich eher belästigt, dass das ruhige Gleichmaß seiner Tage eine Störung erfuhr. Auch wenn ihm das Telefonat ein wenig Zeit gegeben hatte, sich auf die Heimkehr seines Sohnes einzustellen. Er stand auf, trat seinem Sohn zwei Schritte entgegen und sagte, nicht eben geistreich: »Nun also! Da bist du ja.« Und, über die Schulter zurückgewandt, zu dem anderen alten Herrn, der sich gerade eine Zigarre angezündet hatte: »Da ist er.«
»Ich sehe es«, erwiderte Carl Eugen, der sofort nach dem Anruf benachrichtigt worden und heraufgekommen war, um seinem Bruder zur Seite zu stehen. Zwar war Carl Eugen Goltz der ältere der beiden Brüder, doch er erschien um vieles rüstiger und kräftiger als Carl Ludwig Goltz.
Nun legte er die angerauchte Zigarre auf einen großen Zinnaschenbecher, blickte von Jacob zu Madlon und sagte: »Und etwas Hübsches hat er uns mitgebracht.«
»Das ist Madeleine, meine Frau«, sagte Jacob.
So undramatisch verlief die Rückkehr Carl Jacobs in sein Vaterhaus.
Eine Weile verharrten sie alle vier bewegungslos, es gab kein weiteres Wort, keine Umarmung, sie waren wie Schauspieler, die auf ihr Stichwort warteten. Nur Berta, die auf der Schwelle stand, schniefte und wischte sich die Tränen von den Backen.
Auch Madlon rührte sich nicht, auch ihr fielen kein Wort, keine Geste ein, die der Situation angemessen gewesen wären. Carl Eugen fasste sich als Erster.
»Deine Frau, mein Junge? Was für eine reizende Überraschung! Enchanté, madame. Höchst erfreut, Sie zu sehen.« Er trat zu Madlon, machte einen Diener, nahm ihre Hand, die sie ihm schüchtern entgegenstreckte, und führte sie an die Lippen.
»Sei Frau?«, echote Berta von der Tür her, und es klang keineswegs entzückt.
Carl Ludwig scheuchte sie mit einer unwirschen Handbewegung fort.
»Es fehlen zwei Kaffeetassen, Berta«, sagte er, schärfer, als es sonst seine Art war. Dann neigte er kurz den Kopf in Richtung Madlon und kniff die Augen hinter der goldgeränderten Brille ein wenig zusammen. Das kam Madlon bekannt vor. Das tat Jacob auch, wenn er sich unsicher fühlte.
Sie lächelte, wagte aber nicht, ihm ebenfalls die Hand hinzustrecken.
»Willkommen also denn!«, sagte Carl Ludwig abschließend und setzte sich wieder. »Nehmt doch Platz!«
Seine Hand wies auf die beiden geblümten Sessel, die noch um den runden Kaffeetisch standen. Er hatte sich gefasst, die Störung, wenn auch widerwillig, akzeptiert.
Frischer Kaffee kam in einer großen Kanne, vom Gugelhupf wurden weitere Stücke abgeschnitten, Berta überwachte das Dienstmädchen, das die Tassen und Teller auf den Tisch stellte. Es war weder Marie noch Ida, es gab sie beide nicht mehr im Haus, so wenig wie den Kutscher Balthasar. Nur Berta war geblieben und würde bleiben, solange sie stehen und gehen und einen Kochlöffel in die Hand nehmen konnte. Sie war auch nicht mehr nur die Köchin im Haus, sie führte praktisch den Haushalt.
Ein wenig mühsam kam die Konversation in Gang, und ohne Carl Eugen wäre es zweifellos noch mühsamer gewesen. Jacobs Vater war nie sehr gesprächig gewesen, ein stiller Mann, der gern für sich lebte, zwar ordentlich und gewissenhaft seine Arbeit tat, doch von der Familie möglichst nicht allzu sehr behelligt sein mochte.
Das alles war Jacob gleich wieder gegenwärtig, als er seinem Vater gegenübersaß. Als heranwachsender Bub, wenn er Probleme hatte oder Rat brauchte, hatte er sich stets an seinen Onkel gewandt. Auch an seinen Großvater, der ein lebensfroher, heiterer Mensch war, allerdings auch ärgerlich, sogar sehr zornig werden konnte, wenn es Anlass zu Verdruss gab. Jacob gab diesen Anlass öfter; seine Leistungen in der Schule waren bescheiden, seine Streiche und Ungezogenheiten dagegen oft beachtlich. Es war sein Onkel, dem er beichtete, wenn es gar nicht mehr anders ging, und dem es oft gelang, einen Eklat zu vermeiden.
Sein Vater redete außerhalb seines Berufslebens eigentlich nur über die Vögel. Er war durch eigene Beobachtungen und eigene Studien zu einem Ornithologen von Rang geworden. Sein Interesse galt allem, was auf und um und über dem See flog und schwamm, und am liebsten saß er im Wollmatinger Ried und beobachtete das Leben der Tiere.
»Sie sind Französin, Madame?«, fragte Carl Eugen hoffnungsvoll, denn wenn auch die Zeit seiner Pariser Reisen lange vorbei war, seine Liebe zu Frankreich und zu den Pariserinnen war geblieben, daran hatte der Krieg nichts geändert.
»Belgierin«, erwiderte Madlon. »Wallonin, um genau zu sein.«
»Interessant«, meinte Carl Eugen und ließ den Blick dezent über Madlons wohlgeformte Beine schweifen, die sie übereinandergeschlagen hatte.
Zweifellos ein Fortschritt der modernen Zeit, dass man die Beine der Frauen sah, so mochte er denken, wenn es auch früher seine Reize gehabt hatte, einen flüchtigen Blick auf schmale Knöchel unter einem langen Rock zu erhaschen. Abgesehen von den Pariser Cabarets, wo es auch zu seiner Zeit schon mehr zu sehen gab.
Er sammelte seine Gedanken, die ihm jetzt manchmal ein wenig durcheinandergerieten.
»Aus Brüssel?«
»Aus Liège. Lüttich, wie man hier sagt.«
Der Name weckte unangenehme Erinnerungen an den Beginn des Krieges, allerdings nicht in Madlon, die damals schon längst im Kongo lebte.
Madlon, die seinen Blick wohl bemerkt hatte, nahm einen Schluck Kaffee, den Kuchen hatte sie nicht angerührt, ein weiterer Grund, sich bei Berta unbeliebt zu machen.
Dann zog sie ihr Etui aus der Tasche und steckte eine Zigarette zwischen die Lippen. Jacobs missbilligender Blick entging ihr nicht, aber es störte sie nicht. Familie hin oder her, sie würde sich auch in diesem ehrwürdigen Haus nicht von ihren Gewohnheiten abbringen lassen. Soweit hatte sie sich wieder gefangen.
Carl Eugen stand auf und reichte ihr Feuer.
»Ich wollte Sie gerade fragen, Madame, ob es Sie stört, wenn ich rauche. Aber da Sie selbst rauchen …« Erleichtert setzte er seine Zigarre wieder in Brand.
Madlon schenkte ihm ihr strahlendes Lächeln, jenes wohlgeübte Lächeln, dem kein Mann widerstand. Und dieser hier war ein Mann, auch wenn er ein alter Mann war, das hatte sie schon erkannt.
»Ich habe es mir im Krieg angewöhnt. Es beruhigt die Nerven, wenn einem die Kugeln um die Ohren fliegen.«
»Sie waren ebenfalls in … eh, in Afrika?«, schwang sich nun Carl Ludwig zu einer Frage auf.
»Früher noch als Jacob. Ich war zuerst im Kongo. Ich kam schon als junges Mädchen hin. Mit meinem ersten Mann.« Besser, wenn sie gleich Bescheid wussten. »Mein Mann starb an Fleckfieber. Und meine Kinder kamen bei einem Buschbrand um, der unser Farmhaus total zerstörte. Um diesen schrecklichen Erinnerungen aus dem Weg zu gehen, wechselte ich dann hinüber nach Deutsch-Ost.« So, nun hatte sie ihre Geschichte gleich angebracht. Sie vermied Jacobs erstaunten Blick, der bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal von diesen Kindern hörte.
»Wie fürchterlich!«, murmelte Carl Ludwig, und Carl Eugen meinte: »Sie haben Schweres durchgemacht, Madame.«
»Nun, das war noch nicht alles«, erzählte Madlon weiter, die sich zunehmend sicherer fühlte. »Dann kam der Krieg. Vier Jahre lang haben wir Seite an Seite gekämpft, Jacob und ich. Wir sind nicht nur Mann und Frau, sondern auch Kriegskameraden. Und es war ein übler Krieg, meine Herren.«
Das klang nun ein wenig pathetisch, und Jacob zog peinlich berührt die Brauen zusammen. Er kannte Madlons Neigung, von ihren gemeinsamen Heldentaten zu berichten, dabei gelegentlich ein wenig zu übertreiben, und vor allem das Elend und den Schmutz nicht zu verschweigen, in dem sie oftmals gesteckt hatten.
Madlon jedoch konnte mit der Wirkung ihrer Worte zufrieden sein. Die beiden alten Herren betrachteten sie mit einer Mischung aus Staunen, Respekt und Entsetzen.
»Sie wollen doch wohl nicht sagen, Madame, dass Sie mit dieser schönen, zarten Hand ein Gewehr abgefeuert haben?«, fragte Carl Eugen.
»Aber gewiss habe ich das. Bien sûr, monsieur. Und auch getroffen. Ich habe viele Menschen getötet. Um nicht selbst getötet zu werden. Und daran hat oft nicht viel gefehlt. Aber ich habe Glück gehabt. Sehen Sie«, sie streifte die Kostümjacke ab und rollte den Ärmel ihrer Bluse hoch. »Nur ein Streifschuss, das war alles, was ich abbekommen habe.«
Die Narbe an ihrem Oberarm war deutlich zu sehen, und die beiden alten Herren beugten sich vor, betrachteten mit sichtlichem Schauder Madlons schlanken Arm, der noch immer von der Sonne Afrikas leicht gebräunt war.
Sie blickte Jacob herausfordernd an, und nun grinste er. Er hatte begriffen. Sie würde nicht das brave Hausmütterchen spielen, niemals, hier nicht und nirgendwo auf der Welt.
»Madlon war ein tapferer Soldat«, sagte er dann. »Lettow-Vorbeck hat oft gesagt, einer der tapfersten, den er je gekannt hat. Und es ging ja nicht nur ums Schießen, wisst ihr. Es wurde marschiert und geritten, oft unter schwierigsten Bedingungen. Durch den Urwald, durch die Sümpfe, durch den Busch. Wir haben gehungert. Wir haben gefroren und geschwitzt. Es war ein Kampf, der keine Pause kannte. Ein Kampf, in dem wir nicht besiegt wurden. Und in dem uns dennoch der Sieg nicht vergönnt war.«
Jetzt wurde er pathetisch, und Madlon lächelte spöttisch. Aber sie hatte ihn auf ihrer Seite, wieder und aufs Neue.
»Genug davon, würde ich sagen«, sie fand den leichten Plauderton wieder. »Wir wollen die schwere Zeit vergessen. Und ich nehme an, dass Sie auch hier wissen, was in Afrika geschehen ist. Lettow-Vorbeck hat ja einige Bücher geschrieben, die viel gelesen wurden. Übrigens hat auch Jacob in einer Berliner Zeitung über unsere Kämpfe geschrieben.«
»Ah ja?«, machte sein Vater höflich. »Davon wussten wir nichts. Ich hätte es gern gelesen.«
»Es wäre nicht der Mühe wert. Ich bin kein großes Schreibtalent, Vater. Du erinnerst dich sicher noch an meine kümmerlichen Schulaufsätze. Lies lieber, was der General geschrieben hat, da bist du besser informiert.«
»Ich habe seine Erinnerungen aus Ostafrika gelesen«, bekannte Carl Eugen. »Höchst interessant. Und dann kenne ich noch ein Buch von ihm, es ist mehr für die Jugend geschrieben. Es nennt sich Heia Safari. Ich würde sagen, es glorifiziert den Krieg ein wenig zu sehr. Dein Neffe, Agathes Ältester, hat es verschlungen. Er wird dir sicher viele Fragen stellen. Der unbekannte Onkel, der so große Heldentaten vollbracht hat, hat ihn immer schon sehr interessiert.«
Jacob lachte. »Seltsam, dass ich auf einmal ein Onkel bin.«
»Mehrfach, mein Lieber, mehrfach. Agathe hat drei Kinder und Imma zwei.«
Eine Zeit lang wurde nun über die Familie gesprochen, über diesen und jenen, Madlon hörte nur mit halbem Ohr zu, sie würde sie ja sowieso alle kennenlernen. Es fielen eine Menge Namen, Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, doch Madlon wartete immer noch auf einen bestimmten Namen, der jedoch nicht erwähnt wurde. Wo eigentlich war Jacobs Mutter?
Dann wurde lange über die Veränderungen gesprochen, die im Haus eingetreten waren. Das geschah, nachdem die Herren übereinstimmend beschlossen hatten, heute ihre Kanzlei nicht mehr aufzusuchen. Bernhard, so hieß es, würde sicher sehr gut allein mit allem fertig.
Bernhard war Immas Mann, und Carl Ludwig betonte mehrmals, wie glücklich man darüber sein konnte, dass Imma so vernünftig gewesen sei, einen Juristen zu heiraten. So blieben die Familientradition und der Stadt die Kanzlei und das Notariat Goltz und Söhne erhalten.
»Eine Vernunftheirat?«, fragte Jacob schließlich, nachdem das Wort vernünftig zum dritten Mal gefallen war.
»Als du damals fortgingst«, sagte sein Vater, »war sie mit einem anderen verlobt. Das musst du doch noch wissen, ein junger Leutnant, ein Kamerad aus deinem Regiment. Weißt du das nicht mehr?«
»Ja doch, natürlich. Und was geschah mit ihm und der Verlobung?«
»Nun, es gab einigen Ärger. Der junge Mann hatte Spielschulden, sonst noch einige Affären, die man nicht hinnehmen konnte. Frauengeschichten, du verstehst? Imma war eine Zeit lang sehr traurig, aber sie sah später ein, dass wir recht gehabt hatten, die Lösung der Verlobung von ihr zu fordern. Einige Jahre darauf hat sie Bernhard Bornemann geheiratet. Es ist eine gute Ehe geworden, nicht wahr, Eugen?«
Carl Eugen hob die Schultern. »Na ja, gewiss doch. Eine Ehe halt.«
Im Haus hatte sich die Einteilung ebenfalls geändert. Man hatte endlich Großvaters Wohnung, die so lange unberührtes Heiligtum geblieben war, wieder in Betrieb genommen. Carl Eugen wohnte nun mit seinem Diener darin. Den ersten Stock, in dem sie sich befanden, bewohnten Jona und Carl Ludwig. Der zweite Stock schien mehr oder weniger unbewohnt. Agathe und ihr Mann hatten mit den Kindern den zweiten und dritten Stock bewohnt, bevor sie sich ein eigenes Haus bauten. Imma und Bernhard dagegen wohnten im alten Haus am Münsterplatz.
»Praktisch seit sie verheiratet sind. Wir haben allen Mietern gekündigt. Bernhard wollte es so. Er ist immens fleißig«, erzählte Onkel Eugen. »Er ist mehr mit der Kanzlei verheiratet als mit Imma.«
»Aber Eugen«, widersprach Ludwig, »so kann man das nicht nennen.«
»Ich nenne es so. Und es ist doch gut für die Kanzlei. Oder etwa nicht?«
»Berta richtet oben alles für euch her«, lenkte Carl Ludwig ab. »Ich hoffe, ihr werdet eine Weile hierbleiben.«
»Ja, sicher«, sagte Jacob und streifte Madlon mit einem raschen Blick. Sie lächelte.
»Ich möchte gern für eine Weile hierbleiben«, sagte sie herzlich. »Jacob hat mir so viel von allem hier erzählt. Wie schön der See ist und das Land ringsum. Ich möchte es gern kennenlernen.«
»Nun, es ist gerade keine sehr gute Zeit dafür«, sagte Carl Ludwig, und sein Blick ruhte mit ausgesprochener Freundlichkeit auf der neuen Schwiegertochter. »Wir haben meist Nebel um diese Jahreszeit. Der Frühling, der Sommer, und vor allem der Herbst, das ist die rechte Zeit, sich hier umzuschauen.«
Auf Frühling, Sommer und Herbst ging Jacob nicht näher ein, er sagte nur: »Wenn also Platz genug ist im Haus, dann bleiben wir gern.«
»Platz, soviel du willst, mein Sohn.«
Madlon liebkoste mit den Blicken das glänzende Holz der Biedermeiermöbel, mit denen das Zimmer eingerichtet war, in dem sie saßen. Ihre letzte Bleibe, das kahle Pensionszimmer in Berlin, war so hässlich gewesen.
Und die Wanzen, dachte sie mit plötzlichem Schreck, hoffentlich haben wir keine Wanzen mitgebracht. Ich muss jedes Stück einzeln in die Hand nehmen, wenn ich auspacke.
Nun kam endlich die Frage, auf die sie den ganzen Nachmittag gewartet hatte. »Wo ist Mutter?«
»Drüben.«