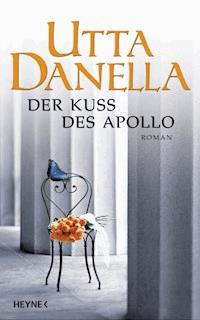6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In den 60er-Jahren, nahe München. In dem rustikalen Waldhaus im Voralpenland verbrachte Adolf Schmitt, genannt Dodo, mit Frau und Tochter glückliche Jahre. Der mäßig erfolgreiche Schriftsteller liebt das einfache Leben mit seinem Hund Dorian und der kapriziösen Stute Isabel, die bei alten Freunden auf dem nahe gelegenen Bauernhof untergebracht ist. Doch dann verlässt die schöne Rosalind ihren Mann nach 14 Jahren Ehe: Sie wünschte sich schon lange ein luxuriöseres Leben und hat nun den passenden Mann dazu gefunden. Der etwas weltfremde Dodo bleibt einsam und verloren zurück, bis er eines Tages Steffi kennenlernt. Sie ist jung, voller Leben, erfrischend und praktisch veranlagt. Die beiden kommen sich langsam näher. Doch der Sommer wird turbulent in dem sonst so ruhigen kleinen Waldhaus: Ständig tauchen unerwartet Besucher auf und stiften gehörig Unruhe …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Utta Danella
Der Sommer des glücklichen Narren
Roman
hockebooks
Besuchen Sie uns im Internet: www.hockebooks.de
Utta Danella: Der Sommer des glücklichen Narren. Roman
Copyright ©2016 by Erbengemeinschaft Utta Danella vertreten durch AVA international GmbH, Germany
Die Originalausgabe ist 1963 im Schneekluth Verlag, Darmstadt erschienen.
Überarbeitete Neuausgabe ©2020 by hockebooks gmbh
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Erlaubnis des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: Joachim Luetke (www.luetke.com) unter Verwendung eines Motivs von Sara Borbala Balogh/shutterstock.com
ISBN: 978-3-957-51357-1
www.ava-international.de
www.uttadanella.de
Das ist eine Einleitung
»Na ja«, sagt Florian und blickt mit dem kühlen Blick des Weltmanns in die Runde, »so was is Geschmacksache. Ihr steht eben auf so was.« Immerhin hat er sich die Haare schneiden lassen zur Feier des Tages und das neue blaue Samtjackett angezogen, das er bisher als »zu affig« abgelehnt hat.
Sein Bruder Sebastian, zwei Jahre jünger, was bedeutet, dass er zwölf ist, lässt sich leichter beeindrucken. Außerdem widerspricht er seinem Bruder, wann immer es möglich ist. Darum erklärt er: »Ich find’s echt klasse. Schnieker Laden.« So weit die Jugend. Meine Tochter Lix, weit gereist und welterfahren, Fernsehreporterin, lächelt mir zu. Für sie ist es eine Selbstverständlichkeit, in einem Luxusrestaurant zu speisen, sie hat die Sicherheit der erfolgreichen jungen Frau von heute. Obendrein hat sie seit einiger Zeit auch einen Ehemann, Dr. phil., Richard mit Namen, von ihr Ricky genannt. Ich kann ihn ganz gut leiden, nachdem ich mich an ihn gewöhnt habe. Man muss sich ja überhaupt erst mal an die Tatsache gewöhnen, Schwiegervater zu sein. Soweit ich es beurteilen kann, kommen die zwei gut miteinander aus. So direkt erfährt man ja von jungen Leuten nicht viel. »Wie ist denn das nun so«, habe ich Lix kürzlich mal gefragt, »mit euch beiden? Seid ihr glücklich? Ist er der Richtige?«
»Gott, Paps, du stellst Fragen! Der Richtige – aus welcher Gartenlaube hast du das denn?«
Es war mir sehr peinlich. »Ich meine ja nur. Geht mich ja nichts an.«
Lix lächelte verzeihend. »Ricky ist okay«, sagte sie dann gelassen. »Man wird sehen, wie er sich so macht mit der Zeit. Sonst wird er ausgetauscht.«
Emanzipation, nicht wahr? Man weiß Bescheid, auch wenn man schon so ein alter Trottel ist wie ich. Bei mir musste es immer Liebe sein.
Sie braucht nicht unbedingt einen Mann. Geld verdient sie selber. Abwechslung hat sie auch ohne ihn, und Männer hat es in ihrem Leben auch immer gegeben. Einzelheiten darüber weiß ich nicht. Ich werde mich hüten und allzu oft dumme Fragen stellen. Ich bin nur der Vater.
Jetzt hat sie also mal geheiratet, und Ricky ist okay. Man wird sehen, was daraus wird.
Mir gegenüber sitzt Rosalind.
Vielleicht sollte ich aber erst einmal berichten, wo wir eigentlich sitzen und wie es zu diesem Auftrieb kommt. Wir sind beim Humplmayr.
Für den Fall, ein Mensch ist aus München, muss man nun weiter nichts erklären. Für den Fall, ein Mensch hat das Pech, nicht aus München zu sein, sei ihm mitgeteilt, dass Humplmayr eins der feinsten Restaurants von München ist. Ein Nobelrestaurant, wie man heute sagt.
Und noch dazu eins, das es schon immer gibt. Das ist das Seltene daran. Denn wir haben natürlich in München eine ganze Menge guter, bester und auch teurer Lokale, gelegentlich kommt ein neues dazu, dann wieder verschwindet eins, irgendeins ist immer besonders »in«, da will dann unbedingt jeder dort essen, und man muss tagelang vorher einen Tisch bestellen. Manchmal ist das nur ein kurzer modischer Höhepunkt, und das Restaurant ist genauso plötzlich, wie es »in« wurde, wieder »out«.
Humplmayr, wie gesagt, hat es immer gegeben und gibt es noch. Ich, der ich ein echter Münchner bin, was eine ziemlich seltene Spezies Mensch geworden ist, weiß, dass es den Humplmayr schon gegeben hat, als ich ein kleiner Bub war. Gegessen haben wir natürlich dort nie, wir waren einfache Bürger und kamen gar nicht auf die Idee, in ein so feines Restaurant zu gehen. Als ich erwachsen war, kam ich auch nicht auf die Idee, ganz einfach darum, weil ich das Geld dazu nicht hatte.
Wer auf solche Ideen kam, war Rosalind. Zwar ist sie auch nicht in einer Millionärsfamilie groß geworden, aber bei ihr ist das eben so. Sie war immer süchtig nach Luxus. Nach jeder Art von Luxus.
Als wir jung verheiratet waren, hatten wir gar kein Geld. Nachkriegszeit und so. Die Zeiten wurden besser und besser, die Zeiten wurden großartig, das Wirtschaftswunder brach über uns herein und bescherte uns ein Schlaraffenland ohnegleichen, wie es das nie zuvor in diesem Land gegeben hat und vielleicht auch nie wieder geben wird.
Bloß, ich, Depp, der ich bin, nahm am Wirtschaftswunder nicht teil. Wieso und warum, werde ich später noch erklären.
Jedes Mal aber, wenn uns der Weg über den Maximiliansplatz führte, blieb Rosalind vor der vornehmen Humplmayr-Holztür stehen und seufzte sehnsüchtig: »Hierher möchte ich für mein Leben gern mal essen gehen.«
Was macht ein Mann, der eine Frau so liebt, wie ich Rosalind liebte, und zudem noch ständig ein schlechtes Gewissen hat, weil er einer so bildhübschen Frau fast keinen ihrer Wünsche erfüllen kann? Er überlegt, rechnet, spart und sagt eines Tages: »Weißt du was, Liebling? Heute Abend gehen wir mal zum Abendessen zu Humplmayr.«
Ein Jubelschrei, ein Kuss, verzweifelter Blick in den Kleiderschrank, Friseur.
So war das damals vor … vor … Zeit, du gefräßiges Ungeheuer, wie lange ist das her? Zweiundzwanzig, dreiundzwanzig Jahre etwa würde ich schätzen.
Rosalind, die es auch nicht gewohnt war, Luxusrestaurants zu besuchen, machte ihre Sache gut. Frauen haben ja dafür ein angeborenes Talent. Anmutig schritt sie hinter dem Oberkellner her, setzte sich auf den zurechtgerückten Stuhl – damals sah das hier ein bisschen anders aus, ein paar Mal haben sie natürlich inzwischen umgebaut und umdekoriert, aber ein sehr vornehmes Lokal war es immer –, sie sah sich mit glänzenden Augen um, strich eine dunkle Locke zurecht und vertiefte sich in die Speisekarte. Das tat ich auch, und zwar tat ich es zunächst auf der rechten Seite. Gott steh mir bei! Ich überzählte im Geist nochmals meine Barschaft, aber dann dachte ich: Sei’s drum! Einmal ist keinmal. Und wenn ich alles ausgebe bis zum letzten Pfennig.
So schlimm war’s dann gar nicht. Gemessen an heutigen Preisen – du lieber Himmel!
Wir suchten beide nicht das Teuerste aus, weder Austern noch Hummer, wir hätten gar nicht gewusst, wie man damit umgehen soll. Aber ich weiß noch, dass es uns großartig geschmeckt hat und dass wir beide hochbefriedigt waren. Der Unterschied zwischen uns beiden bestand darin, dass ich ohne Luxuslokale leben konnte. Rosalind nicht. Aber davon später.
Ob sie wohl noch daran denkt?
Ich schaue sie an, und sie gefällt mir immer noch. Es liegen eine ganze Reihe von Jahren zwischen jenem und dem heutigen Abendessen, und Rosalind ist nun immerhin auch schon – o nein, Schweigen. Einer Frau soll man ihr Alter nie nachrechnen, das ist die unfeinste aller unfeinen Taten, außerdem, und das ist die reine Wahrheit, sieht sie wundervoll aus. Ihr Make-up ist vollendet, das Haar hat einen leichten Kupferschimmer jetzt, was ihr gut steht, das Kleid, das sie trägt, ist weit und breit das eleganteste. An ihrer Hand blitzt es, an ihrem Hals auch, und es blitzt echt. Zwölf Austern verspeist sie jetzt im Handumdrehen, und nun … nun treffen sich unsere Blicke.
Was denkt sie? Ähnliches wie ich? Oder denkt sie gar nicht mehr daran?
Ein kleines Lächeln in ihrem Mundwinkel, sie lässt den Blick über die Tischrunde gleiten, lächelt etwas ausdrucksvoller meinem Verleger zu, er hebt sein Glas, sie nimmt das ihre, sie trinken beide. Ich weiß, dass er eine Schwäche für sie hat, aber welcher Mann wäre ihr gegenüber je gleichgültig geblieben?
Jetzt sieht sie mich wieder an.
»Ein schnieker Laden, Sebastian hat recht. Ist immer noch hübsch hier«, sagt sie. »Weißt du noch, wie wir das erste Mal hier waren?«
Sie erinnert sich also doch. Das freut mich, das freut mich unheimlich. (Unheimlich ist ein Lieblingswort von Florian.)
Sie erzählt der Tischrunde von unserem ersten Ausflug in die Welt der feinen Leute, sie tut das sehr hübsch, mit kleinen Pointen, mit etwas Ironie, und berichtet auch noch, dass ich ihr im Verlauf des Abends drei Rosen kaufte, als die Blumenfrau durch das Lokal kam. Sieh mal an, das hätte ich gar nicht mehr gewusst.
»Drei Rosen«, staune ich. »Ich muss mir vorgekommen sein wie Gunter Sachs.«
Meine Söhne gackern, und ich sehe, wie Muni lächelt. Ein wenig wehmütig, aber nicht ohne Stolz. Sie ist mit dem Ablauf meines Lebens, so wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ganz zufrieden.
»Lümmel dich nicht so«, sagt sie dann streng über den Tisch hinweg zu ihrem Enkelsohn Florian.
Worauf das blaue Samtjackett sich ordentlich hinsetzt und die Ellbogen vom Tisch nimmt.
O nein, auch als Oma ist Muni kein sanftes Lämmchen. Die Buben kriegen nichts anderes zu hören, als ich zu meiner Zeit zu hören bekam. Und bei gegebenem Anlass auch heute noch zu hören bekomme.
Auch über Munis Alter wollen wir nicht reden, auch sie ist eine Frau. Sie ist gesund, Gott sei gedankt, bisschen Arthritis im Knie, bisschen schwerhörig, was sie ärgert und was sie kaschiert, so gut es geht.
»Nuschel nicht«, sagt sie zu mir, wenn sie mich nicht verstanden hat, und ich habe mir in den letzten Jahren zu meinem sowieso sonoren Bariton noch eine erstklassige Artikulation angewöhnt.
Ihre Augen sind klar, ihr Haar ist weiß, sie färbt es nicht, aber sie war heute beim Friseur und sieht ausgesprochen wohlsituiert aus in ihrem hellgrauen Seidenkleid, das um den Hals eine feudale Perlenstickerei aufweist.
Um nun endlich die Tischrunde vollständig vorzustellen und auch den Anlass dieser festlichen Zusammenkunft zu verkünden, fahre ich fort und berichte …
Doch da unterbricht mich mein Verleger.
»Mein lieber Freund«, sagt er, damit meint er mich, woraus jeder entnehmen kann, dass ich kein ganz erfolgloser Schriftsteller bin, »mein lieber Freund, ich finde es so schön, dass wir die ganze Familie hier versammelt haben, um ein bisschen zu feiern. So ein reizendes Familienleben haben nicht alle meine Autoren aufzuweisen.«
Ich muss grinsen.
»Was ein Glück für dich ist«, sage ich. »Das wäre ein teurer Spaß, wenn jeder Autor so viel Familie auf die Beine brächte.«
Denn natürlich muss der Verleger das alles bezahlen. Das ist so der Brauch, wenn Verleger mit Autoren essen gehen, das gehört zu ihrem Geschäft.
Seine Frau, die rechts von mir sitzt, lacht.
»Da ist was dran«, sagt sie.
Ich warte eine Weile ab, ob der Verleger eine Rede halten will, ist aber nicht der Fall, war nur eine Bemerkung. Rede kommt später. Ich werde auch eine halten. Nach dem Dessert. Vor dem Dessert. Mal sehen.
Aber um noch mal darauf zurückzukommen, was wir hier feiern mit Kind und Kegel, Frauen, Mutter und sonstigem Zubehör, ist Folgendes …
Nein, so geht es nicht.
Ich bin kein richtig moderner Autor und bin es gewohnt, eine Geschichte von vorn zu beginnen.
Nicht ganz von vorn, nicht direkt bei meiner Geburt, keine Bange. Aber gehen wir ein paar Jahre zurück, fünfzehn, siebzehn Jahre etwa? Ja?
Das war ein Tag im Mai. Hier in München. Eine schöne Zeit war das. In Bonn regierte noch der Adenauer, das Wirtschaftswunder stand in voller Blüte, es gab nicht so viel Fernsehen, dafür aber noch hübsche Filme, die Röcke der Damen waren nicht zu kurz und nicht zu lang, so gerade richtig, wie ich es gern habe, die jungen Leute hatten keine langen Haare und machten keine Demonstrationen, richtig unzufrieden war eigentlich niemand, denn sooo lange lag der Krieg auch nicht zurück, dass man nicht gewusst hätte, wie mies das Leben sein kann, wenn es wirklich mies ist, es gab keine Terroristen, keiner wurde entführt, Banken nur von echten Bankräubern sehr selten beraubt, Menschenleben wurden irgendwie wichtig genommen, Leute einfach niederschlagen, niederschießen, kaputt machen war absolut nicht Mode, und wenn es mal vorkam, wurde es bestraft, Rauschgift kam nur in Kriminalfilmen vor, aus den Illustrierten sprangen einem noch nicht die nackten Busen und Popos mitten ins Gesicht, was ein Grund war, sich privat mehr für einen hübschen Busen und einen runden Popo zu interessieren, es gab keinen Wohlstandsekel, keine Untergangsstimmung, keinen Leistungszwang, es gab eben geradeso viel Neid, Bösartigkeit und Gehässigkeit, wie sie Menschen zu allen Zeiten füreinander empfinden, aber es hielt sich in normalen Maßen – kurz und gut, es war so eine richtig gute alte Zeit. Auch wenn es gar nicht lange her ist. Die paar Jahre, die vergangen sind, kaum der Rede wert. Man könnte meinen, ein Jahrhundert liege dazwischen, aber es ist nur reichlich ein Jahrzehnt. Ein und ein halbes genau. Was für eine rundherum glückliche Zeit war es für dieses Land und für dieses Volk!
Allerdings für mich war gerade dieser Tag im Mai kein glücklicher Tag.
Geliebte Rosalind
Rosalind sah wie immer bezaubernd aus. Sie trug ein schwarz-weißes Kleid, sehr elegant und seriös, dem ernsten Vorgang angepasst, dazu ein winziges weißes Strohhütchen und an den schlanken Beinen hochhackige Pumps. Ich brauchte sie gar nicht anzusehen, als sie neben mir den langen Gang entlangging, ich wusste, wie schön sie war. Ob ich jemals aufhören würde, sie zu bewundern? Jemals aufhören konnte, sie zu lieben? Vermutlich nicht. Und die Tatsache, dass wir vor einer Viertelstunde geschieden worden waren, schien nichts daran zu ändern. Mir war ziemlich benommen zumute.
Ich hatte Angst gehabt vor diesem Tag. Alles würde zu Ende sein mit dem Tag, mit der Stunde, da Rosalind endgültig von mir getrennt sein würde. So hatte ich gedacht. Nun war es passiert, und ich lebte immer noch und bewegte mich ganz gelassen neben der Frau, die vierzehn Jahre lang meine Frau gewesen war, auf den Ausgang des Justizpalastes zu. Offenbar ging das Leben also weiter. Ich konnte mir nur noch nicht vorstellen, wie. Ganz demnächst würde ich einmal darüber nachdenken müssen.
Übrigens war Rosalind auch sehr ernst. Sie blickte ein wenig abwesend vor sich hin, und als ich sie mit einem vorsichtigen Seitenblick streifte, bildete ich mir sogar ein, eine Träne in ihrem Augenwinkel zu sehen. Vielleicht täuschte ich mich aber.
Es war alles ganz schnell und reibungslos gegangen, Rosalind hatte einen tüchtigen Anwalt, und ich hatte alle Schuld auf mich genommen. Lix, unsere Tochter Angelika, war natürlich Rosalind zugesprochen worden.
Schuld? Hatte ich Schuld auf mich geladen? Vielleicht! Sicher sogar, wenn auch nicht im herkömmlichen Sinn. Ich hatte Rosalind nie betrogen. Nie, nie, und ich hätte es auch nach dreißigjähriger Ehe nicht getan. Wie kann man sich für andere Frauen interessieren, solange Rosalind in der Nähe ist. Ein ganzes Heer von Schönheitsköniginnen wäre machtlos dagegen. Rosalind konnte einen Mann beschäftigen bis zum letzten Atemzug.
Das würde Konrad schon noch entdecken.
Konrad war der Mann, den Rosalind nach einer schicklichen Pause heiraten würde.
Konrad Killinger, Chef von Killinger AG, dreiundfünfzig Jahre alt und – nach Rosalinds Schilderung – groß und stattlich, mit einem interessant geschnittenen, männlichschönen Gesicht, breiten Schultern, erstklassigen Maßanzügen, einem Mercedes 300 und einer Villa in Harlaching. Mit einem Wort, das reine Gegenteil von mir.
Vielleicht wäre das der richtige Moment, mich vorzustellen, dann habe ich es hinter mir. Wie gesagt, kein Vergleich mit Konrad. Ich bin fast vierzig Jahre alt, nur mittelgroß, sehr schlank, und, das möchte ich denn doch betonen, ein guter Schwimmer, ein ordentlicher Reiter, ein standfester Skiläufer und ein ausdauernder Radfahrer. Jawohl! Mein Gesicht ist ganz durchschnittlich, von Beruf bin ich Schriftsteller. Nicht sehr erfolgreich. Und außerdem heiße ich Adolf. O nein, nicht deswegen. Als ich geboren wurde, war es noch nicht peinlich, Adolf zu heißen, und mein Taufpate hieß nun eben mal so. Adolf Schmitt, so lautet mein voller Name. Ist es möglich, dass jemand Karriere macht, der Adolf Schmitt heißt? Wohl kaum.
Rosalind nannte mich immer Dodo. 1946, als wir uns kennenlernten, konnte man einfach nicht Adolf heißen. An Dodo habe ich mich auch nie recht gewöhnen können. Es kam mir so kindisch vor. Als sie mir verkündete, dass sie diesen Menschen, diesen Killinger, heiraten würde, dachte ich schadenfroh: Ob sie ihn wohl Coco nennen wird? Aber auf die Idee kommt bei diesem Mann wohl keiner, nicht einmal Rosalind.
Als wir durch die Tür des Justizpalastes ins Freie traten, schob Rosalind ihren Arm unter meinen. Sie lächelte mich an, gar nicht mehr traurig.
»Nun?«, sagte sie.
»Ja«, erwiderte ich ein bisschen dämlich, »das wär’s denn.«
»Das wär’s denn«, wiederholte Rosalind in sachlichem Ton. »Immer gut, wenn man so was hinter sich hat. Geschichten mit Behörden regen mich immer auf. Aber der Richter war sehr nett, nicht?«
»Sehr.«
»Mir ist etwas flau im Magen«, fuhr sie fort. »Damals war das auch so, als wir heirateten.«
»Nein, wirklich?«, staunte ich. »Davon habe ich nichts gemerkt.«
»Du merkst nie etwas.« Sie blickte einen kleinen Moment nachdenklich in den seidenblauen Himmel hinauf, der sich selig und unberührt über dem Stachus wölbte, als blicke er nicht auf eine wild bewegte, laute Großstadt mittags um zwölf Uhr, sondern auf die weltferne Lichtung vor dem Waldhaus.
»Ein wunderbarer Tag«, meinte Rosalind. »Ist das nun eigentlich das richtige Wetter, um sich scheiden zu lassen?«
»Offenbar doch«, sagte ich und blickte schnell zum Himmel. Ganz fern, ganz hoch zog ein winziges, silbernes Insekt eine weiße Spur in die blaue Seide. Ein Düsenflugzeug. Wir lebten also wirklich im zwanzigsten Jahrhundert. Manchmal vergaß ich das.
»Als wir heirateten«, hing Rosalind weiter ihren Erinnerungen nach, »war mir auch ein bisschen komisch. Und ich hatte Hunger.«
»Kein Wunder damals. Da hatten wir immer Hunger.« Rosalind warf mir unter hochgezogenen Brauen einen kurzen Blick zu.
»Du bist ein Trottel, Dodo«, sagte sie freundlich. »Nicht so einen Hunger. Sondern Hunger aus seelischer Erregung. Das ist etwas anderes.«
Ich zog meinen Arm aus dem ihren, wendete mich ihr voll zu und fragte erstaunt: »Du willst doch nicht etwa behaupten, dass es dich seelisch erregt hat, mich zu heiraten?«
»Doch. Es hat. Und das heute auch.«
Ich betrachtete sie versunken.
»Du bist so schön, Rosalind. Du könntest nicht so schön sein, wenn dich jemals irgendetwas seelisch erregt hätte.«
»Ich sagte ja, dass du ein Trottel bist. Du wirst es nie fertigbringen, eine Frau zu verstehen.«
Ich schwieg beeindruckt. Da war was dran. Und dann, in einem späten Anfall von Eifersucht, stellte ich die törichte Frage: »Glaubst du, dass er es kann? Eine Frau verstehen?«
»Wer?«
»Na, der … dieser Konrad, den du da heiraten willst.«
»Nein. Der noch weniger als du. Er ist schließlich auch nur ein Mann. Und ein Erfolgsmann dazu, da erwartet man das sowieso nicht. Dafür hat er anderes zu bieten.«
»Aha.« Darauf ließ sich nichts weiter sagen. Aber eine Frage konnte ich mir nun doch nicht verkneifen. »Und du liebst ihn trotzdem?«
»Sicher«, erwiderte Rosalind ruhig. »Aber wir wollen jetzt nicht von ihm reden. Mit ihm kann ich mich noch lange genug beschäftigen. Heute bist du dran.«
»Vielen Dank«, murmelte ich.
»Damals«, sagte Rosalind versonnen, »bekamen wir bei Muni eine Kartoffelsuppe als Hochzeitsmahl.«
Ich erinnerte mich. Es war eine erstklassige Kartoffelsuppe gewesen. Aus richtigen Kartoffeln gemacht, mit Gelben Rüben drin, und obenauf schwammen ein paar Speckbrocken. Muni hatte schweigend und lächelnd zugesehen, als ich die Speckbrocken von meinem Teller in Rosalinds bugsierte. Muni ist meine Mutter, und natürlich war der Speck zunächst bei mir gelandet.
»Heute«, fuhr Rosalind fort, »habe ich einen Tisch im Königshof bestellt.«
Irgendwie glaubte ich, ich müsse Munis Kartoffelsuppe verteidigen. »Es war eine sehr gute Suppe.«
»Eine erstklassige Suppe«, gab Rosalind bereitwillig zu. »So, wie sie nur Muni zustande bringt. Aber alles hat seine Zeit. Wenn man jung und verliebt ist, kann man auch mit einer Kartoffelsuppe glücklich heiraten. Ein Scheidungsmahl sollte etwas festlicher sein. Ich werde uns ein Menü zusammenstellen, du darfst gar nicht in die Speisekarte gucken.«
»Wennschon«, sagte ich, »dann möchte ich Spargel haben.«
Das Scheidungsmahl
Ein Tisch am Fenster war für uns reserviert, und der Ober schob Rosalind beflissen den Stuhl zurecht. Der Restaurantdirektor stand einige Schritte entfernt und betrachtete Rosalind wohlwollend. Sie hat immer einen großen Auftritt, wohin sie auch kommt. Auch früher schon, als sie sich noch nicht solche Kleider leisten konnte. Es liegt an ihrer Haltung, an ihrem Gang, ihrem Lächeln – ich weiß auch nicht. Rosalind ist eben Rosalind, damit ist alles gesagt.
Als die Martinis kamen, erschien es mir angebracht, ihr ein kleines Kompliment zu machen.
»Dein Kleid ist fabelhaft.« Es kam, wie immer bei mir, etwas ungeschickt heraus.
Rosalind war daran gewöhnt. Sie lächelte erfreut und sagte: »Ja, nicht? Ich lasse jetzt bei Charleron arbeiten.«
»Aha«, sagte ich.
Sie zog in ihrer unnachahmlichen Weise die Brauen ein wenig hoch.
»Du weißt natürlich nicht, wer Charleron ist.«
»Ich muss gestehen, ich weiß es nicht.«
Mit einer leichten Wendung ihres schlanken Halses lockte sie den Ober herbei. »Einen Zahnstocher, bitte.«
»Du solltest öfter mal Zeitung lesen«, sagte sie dann zu mir. »Dann wüsstest du, dass Charleron zurzeit die Spitze der Haute Couture bedeutet, die wir in München haben. Der Mann ist noch jung, aber er hat ein unerhörtes Modegefühl. Und er versteht die Frauen. Aus jedem Typ das Richtige zu machen, weißt du. Seine Modenschauen sind jedes Mal eine Sensation. Alles ist da, was zur Gesellschaft gehört. Einfach alles.«
»Aha«, sagte ich. »Demnach warst du also auch da.«
»Dieses Frühjahr, ja.« Und befriedigt fügte sie hinzu: »In Zukunft werde ich immer dabei sein.«
Wie leicht es ist, eine Frau glücklich zu machen! Nur ich verstand es eben nicht. Wäre ich auf die Idee gekommen, dass ein kleines Kärtchen von Monsieur Charleron mit einer Einladung zu einer Frühjahrsmodenschau dieses Wunder vollbringen könnte? Nie. Und ich bildete mir ein, ich könnte Romane schreiben, wo ich so wenig von der Frauenseele verstand. Abgesehen davon, dass es natürlich unsinnig ist, eine Frau zu so einer Modenschau gehen zu lassen, wenn man ihr die dort vorgeführten Kleider doch nicht kaufen kann. Dieser Bursche, dieser Konrad, der kann das.
»Danke«, sagte Rosalind, nahm den Zahnstocher entgegen und pickte damit zierlich die Olive aus ihrem Martini.
»Wie gefällt dir meine neue Haarfarbe?«, fragte sie dann.
»Hinreißend. Steht dir großartig.«
Sie nickte, blickte mich aber dabei nachdenklich an. »Sag mal, Dodo, hat dir eigentlich schon einmal etwas an mir nicht gefallen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nicht dass ich wüsste.« Aber dann fiel mir doch etwas ein. »Ja, doch. Eine Kleinigkeit.«
»Und das wäre?«, fragte sie und runzelte ein wenig ihre Kinderstirn, die immer noch ohne eine einzige Falte war.
»Heute«, sagte ich, »dass du dich hast von mir scheiden lassen.«
Das leuchtete ihr ein.
»Mein armer Dodo«, sagte sie schließlich mit einem kleinen Seufzer.
Die Schildkrötensuppe wurde serviert. Rosalind trank sie schweigend, ihre dunklen Augen sahen mich dabei sorgenvoll an.
»Ich weiß«, sagte sie, als das Tässchen leer war, »ich weiß, was ich dir damit angetan habe. Und du weißt, dass ich es mir nicht leicht gemacht habe. Ich hätte oft Gelegenheit gehabt, nicht wahr? Aber ich konnte es nie übers Herz bringen, dich allein zu lassen. Du bist so schrecklich unbeholfen und weltfremd. Und du kannst so gar nicht mit Menschen umgehen. Der Gedanke, dich allein dieser schrecklichen Welt zu überlassen, war mir immer entsetzlich.«
Sie sah wirklich ganz bekümmert aus. Der Ober beugte sich besorgt zu ihr hinab und fragte mit leiser, teilnehmender Stimme: »Darf ich einschenken, gnädige Frau?«
»Bitte«, antwortete Rosalind und sah schweigend zu, wie der blassgoldene Wein in unsere Gläser gefüllt wurde. Dann hob sie ihr Glas, schnupperte ein wenig mit der kleinen Nase an der Blume und nahm einen Probeschluck.
»Schmeckt er Ihnen, gnädige Frau?«, fragte der Ober.
»Ausgezeichnet«, erwiderte Rosalind. »Danke schön.«
Der Ober entfernte sich mit einer kleinen Verbeugung. Ich wusste genau, was er dachte. Bezaubernde Frau, dachte er. Was sie da bloß für einen komischen Stoffel dabeihat. Irgendetwas würgte mich im Hals. Saß da wie ein dicker, trockener Kloß und machte mich ganz elend.
Vielleicht würde ein Schluck Wein helfen. Ich hob das Glas und sagte: »Auf dein Wohl, Rosalind. Ich wünsche dir, dass du sehr, sehr glücklich wirst.«
»Danke, mein Liebling«, sagte sie weich. Sie trank, setzte das Glas nieder und fuhr dann ruhig fort: »Ich werde schon glücklich. Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber du! Was soll bloß aus dir werden?«
Der Kloß war immer noch da. Ich blickte an Rosalind vorbei, durch die Scheibe hinab auf den großen Platz, auf den Verkehr, auf die Autos, die Trambahnen, die Menschen, die dort kreuz und quer durcheinander fuhren und liefen.
»Um mich brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen«, erzählte ich der Scheibe. »Mir geht es bestens. Ich habe das Waldhaus, ich habe Dorian und Isabel, und ab und zu verdiene ich auch mal was. Wenn meine Arbeit mir auch nicht viel Geld einbringt, so weißt du doch, dass sie mich glücklich macht. Komisch, aber es ist so. Und ich brauche nicht viel zum Leben. Da du dich ja gut verheiraten wirst, brauche ich nicht einmal mehr für Lix zu sorgen. Für mich allein reicht es allemal.«
Rosalind schob ihre Hand über den Tisch und legte sie sanft auf meine Rechte, die merkwürdig verkrampft und versteinert auf dem Tisch lag.
»Ich spreche nicht von Geld, Liebling«, sagte sie leise.
»Bitte, nimm deine Hand weg«, sagte ich heiser. »Es wäre dir sicher nicht angenehm, wenn ich hier mitten auf der Terrasse des Königshofes angesichts sämtlicher Gäste und der feinen Ober und der Leute unten auf dem Stachus anfinge zu heulen.«
Sie zog erschrocken die Hand zurück. »Entschuldige«, flüsterte sie. »Komm, trink noch einen Schluck. Der Wein ist wirklich gut.«
Gehorsam nahm ich mein Glas und trank. Ich hätte genauso gut Coca-Cola trinken können. Oder aus der Blumenvase, die auf dem Tisch stand.
Die Forellen wurden serviert. Der Ober wollte sie für uns zerlegen, aber Rosalind sagte: »Danke, das machen wir selbst.«
Fachkundig, mit wenigen geübten Griffen zerlegte sie ihr blaugraues Fischlein. Wenigstens etwas, was sie von mir gelernt hatte. Ich kannte da einen Bauern, nicht weit vom Waldhaus, der hatte ein Fischwasser und von dem bekam ich manchmal ein paar Schwänze.
Wir aßen eine Weile schweigend. Dann kam Rosalind zum Thema zurück.
»Du musst dich nicht so aufregen, Dodo. Ich weiß, dass es dir schwerfällt, dich von mir zu trennen. Denkst du, für mich ist es ein Vergnügen? Aber sieh mal, du musst das verstehen. Ich bin fünfunddreißig, dir kann ich es sagen, du weißt es ohnehin. Sonst sieht man es mir nicht an, oder?«
»Natürlich nicht. Das weißt du ganz genau.«
»Aber ich bin es eben. Wenn ich noch ein bisschen was vom Leben haben will, dann musste ich jetzt Ernst machen. Wir sind vierzehn Jahre verheiratet. Die ersten sechs davon habe ich mit dir und dann auch noch mit Lix in Munis kleiner Wohnung verbracht. Wie wir damals gelebt haben, brauche ich dir nicht zu erzählen. Die anderen Jahre haben wir meist im Waldhaus gelebt. Du liebst das Waldhaus. Ich hasse es. Das weißt du.«
Ihre Stimme klirrte jetzt ein wenig vor unterdrückter Erregung.
Ich nickte. »Ja, ich weiß es.«
»Das Waldhaus ist hübsch, und für ein Wochenende würde es ganz romantisch sein, ein bisschen primitiv zu leben. Als Dauerzustand ist es unerträglich. Unerträglich!«
Über die Teller hinweg blickten wir uns gerade in die Augen. Jetzt hatte sie doch eine Falte auf der Stirn, ihre Nasenflügel bebten, und sie sah fast wirklich wie fünfunddreißig aus.
»Im Winter warst du meist bei Muni«, sagte ich schwach.
»Ja, gewiss. Muni hat, wie dir bekannt ist, eine Dreizimmerwohnung mit Ofenheizung. Ich wollte einmal so leben, wie die meisten Menschen heute leben. Bequem, komfortabel und im Genuss der Errungenschaften des zwanzigsten Jahrhunderts. Ich wollte mal so ein Kleid haben, wie ich es heute trage. Und nicht nur eins. Und zum Friseur gehen, wann es mir passt. Und mal eine Reise machen, und …«
»Hör auf«, unterbrach ich sie. »Ich weiß ganz genau, was zum Lebensstandard eines normalen Mitteleuropäers gehört.«
»Und ich wollte sogar noch ein bisschen mehr haben, als der normale Mitteleuropäer hat«, fuhr sie hartnäckig fort. »Jetzt kriegst du es ja«, sagte ich begütigend. Der Kloß in meinem Hals war weg. Die Forelle war eigentlich gut gewesen. Und der Wein war nicht übel. Aber ich sehnte mich auf einmal nach dem Waldhaus. Dorian würde schon todunglücklich sein. Er war zwar beim Andres, aber sehr wohl fühlte er sich da nie.
»Ja, jetzt kriege ich es«, wiederholte sie trotzig. »Und ich finde, es ist mein gutes Recht.«
»Ich habe dir dieses Recht nie streitig gemacht. Ich habe immer gewusst, dass du mich eines Tages verlassen würdest, und als es nun so weit war, habe ich es dir doch leicht gemacht. Oder nicht?«
»Doch. Du warst sehr fair.«
»Es ist mir leider nicht gegeben, viel Geld zu verdienen. Vielleicht sollte ich es aufgeben, Bücher zu schreiben, die kein Mensch lesen will. Aber selbst wenn ich irgendetwas anderes machen würde, sagen wir mal, eine Stellung suchen oder so etwas, es wäre doch nichts besonders Großartiges und könnte dir nicht den Lebensstil ermöglichen, den du dir wünschst. Ich gebe zu, dass er dir zusteht, dass er zu dir passt und dass es eine Gemeinheit wäre, von dir zu verlangen, dass du noch weitere Jahre deines Lebens an mich verschwendest.«
Der Ober kam, räumte die Teller weg und füllte die Gläser nach.
»Gemeinheit ist kein schönes Wort«, sagte Rosalind sanft, als er wieder fort war. »Und ich betrachte die Jahre, die ich mit dir verbracht habe, nicht als verschwendet.«
»Danke«, sagte ich leise, »du bist sehr großmütig.«
»Wir wollen uns nicht streiten, Dodo. Wir haben uns sehr selten gestritten, und wenn es geschah, war es immer meine Schuld. Immer. Aber es waren die Umstände, in denen wir lebten, die mich manchmal reizbar machten.«
»Ich weiß. Ich habe dies immer verstanden. Aber nun ändert sich dein Leben. Ich habe es schon gesagt, Rosalind, und ich sage es noch einmal, denn es ist mein Ernst: Ich wünsche dir, dass du sehr, sehr glücklich wirst. Mit deinem neuen Leben, deinem neuen Mann, den schönen Kleidern und mit allem, was dazugehört. Du sollst es haben. Alles, was du dir wünschst. Und an mich, bitte, sollst du keinen Gedanken mehr verschwenden.«
Rosalind hob den Kopf, sah mich kampflustig an und erklärte mit Nachdruck: »O doch. Das schlag dir gleich aus dem Kopf. Ich habe mich zwar von dir scheiden lassen, und ich werde Konrad heiraten und werde mir zu jeder Saison mindestens ein halbes Dutzend Kleider bei Charleron machen lassen. Aber denke nicht, dass du«, sie wies mit ihrem spitzesten Zeigefinger mitten auf meine Brust, »dass du aus meinem Leben verschwindest. Ich habe die Verantwortung für dich, und die behalte ich. Die kann mir keiner abnehmen. Ich werde mich immer darum kümmern – immer, hörst du! –, was du treibst, wie du lebst, wovon du lebst und mit wem du umgehst.«
»Pst!«, flüsterte ich und schaute verstohlen um mich. Im Eifer hatte sich Rosalinds Stimme merklich gehoben.
»Du bist mein Mann, und du bleibst mein Mann, und es ist mein Recht und meine Pflicht, mich um dich zu kümmern.«
»Wir sind heute geschieden worden«, erinnerte ich sie. »Du kannst nicht zwei Männer haben.«
»Ich kann«, sagte Rosalind entschieden. »Und ob ich das kann. Das habe ich Konrad schon erklärt. Von vornherein habe ich keinen Zweifel daran gelassen, wie ich zu dir stehe. Genauso wie ich mich um Lix kümmere und für sie sorge, genauso für Dodo, habe ich ihm gesagt. Ihn völlig allein zu lassen, das wäre sein Untergang.«
Der Ober brachte die neuen Teller und servierte dann zarte Kalbssteaks mit frischem Spargel und kleinen Kartöffelchen, die wie Marzipan schmeckten. Warum bekommt man im Laden nie solche Kartoffeln?
Mein Untergang. Na, wennschon. Viel ging da nicht unter. Ein durchschnittlicher Mann von beinahe vierzig Jahren, der es zu nichts im Leben gebracht hatte. Nicht mal eine einzige Heldentat im Krieg hatte ich zustande gebracht. Auf dem schwarzen Markt war ich ein Versager gewesen. Und jetzt erst! Ich selber fand zwar meine Bücher ganz gut, aber sie wurden nicht gekauft. Die einzige Sternstunde meines Lebens war gekommen, als ich Rosalind traf. Die größte Tat, die ich je vollbracht hatte, war es gewesen, sie zur Heirat zu bewegen. Aber das hatte sich ja nun erledigt. Was blieb also von mir übrig?
Ach nein, so unglücklich, wie ich mir jetzt einreden wollte, so unglücklich war ich gar nicht. Meist fand ich das Leben ganz schön. Wie gern lebte ich im Waldhaus, wenn auch Rosalind es primitiv nannte.
Außerdem war es gar nicht mehr so primitiv. Wir hatten jetzt eine Wasserleitung, wir hatten Elektrizität und ein richtiges WC. Und wenn ich wieder einmal eine größere Arbeit an den Rundfunk hätte verkaufen können, dann hätte ich eine Ölheizung einbauen lassen. Für Rosalind.
Jetzt nicht mehr. Ich brauche keine. Ich bin Experte im Feuermachen und habe es sehr gern, wenn die Holzscheite im Ofen knacken. Ich kann wunderbar dabei arbeiten.
Dorian würde bei mir sein, den ich liebte und der mich liebte. Manchmal kamen Rehe auf die Lichtung, und wir beobachteten sie, Dorian und ich. Er dachte nie daran, sie zu jagen oder zu verbellen. Sogar der Förster wusste das und meinte, das sei ein erstaunlicher Hund. Im Sommer sangen die Vögel schon im frühen Morgengrauen, und im Winter kamen sie ans Haus heran, und ich fütterte sie. Um das Haus war eine Wiese, und gleich um die Wiese begann der Wald. In einer Viertelstunde war ich beim Andres, meinem Bauernfreund. Wir führten ein ernsthaftes Männergespräch oder klopften mit Wastl, dem Knecht, einen Skat. Nur zehn Minuten vom Hause entfernt war ein kleiner See, mehr ein Weiher, inmitten einer anderen Lichtung im Wald, dort konnte ich im Sommer schwimmen.
Ich liebte das Haus, den Wald, die Wiesen, den Weiher, die Rehe, die Vögel, meinen Dorian und die schöne Isabel und auch den Andres mit seinem holzgeschnitzten Bauernschädel und sogar den hinterfotzigen Wastl. Es war meine Welt, in der ich gern lebte. Im Sommer und im Winter, wenn die Sonne schien, wenn es regnete, wenn es schneite. Einfach immer. Und in Zukunft würde ich dort unbehelligt leben können, wie es mir passte, ohne ewig von meinem schlechten Gewissen geplagt zu sein, wenn ich Rosalinds unzufriedene Miene sah. Ohne geplagt zu sein von Unruhe und Eifersucht, wenn sie auf Tage oder sogar Wochen in die Stadt hinein verschwand. Ohne mir Sorgen zu machen wegen Lix, die bei Muni lebte, seit sie die höhere Schule besuchte, weil bei uns draußen der Schulweg zu weit und zu umständlich gewesen wäre. Und die Muni wahrscheinlich auf der Nase herumtanzte und trieb, was sie wollte.
Und ich konnte arbeiten, wie ich wollte. Schreiben, was mir passte. Rosalind würde mir nicht mehr über die Schulter blicken und fragen: »Was wird denn das nun wieder? Lieber Himmel, Dodo, eine ganze Seite Naturschilderungen, wer will denn das lesen? Schreib doch mal was Flottes, Aufregendes, etwas, was die Illustrierten kaufen. Das bekommt man prima bezahlt, habe ich mir sagen lassen.«
Na schön, ich hatte es versucht. Aber ich war nicht weit damit gekommen. Das lag mir nun mal nicht. Keine Illustrierte würde kaufen, was ich schrieb, also warum die Zeit damit vergeuden.
Nein, ich war nicht unglücklich. Ich blickte sogar recht vergnügt und hoffnungsfroh in die Zukunft. Ich würde in Frieden leben können. Ohne Rosalind, nun ja. Aber dass dies eines Tages so sein würde, mit diesem Gedanken hatte ich mich seit Jahren vertraut gemacht.
Es war nur gerade heute. Schließlich wusste ich seit nun bald einem Jahr, dass Herr Killinger an der Reihe war. Es war eine alte Wunde. Und sie schmerzte manchmal noch. Sehr oft sogar. Aber das würde vorübergehen. Dann würde ich Frieden haben. Und eine Frau, das hatte ich mir geschworen, eine Frau sollte mir diesen Frieden nicht mehr stören. Nicht einmal Rosalind. Und eine andere kam sowieso nicht infrage.
»Wenn ich mich etabliert habe«, nahm Rosalind den Faden wieder auf, »gesellschaftlich vor allem, weißt du, und die richtigen Leute kenne, dann werde ich dich lancieren.«
Sie hob abwehrend die Hand, um meinen Widerspruch im Keime zu ersticken. »Doch, das werde ich. Und du wirst uns regelmäßig besuchen. Und ich werde hinauskommen zu dir, ich habe ja dann einen Wagen. Du bist mein Mann, und du bleibst mein Mann, und ich habe die Verantwortung für dich. Dabei bleibt es.«
O süßer Friede! Schwer wirst du zu erringen sein.
»Du kannst nicht zwei Männer haben«, sagte ich noch einmal.
»Das werden wir sehen«, sagte sie. »Lix wird schließlich auch zwei Väter haben. Oder möchtest du darauf verzichten, deine Tochter regelmäßig zu sehen?«
»Natürlich nicht.«
»Siehst du. Das wird sich alles arrangieren. Lass mich nur machen. Jetzt möchte ich noch ein Champagner-Sorbet. Und was nimmst du zum Nachtisch?«
»Nichts«, antwortete ich grantig.
»Vielleicht eine Birne Hélène? Das magst du doch, nicht?« Ich schwieg verbockt. Vielleicht sollte ich das Waldhaus verkaufen und mir lieber ein Häuschen in der Holsteinischen Schweiz zulegen? Das Dumme ist, ich kann das Waldhaus nicht verkaufen, weil es mir nicht gehört. Es gehört dem Andres, der mich dort umsonst wohnen lässt. Weil er mich mag. Und weil ich ihm mal einen Gefallen getan habe. Das ist lange her, das war noch im Krieg. Der Andres behauptet, ich hätte ihm das Leben gerettet. Dabei habe ich ihn gerade von einem Fleck zum anderen getragen, weil er einen Schuss ins Bein gekriegt hatte und nicht laufen konnte. Und da, wo er lag, da schossen sie mit Fleiß hin. Es war wirklich eine kleine Mühe gewesen. Doch der Andres hatte es nicht vergessen.
Rosalind ließ sich vom Portier ein Taxi herbeitelefonieren, nachdem sie den Champagner-Sorbet und ich die Hélène verspeist und wir obendrauf noch einen Mokka getrunken hatten.
»Kann ich dich irgendwo absetzen?«, fragte sie.
»Nein«, sagte ich. »Ich möchte noch ein bisschen durch die Stadt bummeln.«
»Gut. Wann fährst du hinaus?«
»Morgen.«
»Grüß Dorian von mir. Und meinetwegen auch deine Isabel. Obwohl sie sich ja nichts aus mir macht. Anfang der Woche fahre ich nach Paris. Konrad hat geschäftlich dort zu tun. Sobald ich zurück bin, komme ich zu dir hinaus.«
»Bitte sehr«, sagte ich resignierend. »Ich werde mich immer freuen, dich zu sehen.«
»Mit dem Heiraten müssen wir noch ein bisschen warten. Aber du wirst es natürlich rechtzeitig erfahren, wenn es so weit ist.«
»Das wäre sehr freundlich. Ich würde dir gern einen Blumenstrauß schicken. Aber komme bitte nicht auf die Idee, mich zur Hochzeit einzuladen.«
Rosalind betrachtete mich einen Augenblick stirnrunzelnd. Anscheinend hatte sie wirklich daran gedacht. Aber dann sagte sie hoheitsvoll: »Natürlich nicht. Wofür hältst du mich? Ich bin schließlich eine Frau mit Geschmack.«
»Eben. Also«, ich nahm ihre Hand und drückte einen ziemlich flüchtigen Kuss darauf, »mach’s gut. Und … ja, also, auf Wiedersehen.« Beinahe hätte ich gesagt: Grüß Konrad von mir. Aber das ging ja wohl zu weit.
Ich sah ihr zu, wie sie graziös in die Taxe kletterte. Ihr Rock war sehr kurz, und ich hatte noch einmal Gelegenheit, ihre vollendeten Beine zu bewundern. Aber ich tat es nur ganz oberflächlich. Das war nun vorbei. Mochte dieser verdammte Konrad ihr in Zukunft Komplimente machen. Ich war ein geschiedener Mann und hatte nicht die geringste Verpflichtung, die Reize meiner verflossenen Frau zu bewundern. Ich konnte nun, wenn ich wollte, die Reize anderer Frauen bewundern. Aber ich wollte gar nicht. Alle Frauen der Welt waren mir schnurzpiepegal. Ein herrliches Gefühl.
Ich steckte die Hände tief in die Hosentaschen, spitzte die Lippen und begann zu pfeifen. So schlenderte ich über den Stachus. Ich würde jetzt mal eine Rundreise antreten und die Schaufenster der Buchhandlungen betrachten. Vielleicht sah ich irgendwo ein Buch von mir ausgestellt. Wenn nicht, würde es mich auch nicht weiter überraschen. Und vielleicht konnte ich eben mal kurz Camilla besuchen, die eine hübsche kleine Buchhandlung in der Innenstadt hatte. Sie war ein mächtig gescheites Mädchen. Ihr gefielen meine Bücher nämlich. Und sie verkaufte sogar manchmal eins.
Camilla hält mich für einen Dichter
Camilla hatte noch drei Bücher von mir in den Regalen stehen. Im Januar waren es fünf gewesen, und demnach hatte sie inzwischen zwei Stück verkauft.
»Sie sind wahrscheinlich der einzige Buchladen in der Stadt, der dieses Wunder fertigbringt«, sagte ich anerkennend. »Sie wissen, dass ich mich immer sehr für Ihre Bücher einsetze, Herr Schmitt«, antwortete sie. »Ich finde sie ausgezeichnet. Wirklich. So romantisch und so … so echt. Freilich, die Kunden sind heute komisch. Sie kaufen alle dasselbe. Wenn ein Buch ins Gerede kommt, wenn darüber geschrieben wird, dann kaufen sie es eben, ganz egal, was drinsteht. Das ist unsere Zeit, verstehen Sie? Wir leben in einem genormten Zeitalter. Auch der Geschmack der Leser ist genormt. Da kann man nicht gegen an.«
»Ich weiß schon«, sagte ich.
»Aber Sie dürfen sich nicht entmutigen lassen«, fuhr sie tröstend fort. »Ihre Zeit kommt noch. Sie sind ein Dichter, ich sage es der Leni immer. Nicht, Leni?«
Leni, die kleine Gehilfin, nickte so nachdrücklich mit dem Kopf, dass ihr blonder Pferdeschwanz lebhaft auf und ab wippte.
»Dichter haben es immer schwer. Ein richtiger Dichter braucht Zeit, bis er anerkannt wird. Manche schaffen es erst nach ihrem Tod.«
»Na, das kann ich ja leicht abwarten«, sagte ich. »Immerhin vielen Dank, Camilla. Sie haben mich moralisch wieder aufgerichtet.«
Meine Einladung, abends mit mir ins Kino zu gehen, nahm sie trotzdem nicht an. Es täte ihr sehr leid, aber ausgerechnet heute hätte sie schon eine Verabredung. Vielleicht ein andermal.
Als ich wieder auf der Straße stand, war ich ganz froh, dass sie abgelehnt hatte. Ich wollte gar nicht ins Kino gehen, das Wetter war viel zu schön. Ich hatte das bloß gesagt, weil sie so nett gewesen war und weil ich dachte, es freute sie. Frauen freuen sich immer, wenn man sie zu irgendetwas einlädt. Auch wenn sie ablehnen müssen. Das macht nichts. Hauptsache, die Einladung ist ausgesprochen worden.
So wenig, wie Rosalind behauptete, verstand ich gar nicht von den Frauen.
Während ich zum Odeonsplatz weiterschlenderte und dann einen kurzen Rundgang durch den Hofgarten machte, stellte ich mir vor, wie es sein müsste, Camilla zu heiraten. Sie hielt mich für einen Dichter, war so weit eine ganz passable Person, natürlich nicht entfernt mit Rosalind zu vergleichen. Aber sie war eine tüchtige Buchhändlerin, hatte diesen netten kleinen Laden, verstand viel von Literatur und anderen gescheiten Dingen und hatte sicher kein Verlangen, Kleider von Monsieur Charleron zu tragen. Eine Ehe zwischen einer Buchhändlerin und einem Schriftsteller müsste eigentlich ganz glücklich sein. Müsste doch eine brauchbare Gemeinschaft geben.
Gab es eigentlich Präzedenzfälle? Ich dachte eine Weile angestrengt darüber nach, mir fiel aber keiner ein. Außerdem wollte ich sowieso nicht heiraten, weder Camilla noch sonst jemand. Ich hatte Rosalind haben wollen, und die war fort, und dafür hatte ich meine Ruhe. Das war nach Rosalind das Zweitbeste, was es auf der Welt geben konnte.
Muni, mein bestes Stück
Muni stellte keine Fragen, als ich abends nach Hause kam. Sie hatte ein Hühnchen gebraten, weil sie wusste, dass das mein Lieblingsessen war, und weil sie vermutlich der Ansicht war, man müsse mir an diesem Tag irgendetwas Gutes tun.
So kam ich an meinem Scheidungstag zweimal zu einem Schlemmermahl. Wie hatte Rosalind gesagt? Wenn man verliebt ist, kann man auch mit einer Kartoffelsuppe glücklich sein. Ja, das stimmte wohl. Und wenn man enthoben ist, braucht man mindestens Forellen, Kalbssteaks, Spargel, Hühnchen und einen guten Wein dazu. Dann ist man zwar auch nicht gerade glücklich, aber es schmeckt wenigstens. Und eins war sicher, wenn Muni mir etwa an diesem Abend Kartoffelsuppe vorgesetzt hätte, dann wäre mir bestimmt das heulende Elend gekommen.
Wir redeten ein bisschen hin und her, Muni betrachtete mich verstohlen mit besorgt-mütterlichen Blicken, sehr verstohlen, aber ich merkte es natürlich trotzdem. Doch es schien sie zu trösten, dass es mir offensichtlich schmeckte. Schließlich erzählte ich ihr freiwillig, wie sich das alles am Vormittag und Mittag abgespielt hatte. Sie wollte es nun doch mal gern wissen. Auch einer meiner großen Fehler: Ich bringe es nie fertig, einen Menschen zu enttäuschen. Wenn Rosalind auch zehnmal sagt, dass ich ein Trottel sei und nichts von Frauen verstünde, ich weiß doch immer ziemlich genau, was in einem anderen Menschen vorgeht, auch in einer Frau. Ich bilde mir ein, die Menschen gut zu verstehen. Und darum bilde ich mir auch ein, sie in meinen Büchern sehr lebensecht zu schildern. Aber außer mir ist niemand dieser Meinung. »Na gut, na schön«, sagte Muni resolut, als ich mit meinem Bericht zu Ende war, »das ist nun endlich mal erledigt. Reisende soll man nicht halten. Es war ein Fehler, Rosalind zu heiraten, das habe ich dir von Anfang an gesagt. Oder etwa nicht?«
»Doch«, musste ich zugeben, »das hast du gesagt.«
Sie hatte es wirklich gesagt. Damals in der mageren Nachkriegszeit, als ich als halb verhungerter, berufs- und zukunftsloser Gefreiter wieder bei Muni in München untergekrochen war, die durch ein Wunder ihre kleine Wohnung heil durch den Bombenkrieg gebracht hatte, und ihr dann eines Tages Rosalind präsentierte, die ich einem wohlgenährten Ami in letzter Minute weggeschnappt hatte.
Ich war damals, ähnlich wie heute, durch die Stadt geschlendert, gekleidet in eine feldgraue, von Muni zurechtgeschneiderte Joppe, und war dabei vor dem PX in der Brienner Straße vorbeigekommen. Hier standen immer eine Menge Mädchen herum, die auf ihre amerikanischen Freunde warteten.
Etwas abseits stand ein schmales, zierliches Ding mit riesigen dunklen Augen, die ängstlich, wie hypnotisiert auf den Eingang des verlockenden amerikanischen Paradieses gerichtet waren.
Die Kleine fiel mir auf. Ich verlangsamte meinen Schritt, um sie genauer zu betrachten. Das Gesicht war süß, kindlich rein und unberührt erschien es mir, doch dabei von pikantem Reiz. Das schwarzbraune Haar fiel ihr lang und lockig bis auf die Schultern. Sie trug ein kurzes, verwaschenes Leinenkleid in einem verblassten rosa Ton. Ich sehe das alles noch vor mir, als sei es heute gewesen. Ich ging noch einmal zurück, um sie näher zu betrachten. Sie bemerkte mich gar nicht.
Und plötzlich sagte ich – ich weiß auch nicht, warum, ich hatte zuvor noch nie ein Mädchen auf der Straße angesprochen und seitdem auch nicht mehr: »Das sollten Sie aber nicht tun.«
Sie schaute mich überrascht an. »Was?«
»Na, hier stehen. Und auf einen Ami warten.«
»Aber ich …«
»Das passt nicht zu Ihnen«, sagte ich streng. Man muss das verstehen. Ich war ein armer, besiegter deutscher Soldat. Ich sah es nun einmal nicht gern, wenn unsere Mädchen mit den Amis herumliefen. Und in diesem Fall störte es mich besonders.
Sie schob trotzig die Unterlippe vor und sagte: »Aber ich habe Hunger.«
»Haben wir alle«, knurrte ich. »Trotzdem sollten Sie das nicht tun.«
Jetzt waren die großen dunklen Augen voll auf mich gerichtet. »Ich habe noch gar nichts getan«, sagte das Mädchen im rosa Kleid. »Ich habe den gestern erst kennengelernt. Und heute habe ich mich mit ihm verabredet. Und nun ist er hierhergegangen, um einzukaufen.«
»Und?«
Sie hob auf eine rührende Weise die zarten Schultern. »Er würde mir was mitbringen, hat er gesagt. Was zu essen und Zigaretten und … und vielleicht auch ein Paar Strümpfe.«
Es klang kindlich.
»Und wie geht’s weiter?«
Sie hob wieder die Schultern. »Ich weiß es nicht.«
»Aber ich. Denken Sie etwa, der tut das aus reiner Menschenfreundlichkeit? Wenn er Ihnen etwas mitbringt, müssen Sie auch dafür bezahlen. Das wissen Sie doch, oder?«
»Ja«, sagte sie, »das weiß ich.«
»Das sollten Sie aber nicht tun.«
Sie grub ihre weißen kleinen Zähne in die volle Unterlippe und antwortete mir nicht. Eigentlich hätte sie sagen können, dass mich das einen Dreck anginge.
»Da kommt er«, rief sie plötzlich.
In der Tür des PX war so ein großer stämmiger Bursche in stramm sitzenden Hosen und mit einem Bürstenkopf aufgetaucht und schaute sich suchend um.
»Los, kommen Sie«, sagte ich, nahm sie an der Hand und rannte los. Sie rannte mit. Wie zwei Kinder, Hand in Hand liefen wir, bis wir um die nächste Ecke waren. Dort blieben wir heftig atmend stehen.
Sie sah mich vorwurfsvoll an. »Na, so was. Jetzt kriege ich nichts.«
»Nein«, sagte ich fröhlich. »Jetzt kriegen Sie nichts. Strümpfe habe ich jedenfalls nicht. Aber wenn Sie Hunger haben, kommen Sie mit zu meiner Mutter, die kocht schon irgendwas. Irgendetwas kriegt sie immer zusammen.«
So ging das los. Natürlich erzählte ich Muni in meiner Harmlosigkeit, wie das vorgegangen war. Im Gegensatz zu mir glaubte sie nie, dass die Bekanntschaft zwischen Rosalind und dem Amerikaner so kurz gewesen sei. Ich glaubte es. Denn man konnte gegen Rosalind sagen, was man wollte, beschwindelt hat sie mich nie. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste.
Mit mir war damals nicht viel los. Ich hatte ja auch keinen Beruf erlernt, gerade eben ein paar Semester studiert, ehe ich Soldat werden musste. In der Nachkriegszeit belegte ich noch mal ein paar Vorlesungen an der Uni, aber lange konnte ich das nicht durchhalten, ich hatte einfach kein Geld.
Damals gab es in München eine amerikanische Zeitung, und ich versuchte, da unterzukommen. Aber sie nahmen mich nicht. Ich musste nämlich einen Fragebogen ausfüllen, und da stellte sich heraus, dass ich Führer bei der Hitlerjugend gewesen war. Nur ein ganz kleiner, aber immerhin. Heute spielt es ja keine Rolle mehr. Damals eben doch.
Später arbeitete ich eine Zeit lang bei einer deutschen Zeitung, aber eine besonders hohe Meinung hatten sie dort von mir auch nicht. Da machte ich mich dann selbstständig als freiberuflicher Schriftsteller. So ziemlich das Letzte, was der Mensch werden sollte. Das sieht man an mir.
Nun hatte ich Rosalind doch an den fremden Mann mit den vollen Händen verloren, an einen Sieger. Ich hätte sie genauso gut damals vor dem PX stehen lassen können. Es war jetzt kein Amerikaner mehr, und eine Schachtel Zigaretten und ein Paar Strümpfe taten es auch nicht, aber im Grunde genommen blieb es das Gleiche.
Muni hatte Rosalind damals nicht gerade mit offenen Armen aufgenommen. Sie traute ihr nie so recht. Obwohl sie sich natürlich mir zuliebe mit meiner Heirat und mit Rosalind abgefunden hatte. Und die zwei waren auch so weit ganz gut miteinander ausgekommen. Sie sind beide reizende Menschen, und da geht es eben, auch wenn man sich nicht so ganz grün ist.
Dazu kam, dass Muni selig war, als Lix geboren wurde. Ich war ihr einziges Kind, und sie hatte sich immer eine Tochter gewünscht, und nun kam also wenigstens eine Enkeltochter.
Lix hing sehr an Muni. Kein Wunder, sie war von klein an fast mehr von Muni betreut worden als von Rosalind. Und seit sie die höhere Schule besuchte, hatte sie ständig bei Muni gewohnt, und die beiden hatten sich glänzend verstanden.
Aber seit einem halben Jahr, seit es feststand, dass Rosalind diesen Konrad bestimmt heiraten würde, hatte Rosalind eine kleine Wohnung in der Stadt, und Lix wohnte nun bei ihr. Seit Allerneustem sogar in der feudalen Villa des Herrn Killinger. Ja, so schnell verliert man Kinder. Und es war vielleicht für Muni noch härter gewesen als für mich.
Der gute Konrad war natürlich auch keine Jungfrau mehr. Er war schon mal verheiratet und hatte aus dieser Ehe ebenfalls eine Tochter, die etwa in Lix’ Alter war. Rosalind hatte das Wunder vollbracht, die beiden Mädchen nicht nur zusammenzubringen, sondern auch zu Freundinnen zu machen. Jetzt gingen sie in dieselbe Schule. Lix wohnte bereits draußen in Harlaching und wurde von Frau Boll, Konrads tüchtiger Hausdame, mit betreut.
Praktisch lebte Rosalind auch schon dort mit im Haus. Das kleine Appartement behielt sie bloß aus Anstandsgründen bis zu ihrer Heirat.
Muni erzählte mir, dass Lix am Nachmittag dagewesen sei. »Sie dachte, sie würde dich treffen. Sie hat eine Eins geschrieben in Mathematik.«
»Wie schön«, sagte ich. »Von wem sie nur die mathematische Begabung hat? Von mir bestimmt nicht und von Rosalind auch nicht.«
»Von deinem Vater«, erwiderte Muni. »Wenn der mir mein Haushaltsbuch nachrechnete, fand er jeden kleinsten Schummel.« Sie machte eine verdrießliche Miene dabei. Offensichtlich hatte sie das meinem Herrn Papa bis heute nicht verziehen.
»Wusste sie, dass das … das Dings da heute stattgefunden hat?«, fragte ich.
»Natürlich. Du weißt ja, Rosalind war immer dafür, ihre Tochter möglichst aufgeklärt zu erziehen. Und anscheinend haben die beiden Fratzen den Fall ausführlich bekakelt. Diese Dolly hat gesagt: ›Weißt du, Lix, ich finde es prima, dass deine Eltern so modern und vernünftig sind. Wenn ich denke, was es bei uns damals für ein Theater gab, bis wir glücklich geschieden waren. Schreckliche Szenen.‹ – Was sagst du dazu?«
»Was soll man dazu sagen? Ich könnte einen Vortrag über die Jugend von heute halten, aber was soll’s denn? Vielleicht ist es ganz gut, wenn die Mädchen ohne Illusionen aufwachsen. Möglicherweise erleichtert es ihnen das Leben.«
»Ich finde es gräulich«, sagte Muni entschieden.
Dann fragte sie mich, wann ich ins Waldhaus zurückfahren würde, und ich antwortete: morgen.
Ob sie mitkommen solle?
»Danke, nein«, sagte ich ein wenig nervös. »Ich bin schon lange genug allein draußen, und es macht mir wirklich nichts aus. Außerdem habe ich zu arbeiten.«
Muni gab mir einen langen, besorgten Blick. Sie sah die Falten auf meiner Stirn, die Furchen in meinen Mundwinkeln und die ersten grauen Haare an meinen Schläfen und bestimmt auch den Kummer in meinen Augen.
Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Kein Grund zur Besorgnis, Muni. Mir geht es großartig.«
»Schön, mein Junge«, erwiderte Muni und lächelte auch.
Aber ihr Lächeln und der Klang ihrer Stimme hätten mich bald zum Weinen gebracht.
In der Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich stand ganz leise wieder auf, rauchte ein paar Zigaretten und setzte mich schließlich hin, um eine Novelle zu schreiben. »Abschied von der Liebe« sollte sie heißen. Sehr schöner Titel. Aber nachdem ich zwei Seiten vollgeschrieben hatte, fand ich das Unternehmen sinnlos und zerriss die Blätter. Wer wollte das schon lesen?
Am nächsten Morgen fuhr ich mit dem Vormittagszug in meine Einsamkeit zurück. Meine Ruhe und meinen Frieden würde ich haben und tun können, was ich wollte. Das hatte ich mir so gedacht. Wie man sich täuschen kann!
Das Waldhaus
Das Waldhaus liegt in einer Gegend, die der liebe Gott in einer seiner gnädigsten Stunden geschaffen hat. So ein Stück Landschaft ist es, dass man sich immer fragt, wieso es eigentlich so viel Schönheit in der Welt geben kann. Muss ich immer lachen, wenn die Leute sich in ihre Benzinkarren setzen oder sich in die volle Eisenbahn quetschen und dann Hunderte von Kilometern weit in ferne Länder fahren. Nach Italien, ins Tessin, an die Côte d’Azur, an die Costa Brava und neuerdings bis nach Afrika, wo ihnen die Sonne das Hirn versengt. Aber sie haben ja keines. Sonst würden sie nicht so weit fahren, um woanders die Schönheit zu suchen, die ihnen der liebe Gott direkt vor die Tür gesetzt hat.
Um in die Gegend zu kommen, wo mein Waldhaus steht, brauche ich von München aus eine knappe Stunde. Und wie soll ich die Gegend beschreiben, wo soll ich die Worte hernehmen, um ihre ganze Schönheit zu schildern? Ich brauchte viele Seiten dazu, und dann wäre es immer nur noch ein mattes Abziehbild. Außerdem sagt Rosalind immer, meine ewigen Natur- und Landschaftsschilderungen seien altmodisch, heutzutage wolle das kein Mensch mehr lesen.
Also darum nur ganz kurz: Das Waldhaus liegt im Voralpenland, da, wo die Gegend sanft gehügelt ist und man die großen Berge nur aus der Ferne sieht. Das nächste Dorf vom Waldhaus aus heißt Unter-Bolching, ein Stückchen weiter ist Ober-Bolching, und noch ein paar Kilometer weiter ist Tanning, die Kleinbahnstation. Dort kommt mein Zug an, nachdem ich in Rosenheim umgestiegen bin oder vom Bahnhof München-Ost aus gleich die Kleinbahnstrecke benütze. Hört sich ein bisschen umständlich an, ist es aber nicht, wenn man die Züge kennt. Von Tanning aus fahre ich mit dem Rad auf schmalen Straßen über Ober-Bolching und Unter-Bolching bis in meine kleine geliebte Welt.
Da fahre ich durch dunkle, schweigende Nadelwälder, durch ein Stück lichten, vogelliedererfüllten Laubwald, über ein paar Hügel zwischen grünen Wiesen entlang, vorbei an einsamen Bauerngehöften, an sanftäugigen Kühen, die mir freundlich nachschauen. Wenn ich durch die Dörfer fahre, grüßen mich die Leute, und ich grüße sie auch. Sie kennen mich. Sie haben sich an mich gewöhnt.
Die Landschaft ist ohne Härte, ohne grandiose Überraschungen, sie ist ein einziges Abbild von Ruhe, Frieden und Schönheit. Sie ist so harmonisch wie eine Sinfonie von Mozart, und wenn ich mir je ein Paradies vorstellen könnte, dann müsste es so aussehen wie diese Gegend hier, halbwegs zwischen München und dem Chiemsee. Keine berühmte Gegend, keine Kurorte, keine Namen von Weltruf, aber eine friedliche Einheit zwischen Himmel und Erde, die unerschütterlich erscheint.
Ich bin auch schon den ganzen Weg von München her mit dem Rad gefahren, das ist keine große Sache. Und wenn man ein Auto hat, ist man vollends im Nu heraußen. Die Straße München-Rosenheim, nicht die Autobahn, sondern die Landstraße, führt gar nicht sehr weit vom Waldhaus entfernt durch die Gegend. Aber wo man abbiegen muss, um zum Waldhaus zu gelangen, das verrate ich nicht. Wer weiß, vielleicht werde ich doch noch mal berühmt, und dann soll mir nicht jeder hier angekleckert kommen.
Ich fuhr an diesem Tag nicht direkt nach Hause, sondern bog hinter Unter-Bolching rechts ab und schlug den ordentlichen, gut gehaltenen Weg zum Gstattner-Hof ein.
Der Gstattner-Hof liegt an einem gottgesegneten Platz. Hoch oben auf dem geräumigen Plateau eines weit gewölbten Hügels, von dem aus man bei klarem Wetter die Chiemseeberge sehen kann. Dem Gstattner gehört einer der reichsten Höfe rundum, viele Tagwerk Land ; Wiesen, Felder und Wald, eine stattliche Anzahl Kühe und Ochsen, zwei Gäule und was eben sonst noch alles zu einem rechten Bauernhof gehört.
Der Andreas Gstattner ist mein Freund. Ich glaube, ich erzählte es schon. Und seine Frau, die Mali, hat mich ebenfalls ins Herz geschlossen.
Als ich an diesem Tag, es war wieder ein strahlender, himmelblauer Maientag, gegen Mittag auf dem Gstattner-Hof eintraf, heiß und pustend, denn den Hügel hinauf muss man immer ziemlich strampeln, und es ist mein Ehrgeiz, nicht abzusitzen, sondern auf meinen beiden Rädern hinaufzukommen, kam ich gerade zum Essen zurecht.
Zuvor allerdings kam das Wiedersehen mit Dorian.
Russl, der Hofhund vom Gstattner, kam mir schon mit lautem Gebell entgegengestürzt und umtanzte mich freudig, nachdem er mich erkannt hatte.
Dorian ist eine vornehme Natur. Er rennt und bellt niemals mit, wenn Russl rennt und bellt. Aber er erschien immerhin oben, wo der Weg in das Gehöft mündet, und spähte hinab. Ich sah ihn schlank und hochbeinig, eine goldbraune Silhouette vor dem blauen Himmel, da oben stehen.
Dann hatte er erkannt, dass ich es war, der kam. Wie ein Pfeil schoss er den Weg herab. Russl hätte niemals mit ihm Schritt halten können, wenn er nicht schon zuvor da gewesen wäre.
Dorian gab keinen Laut von sich, stürmte wie ein Geschoss auf mich zu, seine seidige Rute wehte wie eine Flagge hinter ihm her, und dann, kurz vor mir, bremste er, seine großen liebenden Augen umfassten mich, er gab einen einzigen Laut von sich, fast könnte man es einen Schluchzer nennen, so menschlich, so aus dem Herzen kommend, hörte es sich an, und dann warf er sich zu meinen Füßen, sein schöner, schmaler Kopf schmiegte sich an meine Wade.
»Grüß dich, Dorian«, sagte ich, beugte mich hinab und strich ihm über den Kopf. Er richtete sich auf, stand nun groß und schlank neben mir, ich brauchte mich nicht mehr zu bücken, um ihn zu streicheln, und so verharrten wir eine Weile schweigend, er den Kopf an meiner Hüfte, ich die Hand auf seinem Kopf, während uns Russl mit wildem Gebell umkreiste.
»Wie geht’s dir, mein Freund?«, sagte ich.
Dorian blickte mich an. »Jetzt wieder gut«, stand in seinen Augen so deutlich geschrieben wie hier auf dem Papier. Ich saß wieder auf, und zu dritt ging es das letzte Stück den Hügel hinan. Dorian wie der Wind voran, Russl springend und hopsend hinterdrein, und am Ende strampelte ich hinauf.
Dorian, um das auch gleich vollständig zu berichten, ist ein reinrassiger Setter, mit einem Fell von kastanienbrauner glänzender Seide, sehr sensibel, mit Augen so beseelt, wie man oft in drei Paar Menschenaugen zusammen nicht Seele finden kann. Mit Bewegungen von gespannter, federnder Kraft und tänzerischer Grazie. Mein Freund Dorian. Andres hatte seinen Russl bellen hören und stand schon vor der Tür und blickte mir entgegen.
»Alsdann«, sagte er, als ich angekommen war, »bist wieder heroben? Kommst grad recht zum Essen. A G’selchts gibt’s.«