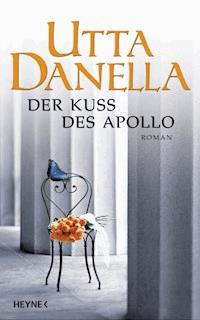6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1987 in München. Die beiden Schwestern Georgia und Karen Wieck könnten unterschiedlicher nicht sein, leben aber in großer Harmonie gemeinsam im elterlichen Haus. Georgia, die verschlossene, ängstliche Malerin und ihre quirlige Schwester Karen, eine bekannte Journalistin, die für ihre politischen Reportagen rund um den Globus reist. Aufgewachsen sind die Schwestern beim Großvater Panino. Der Vater hat die Familie früh verlassen, hat sich nie mehr gemeldet, die depressive Mutter starb, als die beiden Mädchen noch klein waren. Für eine Reportage über die Apartheid reist Karen nach Südafrika. Auf dem Flug lernt sie August Heinze kennen, einen reichen Südafrikaner mit bewegter Geschichte, dessen Familie aus Deutschland stammt. Der besitzergreifende, weltgewandte Mann fasziniert Karen mehr als alle anderen Männer zuvor. Georgia dagegen ist misstrauisch …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Utta Danella
Ein Bild von einem Mann
Roman
hockebooks
Besuchen Sie uns im Internet:www.hockebooks.de
Utta Danella: Ein Bild von einem Mann. Roman
Copyright ©2016 by Erbengemeinschaft Utta Danella vertreten durch AVA international GmbH, Germany
Die Originalausgabe ist 1992 im Heyne Verlag, München erschienen.
Überarbeitete Neuausgabe ©2020 by hockebooks gmbh
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Erlaubnis des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: Joachim Luetke (www.luetke.com) unter Verwendung eines Motivs von Andrey Arkusha/shutterstock.com
ISBN: 978-3-957-51347-2
www.uttadanella.de
www.ava-international.de
Abschiedsszene
Noch eine halbe Stunde bis zum Abflug. Georgia saß kerzengerade in ihrem Sessel, das Gesicht unbewegt, starr der Blick. Keiner sollte ihr anmerken, wie die Angst sie erfüllte, wie mühsam, wie langsam ihr Herz schlug.
Wie töricht von ihr, mit nach Riem zu fahren! Es würde wieder ein Abschied sein, und dann wäre sie endgültig allein, dann hätten alle sie verlassen.
Wäre sie zu Hause geblieben, könnte sie jetzt weinen. Nun saß sie hier unter diesen Leuten, die sie nichts angingen, und musste so tun, als sei die Abreise ihrer Schwester nichts Besonderes, eine alltägliche Angelegenheit, oft genug erlebt. Da stand sie, Karen, ein paar Schritte entfernt, sie redete, sie lachte, freudige Erregtheit ging von ihr aus, wie immer wenn sie eine große Reise begann, wenn sie eine neue Aufgabe vor sich hatte.
Für Georgia hatte sie kein Wort, keinen Blick.
Der Fotograf Raabe, der mit seiner Frau an diesem Tisch saß, hatte schon zweimal den Versuch gemacht, ein Gespräch mit Georgia zu beginnen. Er kannte sie inzwischen ganz gut; während die Reise vorbereitet wurde, war er einige Male ins Haus gekommen, sie hatte ihn liebenswürdig begrüßt, und manchmal schien es, als interessiere sie sich für das Unternehmen. Er beugte sich vor und sprach sie direkt an.
»Kaum zu glauben, dass es jetzt wirklich so weit ist. Aber wenn Ihre Schwester etwas in die Hand nimmt, haut es meist hin.«
Schweigen. Sie schien ihn gar nicht gehört zu haben.
»An sich freue ich mich ja immer, wenn so ein großes Ding startet«, fuhr er fort. »Dieses Mal habe ich nur Sorgen wegen meiner Frau. Ich lasse sie wirklich ungern allein.«
»Ach, sei doch still«, sagte Almut Raabe, eine zierliche Brünette, verlegen.
»Ich wünschte, Frau Wieck, Sie würden sich ein wenig um Almut kümmern.«
Er bekam auch diesmal keine Antwort, aber immerhin einen erstaunten Blick. Seine Ohren röteten sich. Wie konnte er nur so etwas Dummes sagen?
Georgia sah die junge Frau an, die sie bisher gar nicht beachtet hatte. Sicher hatte man sie zuvor mit ihr bekannt gemacht, aber was ging sie die Frau des Fotografen an. Um andere Leute kümmerte sie sich sowieso niemals. Es gab nur einen Menschen auf der Welt, der ihr etwas bedeutete, den sie liebte, um den sie sich, wenn man diesen Ausdruck gebrauchen wollte, kümmerte, das war ihre Schwester.
»Sag mal, Erwin, spinnst du?«, fragte Almut Raabe. »Wie kommst du denn darauf? Frau Wieck kennt mich doch gar nicht.«
»Na, es war halt so eine Idee von mir. Weil wir wegfliegen, und ihr bleibt da. Irgend so eine Gedankenverbindung muss es gewesen sein. Entschuldigen Sie, Frau Wieck.«
Georgia neigte ein wenig den Kopf.
»Ich dachte«, sprach er weiter, »Sie hätten meine Frau mal kennengelernt, beim Filmball. Oder beim Presseball. Oder …« Er schwatzte über seine Verlegenheit hinweg.
»Ich war weder da noch dort«, sagte Georgia kühl.
Das hätte er wissen können, auf Bällen oder Partys sah man sie nie, höchstens bei Opernpremieren oder in einem Konzert.
»Tut mir leid«, murmelte er.
»Was?«, fragte Georgia und nun sah sie ihn lächelnd an.
Dieses sanfte Lächeln, das sie noch schöner machte und allen Hochmut, alle Kälte vergessen ließ.
Raabe schmolz sogleich dahin.
»Na, ich dachte nur. Ich meine, ich dachte, Sie kennen meine Frau. Ich bin zurzeit etwas besorgt um sie.«
»Das sagten Sie schon.« Und etwas abgelenkt von ihrer Angst, betrachtete sie die Frau des Fotografen, die nun auch lächelte. Doch die Traurigkeit in ihren Augen war nicht zu übersehen. Georgia begriff, dass sie nicht die Einzige war, die vor dem Start der Maschine Angst hatte.
»Mir geht es gut«, sagte Almut Raabe leise. »Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen.« Und zu Georgia: »Ich kenne Sie, Frau Wieck. Ich war im Frühjahr bei Ihrer Vernissage.«
»Ah ja?«, machte Georgia.
»Es war ein so schöner Abend. Und so interessante Leute. Und Ihre Bilder waren … Ihre Bilder sind ganz fantastisch.«
»Ja, ich erinnere mich«, sagte Georgia höflich. »Ihr Mann hat recht, damals haben wir uns kennengelernt. Sie trugen ein zartlila Kleid und einen goldenen Schal um den Hals.«
Almut öffnete den Mund vor Erstaunen. Zweihundert, dreihundert Menschen hatten sich in den Räumen der Ausstellung gedrängt. Und sie hatte ein zartlila Kleid getragen.
»Das Auge der Malerin«, sagte Raabe, und dann lachte er.
Er war auch bei der Vernissage gewesen, er kannte die Bilder, und er hatte schließlich einen Blick für Bilder. Ganz instinktiv hatte Almut den passenden Ausdruck gefunden: Sie waren fantastisch, die Bilder, die Georgia Wieck malte, im wahrsten Sinne des Wortes. An eins erinnerte er sich besonders, an ein Gesicht, ein leeres Gesicht. Das eine Auge, braun, befand sich oben an der rechten Ecke der Leinwand, das andere, grün statt braun, an der linken oberen Ecke. Und der Mund nicht etwa unten in der Mitte, sondern rechts unten am Rand.
Fantastisch, jawohl! Er hatte eine Weile vor diesem Bild gestanden, es war relativ groß, etwa achtzig zu siebzig, und hatte zugehört, was andere Betrachter dazu zu sagen hatten. Manche fanden es großartig, auch der Ausdruck fantastisch war gefallen, und irgendeiner hatte gesagt: Für mich ist das krank.
Aber es spielte keine Rolle. Wenn man so viel Geld besaß wie Georgia Wieck, konnte man malen, was man wollte. Sie musste die Bilder nicht verkaufen, der Aufmerksamkeit der Presse und der Kunstwelt konnte sie gewiss sein, nur weil sie, die schöne Wieck, sie gemalt hatte. Georgia hatte unter den Leuten ein wenig geistesabwesend gewirkt, hatte kaum gesprochen, und dann war sie auf einmal verschwunden.
»Meine Schwester ist ein wenig menschenscheu«, hatte Karen Wieck gesagt und ihrerseits die Repräsentation übernommen.
Für eine kleine Weile vergaß Almut ihren Kummer. Sie war fasziniert von dieser Frau, die ihr hier gegenübersaß, hingerissen von diesem Gesicht.
Almut kannte Frauengesichter gut, junge und alte, verlebte und lebendige, hübsche, schöne, auch sehr schöne, aber es kam ihr vor, als hätte sie nie ein schöneres Gesicht gesehen. Es war makellos, es war vollkommen, der helle Teint ohne jede Unebenheit, keine Schminke, die großen Augen fast schwarz, ebenso dunkel das glatte Haar über der hohen Stirn.
Raabe hatte sich ihr wieder zugewandt, fasste ihre Hände mit beiden Händen.
»Du weißt, was du mir versprochen hast.«
Sie befreite sich unwillig aus der Umklammerung.
»Wir reden seit Tagen ununterbrochen darüber, und versprochen habe ich gar nichts.«
»Doch, hast du. Gestern Abend. Du wirst schön ausschlafen, wirst gut und reichlich essen und viel spazieren gehen, solange das Wetter noch so schön ist.«
»Ich werde sechs Wochen allein sein, und ich würde diese sechs Wochen leichter ertragen, wenn ich wieder arbeiten könnte.«
Er fasste wieder nach ihrer Hand, Georgia sah, wie sich der Mund der jungen Frau verzog, gleichzeitig kam etwas wie Trotz in ihren Blick.
»Aber ich …«
»Sechs Wochen gehen schnell vorbei. Ich will nicht, dass du schon wieder arbeitest, es ist zu anstrengend. Du musst die meiste Zeit stehen. Du könntest ja zu deiner Mutter fahren.«
»Auch das noch! In diesem Zustand!« Und dann, fast wütend, fügte sie hinzu: »Hör endlich auf damit, ich kann es nicht mehr hören.«
Almut Raabe blickte Georgia an, die jedes Wort verstanden haben musste, wenn auch nicht deren Sinn. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, sie zog ihre Hand wieder heftig zurück und wiederholte gereizt: »Hör endlich auf!«
Der Zustand war kein Zustand mehr: Almut hatte vor drei Wochen eine Fehlgeburt gehabt, sie war im vierten Monat gewesen, und bis dahin war ihre Schwangerschaft ganz normal verlaufen.
Georgia lehnte sich in ihrem Sessel zurück, der Disput der beiden interessierte sie nicht. Sie blickte auf ihre Schwester. Die stand mit dem Rücken zu ihnen, schlank und biegsam in dem hellen Hosenanzug, und selbst von hinten sah man ihr an, wie voller Leben und Schwung sie war. Karen tat, was sie immer tat, wenn sie nicht arbeitete: sie flirtete.
Zwei Männer waren es, mit denen sie sich beschäftigte, der Chefredakteur und dieser junge Beau, der seit Neuestem eine Rolle in Karens Leben zu spielen schien.
Georgia stand zögernd auf. Warum konnte Karen in diesen letzten Minuten, ehe sie für lange Zeit fort sein würde, nicht mit ihr sprechen? Vielleicht war es das letzte Mal, dass sie sich sahen.
Georgia presste die Lippen zusammen. Diese Einsamkeit, diese fürchterliche Einsamkeit. Ob Karen jemals begriff, was es bedeutet, allein gelassen zu werden?
Almut neigte sich zu ihrem Mann und flüsterte: »Welche gefällt dir besser?«
»Wie? Was meinst du?«
»Ich möchte wissen, welche von den beiden Wieck-Mädchen dir besser gefällt.«
»Ach so.« Raabe lachte. »Karen natürlich. Sie ist ein prima Kumpel. Ich arbeite gern mit ihr, wir sind ein Superteam. Denk an die argentinische Reportage. Und was wir jetzt machen, wird noch besser. Da fällt auch noch für andere Blätter, außer für Karens, eine Menge ab. Und vermutlich können wir in Kapstadt auch mit einem First-Class-Fernsehteam was machen. Das ist es, verstehst du? Das wird ganz groß. Diesmal schlagen wir sie alle, Karen und ich.«
Er strahlte, und Almut begriff, dass er eigentlich schon fort war, auch wenn er hier noch neben ihr saß.
Sie würde nicht mehr weinen, auch wenn es acht Wochen dauern sollte, dann würde sie einfach doch wieder arbeiten. Im gleichen Augenblick betrat Thomas Keller die Senator-Lounge, oder besser gesagt, er stürmte herein, denn langsam hatte ihn noch keiner gehen oder kommen sehen.
»Da kommt Tommy«, sagte Almut.
Raabe stand auf. »Fürwahr, ein treues Herz schlägt in dieser Brust«, grinste er, und Tommy, der schon da war, lachte.
»Ich kann mir die Gelegenheit doch nicht entgehen lassen, Karen wenigstens noch einmal zu umarmen«, sagte er, schlug Raabe auf die Schulter, küsste Almut auf die Wange und machte einen artigen Diener vor Georgia.
Sie reichte ihm die Hand, und Tommy neigte sich zu einem formvollendeten Handkuss darüber. Georgia war die einzige Frau unter Gottes Sonne, bei der er so was tat.
»Du siehst, der hohe Chef ist eigenhändig persönlich da«, sagte Raabe, »und den Typ, mit dem Karen flirtet, kennst du ja wohl. Lorenzo bello, eines reichen Vaters Sohn, und bereit, deiner verflossenen Braut die Welt im Ganzen oder auch in wohlsortierten kleinen Stückchen zu Füßen zu legen.«
Karen, obwohl ein paar Schritte entfernt, hatte wie immer jedes Wort gehört. Sie drehte sich lachend um, das Glas mit dem Tomatensaft in der Hand.
»Die Welt liegt mir sowieso zu Füßen, heute noch, jedenfalls ganz Afrika. Grüß dich, Tommy. Nett, dass du gekommen bist.«
Ein Jahr lang waren sie ein Paar gewesen, Karen Wieck und Thomas Keller, ein ausnehmend schönes Paar sogar, beide groß, schlank, blond und zumeist guter Laune. Jetzt war es aus, warum, wusste keiner.
Georgia, wie immer von Eifersucht geplagt, hatte depressive Anfälle bekommen, als es anfing, obwohl sie mittlerweile an Karens Affären gewöhnt sein müsste. Erstaunlicherweise hatte sie sich dann mit Tommy ganz gut angefreundet, er war warmherzig, aufrichtig und viel sympathischer als der Beau, mit dem Karen zurzeit beschäftigt war.
»Warum, Karen?«, hatte sie gefragt. »Liebst du ihn nicht mehr?«
»Uff«, hatte Karen gemacht. »Georgia, hör auf, mich so schwachsinnig anzureden. Ich hatte ihn gern, und ich habe ihn noch gern, und bin vor allem gern mit ihm ins Bett gegangen. That’s it. Das dauert eine Weile, und dann hat man es gehabt.«
Georgia hatte sich an Thomas Keller gewöhnt, er kam oft am Abend, vor oder nach einer Premiere, brachte immer etwas mit, selten Blumen, meist eine Flasche Whisky oder Rote Grütze von Käfer, die er pfundweise verschlang, manchmal waren es Platten oder eine CD mit dem letzten grölenden Hit, dazwischen auch ein Klavierkonzert von Mozart.
Dann saß er auf dem Teppich, saß endlich mal still, die Beine im Türkensitz, wenn er sich nicht gleich der Länge nach hinlegte, und hörte zu, ganz hingegeben.
»Der konnte Musik machen, was? Kann heute keiner mehr.«
»Wir können sie hören«, hatte Georgia darauf erwidert. »Der Technik sei Dank. Der Lärm, den du sonst mitbringst, auf den kann ich leicht verzichten.«
»Passt auch nicht zu dir, Madonna. Aber das ist nun mal die Zeit, in der wir leben. Und so wie dieser Göttersohn komponiert hat, kann keiner mehr komponieren.«
»Sie können es nicht komponieren, aber sie können es spielen und singen, alle Orchester, alle Kammermusiker, alle Solisten, alle Sänger. Wie ist das möglich, wenn es doch nicht in unsere Zeit passt, wie du sagst. Sie bringen es uns vollendet dar, vermutlich besser als zu Mozarts Zeit. Aber diese Musik machen, das kann keiner.«
»Machen, das ist es. Machbar ist alles, hier und heute. Denken wir. Weit davon entfernt. Kein neuer Mozart, kein neuer Schiller, kein neuer Rembrandt, kein neuer Michelangelo, kein neuer Johann Strauß, kein neuer …«
Georgia unterbrach ihn.
»Diese Reihe kannst du beliebig fortsetzen. Auch kein neuer Verdi oder Wagner. Nicht mal ein neuer Franz Lehár. Und weißt du, warum? Was würden du und deinesgleichen tun mit einem neuen Verdi, einem neuen Mozart, einem neuen Schiller? Ihr würdet ihn in Grund und Boden donnern. Ihr würdet ihn so verreißen, dass er sich selbst nicht wiedererkennt.«
»So, so, du meinst also, wir heutigen Kritiker seien nicht imstande, ein Genie zu erkennen, wenn sich denn eines hören und sehen ließe.«
»Das meine ich. Und wenn du ehrlich bist, wirst du mir recht geben.«
Da lag er auf dem Teppich, lang wie er war, beide Arme ausgebreitet wie ein Gekreuzigter. Dann sagte er: »Es wäre der größte Wunsch meines Lebens, einem Genie zu begegnen. Oder, noch besser, es zu entdecken.«
Ungerührt erwiderte Georgia: »Keiner von euch Zeitungsschmierern würde ein Genie erkennen, selbst wenn er ihm gegenüberstünde.«
Tommy schwieg eine Weile, dann fragte er: »Nennst du deine Schwester auch Zeitungsschmierer?«
»Stell dir vor, jemand würde heute eine Operette schreiben wie Franz Lehár. Was würdet ihr mit dem machen? Kitsch und Käse. Käse und Kitsch, wäre das Einzige, was euch dazu einfiele. Ich spreche absichtlich von Lehár, damit wir nicht bei Mozart kleben bleiben. Beide haben für das Ohr und das Gefühl, für die Sinne und für das Herz zuhörender Menschen Musik gemacht. Das trifft genauso auf Verdi und Wagner zu. Und auf viele andere. Denk bloß an Richard Strauß.«
»Nennst du deine Schwester auch Zeitungsschmierer?«, wiederholte Tommy.
»Karen ist kein Feuilletonjournalist, sie interessiert sich nur für Politik. Und da besteht wohl kaum die Möglichkeit, einem Genie zu begegnen.«
»Vielleicht war das früher auch anders. Denken wir mal an Bismarck oder Napoleon oder Friedrich den Großen oder Julius Cäsar.«
Georgia musste lachen. »Auch diese Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Es erinnert mich an ein Spiel, das wir als Kinder mit Panino spielten. Nenn mir einen großen Mann aus dem zwölften Jahrhundert, fragte er beispielsweise. Karen war da immer viel schneller als ich, ihr fiel sofort einer ein, ich musste erst nachdenken.«
Das war der Abgrund, der Thomas Keller von Karen Wieck trennte – sie eine Journalistin, der alle großen Blätter offen standen, deren Name selbst im Ausland gut bekannt war, die schreiben konnte, dass sich der Bericht einer Parlamentsdebatte wie ein spannender Krimi las, und er ein Feuilletonjournalist zweiter Güte. Er berichtete auch nur über Premieren zweiter und dritter Güte, über kleine Privattheater, Hinterhofbühnen, selbstgemachtes Kabarett, und als Höhepunkt ein Popkonzert. Und er tat sich immer schwer, bis er zusammengebastelt hatte, was die Zeitung drucken sollte, sowieso strich man ihm die Hälfte davon.
Es war alles katalogisiert in dieser modernen Welt, auch die Redaktion einer großen Zeitung. Da schrieben einige über Oper und Konzert, und ein anderer über Ballett, für die Premieren der großen Theater hatte sie ihre bestimmten Rezensenten. Ganz zu schweigen von bildender Kunst oder gar Literatur.
Tommys Unglück war, dass er von allem eine Menge verstand, er hatte schließlich lange studiert, er konnte darüber reden, und er hätte auch gern darüber geschrieben, nur, man ließ ihn nicht. Darüber beklagte er sich oft bei Georgia, sie ließ ihn reden, hörte zu oder auch nicht, er interessierte sie so wenig wie die anderen verflossenen Liebhaber ihrer Schwester. Einerseits war sie froh, wenn eine Affäre sich dem Ende näherte, andererseits würde dann wieder ein neuer Mann einen Platz in Karens Leben beanspruchen, und genauso wie jeder andere zuvor ein Störenfried, ein Ärgernis für Georgia sein. Darum hätte sie ganz gern diesen netten, harmlosen Tommy behalten, er störte nicht allzu sehr, und dass Karen ihn nicht wirklich liebte, wusste sie.
Aber wen liebte Karen schon wirklich außer sich selbst, außer ihrer Schwester, außer Panino, und außer ihrem Pferd und dem Hund? Niemand. Und wenn es denn unbedingt ein Mann sein musste, wäre es besser gewesen, diesen zu behalten.
»Warum magst du ihn nicht mehr?«, hatte sie also gefragt. »Er ist doch ein netter Junge.«
»Sicher. Er ist nett. Und pflegeleicht. Und zudem versteht er es noch, dich zu unterhalten.«
Dieser Dialog hatte an einem Abend, oder besser gesagt in einer Nacht vor ungefähr einem Monat stattgefunden. Karen kam gegen zwei Uhr nachts nach Hause und fand Tommy dozierend auf dem Boden sitzen, Georgia hing blass und müde in einem Sessel. Auf dem Kaminsims stand eine leere Whiskyflasche.
Karen war mit dem Hund ins Zimmer gekommen, der sie wie immer in der Diele erwartet hatte.
»Sag mal, Tommy, bist du noch ganz dicht? Was belämmerst du meine Schwester mitten in der Nacht mit deinem blöden Geschwätz? Zieh ab, aber tempo allegro.«
Er blickte unglücklich zu ihr auf. »Ich hab’ ja nur gewartet, bis du kommst.«
»Da bin ich, und nun hau ab.«
»Darf ich nicht noch ein bisschen bleiben, jetzt, wo du da bist?«
Karen stand immer noch an der Tür, eine steile Falte erschien auf ihrer Stirn.
»Nein. Und nun verschwinde. Ich möchte es nicht noch einmal sagen.«
»Leihst du mir wenigstens deinen Wagen? Ich bringe ihn morgen früh mit.«
»Ich denke nicht daran«, erwiderte Karen mit einem Blick auf die leere Flasche. Sie wusste, dass Georgia höchstens zwei oder drei Glas davon getrunken hatte. »Wie bist du denn hergekommen?«
»Zu Fuß. Es war ein schöner Abend mit Sternenhimmel.«
»Ist es noch. Die Luft wird dir guttun. Da wirst du wieder nüchtern und kannst dir überlegen, was du über den Schmarrn schreiben sollst, den du heute gesehen hast. Warst du nicht in der kleinen Quetschbude hinter dem Max-Weber-Platz?« Obwohl Karen diese Theaterchen nicht besuchte, wusste sie immer genau, was wo gespielt wurde.
Als die Schwestern allein waren, sagte sie: »Dass dir dieser Bursche nicht auf den Geist geht mit seinem endlosen Geschwätz.«
»Er ist nicht dumm«, antwortete Georgia, die Augen waren überschattet von Müdigkeit, das Gesicht weiß.
»Geh zu Bett, meine Kleine. Ich bin auch müde. Um acht geh ich reiten, und vor der Redaktionskonferenz muss ich noch zu Andreas wegen diesem Krach mit den Sozis.«
»Ich denke, da warst du heute Abend.«
»Wollte ich. Aber er war nicht da. Musste plötzlich zu einer Besprechung, sagte seine Frau.«
»Wo bist du denn dann so lange gewesen?«
»Ich war mit Lorenz Balke zum Essen und dann noch in einer Disco.«
»Lorenz Balke? Wer ist das denn?«
»Der Sohn vom Chemie-Balke. Flotter Junge. Klotzig reich.«
»Ach Gott«, sagte Georgia. »Schon wieder einer.«
»Ich habe keine Zeit, weißt du doch. In vier Wochen starte ich nach Johannesburg.«
»Ach, Karen! Warum denn nur? Dann bist du wieder so weit weg.«
Karen hatte gelacht. »Du musst dich entscheiden, was schlimmer ist, ein neuer Mann oder eine neue Reportage. Und nun geh ich noch ein paar Schritte mit Pedro.«
»Allein? Mitten in der Nacht? Da hättest du doch auch ein Stück mit Tommy gehen können.«
»Eben gerade nicht.«
»Dann komme ich mit.«
»Du gehst schlafen, meine Kleine. Ich fürchte mich nicht. Und es ist wirklich eine schöne Nacht, warm wie im Sommer.«
Das war Mitte September gewesen, und nun flog Karen wirklich nach Südafrika, für endlose Wochen, ans andere Ende der Welt.
Eine Viertelstunde bis zum Abflug der Maschine nach Frankfurt, in der Senator-Lounge rüstete man zum Aufbruch.
Karen stand jetzt ein wenig abseits mit dem Chefredakteur. Andere hätten es als Auszeichnung empfunden, dass er sich zum Abflug einer seiner Journalistinnen einfand, für Karen war es eine Selbstverständlichkeit. Sie und der Chef waren befreundet, er mochte sie, ihre Arbeit, ihre Art zu schreiben, ihre Sicherheit, Probleme zu erkennen und darzustellen.
Raabe, seine Tasche und die wertvolle Kamera in der Hand, dachte: ob sie auch mit ihm schon …
Nein. Diese Frage konnte er sich selbst beantworten. Dazu war Karen zu klug. Mit einem kleinen Feuilletonjournalisten, gut. Mit dem Chef, nein. Niemals würde sie ihre stolze Unabhängigkeit aufgeben.
Er empfand fast so etwas wie Zärtlichkeit für sie. Wie gern er sie hatte. Wer eigentlich liebte sie nicht? Nun, viele Frauen, das mal gewiss, und nicht nur in der Redaktion.
»Off we go«, rief er. »Es wird Zeit, Kollegin.«
Karen schüttelte das kurze blonde Haar aus der Stirn. »Ohne uns fliegen sie schon nicht.« Sie blickte sich um. »Wir sind offenbar die einzigen VIPs an Bord.«
Raabe grinste. »Du vielleicht. Wer fragt schon nach mir?«
»Spiel bloß nicht den Bescheidenen. Seit der Penner-Serie bist du berühmt.«
Die hatte er im vergangenen Jahr gemacht. Armut in der reichen Stadt. Es war typisch für sie, dass sie es jetzt erwähnte, vor dem Chef. Gerade diese Serie, nicht etwas, das sie zusammen gemacht hatten. Sie war sehr fair.
Er wandte sich wieder seiner Frau zu, beugte sich zu ihr, küsste sie auf die Schläfe und flüsterte etwas sehr Dummes: »Wenn ich zurück bin, probieren wir es noch einmal.«
Almut empfand fast so etwas wie Hass. Typisch Mann. Wer war sie denn? Ein Versuchsobjekt?
»Mach, dass du wegkommst. Ich werde froh sein, wenn ich dich eine Weile nicht sehe.«
Er war erstaunt, betroffen. Würde ein Mann je verstehen, was eine Frau dachte und fühlte?
Georgia hatte verstanden, was die Frau des Fotografen gesagt hatte. Nicht seine Worte. Es amüsierte sie. Diese zierliche kleine Frau war offenbar gar nicht so harmlos, wie sie ihr bisher erschienen war. Auch sie fühlte sich nicht mehr so elend. Wenn Karen erst fort war, würde sie sich schon damit abfinden, wie immer, wie jedes Mal.
Während sie zum Abflugschalter gingen, sagte sie etwas für sie Ungewöhnliches zu Tommy Keller, der neben ihr ging. »Ich hoffe, Tommy, du wirst mich trotzdem gelegentlich besuchen.«
»Trotzdem was?«, fragte Tommy geistesabwesend, den Blick auf Karen gerichtet, die mit ihren langen beschwingten Schritten vor ihnen ging.
»Vergiss es«, erwiderte Georgia.
Es würde kein Trost sein, wenn Tommy manchmal auf ihrem Teppich saß, Whisky trank und Mozart hörte.
Kaffee und Cognac
Der Chefredakteur verabschiedete sich rasch, Tommy zögerte. »Darf ich die Damen zurück in die Stadt fahren?«
»Aber das tue ich doch selbstverständlich mit Vergnügen«, sprach der schöne Lorenz und blickte Georgia eindringlich an.
»Danke«, erwiderte Georgia kühl. »Wir sind mit unseren eigenen Wagen da.«
Almut schwieg dazu. Sie waren mit dem Lufthansa-Bus gekommen, sie und ihr Mann. Doch sie begriff, dass Georgia diese kleine Abschiedsszene beherrschen wollte nach dem großen Abschied.
»Da haben wir es wieder mal«, sagte Tommy mürrisch. »Drei Autos unterwegs, um drei Personen zu befördern. Daran ersticken wir so kontinuierlich.«
»Zunächst waren wir fünf Personen«, verbesserte Georgia.
»Und wenn wir dich noch dazurechnen, und euren Chef, und diesen Herrn hier«, ihr Blick glitt an dem schönen Lorenz vorbei, »dann waren es noch mehr Autos und nicht viel mehr Personen. Gute Nacht allerseits.« Das klang entschieden.
Lorenz machte eine knappe Verbeugung und dachte: Eingebildete Ziege! Tommy sagte melancholisch: »Leb wohl, Madonna. Ich werde dich nie vergessen.« Dann verschwand er, für seine Verhältnisse bemerkenswert langsam Richtung Ausgang.
Georgia hatte verschwiegen, dass sie mit dem Taxi gekommen waren. »Lass bloß die Karre stehen«, hatte Karen gesagt. »Du fährst viel bequemer mit dem Taxi zurück.« Karen wusste schließlich, was für eine miserable Autofahrerin Georgia war, und wenn sie jemals Angst um ihre Schwester hatte, dann, wenn sie am Steuer saß.
»Meine Kleine«, sagte Karen oft, »denk immer daran, dass es genügend Taxen in dieser Stadt gibt.«
Meine Kleine, so nannte Karen ihre Schwester, obwohl Georgia nur ein Jahr und vier Monate jünger war. Doch es war nicht das Alter, es war ihr Leben, das sie voneinander unterschied. In gewisser Weise war es daher verständlich, was Almut Raabe sagte, als sie beide, Georgia und Almut, zwei bisher Fremde, in der Abflughalle in Riem standen. »Man kann es gar nicht begreifen, dass Sie Schwestern sind.«
Der Satz kam ganz spontan, und gleich darauf fügte sie hinzu: »Entschuldigen Sie die alberne Bemerkung, Frau Wieck.«
Georgia lächelte. »Wir sind daran gewöhnt, das sagt jeder. Das hat man schon gesagt, als wir noch Kinder waren.«
Almut versuchte, sich die Schwestern als Kinder vorzustellen, das war gar nicht schwer. Zwei kleine Mädchen, die eine dunkelhaarig mit großen, dunklen Augen, immer etwas still, etwas scheu, die andere blond, mit hellen Augen, mit sprühendem Temperament, sicher lebhaft, laut, zu allen möglichen Streichen aufgelegt.
»Ich sehe es direkt vor mir«, sagte sie eifrig.
»Was?«, fragte Georgia.
»Sie beide. Als kleine Mädchen. So ein … ein bezaubernder Gegensatz. Sicher waren Ihre Eltern ganz vernarrt in diese Kinder.«
»Ah ja«, machte Georgia.
»Und Sie verstehen sich so gut, das ist ja das Allerschönste daran. Ich meine, es ist nicht immer bei Schwestern so, nicht?«
Almut kämpfte mit ihrer Befangenheit vor diesem prüfenden Blick der dunklen Augen. »Ich höre das immer von meinem Mann. Er ist restlos begeistert von Karen. Er arbeitet so gern mit ihr zusammen, und darum erzählt er auch so viel von ihren gemeinsamen Reisen. Karen hat ja ein Buch angefangen über die argentinische Reportage. Karen den Text, und mein Mann die Bilder. Aber nun wird das ja irgendwie – irgendwie …«
»Überlagert durch Südafrika«, half Georgia freundlich aus. »Da können Sie ganz beruhigt sein. In Karens Kopf ist alles wohl geordnet. Ich wäre sehr froh, wenn sie eine Weile am Schreibtisch sitzen und nicht ewig in der Welt herumzigeunern würde.«
»Aber als Nächstes wollen sie in die Antarktis.« Almut hob erschrocken die Hand an den Mund. »Oh, das hätte ich vielleicht nicht verraten sollen.«
Georgia lächelte. »Ich weiß auch das. Meine Schwester redet ununterbrochen von ihren Plänen. Auch von denen, die glücklicherweise nicht zur Ausführung kommen.«
Zum Beispiel der: »Denk mal an Jules Verne. Eine Reise um die Erde, diesmal in acht Tagen, wie fändest du das?«
»Nicht sehr originell. Das veranstaltet heute jedes Reisebüro für seine Kunden.«
Oder: »Ich wünschte, es wäre mal wieder irgendwo Krieg. Ich möchte dabei sein.«
»Als was, Karen?«
»Als Kriegsberichterstatter natürlich.«
»Hast du gesagt, du wünschst dir, dass es Krieg gibt?«
»Nein, so meine ich es nicht. Ich meine nur, falls es mal einen gibt.«
»Es gibt pausenlos Krieg auf dieser Erde.«
»Für Vietnam war ich noch zu jung. Ich könnte mal in den Libanon. Oder nach Sri Lanka. Aber das ist alles kein Krieg. Nicht so richtig.«
»Du wünschst dir also meinen Tod?«
»Aber Georgia! Bist du verrückt?«
Ob Karen je begriff, ob sie trotz ihrer vielen Talente je so viel Fantasie auf brachte, um zu begreifen, was es für ihre Schwester bedeutete, immer wieder für längere Zeit allein gelassen zu werden? Georgia war ziemlich sicher, dass Karen es sehr gut begriff.
Es war relativ ruhig in dieser Abendstunde in der Abflughalle von Riem. Ein Flug nach Berlin wurde aufgerufen, dann einer nach London.
Paris und London, das waren die einzigen Flüge, zu denen Karen sie je hatte überreden können. Georgia hatte Angst vor dem Fliegen, vor dem Eingesperrtsein da oben in der Luft.
Karen verstand das nicht, für sie war Fliegen nur der Weg zu einem Ziel.
Almut Raabe blickte befangen in das schöne, blasse Gesicht, das an ihr vorbei, in ein Nichts zu blicken schien.
»Dann müssen wir wohl gehen«, sagte sie.
»Ja«, erwiderte Georgia und rührte sich nicht.
Sie dachte an das leere Haus. Der Hund würde warten, und sie musste ihn trösten, auch morgen und übermorgen, denn wie immer würde er sich tagelang nicht beruhigen können darüber, dass Karen nicht da war.
»Wir könnten noch einen Cognac trinken«, schlug sie vor. »Und uns darüber freuen, dass wir nicht nach Südafrika fliegen müssen. Außerdem soll ich mich ja um Sie kümmern.«
»Oh«, rief Almut. »Das wäre ja wunderbar.«
»Was?«, fragte Georgia amüsiert.
»Wenn wir noch etwas trinken. Einen Cognac. Und vielleicht einen Kaffee. Ich komme sowieso viel zu früh in die leere Wohnung zurück.«
»Ihre letzten Worte vorhin haben sich aber gar nicht so angehört.«
»Tut mir ja auch leid. Aber es war so eine quälende Rederei in den letzten Tagen. Darum bin ich ganz froh, wenn er eine Weile verschwunden ist. Aber sonst natürlich …« Sie verstummte.
Als sie Kaffee und Cognac vor sich stehen hatten, sagte Georgia: »Sie müssen doch daran gewöhnt sein, dass Ihr Mann oft unterwegs ist.«
»Früher war er meist da. Er hat nicht für Zeitschriften gearbeitet. Meist waren es Auftragsarbeiten für die Industrie, das war seine Spezialität. Auch Porträts von Künstlern, das war ihm sehr wichtig. Ihre Schwester hat ihn gewissermaßen entdeckt. Sie hat ihn mit nach Rom genommen, und nach Hamburg, und dann haben sie diese Reportage in England gemacht. Und schließlich die große Argentinienreportage. Er ist Karen sehr dankbar. Er sagt, ohne sie wäre er nie aus seinem Atelier rausgekommen.«
»Ja, ich kenne das alles. Karen findet, er ist unerhört begabt, er hat sofort den richtigen Blick für das Wesentliche.«
»Karen ist einfach toll, sagt Erwin. Und diese Reise nach Südafrika hat ihn restlos begeistert. Er hat in letzter Zeit alles gelesen und angeschaut, was darüber erschienen ist. Das ist höchst aktuell, findet er, diese Apartheid und das alles. Man muss einen eigenen Eindruck gewinnen und nicht ungesehen alles glauben, was hier darüber geschrieben wird.«
Georgia nickte. Es waren Karens Worte.
Südafrika war ihr genauso gleichgültig wie Argentinien. Sie hörte sich Karens lange und begeisterte Schilderungen an, die vor der Reise und die nach der Reise, doch die fernen Länder lockten sie nicht. Viel lieber wäre sie wieder einmal in den Schwarzwald gefahren. Als Kind hatte sie dort längere Zeit verbracht; der breit hingelagerte Hof mitten in einer weiten, grünen Wiese, der Wald dahinter, die sanft ansteigenden Hügel … sie sah das alles noch vor sich. Das Märchen, das man ihr erzählt hatte – Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon viel hundert Jahre alt.
Auf die Idee, allein dorthin zu fahren, kam sie nicht.
Almut nippte an ihrem Cognac. »Es ist nur gerade jetzt …«, sagte sie, die Augen wieder voller Traurigkeit.
»Was ist denn jetzt so Besonderes?«, fragte Georgia sanft.
Almut erzählte von dem Kind, das sie verloren, und wie sehr sie sich darauf gefreut hatte.
»Wir sind seit fünf Jahren verheiratet. Und es war nie etwas. Ich dachte immer, mit mir ist etwas nicht in Ordnung, obwohl der Arzt sagte, davon könne keine Rede sein. Aber es ist eben doch so. Sonst wäre es ja gut gegangen.«
Almuts Augen füllten sich mit Tränen, das hatte Georgia an diesem Abend schon einmal gesehen.
»Entschuldigen Sie«, flüsterte Almut. »Ich bin noch so … ich meine, irgendwie durcheinander. Sie können das sicher nicht verstehen.«
»Warum nicht? Ich hätte auch gern ein Kind.«
Mit tränennassen Augen blickte Almut die schöne fremde Frau an. »Sie?«
»Ja«, sagte Georgia ruhig. »Was finden Sie daran so merkwürdig? Ist es nicht normal?«
»Doch, natürlich. Ich dachte nur, bei Ihnen ist das ganz anders. Weil Sie … weil Sie …«
»Weil was?«, fragte Georgia, das Glas in der Hand. Sie trank selten Alkohol, aber dies war so ein Abend, wo sie ihn brauchen konnte.
»Ach, ich rede Unsinn. Sie haben so ein wunderbares Leben, Sie und Karen.«
»Ein wunderbares Leben? Wer sagt das denn?«
»Ich weiß ja nur, was Erwin erzählt. Karen, na ja, die kennt ja jeder. Aber Sie malen diese herrlichen Bilder.«
»Wollen Sie sagen, meine Bilder haben Ihnen gefallen?«
Almut blickte hilflos. »Doch. Ich verstehe nicht viel davon. Aber es stand ja sogar in der Zeitung.«
Georgia lachte amüsiert. »Ich habe sogar ein paar von meinen Bildern verkauft. Dafür hat Karen gesorgt. Sogar ihr Chefredakteur hat eins erstanden. Ich fühlte mich hochgeehrt.«
Es hing in seinem Büro, wie Georgia wusste. Nach Hause durfte er es nicht mitnehmen, da würde wohl seine Frau protestieren.
Almut war an dem Chefredakteur nicht weiter interessiert, sie hatte ihn heute zum ersten Mal gesehen, und auch nur von Weitem. Viel mehr beschäftigte sie das Kind, das Georgia Wieck sich wünschte.
»Es ist so seltsam«, sagte sie, »dass Sie nicht verheiratet sind. Karen hat so viele Verehrer. Und Sie doch sicher auch, Frau Wieck. Ach, entschuldigen Sie. Ich rede Blödsinn.«
Georgia lächelte. »Das hat mehr oder weniger familiäre Gründe. Wir wollten uns nie trennen, Karen und ich. Sie hat sowieso keine Zeit zum Heiraten. Und auch keine Lust dazu. Ein Ehemann sei nur lästig, das ist ihre Meinung. Verehrer, wie Sie es nennen, Frau Raabe … wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen?«
»Almut.«
»Verehrer hat Karen viele, Almut. Und mehr als das. Sie führt ein sehr unbekümmertes Leben. Sie verliebt sich öfter mal, sie nimmt das leicht. Das war in ihrer Kindheit schon so. Viele Freunde, viel Amüsement, das beginnt, das hört auf. Es hat sie noch nie ernsthaft erwischt, so nennt sie das wohl.«
»Ach so«, machte Almut und unterdrückte die Frage, die ihr auf den Lippen lag.
Georgia kannte sie trotzdem.
»Bei mir ist das anders. Bei mir müsste es Liebe sein. Was man halt so darunter versteht. Nach Karens Ansicht ist das nur Einbildung. Ich hatte vor einigen Jahren mit dieser Einbildung zu tun, und ich meinte es ernst.«
»Und dann?«
»Karen sagte, du wirst doch diesen Blödmann nicht etwa heiraten wollen.«
»Und dann?«, wiederholte Almut.
»Ich habe ihn nicht geheiratet.«
»Ach so«, sagte Almut. Viel mehr fiel ihr dazu nicht ein. Sie erinnerte sich, was Erwin vor einiger Zeit über Karen gesagt hatte: Es geht immer nach ihrem Willen, sie wird sich jederzeit und überall durchsetzen, und das ohne jede Härte, nur mit ihrem Charme, mit ihrer Siegessicherheit, ich habe noch nie in meinem Leben einen Mann, geschweige denn eine Frau gekannt, die so siegessicher durchs Leben geht. Es ist fabelhaft. Es ist beneidenswert. Diese Frau ist ein Phänomen.
Normalerweise hätte Almut eifersüchtig sein müssen. Aber dazu bestand kein Grund, das wusste sie genau. Für Karen war Erwin Raabe ein Partner, mit dem sie arbeitete. Kein Mann. Das war so deutlich zu sehen, dass man gar keinen Zweifel haben konnte. Alles an dieser Frau war übersichtlich. Gab es das wirklich, eine Frau, die immer nur tat, was sie wollte? Was sie für richtig hielt?
Du wirst doch diesen Blödmann nicht heiraten …
Weiter zu fragen traute sich Almut nicht. Es war sowieso fast unwirklich, dass sie hier mit dieser seltsamen Frau saß, die hochmütig und abweisend gewirkt hatte, und sie nun mit einem freundlichen Lächeln betrachtete und alle Zeit der Welt zu haben schien.
Dass Georgia einfach Angst hatte, in das leere Haus zurückzukehren, konnte sie nicht wissen.
»Trinken wir noch einen Cognac«, schlug Georgia vor, ihre Stimme klang heiter. »Ausnahmsweise mal. Da Sie nicht mehr schwanger sind, Almut, dürfen Sie das. Und nun erzählen Sie mir von Ihrem Beruf. Ich habe vorhin, als wir da drin saßen, einen Teil Ihres Gespräches mit Ihrem Mann gehört. Sie möchten arbeiten, und er will es nicht.«
»Nein, er will es nicht. Ich soll mich erholen, sagt er. Wovon eigentlich? Von dem Kind, das ich nicht bekommen habe? Mir ginge es viel besser, wenn ich arbeiten könnte. Dann wäre ich nicht so allein und müsste nicht immerzu darüber nachdenken. Ich bin Kosmetikerin.«
»Ah ja!«
»Bei Kollander. Das ist einer der besten Kosmetiksalons in München. Wenn nicht überhaupt der beste«, erklärte sie stolz.
»Ah ja?«
»Ich liebe meinen Beruf. Und ich glaube, ich bin ganz gut. Ich habe aufgehört, als ich im dritten Monat war. Aber ich könnte morgen wieder anfangen, sie nehmen mich mit Handkuss. Ich habe meine Kunden, wissen Sie. Die waren sehr traurig, dass ich aufgehört habe.«
Georgia begann das Gespräch zu langweilen.
»Ein schöner Beruf«, sagte sie liebenswürdig. »Für die Schönheit und das Wohlbefinden der Frauen zu sorgen, muss Spaß machen.«
»Gehen Sie nie zu einer kosmetischen Behandlung, Frau Wieck?«
»Nennen Sie mich doch Georgia. Sehr selten. Aber meine Schwester geht, wenn sie sehr gestresst ist, oder nach einer anstrengenden Reise, zu einer Dame, nicht weit von uns entfernt. Sie macht das in ihrer Wohnung. Da war ich auch schon. Sicher nicht zu vergleichen mit Ihrem Salon Ko…«
»Kollander. In der Maximilianstraße, schräg gegenüber der Oper. Es wäre schön, wenn Sie einmal kämen … Georgia.«
»Oh ja«, sagte Georgia liebenswürdig, »das will ich gern einmal tun.«
»Ich arbeite seit vielen Jahren dort, schon ehe ich geheiratet habe. Und morgen gehe ich hin, ob Erwin das nun passt oder nicht. Ich kann nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen, da werde ich verrückt.«
Georgia winkte dem Kellner und verlangte die Rechnung.
»Fahren wir erst mal heim. Sechs Wochen werden vorübergehen. Bis die beiden zurückkommen, ist bald Weihnachten. In Südafrika ist jetzt Frühling. Oder fast Sommer. Es soll ja ein schönes Land sein.«
»Ein wunderschönes Land. Erwin hat mir viele Bilder gezeigt. Und auch aus der Geschichte des Landes erzählt, von den Buren, die das Land besiedelt und kultiviert haben. Und dann kamen die Engländer, und es gab einen schrecklichen Krieg.«
»Ja, der sogenannte Burenkrieg. Karen hat ebenfalls verschiedene Bücher zu diesem Thema studiert …«
»Und sie müssen unvorstellbar reich sein. Das größte Goldvorkommen in der Welt, und die Diamanten, und Platin. Alles liegt in dieser Erde. So etwas kann man sich gar nicht vorstellen.« Almut kicherte, leicht beschwipst von dem Cognac, sie hatte monatelang keinen Alkohol getrunken. »Erwin will mir einen Diamanten mitbringen. Für einen Ring.« Ihr Blick haftete auf dem Ring an Georgias Finger. »Sie brauchen sich so was nicht aus Südafrika mitbringen zu lassen.«
»Nein. Man kann das hier kaufen. Und wenn Sie diesen Ring meinen, Almut«, Georgia hob die Hand, »er ist ein Erbstück, er gehörte meiner Großmama.«
»Es ist ein wunderschöner Ring.«
»Ja, ganz hübsch.« Es war ein heller Opal, von einem Kranz kleiner Brillanten eingefasst. »Sie hatte viel Schmuck. Mein Großvater schenkte ihr zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit ein Schmuckstück. Es bleibt mir überlassen, ihn zu tragen. Karen mag nur Modeschmuck.« Sie zögerte und fügte hinzu: »Wir bewahren das natürlich nicht im Haus auf, die meisten Stücke befinden sich in einem Banksafe.«
Was nicht ganz stimmte, denn Georgia liebte die Steine und das Gold, und sie holte sich immer wieder die Colliers, die Armbänder, die Ringe aus dem Safe und trug sie zu ihrem Vergnügen, manchmal auch einfach nur zu Hause.
»Ich finde echten Schmuck viel schöner als Modeschmuck«, sagte Almut.
»Ach, ich weiß nicht. Hauptsache, es glitzert.«
Plötzlich sagte Almut ganz ernst: »Ich denke mir, es ist wie mit der Liebe. Es kann ein bisschen Glitzer sein, oder es kann echt sein.«
»Ja«, gab Georgia zu, »ich denke, da haben Sie recht, Almut. Die Liebe – sie kann echt oder Talmi sein. Falls es sie gibt und es eben nicht nur Einbildung ist.«
Sie stand auf, Almut ebenfalls, und sie gingen langsam aus dem Restaurant. Auf einmal war mehr Betrieb, es kamen Durchsagen, die letzten Nachtflüge wurden angesagt.
»Ob sie schon in Frankfurt sind?«, fragte Almut.
Georgia blickte auf ihre Armbanduhr. »Ganz demnächst. So umständlich, nicht? Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass es von München aus keinen Direktflug nach Südafrika gibt.«
»Und dann fliegen sie über die Alpen«, meinte Almut versonnen. »Schade, dass es dunkel ist.«
»Im Dunkeln über die Berge. Und zu wissen, wie tief der Abgrund ist.«
»Was für ein Abgrund?«, fragte Almut erschrocken.
»Nun«, Georgia legte leicht die Hand auf den Arm der jungen Frau, »ich meinte es mehr symbolisch. Unser ganzes Leben ist ein Flug über den Abgrund, von dem wir nicht wissen, wann er uns hinabziehen wird.«
»Aber das klingt schrecklich, Georgia. Warum sagen Sie so etwas? Gerade heute?«
»Wieso heute nicht? Der Abgrund ist immer da. Es ist der Tod, dem wir nicht entgehen können. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Almut, dass Ihr Kind nie sterben muss, weil es nicht geboren wurde?«
»Nein. Nein. Das ist ein furchtbarer Gedanke, Georgia. Wenn alle so denken würden, könnte keine Frau ein Kind zur Welt bringen.«
»Man denkt die Dinge meist nicht zu Ende«, sagte Georgia ruhig. »Denn wenn man es täte, gäbe es längst kein Leben mehr auf dieser Erde.«
Sie gingen langsam durch die Halle zum Ausgang, und Georgia dachte, dass sie das malen musste: den Abgrund, aus dem sich eine gierige Hand streckt. Und darüber zitternd, angstbebend die Menschen, die Kinder, die Tiere. Nein, die Tiere wohl nicht. Die wussten nicht um den sicheren Tod. Oder wussten sie es doch? Sie blieb stehen, ihre rechte Hand umklammerte ihren Hals, sie konnte nicht mehr atmen vor Entsetzen.
Ich weiß es. Ich weiß es. Alles holt sich die gierige Hand, alles, was ich liebe. Mama, die Großmama, Panino, und nun wird sie Karen holen. Aber ich werde nicht warten, bis sie nach mir greift, ich werde freiwillig in den Abgrund springen. Mama hat es getan. Ich kann es auch.
Ihre Stirn wurde feucht, ihr Atem stockte, gleich würde sie umfallen. Nun begann sie also wieder, diese entsetzliche Zeit der Depression.
Warum, Karen, warum lässt du mich allein?
Ihre Hände krampften sich ineinander, sie spürte den Ring an ihrer linken Hand. Sollte sie ein Opfer bringen wie Polykrates? Dieser Gedanke brachte sie wieder zu sich. Die Frau des Fotografen würde es höchst merkwürdig finden, wenn Georgia Wieck ihr in der Abflughalle von Riem einen kostbaren Ring schenkte. Und ein Opfer würde es schon gar nicht sein, sie besaß so viel Schmuck.
Almut war auch stehen geblieben und blickte hilflos in das schöne Gesicht, das noch blasser geworden war, fast weiß sah es jetzt aus.
»Das ist ein furchtbarer Gedanke, Georgia«, wiederholte sie.
Georgia sah sie wie erwachend an, dann lächelte sie. »Vergessen wir ihn, Almut«, sagte sie gelassen, »ich denke manchmal solche Dinge, aber daran soll sich keiner ein Beispiel nehmen. Meine Schwester nennt mich eine morbide Spinnerin. Vermutlich hat sie recht.«
»Sie haben so einen schönen Namen«, sagte Almut, während sie weitergingen. »Georgia. Das habe ich noch nie gehört.«
»Das ist ganz einfach zu erklären. Mein Vater hieß Georg. Nachdem das zweite Kind wieder ein Mädchen war, bekam ich den Namen Georgia. Vermutlich hat er sich einen Sohn gewünscht.«
»Aber der konnte ja noch kommen.«
»Soviel ich weiß, bestand wenig Hoffnung darauf.«
»Ihr Vater – lebt nicht mehr?«
»Das weiß ich nicht. Er verließ uns, als ich ein Jahr alt war.«
Weiter zu fragen, traute sich Almut nicht. Sie schwieg, bis sie im Taxi saßen, dann war ihre Neugier doch zu groß.
»Sie wissen nichts von Ihrem Vater?«
»Nicht das Geringste. Es existiert nicht einmal ein Bild von ihm. Wo darf ich Sie hinbringen, Almut?«
»Nach Schwabing. In die Herzogstraße. Aber ich kann mir ja auch ein anderes Taxi nehmen.«
»Wozu denn?«
Und dann sprachen sie nicht mehr bis auf ein paar kurze formelle Abschiedsworte.
Karen Wieck und Erwin Raabe flogen in dieser Nacht über die dunklen Alpen, über das Mittelmeer, über den afrikanischen Kontinent, erfüllt von ihren Erwartungen, verbunden durch die gemeinsame Arbeit.
Georgia Wieck und Almut Raabe verband nichts als eine Unterhaltung bei Kaffee und Cognac. Und die Einsamkeit, die sie nun für einige Zeit ertragen mussten. Jedoch bestand kein Grund, einander wiederzusehen.
Das leere Haus
Das Taxi fuhr rasch weg, nachdem Georgia ausgestiegen war, sie stand allein auf der dunklen Straße. Es war eine weite Fahrt gewesen, von Riem nach Schwabing, und dann nach Bogenhausen, und sie hatte ein gutes Trinkgeld gegeben. Ein höflicher Taxifahrer hätte gewartet, bis sie im Haus war. Aber so höflich, man konnte auch sagen, so ritterlich waren Taxifahrer nur noch ganz selten.
»Die Ritterlichkeit des Mannes einer Frau gegenüber beweist seine Männlichkeit«, das hatte Panino einmal gesagt. »Und das hat nichts mit seinem Stand, seiner Herkunft, seiner Bildung zu tun. Er hat sie, oder er hat sie nicht.«
Eine kurze Weile stand sie regungslos und starrte auf das leere Haus. Wenn Panino doch darin wäre! Wenn er da wäre und auf sie wartete! Dann gäbe es keine Leere in ihrem Leben, genauso wenig wie in diesem Haus, dann wäre Liebe da, Wärme, Schutz, Geborgenheit. Das alles war mit ihm aus ihrem Leben gegangen. Geblieben war sein Geld, das bot zumindest Schutz.
Sie ging durch das Gartentor, ließ es hinter sich zufallen, sofort bellte im Haus der Hund, und als er den Schritt erkannte, der sich auf den Steinplatten näherte, ging das Bellen in ein aufgeregtes Jaulen über.
Die Haustür war hoch und breit, aus festem dunklem Holz, die Jugendstillampe, die darüber hing, gab nur ein mattes, gelbliches Licht, das kaum die umliegenden Büsche erreichte. Jeder konnte sich dort verstecken, und Georgias Hand zitterte ein wenig, als sie hintereinander die drei Schlösser aufsperrte.
Die Lampe über der Haustür stammte auch von Panino, und Karen hatte es entschieden abgelehnt, sie durch eine helle, moderne zu ersetzen. Dafür hatte sie an allen vier Hausecken Strahler anbringen lassen, die wie Scheinwerfer das Dunkel im Garten durchdrangen, Bäume und Büsche in ein gespenstisches Licht tauchten. Man konnte sie innen, gleich neben der Tür mittels eines Knopfdruckes anknipsen, ein zweiter Knopf befand sich neben Georgias Bett.
Pedro drängte sich glücklich an ihr Knie, doch bevor sie ihn streicheln konnte, war er schon an ihr vorbeigelaufen, den Gartenweg entlang, bis zum Tor. Dort stand er, schaute, wartete. Vergebens.
Georgia drückte auf den Knopf, die Strahler flammten auf. Gleichzeitig dachte sie, wie töricht das von ihr war. Jeder, der sich im Garten verbarg, konnte sehen, dass sie allein gekommen war. Jeder hätte auch beobachten können, wie vor zwei Stunden die Koffer in das Taxi geladen wurden, wie sie weggefahren waren. Jemand konnte inzwischen eingebrochen haben, konnte sich jetzt im Haus verbergen, in diesem riesigen Garten mit den alten Bäumen, den hohen Büschen. Es wurde viel eingebrochen in dieser Gegend hier draußen, ziemlich am Ende des Herzogparks, wo es viele schöne alte Villen gab.
»Pedro, komm!«, rief sie laut, damit jeder es hören konnte. »Karen kommt gleich, und sie bringt Tommy mit. Und diesen Lorenz. Hörst du, Pedro? Komm! Hierher!«
Der Gordon Setter kam langsam herangetrabt, die Enttäuschung war ihm anzusehen.
Schon als Kind hatte sie diese Angst gehabt, wenn sie allein in einem Zimmer war, allein im Dunkeln, allein auf einer langen, einsamen Straße, aber sie war selten allein gewesen.
Da war die Großmama, da war Panino, da waren Kathi oder Onkel Huber, als sie noch sehr klein war, ein Kindermädchen. Egal wer, Hauptsache es war einer da, der ihre Hand nahm.
Seltsam, an ihre Mutter dachte sie in diesem Zusammenhang nie. Mama war niemals Schutz, Hilfe, Geborgenheit gewesen. Sie war Zärtlichkeit, stürmische, auch unberechenbare Zärtlichkeit, aber keine Geborgenheit. Mama war Unruhe, Erregung, und eben auch wieder Angst.
Karen hatte das nie so empfunden. Und Karen hatte niemals Angst, vor nichts und niemand, sie lief mitten in der Nacht allein den Isarweg entlang, mit oder ohne Hund.
»Und was machst du, wenn dich einer anfällt?«
»Der kriegt einen Tritt in die Eier.«
Georgia schloss die Tür, beugte sich zu dem Hund und strich sanft und zärtlich über seinen Kopf.
»Ich habe geschwindelt, Pedro. Sie kommt heute nicht. Und morgen auch nicht. Sie kommt lange nicht. Freust du dich denn nicht, dass ich wenigstens da bin? Stell dir vor, ich wäre auch auf und davon geflogen.«
Doch, Pedro freute sich, dass sie da war. Er ließ sich streicheln, drängte sich eng an sie, lauschte dennoch immer zur Tür hin.
Georgia ging durch sämtliche Zimmer, machte überall das Licht an, die Vorhänge hatte sie zugezogen, ehe sie nach Riem gefahren waren.
Das Haus war groß: das Terrassenzimmer mit dem Kamin, das Wohnzimmer, das Speisezimmer, Paninos Bibliothek, der gelbe Salon, der jetzt Karens Arbeitszimmer war, der blaue Salon, die riesige Küche, das Mädchenzimmer, die Vorratsräume, ein Duschraum, zwei Toiletten. Im oberen Stock die Schlafzimmer, die Bäder, die Ankleidezimmer, Georgias Atelier.
Nachdem sie durch das ganze Haus gegangen war, auch hier alle Lichter brannten, atmete sie auf.
Der Hund war ihr nachgekommen und blickte erwartungsvoll zu ihr auf.
»Ich weiß, du möchtest noch spazieren gehen, aber ich verlasse das Haus nicht mehr. Du gehst einfach in den Garten, und dann bekommst du eine Kleinigkeit zu fressen. Und ich werde dir ein bisschen Gesellschaft leisten. Schlafen kann ich sowieso noch nicht.«
Pedro wedelte mit dem Schwanz, das Wort fressen war ihm wohlbekannt.
Eine Weile blieb Georgia in ihrem Atelier stehen und betrachtete das Bild auf der Staffelei, Karens Pferd, der Rappe Tassilo. Ein ganz normales Bild, das Pferd sah aus wie ein Pferd, und es sah aus wie Tassilo.
»Das wird prima«, hatte Karen heute Mittag gesagt, »bis ich zurück bin, ist das Bild fertig, und du schenkst es mir zu Weihnachten. Und dass du mir Tassilo jeden Tag besuchst. Rüben und Äpfel nicht vergessen, bitte. Das ist genau der richtige Spaziergang für dich und Pedro. Ich möchte nicht, dass du den ganzen Tag zu Haus sitzt, meine Kleine.«
Es würde ein recht ausgedehnter Spaziergang sein, isar-aufwärts bis zur Tivolibrücke – die Brücke zu überqueren war unangenehm, dort herrschte starker Verkehr – nach der Brücke in den Englischen Garten, dann die ganze Breite durchspazieren, bis zur Universitätsreitschule, wo Tassilo sein Quartier hatte.
»Das ist gut und gern eine Stunde Weg, Tassilo«, sprach Georgia zu dem Bild. »Und zurück müssen wir ja auch wieder. Dir allerdings, Pedro, wäre der Weg gerade recht, wie ich dich kenne.«
Pedro wedelte wieder mit dem Schwanz, der Weg war ihm sehr recht, denn Karen nahm ihn oft mit in den Stall. Wenn sie denn Zeit fand, um zu reiten, und mit dem Rad fuhr. Wenn sie viel zu tun hatte, nahm sie das Auto, und Pedro musste zu Hause bleiben, denn dann kam sie meist nicht hierher zurück.
Für Georgia stand auch ein Rad im Keller.
»Wenn es nicht regnet, können wir mit dem Rad fahren, Pedro. Und über die Brücke schieben wir das Rad. Und wir nehmen einfach Karens Rad, das lehnt sicher hinten an der Hauswand. Oder hast du schon einmal erlebt, dass sie es in den Keller bringt?« Und dann wieder zu dem Bild. »Wir kommen dich oft besuchen, Tassilo, ich habe es Karen versprochen.«
So würde es jetzt immer sein; sie würde mit dem Hund sprechen, mit den Bildern, mit sich selber, solange sie allein war. Viel war an dem Bild nicht mehr zu tun, dachte sie, noch ein paar Lichter auf Tassilos seidenglatten Hals, das große Auge noch lebendiger, an der schmalen Blesse eine Winzigkeit ändern. Sie warf einen Blick auf die Skizzen, die auf ihrem Arbeitstisch lagen, nahm den Pinsel in die Hand, legte ihn wieder hin. Heute nicht mehr. In den nächsten Tagen würde sie das Bild fertigmachen.
Weihnachten! Das war noch zwei Monate entfernt.
Sie stand und dachte nach. Was war ihr da vorhin durch den Kopf gegangen, als sie mit der jungen Frau Cognac trank, mit der Frau, die das Kind verloren hatte?
Wie hieß sie? Ach ja, Almut.
»Sie heißt Almut«, sagte sie laut. »Sie ist Kosmetikerin, Pedro.«
Georgia lachte leise. »Stell dir das vor, Pedro. Ich male auf Leinwand, auf Papier, manchmal auch auf Holz. Sie malt auf Gesichtern. Und ich habe geschwindelt, als ich sagte, ich ginge manchmal zu Karens Kosmetikerin da vorn am Kufsteiner Platz. Ich war noch nie dort. Aber ich dachte, es freut sie, dass ich weiß, wie so was geht.«
Eine Hand, die aus dem Abgrund kam und nach den Lebenden griff. Eine tote, dürre Hand. Wieso tot? Sie war weder tot noch lebendig, es war eine Geisterhand. Wieso eine Geisterhand? Eine tötende Hand, eine würgende Hand, eine gierige Hand, die nie genug bekam.
Sie bekam genug. Sie bekam früher oder später alles, was sie wollte.
Das würde sie als Nächstes malen. Und jeder würde erkennen, was für eine Hand das war. Dass es die Hand war, die jeden angeht. Die auf jeden wartet.
»Die Hand, die nach jedem greift. Nach mir. Nach dir, Pedro. Nach dir, Tassilo.« Sie machte eine Pause. »Nach Almut, nach ihrem Mann, nach Tommy. Nach dem allmächtigen Chefredakteur.« Wieder eine Pause, dann fast wütend: »Auch nach Karen. Falls das Flugzeug über den Bergen abgestürzt ist, hat die Hand schon, was sie will. Ach, wie sich ihre Finger krümmen, wie ihr das schmeckt. Man könnte sie schmatzen hören, diese Hand.«
Fröstelnd zog sie die Schultern zusammen.
»Es ist kalt. Wir müssen morgen den Huber anrufen, damit er uns die Heizung höher stellt.«
Sie wohnte in diesem Haus, seit sie geboren war, früher hatte es eine Koksheizung, inzwischen gab es eine Ölheizung, aber Georgia hatte nie gelernt, damit umzugehen.
Sie ließ im oberen Stock alle Lichter brennen und ging mit Pedro die Treppe hinab.
Das Kind von dieser Almut hatte die Hand schon geholt, ehe es geboren war. Oder konnte man sagen, es war der Hand entgangen, weil es nicht geboren wurde?
Ob man das malen konnte, ein ungeborenes Kind?
Ein Mensch, der da gewesen war und den es nicht gab.
Gedanken, die nicht gedacht, Taten, die nicht getan wurden. Freude, die nicht empfunden, Leid, das nicht erlitten wurde. Ein Lächeln, niemals gelächelt. Ein Gesicht, das keiner kennen konnte, ein schönes Gesicht, ein hässliches, ein kluges, ein dummes, ein glückliches, ein verzweifeltes – mit dem Gesicht war es noch am einfachsten, man konnte Almuts Gesicht nehmen und das von dem Fotografen, man konnte die beiden Gesichter ineinanderfließen lassen, aber damit war noch lange nicht dargestellt, wie das Gesicht geworden wäre. Ein Gesicht, das es nicht gab. Nie geben würde.
Ein Gesicht, das die gierige Hand nicht zerfetzen würde. »Ich glaube, das kann man nicht malen, Pedro. Willst du jetzt mal in den Garten gehen und deine Sachen erledigen? Ich mache uns inzwischen etwas zu essen. Und dann machen wir diese grässliche Beleuchtung aus. Jeder Mensch kann wissen, dass wir allein im Haus sind. Wenn du zurück bist, schalte ich die Alarmanlage ein.«
Sie stand eine Weile unter der offenen Tür, es war ein milder Oktoberabend, das Laub raschelte unter Pedros Füßen, längs und quer lief er durch den riesigen Garten. Die Strahler beleuchteten auch die Rosen, die immer noch blühten.
Panino hatte die Rosen gehegt und gepflegt, zusammen mit Herrn Huber. Wunderschöne Rosen, groß und leuchtend, das ganze Jahr über mussten sie betreut werden, geschnitten, gedüngt, im Winter, wenn es kalt war, bekamen sie schützende Hüllen. Im Mai begannen sie zu blühen, und sie blühten bis in den späten Oktober.
»Sie sind das Schönste und Edelste, was auf dieser Erde lebt«, hatte Panino gesagt, den Arm um die Schultern des Kindes Georgia gelegt. »Ein Geschöpf, das nichts Böses tun kann. Das in aller Schönheit nur für sich allein lebt.« Eine Zeit lang hatte Georgia, sie war noch sehr jung damals, Rosen gemalt, immer wieder Rosen.
»Ja, ja«, hatte Panino gesagt. »Aber sie leben nicht, sie duften nicht. Man kann sie nicht festhalten, nicht beschreiben, nicht darstellen. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Es ist die Vollendung.«
Nach Paninos Tod wurden die Rosen von Herrn Huber allein gepflegt, es schien sie nicht zu stören, dass Panino nicht mehr da war. Und wie man mit Rosen umging, hatte Herr Huber gelernt.
Karen betrachtete es sachlicher.
»Rosen, gut und schön. Die Hauptsache ist, Onkel Huber kommt jeden Tag. Ich möchte nicht, dass du allein bist, wenn ich verreist bin.« Das war vor der argentinischen Reportage.
Kathi, die den Großeltern den Haushalt geführt hatte und die die Mädchen seit ihrer Kindheit kannten, war eines Tages nicht mehr da gewesen. Sie war alt und wackelig geworden, halb taub dazu, Töpfe und Teller fielen ihr aus der Hand, sie zog um in ein Altersheim. Auch dafür hatte Panino gesorgt. Danach kam eine Haushälterin, die faul war und widerspenstig und Georgia auf die Nerven ging. Die nächste redete zu viel, bis man merkte, dass sie stahl. Und die dritte, die im Haus lebte, war hysterisch, so nannte es Karen.
Vor all diesen Frauen und ihrem Anhang musste man jetzt Angst haben, denn sie wussten, wer im Haus lebte, wussten, dass Karen oft auf Reisen war, wussten von dem Schmuck, und dass Pedro sehr gutmütig war.
Jetzt gab es keine Haushälterin mehr, nur Frau Moser. Sie kam jeden Tag, räumte auf, machte sauber, kaufte ein und bereitete das Essen, erträglich, aber nicht sehr raffiniert, nicht zu vergleichen mit Kathi, die nicht nur bayerisch und fränkisch kochen konnte, sondern von der Großmama allerlei Finessen französischer Küche übernommen hatte.
Ins Haus ziehen wollte Frau Moser nicht. Sie hatte eine Tochter, die geschieden war und arbeitete, und zwei Enkelkinder, die versorgt werden mussten, sie beeilte sich immer, schon zu Hause zu sein, wenn die Kinder aus der Schule kamen. Aber sie kam pünktlich und zuverlässig, und Karen hatte seufzend zugegeben: »Wir können froh sein, dass wir wenigstens sie haben.«
Herr Huber hatte eine gelähmte Frau, für die er sorgen musste, die konnte er auch nicht mit ins Haus bringen. Denn bei aller Liebe zu den Rosen und zu den beiden Wieck-Mädchen dachte er nicht daran, seine Frau aus dem gewohnten Rahmen zu reißen. Dort konnte sie sich einigermaßen bewegen, ein kleiner Garten war da, und es gab die Nachbarin, die sich kümmerte, wenn er nicht da war.
Die Hubers wohnten in Unterföhring, das war nicht allzu weit entfernt, und Herr Huber kam mit dem Rad, aber immerhin war er auch schon einundsiebzig. Als Karen sich einen neuen Wagen kaufte, einen Porsche, sagte sie mit aller Selbstverständlichkeit: »Weißt du was, Onkel Huber, du nimmst einfach meinen alten Wagen, da bist du schneller da und kannst mal so zwischenrein nach meiner Schwester sehen, wenn ich nicht da bin.«
»Aber Fräulein Karen, ich kann doch nicht mit einem Mercedes fahren.«
»Na, warum denn nicht? Du fährst doch prima.«