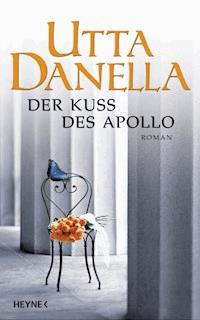6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ende der 50er-Jahre sucht der erfolgreiche Filmregisseur Steffen Rau einen geeigneten Drehort. In dem kleinen Städtchen Ahlsen trifft er auf die junge Jovana. Sie ist verzweifelt, ihre große Liebe heiratet eine andere, die Stiefmutter lehnt sie ab, sie fühlt sich hässlich – sieht keinen Sinn mehr im Leben. Steffen muntert sie auf. Als er sie einige Zeit später in Hamburg wiedersieht, wo er mit seiner Frau Dorothy lebt, erkennt er schnell, dass Jovana das Talent der Mutter, einer tschechischen Schauspielerin, geerbt hat. Er unterstützt sie, bald nicht nur aus beruflichem Interesse, und Jovana lernt schnell, sich in seiner Welt zu behaupten. Sie ist außerordentlich ehrgeizig und diszipliniert. Ihre erste Rolle bringt sie dem Traum von der Schauspielkarriere näher. Doch wird sich auch ihr größter Traum erfüllen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 914
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Utta Danella
Jovana
Roman
hockebooks
Besuchen Sie uns im Internet: www.hockebooks.de
Utta Danella: Jovana. Roman
Copyright ©2016 by Erbengemeinschaft Utta Danella vertreten durch AVA international GmbH, Germany
Die Originalausgabe ist 1969 im Schneekluth Verlag, München erschienen.
Copyright © 2016 by Erbengemeinschaft Utta Danella vertreten durch AVA international GmbH, Germany
Überarbeitete Neuausgabe ©2020 by hockebooks gmbh
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Erlaubnis des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: Joachim Luetke (www.luetke.com) unter Verwendung eines Motivs von Sergey Nivens/shutterstock.com
ISBN: 978-3-957-51349-6
www.uttadanella.de
www.ava-international.de
Begegnung
Der Weg war weiter als vermutet, dreiviertel Stunde von der Autobahn, und dann endlich dieser Ort namens Ahlsen, von dem Steffen noch nie gehört hatte und der ihm auf den ersten Blick nicht gefiel.
Barenth, sein Regieassistent, hatte ihn zu dem Umweg veranlasst. »Sie sollten da mal vorbeischauen, Chef. So ein richtig verschlafenes Städtchen voller Spießer. Mitten auf dem Marktplatz steht eine alte Kirche, nicht schön, aber irgendwie wirkungsvoll. Und am Ende des Platzes sind zwei alte Wehrtürme, sehr imposante Dinger. Das könnte was für uns sein. Nie gehört davon? Na, ich glaube, das Nest kennt außer mir sowieso keiner.«
Woher er es denn kenne, hatte Steffen wissen wollen.
»Woher schon? Aus dem Krieg natürlich. Letzte Kriegs- und erste Nachkriegszeit. Ich war durch einen Zufall dort gelandet. Halb verhungert und ziemlich am Ende meines Lateins. So gegen Ende hatten sie mich noch rangekriegt, als Flakhelfer. Und ich sagte mir, was soll der Quatsch? Ich werde den Krieg auch nicht mehr gewinnen. Da bin ich getürmt. Erst trieb ich mich im Wald und auf der Heide herum, und als ich nicht mehr weiterwusste, wagte ich mich in einen Ort. Ahlsen eben. War goldrichtig. Es gab da eine einsame Witwe, die hatte ein Herz für einen armen heimatlosen Jungen. Nicht nur, dass sie mir zu essen gab, sie führte mich sogar in die Liebe ein. Unvergesslich für mich – Ahlsen.«
Am Abend zuvor war Steffen bei der Premiere seines letzten Films in Frankfurt gewesen. So das Übliche. Presseempfang, Party, Fotografen. Die Thorwald ständig an seiner Seite, deutlich demonstrierend, wie nahe sie einander standen. Dabei wusste sie, dass sie ihn überhaupt nicht beeindruckte. Er schätzte sie nicht einmal als Star seiner Filme, geschweige denn, dass er mit ihr ins Bett gegangen wäre.
Er mochte auch den Film nicht, den sie da gerade gestartet hatten, eine sirupsüße Liebesgeschichte mit verlogenem Hintergrund. Nicht zu glauben, dass die Leute so etwas sehen wollten. Was für gute Filme hatte er noch vor einigen Jahren gemacht – aber jetzt, alles Kitsch.
Darum freute er sich ja auch so auf den nächsten Film, ein interessanter Stoff, ein gutes Buch. Diesmal würde er sich nicht hineinreden lassen von engstirnigen Produzenten und Verleihern. Wichtig war beispielsweise der Ort, an dem sie drehen würden, eine Kleinstadt, ein wenig düster und verschlafen.
»Ein Städtchen, in dem die Spießer hinter dem Monde leben und wo man es ihren leeren Gesichtern ansieht, dass sie nie begreifen, was geschieht. Aber den Steinen dieses Ortes muss man es ansehen, dass auch hier etwas geschah. Irgendwie schicksalsträchtig muss der Ort sein.« – So weit der Autor. So stellte er sich die kleine Stadt vor, in der »Zwielicht« spielen sollte.
Steffen fuhr eine Runde durch Ahlsen und entschied sofort, dass er hier nicht fand, was er suchte. Hier war es nur langweilig, sonst nichts. Die leeren Gesichter würde man vielleicht finden, aber den Steinen und Mauern sah man nichts von Schicksal und Geschichte an.
Er parkte schließlich auf dem Marktplatz und stieg aus. Sah sich um. Auch schon was!
Er war unausgeschlafen und schlecht gelaunt, und dazu nun noch Ahlsen. Das war zu viel.
Da war also die Kirche, von der Barenth erzählt hatte, wuchtig und alt, unschön, aber irgendwie imponierend – das stimmte. Sie stand mitten auf dem relativ großen Platz, rundherum Kopfsteinpflaster.
Kopfsteinpflaster machte sich immer gut. Weiter. Dort am Nordende des Platzes die Türme. War das Norden? Na egal. Vierschrötige dicke Türme, oben flach, schwere Quader. Mussten sehr alt sein, die Dinger. Sicher gab es eine Art Geschichte zu diesem Nest – wo gab es die nicht? Aber er hatte nicht die geringste Lust, einen Archivar oder Bibliothekar aufzustöbern und sich über die Historie von Ahlsen unterrichten zu lassen. Denn er hatte schon entschieden, dass er hier nicht drehen würde. Gefiel ihm nicht. Das war keine Kleinstadt, kein Städtchen, das war wirklich nur ein Nest.
Pflichtbewusst umrundete er wenigstens einmal die Kirche zu Fuß, besah die Türme aus der Nähe und ging dann auf der entgegengesetzten Seite eine der beiden Straßen entlang, die parallel vom Platz ausgingen. Vermutlich die Hauptstraßen. Das Übliche: Läden, Handwerksbetriebe, ein Gasthof, ein mickriges Kaufhaus, an einer Ecke ein etwas größeres, recht ansehnliches Kaufhaus. Wieder auf dem Marktplatz, beschloss er, ein Bier zu trinken, ehe er weiterfuhr. An der einen Längsseite des Platzes war ein Gasthaus, es nannte sich »Zum schwarzen Adler« und machte einen guten Eindruck.
Zuerst eine kleine Gaststube mit Holztischen. Leer. Durch eine weitgeöffnete Tür konnte er in einen zweiten größeren Raum blicken, offenbar das Restaurant für bessere Kunden. Eine Weile sah er stumm dem regen Betrieb zu, der dort herrschte. Die Vorbereitungen zu einem Fest. Eine große Tafel, an deren Ausstattung emsig und lautstark gearbeitet wurde; Porzellan, Kerzenleuchter, Gläser, Blumen.
Kaum anzunehmen, dass man auf seinen Besuch Wert legte.
Doch nun hatte ihn eines der Mädchen entdeckt. Es kam heran, hübsch und rotwangig, ein bisschen erhitzt, und lächelte ihn freundlich an.
»Der Herr wünschen?«
»Kann ich ein Bier haben?«
»Natürlich. Macht’s Ihnen etwas aus, hier draußen zu sitzen?«, fragte sie höflich und überflüssigerweise und wies ihn zurück in die kleine Gaststube. Eine rein rhetorische Frage, dachte Steffen. Angenommen, ich sage Nein, ich will an der Festtafel sitzen, was dann?
Er schmunzelte, schon besser gelaunt. Solche Kleinigkeiten erheiterten ihn. Er war ein Wortklauber, das brachte der Beruf so mit sich. Stundenlang konnte er an Dialogen feilen, und es machte ihn wahnsinnig, wenn seine Autoren unnötige Phrasen drechselten, was, wie er nun wieder einmal feststellte, höchst töricht von ihm war. Man verständigte sich sein halbes Leben lang mit unnötigen Phrasen, das also konnte man getrost als lebensechten Dialog bezeichnen. Wer redete schon immer genau und zielbewusst zur Sache.
»Es wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben«, erwiderte er und schenkte dem Mädchen sein berühmtes Lächeln, dessen Charme den arrogantesten Star in ein williges Lamm verwandelte. »Da Sie hier offenbar ein Fest vorbereiten …«
Das Mädchen lächelte zurück. »Eine Hochzeit.« Und stolz, als sei es ihre eigene, fügte sie hinzu: »Eine sehr große Hochzeit.«
»Wenn Sie mir trotzdem ein Bier bringen, werde ich es Ihnen nie vergessen.« Er lächelte immer noch.
Die Blonde, gefangen von seinen grauen Augen, vergaß für einen Moment die Hochzeit und die viele Arbeit. Einen Mann wie diesen sah man in Ahlsen nie. Die Wangen noch ein wenig röter, rief sie: »Ich bring’s Ihnen sofort, einen Augenblick nur«, und da lief sie schon.
Steffen setzte sich zufrieden an einen Tisch am Fenster. Und registrierte bei sich wieder einmal, mit oft geübter Selbstironie, seine nicht zu verleugnende Eitelkeit. Siebenundvierzig Jahre – und auch Mädchen, die nicht wussten, wer er war, gerieten in Verwirrung. Nicht, dass er allzu viel Gebrauch davon machte. Eigentlich schon eine ganze Zeitlang nicht mehr. Aber es freute einen doch.
»Du hast etwas von einem Dompteur an dir«, sagte Dorothy, seine Frau, manchmal. »Wärst du nicht Regisseur geworden, hättest du dich sicher großartig als Löwendompteur geeignet.«
»Wennschon, dann lieber Tiger. Und wo, bitte, ist der Unterschied zwischen einem Regisseur und einem Dompteur? Die Tigerkatzen, mit denen ich zu tun habe, sind weitaus gefährlichere Raubtiere und viel schwieriger zu behandeln. Ich stelle es mir erholsam vor, einem Tiger mein Haupt in den Rachen zu legen, anstatt acht Wochen lang Britta Thorwald bei guter Laune zu halten – man reiche mir die Tiger!« Dorothy hatte gelacht. Aber er dachte nicht nur an Britta, er dachte auch an Autoren, Kameramänner, an Produzenten, Verleiher, sonstige Geldgeber und auch an die Presse. Nein, Tiger mussten ein Kinderspiel dagegen sein.
Das Bier kam mit Windeseile. Und das blonde Mädchen hatte sich offenbar inzwischen intensiv mit ihm beschäftigt, es sagte: »Falls der Herr hier auch essen will, dann wäre es gut, wenn Sie das bald bestellen würden. Wenn das große Essen losgeht, ist in der Küche viel Betrieb.«
An Essen hatte er eigentlich nicht gedacht. Aber nun, darauf angesprochen, schien es ihm ganz verlockend, einen kleinen Imbiss zu nehmen. Er konnte dann ohne Aufenthalt durchfahren.
»Angenommen«, sagte er und blickte die Blonde liebevoll an, »Sie könnten mir eine ordentliche Portion Rührei mit Schinken bringen, ehe der Festschmaus losgeht – wie wäre das denn? Das macht nicht viel Arbeit, bringt die Küche nicht noch mehr durcheinander, als sie es sowieso schon ist. Und dazu kriege ich Brot und Butter, möglichst schwarzes Brot, und einen doppelten Klaren. Geht das?«
»Aber natürlich«, erwiderte das Mädchen, nun restlos für ihn da und abgelenkt vom Tumult des Hauses. »Sie können auch ein Schnitzel haben.«
»Nein. Rührei mit Schinken – das wäre es, was mich glücklich macht. Im Moment.« Sie lachte vergnügt und verschwand. Steffen zündete sich eine Zigarette an und war nun wirklich hervorragender Laune. Das ging bei ihm oft von einer Sekunde zur anderen. Sehr gemütlich, hier zu sitzen, abseits vom Trubel im Haus und irgendwie doch als stiller Beobachter daran beteiligt. Er stellte sich vor, wie die Blonde in die Küche kam mit seiner Bestellung und die Wirtin entsetzt die Hände zusammenschlug. »Was sagst du? Rühreier will einer essen! Jetzt?«
Auf dem Marktplatz wurde es nun auch lebendig. Es musste bald so weit sein. Allerhand Leute hatten sich eingefunden, um die Hochzeiter zu betrachten. Dann begannen die Glocken der alten Kirche tief und dumpf zu läuten. War sehr gut und richtig, dies alles zu beobachten, man konnte nie wissen, wie und wann man das brauchte. Große Hochzeit in einem Nest wie Ahlsen. Für einen Regisseur waren solche Eindrücke Gold wert.
Zunächst kamen die Hochzeitsgäste, eine stattliche Zahl, die meisten davon fuhren in recht ansehnlichen Autos vor.
Zusammen mit dem Brautpaar kamen die Rühreier. Das Brautpaar in einem Prachtwagen. Es konnten keine armen Leute sein, die hier die Ehe schlossen. Die Schaulustigen vor der Kirchentür versperrten ihm die Aussicht; er sah nur, dass es zuging wie im Bilderbuch. Blumenstreuende Kinder, die Braut ganz in Weiß.
Die Blonde war bei ihm am Tisch stehen geblieben und blickte auch aus dem Fenster mit dem sehnsüchtig neidvollen Ausdruck, mit dem Frauen solche Aufmärsche betrachten.
»Schön, nicht?«, sagte sie verträumt. »Sehr«, gab er bereitwillig zu. Und dann prosaisch: »Wie wär’s, wenn ich gleich zahle, dann brauche ich Sie nachher nicht zu stören.«
Das sei nicht nötig, meinte sie, aber er zahlte doch, sie wünschte ihm guten Appetit und begab sich wieder an ihre Arbeit.
Die Glocken schwiegen.
Steffen strich auf eine Scheibe schwarzes Vollkornbrot dick Butter und aß mit großem Appetit seine Rühreier. Dorothy würde es amüsieren, ihn zu sehen. Rühreier mit Schinken waren seine große Leidenschaft. Wenn sie ihm lange genug die raffiniertesten Vorschläge unterbreitet hatte, was man kochen könnte, sagte er friedvoll: »Aber, Liebling, mach doch einfach Rühreier, mit viel Schinken, und ein Butterbrot dazu.«
»Du bist einfach zu ernähren.«
»Ich bin ein bescheidener Mensch, das weißt du doch.«
Dieser Rührei-mit-Schinken-Komplex stammte noch aus seiner Kindheit. Er kam aus armseligen Verhältnissen. Sie hatten immer bescheiden gegessen zu Hause. Und wenn seine Mutter den Kindern etwas Besonderes bieten wollte, weil sie krank waren vielleicht oder gute Zeugnisse brachten, dann sagte sie verheißungsvoll: »Ich mach dir eine große Portion Rühreier mit Schinken, ja?«
Die große Portion bestand aus höchstens zwei Eiern und wenigen Schinkenschnipseln darin. Er und seine Geschwister genossen es. Einmal viel davon zu essen, war sein Traum. Später im Krieg, in Russland, wenn er Hunger hatte, ging es ihm nur darum, ein paar Eier zu organisieren. Notfalls ging es auch ohne Schinken. Nach dem Krieg, in der schlechten Zeit, kaufte er Eier auf dem schwarzen Markt, wenn er sie bekommen konnte. Und Dorothy hatte ihm Rühreier serviert, als er sie das erste Mal wiedersah. 1946 – in der kleinen Stadt in Schleswig, wo ihr Vater sie vor den Bombenangriffen in Sicherheit gebracht hatte.
Die Neugierigen auf dem Marktplatz hatten sich zerstreut, standen in Gruppen herum und besprachen das Ereignis. Wer nicht mit in die Kirche gegangen war, wartete hier auf das Ende der Zeremonie, um den zweiten Teil, das junge Ehepaar, zu erleben. Eine Kapelle fand sich ein, die Männer in grüner Jägertracht, wohl so eine Art Schützenverein.
Ob sie glücklich waren, diese beiden in der Kirche? Was für eine Frage! Im Augenblick waren sie es wohl. Die Frage musste anders gestellt werden: Ob sie es blieben?
Diese Frage war leicht zu beantworten. Meist mit Nein. Das Glück der Liebe war es immer noch, was die Ehe zuerst und am liebsten fraß, was ihr am besten schmeckte.
Er schob den letzten Bissen in den Mund und wies sich selbst zurecht. Gerade er hatte keinen Grund, so etwas zu denken. Wenn je ein Mann zufrieden sein konnte mit seiner Ehe, zufrieden mit der Frau, die er geheiratet hatte, dann konnte er es sein. Nicht immer ging es so gut, schon gar nicht bei seinem Beruf. Er hatte Dorothy nicht oft betrogen. Und nie ernsthaft daran gedacht, zu einer anderen zu gehen. Das war schon viel. Die meisten Liebesgeschichten endeten mit dem Beginn der Ehe. Es war in seinen Filmen nicht anders. Man hörte auf, wenn es begann, und ließ dem Zuschauer die Illusion eines echten Glückes.
Dazu sind wir da. Das ist mein Beruf, den Leuten die Illusion des großen Glücks vorzuspielen, dachte er. Wir von der Traumfabrik. – Er hasste das Wort. Wie er manchmal seine Arbeit hasste. Als er noch ein junger Schauspieler war und dann, als er seine ersten Inszenierungen am Theater machte, da hätte er sich beleidigt gefühlt, wenn man ihm prophezeit hätte, er würde einst nichts anderes tun als alberne Filme drehen, die das primitive Glücksbedürfnis eines primitiven Publikums befriedigten. Gewiss – er gab sich Mühe, trotzdem gute Filme zu machen. Aber die meisten stimmten nicht. Das Leben war anders. Wenn er davon sprach, hoben die Produzenten, die Verleiher beschwörend die Hände. »Mein lieber Rau! Bloß nicht! Die Leute wollen das nicht. Das Leben ist für sie ärgerlich genug. Das darf es nicht im Kino auch noch sein.«
Er hörte das nicht gern, aber vermutlich hatten sie recht. »Dunkelheit am Morgen« war eine Pleite gewesen, obwohl er ihn immer noch für seinen besten Film hielt. Die Kasse hatte nicht gestimmt. – Das allein zählte.
Aber nun »Zwielicht«, das würde … Übrigens merkwürdig, fast ein ähnlicher Titel, das war ihm noch gar nicht aufgefallen, jedenfalls dem Sinne nach – hoffentlich wurde es nicht auch eine Pleite. Er klopfte rasch auf die Holzplatte des Tisches. Es war auch ein anspruchsvoller Stoff. Kriegszeit. Keine Schnulze.
Das brachte ihn wieder zu seinem Anliegen zurück, einen passenden Ort zu finden, an dem man drehen konnte. Ahlsen? Ach nein, doch lieber nicht. Komisch, dass Barenth gerade darauf gekommen war. 1945 war er hier gewesen, wohl deswegen war ihm der Ort eingefallen. Der Achtzehnjährige, der desertiert war und sich hier versteckte. Bei einer einsamen Witwe, die am Marktplatz wohnte.
Ob sie wohl immer noch hier wohnte? Steffen beugte sich unwillkürlich vor und musterte die Häuser, die in seinem Blickfeld lagen, kritisch. Barenth hatte nicht gesagt, wie alt die Frau gewesen war. Dreißig, vierzig? Mehr? – Wie alt war sie heute, was tat sie? Hatte sie wieder geheiratet, lebte sie allein, war sie tot? Erinnerte sie sich noch an den Jungen von damals?
Unversehens war ihm der Stoff zu einem neuen Film eingefallen. Genau dieses Thema. 1945, der achtzehnjährige Deserteur versteckt bei der einsamen Frau, Rühreier mit Schinken zum Abendessen, ungeschickte Umarmungen in der Dunkelheit eines kleinstädtischen Schlafzimmers. Und heute, mehr als zehn Jahre später, dieser Barenth, flott, frech und begabt und absolut kein Anfänger mehr, in keiner Beziehung. Und hier die Frau, für die er vielleicht der letzte Mann im Bett gewesen war. Mann! Wer sprach hier von Mann!
Barenth muss mir das unbedingt mal genau erzählen, dachte er, wie alt die Frau war, wie sie aussah und – lächerlich! Muss ich eigentlich aus allem einen Film machen?
Stoffe gab es wie Sand am Meer. »Greift nur hinein ins volle Menschenleben …« Goethe hatte immer recht. Kam immer nur darauf an, wie man es machte. Was man daraus machte.
Er trank sein Bier aus, warf noch einen Blick ins Nebenzimmer, wo die Tafel nun fertig war. Sehr hübsch. Rote Nelken und weiße Lilien als Tischdekoration. Auf dem Gang umfingen ihn Küchendüfte, Ente, wenn ihn seine Nase nicht täuschte.
Auf dem Marktplatz betrachtete er noch einmal alles genau, die Leute, die Autos, die Schützenkapelle, und dann begab er sich zu den Türmen.
Was ihn bewog, nachdem er die Pforte entdeckt hatte, in den einen Turm einzutreten und die Steinstufen hinaufzusteigen, wusste er nicht. Vielleicht immer noch der Pflichtgedanke an die Kulisse, die er für »Zwielicht« brauchte. Vielleicht auch, weil alte Türme dazu verlocken, in ihnen herumzusteigen.
Es war dunkel auf der Treppe, nur kümmerliches Licht fiel gelegentlich durch kleine Mauerlöcher. In halber Höhe etwa mündete die Treppe in einen kleinen Raum, der etwas heller war durch eines der größeren Fensterlöcher, die auf den Platz hinabblickten. Von hier aus würde man einen guten Blick haben. Jedoch er verhielt den Schritt, ehe er den Raum betrat. Hier war bereits jemand.
Vor dem Mauerloch stand ein Mädchen, eine schmale Gestalt in einem roten Röckchen und einer weißen Bluse. Das Rot und Weiß sprang einem sofort entgegen, hob sich leuchtend von den grauen Steinen ab.
Das Mädchen stand nicht direkt vor der Öffnung, es hatte sich eng seitwärts an die Mauer gedrückt und nur den Kopf so weit vorgeschoben, dass es gerade, gewissermaßen um die Ecke herum, auf den Marktplatz hinabspähen konnte.
Im gleichen Moment fingen die Glocken wieder an zu läuten. Hier oben dröhnte es gewaltig, der Klang fing sich in den Mauerwinkeln der alten Steine.
Von seinem Platz vom Eingang aus konnte Steffen nicht sehen, was unten vorging, er hörte nur, wie die Kapelle anfing zu blasen, Hochrufe, es interessierte ihn auch weiter nicht sonderlich. Das Schauspiel unmittelbar vor ihm war interessanter. Er beobachtete die Gestalt an der Mauer.
Sie hatte sich eng an die Steine gepresst, den Hals hatte sie vorgereckt, sie war gespannt von Kopf bis Fuß. Ihr Profil war reizvoll, eine kurze gerade Nase, ein energisches festes Kinn, volle Lippen, die leicht geöffnet waren. Und was hatte sie auf der Wange? Tränen?
Dann sah er ihre Hand. Ihre Hand, fest in die Mauer gekrallt, so dass die Finger weiß geworden waren. Er sah, dass sie zitterte, dass ihre Zähne sich tief in die Unterlippe gruben.
Da begriff er, dass er Zeuge einer tragischen Szene war. Keine Neugierige, die von oben aus das Hochzeitspaar sehen wollte. Jetzt hörte er ein Stöhnen, ein tiefes verzweifeltes Stöhnen, und im selben Moment machte die Gestalt eine rasche Bewegung auf die Mauerluke zu, und er, mit seinem Sinn für Dramatik, dachte sofort: Um Gottes willen, sie stürzt sich hinab! – Unwillkürlich stieß er einen Ruf aus, die Mädchengestalt fuhr herum, er sah zwei weit aufgerissene Augen, ein Gesicht nass von Tränen, einen Laut hörte er, wie von einem gepeinigten, gequälten Tier, dann stürzte das Geschöpf an ihm vorbei. Eiliges Geklapper ihrer Schritte auf der Steintreppe.
Stille.
Etwas ratlos fuhr sich Steffen durchs Haar. Dieser Ort, den er als langweilig und trostlos angesehen hatte, schien es in sich zu haben. Nichts Neues unter dieser Sonne. Überall liebten und litten Menschen. Das, was er eben hier gesehen hatte, war so schwer nicht zu interpretieren. Das war eine, die nicht glücklich war über diese Hochzeit, eine, die wohl selbst gern da unten gewesen wäre anstelle der Braut im weißen Kleid und im Schleier. Anders konnte es kaum sein.
Er trat nach vorn und blickte hinab. Die Kapelle blies, das Brautpaar wurde fotografiert. Die Braut schien ein wenig üppig zu sein, ein kräftiges, stattliches Mädchen. Der Bräutigam wirkte schlank und elegant neben ihr.
Als er wieder auf den Platz herunterkam, war es stiller geworden. Die Hochzeitsgesellschaft hatte sich in den »Schwarzen Adler« zurückgezogen. Zeit für ihn, abzufahren.
Er saß schon im Wagen, da fiel ihm sein Hut ein. Für gewöhnlich trug er keine Hüte. Dorothy störte das immer, das war das Hamburger Patrizierblut in ihr. Immer wieder schenkte sie ihm einen Hut, immer wieder vergaß oder verlor er ihn. Dieser hier fiel ihm gerade noch rechtzeitig ein, er hatte ihn vor der Fahrt nach Frankfurt bekommen. Jetzt musste er wohl im »Schwarzen Adler« hängen. So betrat er also noch einmal das Gasthaus und hatte Gelegenheit, die Festgäste aus der Nähe zu sehen.
Das Essen hatte noch nicht begonnen, man stand herum, Sektgläser in den Händen. Im kleinen Gastzimmer waren nur zwei ältere Männer, die es vorzogen, einen klaren Schnaps zu kippen. Vielleicht die beiden Väter?
Er trat auf die Schwelle zu dem großen Raum und sah nun endlich das Brautpaar in voller Lebensgröße. Die Braut war wirklich eine mollige Person, blond und rundgesichtig, nicht direkt hässlich, aber mit groben Zügen, ohne jeden Liebreiz. Man konnte sich unschwer vorstellen, wie sie in zehn, geschweige denn in zwanzig Jahren aussehen würde. Unwillkürlich mischte sich in Steffens Gedanken ein wenig Mitleid, als er den jungen Mann betrachtete, der diesen Schatz nach Hause führte. Er war ein ausgesprochen hübscher Bursche, schlank, drahtig, dunkelhaarig und dunkeläugig, mit einem Zug charmanten Leichtsinns um die Lippen. Und wohl auch etwas jünger als die Braut.
Zweifellos ein Junge, der den Mädchen gefiel und der wohl auch dem Mädchen vom Turm gefallen hatte.
So eine Art Kleinstadt-Casanova, entschied Steffen rasch, gewohnt, immer alle Rollen zu besetzen. Dies hier dürfte keine reine Liebesheirat sein. Er stellte sich das junge Paar im Bett vor, heute Abend oder wann immer ihre Hochzeitsnacht begann. Sie brachte gut und gern zwanzig Pfund mehr mit auf die Waage. Sie wird ein Kind kriegen und noch ein bisschen dicker werden. Und er wird den Mädchen auch weiterhin gefallen.
Ein befremdeter Blick aus älterem Frauenauge traf ihn, eine Mutter, eine Tante, was auch immer. Er zog sich zurück, griff seinen Hut vom Haken und verließ nun endgültig die festliche Stätte.
Eigentlich, sinnierte er, als er langsam aus der Stadt hinaussteuerte, war der Abstecher ganz nützlich, gleichgültig, ob sich Ahlsen als Drehort eignete oder nicht. Eine Menge Eindrücke für die kurze Zeit. Die Vorbereitungen im Gasthaus, die Hochzeit, das ungleiche Brautpaar, das Mädchen im Turm, das alles waren Dinge, die man behalten und später verwenden konnte. Irgendwann erwiesen sie sich als brauchbar.
Jedoch, wie sich herausstellen sollte, waren es noch mehr Eindrücke, die Ahlsen ihm bescheren sollte. Und zwar nicht nur Eindrücke, eine Art Wendepunkt war es für ihn. Aber das konnte er zu dieser Stunde nicht wissen.
Aus der Stadt hinaus führte eine gerade, wenig befahrene Straße durch ebenes Land. Die Landschaft gefiel ihm. Heide, dazwischen Wiesen. Nach einem trüben Vormittag kämpfte sich die Sonne durch, verlieh der eintönigen Landschaft eine herbe Lieblichkeit.
Er fuhr langsam, blickte nach rechts und links, und so entdeckte er auch das rote Röckchen wieder. Es rannte querfeldein, als würde es gejagt, verschwand in einem Waldstück. Steffen lächelte. Arme Kleine! Nun würde sie ihren Kummer im Wald ausweinen.
Wenige Minuten später überquerte er einen Eisenbahnübergang. Und nun – von seinem Sinn für Dramatik war schon die Rede – war er plötzlich alarmiert. Die Schienen, das laufende Mädchen … er trat auf die Bremse, überlegte kurz, kam sich albern vor, aber dann wendete er den Wagen doch. Gerade als er die Schienen wieder passiert hatte, läutete hinter ihm das Signal, die Schranken gingen nieder.
Direkt neben dem Schienenstrang führte ein Feldweg landeinwärts, verlor sich nach einer Weile im Wald. In ziemlichem Tempo fuhr er den Weg entlang, solange er befahrbar war. Unter den Bäumen hielt er, stieg aus, und nun lief auch er.
Zu seiner Linken durch die locker stehenden Stämme sah er die Gleise im Sonnenschein blinken. Dann wurde der Wald dichter, lichtete sich wieder, er sah freies Feld, die Gleise liefen hier in einer Kurve um den Wald herum – und da plötzlich sah er sie.
Hinter sich hörte er das Geräusch des nahenden Zuges. Sie stand am Waldrand, dicht neben den Gleisen, den Kopf vorgereckt, lauschend. Fast dieselbe Haltung wie im Turm.
Er verlangsamte den Schritt, näherte sich ihr von hinten, sicher, dass er vor dem Zug bei ihr sein würde. Der weiche Boden verschluckte seine Schritte.
»Hallo«, sagte er, als er hinter ihr stand. Sie fuhr herum, starrte ihn an. Wie schon einmal heute, sah er die großen, vor Schreck geöffneten Augen.
Jetzt musste der Zug gleich um die Ecke kommen. Vorsichtshalber legte er seine Hand um ihren Arm und hielt sie fest. Kein Bummelzug, ein richtiger Schnellzug, der vorbeibrauste. Die Stelle war gut gewählt, der Lokomotivführer hatte keine Übersicht über die Strecke.
Das Mädchen sah nicht auf den Zug. Es starrte den fremden Mann an, der ihm heute zum zweiten Mal begegnete. Dann riss es heftig seinen Arm los und rief laut, noch übertönt vom Räderrollen des Zuges: »Was wollen Sie eigentlich von mir?«
Steffen schwieg, bis der Zug vorüber war. Dann lächelte er freundlich.
»Nichts, mein Fräulein. Ich gehe hier spazieren, geradeso wie Sie.«
»Warum fassen Sie mich an?«
»Habe ich Sie angefasst? Entschuldigen Sie bitte. Ich war etwas erschrocken, als der Zug so plötzlich kam.«
Sie blickte ihn gerade und keineswegs eingeschüchtert an. Um ihre Lippen lag Trotz.
»Ich möchte wissen, was Sie das angeht?«
»Was?« – »Was ich hier mache.«
»Habe ich behauptet, dass es mich etwas angeht? Aber da Sie schon davon sprechen – was machen Sie hier?«
Sie gab keine Antwort, blickte geradeaus über die Schienen hinweg auf die Heidelandschaft, die jetzt voll in der Sonne lag.
»Hübsch ist es hier«, sagte er nach einer Weile angespannten Schweigens. »Wirklich eine hübsche Gegend.«
»Es ist abscheulich hier«, sagte sie heftig. »Ich hasse alles hier. Dieses verdammte Nest! Diese scheußliche Gegend!«
»Sie werden Ihre Gründe haben.«
Um sie abzulenken, fing er an zu sprechen. »Man betrachtet natürlich jede Gegend, jede Stadt, jeden Ort mehr oder weniger subjektiv. Wenn man in der Wüste glücklich war, wird sie einem wie ein Paradies vorkommen. Und der Garten Eden wird einem zur Hölle, wenn man dort leiden muss.«
Na, na, dachte er, sich selber zuhörend, was für ein Kitsch! Wenn einer meiner Autoren das schreiben würde, was täte ich ihm an!
»Rein objektiv betrachtet ist es eine hübsche Gegend, gerade in ihrer kargen Einfalt, man muss nur das richtige Auge dafür haben. Und dieses Städtchen – wie heißt es doch gleich? Ach ja, Ahlsen –, ich kann mir denken, dass es nicht sonderlich amüsant ist, dort zu leben. Kleine Städte, so abseits gelegen, sind natürlich immer etwas eintönig. Obwohl auch da das Leben seine Höhepunkte haben kann …«
So redete er noch eine Weile weiter, lauter Unsinn, wie ihm schien, und beobachtete sie dabei von der Seite, wie sie da stand, gespannt, fluchtbereit, doch irgendwie hilflos, erschöpft, am Ende ihrer Kräfte angelangt.
Er täuschte sich nicht. Die Spannung wich aus ihrem Körper. Sie ließ die Schultern sinken und fragte leise: »Was wollen Sie von mir?«
»Von Ihnen? Liebes Kind, ich will absolut nichts von Ihnen. Ich ging hier spazieren, und da sah ich Sie und … na ja, ich sprach Sie an. Ist das so ungehörig?«
Ohne ihn anzusehen, sagte sie leise: »Sie wissen genau, was ich hier wollte.«
»Vielleicht vermute ich es. Ich habe Sie im Turm gesehen.«
»Warum sind Sie mir in den Turm nachgegangen?«
»Ich kam zufällig in den Turm.«
Sie wandte ihm ihr Gesicht wieder zu, das jetzt klein, mutlos, direkt kümmerlich aussah. Nie glaubte er so viel Trostlosigkeit im Gesicht eines Menschen gesehen zu haben.
»Sie werden nicht den ganzen Tag und die ganze Nacht hier stehen bleiben. Es kommen noch mehr Züge.«
»Zweifellos. Und sehr lange werde ich hier nicht mehr stehen, da haben Sie recht. Auch Schutzengel haben ihre bestimmten Einsatzzeiten. Ich finde nur, man sollte das erkennen und dankbar dafür sein.«
Die leicht frivole Art, mit der er über die Angelegenheit redete, verwirrte sie. Es fehlte ihr an Gewandtheit, darauf einzugehen. Sie antwortete mit Zorn.
»Machen Sie, dass Sie wegkommen. Sie können mich nicht daran hindern. Ich tue es doch.«
»Bitte!«, sagte er. »Man kann niemanden auf die Dauer daran hindern, etwas Falsches zu tun.«
Er blickte sich um. Ein Stück entfernt lag ein dicker Baumstamm. »Aber inzwischen können wir uns dort hinsetzen und eine Zigarette rauchen. Und auf den nächsten Zug warten. Wenn er kommt, werde ich sitzen bleiben und mich nicht rühren, und Sie können tun, was Sie wollen.«
Nun war es ihm offenbar wirklich gelungen, sie von ihrem Kummer abzulenken. Mit kindlichem Staunen sah sie ihn an.
»Sie würden sich nicht rühren?«
»Nein. Ich verspreche es Ihnen. Man kann einen Menschen nicht pausenlos vor seiner Dummheit bewahren. Oder vor seinem Schicksal, wenn Ihnen das besser gefällt.«
Er ging auf den Baumstamm zu und zog im Gehen die Zigaretten aus der Tasche. Befriedigt registrierte er, dass sie mitkam. Als er sich setzte, blieb sie vor ihm stehen, er bot ihr die Zigaretten an, und sie nahm eine. Er gab ihr Feuer und hatte nun Gelegenheit, sie näher zu betrachten.
Eine seltsame kleine Person! War sie hübsch? Nicht im landläufigen Sinn. Apart? So konnte man es nennen. Das Gesicht hatte einen sehr persönlichen Ausdruck, die Backenknochen etwas betont, Eigenwilligkeit entdeckte er, das verriet ihr Mund, der eine merkwürdig geformte, gerade, volle Unterlippe hatte. Sehr große schöne Augen, graugrün mit dichten dunklen Wimpern gesäumt. Sie war nur knapp mittelgroß, aber gut gewachsen, wohlproportioniert. Die nackten Beine waren braun gebrannt und die Zehen in alten verbrauchten Sandaletten besonders hübsch und wohlgeformt.
Unwillkürlich griff er nach ihrer Hand und betrachtete sie von beiden Seiten. Hände sagten ihm viel über einen Menschen.
Ihre Hand war schmal, doch kräftig, mit langen Fingern und langen, gewölbten Nägeln, die ein wenig schmutzig waren und nicht lackiert. Sehr schmal das Handgelenk.
»Wollen Sie mir aus der Hand lesen?«, fragte sie, mit deutlichem Spott in der Stimme.
»Nein, das kann ich nicht. Ich wollte bloß die Form Ihrer Hände sehen.« – »Warum?«
»Weil es mich interessiert. – Keine labile Hand, würde ich sagen. Eine Hand, geschaffen, das Leben zu packen. Nicht, es wegzuwerfen.«
Sie zog die Hand zurück, setzte sich neben ihn auf den Baumstamm. »Vielleicht hätte ich es auch nicht getan.«
»Umso besser. Ich könnte auch nicht verstehen, warum. Ist Liebe so wichtig?« – »Ist sie nicht wichtig?«
Er überlegte seine Antwort sorgfältig. »Doch, in gewisser Weise schon. Es kommt immer darauf an …«, er stockte, es war schwer, eine glaubhafte Formulierung zu finden. Schwer für einen Mann, der Erfolg in der Arbeit hatte, eine gute Ehe führte und, wenn es ihm beliebte, jederzeit eine Geliebte fand. Worauf kam es bei einem jungen Mädchen an? Bei einem Mädchen wie diesem, das Stolz, Trotz und die Fähigkeit zu hassen besaß?
»Worauf kommt es an?«
»Auf die Art von Liebe kommt es an, um die es sich handelt. Liebe ist immer nur eine vorüberfliegende Wolke, die man nicht festhalten kann. Das muss man eines Tages lernen, früher oder später. Auch Sie, mein Kind, müssen das. Es ist ein bisschen kindisch und sehr unreif, zu glauben, man könne ein Spielzeug für die Ewigkeit daraus machen. Es gibt jedoch andere Gefühle, die dauerhaft sind. Mit denen man auskommen und leben kann.« Es schien ihm nicht überzeugend, was er sagte. Glaubte er es eigentlich selbst? Unwillkürlich dachte er an Dorothy. Liebte er sie denn nicht? Natürlich. Dies war Liebe. Aber vermutlich nicht das, was dieses Mädchen unter Liebe verstand. Dorothy und er – das war eine beständige Freundschaft, eine erprobte Gemeinschaft, war Einverständnis und Vertrauen. Doch es war nicht Glanz und Jubel und Spiel. Nicht mehr. Es war nicht Verhängnis, nicht Untergang und nicht Aufschwung.
»Wichtig ist sie nicht«, sagte plötzlich die Stimme neben ihm, deren Klang er nun schon kannte; sie war ein wenig rau, überraschend tief, ein kleiner spröder Sprung war darin. Immer? Oder nur heute, da sie Tränen in der Kehle hatte? »Liebe ist nicht wichtig«, wiederholte das Mädchen hart. »Nichts ist wichtig. Nur das, was man selber ist.«
Er sah sie überrascht an. Irgendein dummes kleines Mädchen mit Liebeskummer, so war sie ihm erschienen. Aber er hatte kaum einige Sätze mit ihr gesprochen, schon musste er dieses Urteil revidieren. Auf eine ihm noch nicht ganz erklärliche Art war dieses Mädchen ein nicht alltäglicher Fall. Er empfand auf einmal Neugier. Er hätte gern mehr von ihr gewusst.
Er fragte: »Was bedeutet Ihnen dieser Junge, der da heute geheiratet hat?«
Diese klare, unumwundene Frage versetzte Jovana in Verwirrung. Die naheliegende Antwort war: Ich liebe ihn. Aber eben hatte sie gesagt, Liebe sei nicht wichtig. Und hatte es geglaubt. Aber alles, was mit Peter zusammenhing, war das Wichtigste auf der Welt gewesen. Ein ganzes Jahr lang. Und wie sie ohne ihn weiterleben sollte, hatte sie nicht gewusst. Beschämt, verlassen, blamiert – das war es. Auch wenn er behauptete, sie weiterhin zu lieben, er hatte die andere geheiratet. Nie würde sie diese Schmach verwinden.
Erst hatte sie daran gedacht, ihn zu töten. Und nun hatte sie selber sterben wollen, am Tage seiner Hochzeit. Er sollte ewig, ewig daran denken.
Peter, der hübscheste und begehrteste Bursche in Ahlsen, der Junge, nach dem alle Mädchen verrückt waren. Er ging noch in die Schule, da waren die Mädchen schon hinter ihm her, erzählten von ihm, kicherten und lachten, berichteten, ob er geschaut oder nicht geschaut, was er gesagt, getan oder beinahe getan hätte.
Seinem Vater gehörte die größte Reparaturwerkstatt und Tankstelle in Ahlsen, Peter fuhr schon bald mit dem Auto durch die Gegend, kurvte um die Mädchen herum und lud sie ein, bei ihm einzusteigen.
Neben Jovana hielt er das erste Mal, als sie sechzehn war. Sie ging seit zwei Jahren im Kaufhaus Moorwald in die Lehre, war fleißig und tüchtig, nur manchmal bockig. Und scheu war sie. Ein scheues, unglückliches Kind, das keiner liebte. Sie wäre gern weiter in die Schule gegangen, hatte gut und leicht gelernt, aber das stand niemals zur Debatte. Bei Moorwald die Ahlsener und die Bauern, die vom Land kamen, zu bedienen, das behagte ihr auch nicht, sie hatte ihre eigenen Ideen mit sich selbst. Sie wusste nur nicht, wie sie zu verwirklichen waren.
Sie wolle lieber ins Büro gehen, ließ sie ihren Vater wissen. Ihres Vaters Frau fand das unsinnig. Moorwald sei das größte Geschäft im Ort, die Moorwalds die reichsten Leute hier, eine Ehre, dort zu arbeiten, und Verkäuferin sei ein großartiger Beruf. Soweit die Stiefmutter. Ihr Vater kuschte zunächst wie stets vor seiner Frau. Er war immer noch ein Fremder in Ahlsen, seine Frau war zuständig für alle Kontakte, für seine Arbeit, für sein Anerkanntwerden. Dieses Kind aus seiner ersten Ehe blieb ein Hemmschuh und eine Belastung für ihn, für seine Frau, für die Verwandten seiner Frau. Zumal das Kind schwierig war, trotzig und unzugänglich, sich keinem anschloss, niemandem Vertrauen schenkte.
Hartnäckig war das Kind jedoch auch. Es setzte durch, dass es Stenographie und Schreibmaschine lernen durfte.
Eines Abends auf dem Heimweg von diesem Kurs, ein heller Sommerabend war es, hielt der vielgeliebte Peter mit seinem Wagen neben ihr. »Komm! Steig ein!«
Es war mehr ein Schreck als eine Freude. Sie schüttelte stumm den Kopf und blickte ihn ängstlich an.
»Na, komm schon. Wir machen eine kleine Spritztour. Du kommst doch nie zum Autofahren.«
Das stimmte. Sie konnte es zählen, wann sie in einem Auto gesessen hatte. Scheu blickte sie sich um. Es war eine Nebenstraße, niemand sah sie hier.
Er griff nach ihrer Hand, zog sie ins Auto und brauste davon. Peter war ein toller Autofahrer, und das zeigte er gern. Einmal durch das Städtchen und dann hinaus auf die Straße. Dort drehte er auf.
»Schicke Karre, was?«, rief er. »Macht leicht ihre hundertfünfzig Sachen. Tadellos in Ordnung wieder. War bei uns zur Reparatur, und ich muss sie jetzt ein bisschen herumjagen, ob alles wieder stimmt.«
Das war so ziemlich das Einzige, was er in der Werkstatt tat. Peter brauchte sich die Hände nicht schmutzig zu machen, dafür waren sein älterer Bruder und die Gesellen zuständig. Sein Vater, nachdem er entdeckt hatte, was der Junge für ein geschickter Verkäufer war, setzte Peter im Außendienst ein. Es wollten viele Leute nun Autos kaufen, neue oder gebrauchte. Auch die Bauern fuhren nicht mehr gern mit Gespannen, ein Auto war der letzte Schrei, auch für sie. – Peter führte die Wagen vor, lachte, schwatzte und trank mit den Leuten. Das Geschäft wuchs von selbst, sie nahmen eine Ölvertretung dazu, vergrößerten die Werkstatt, bauten Garagen. Peter war zweiundzwanzig, bekannt in der ganzen Gegend bis in die Kreisstadt hinein, ein tüchtiger Bursche. Der Stolz seines Vaters, der Liebling seiner Mutter. Und der Abgott aller Mädchen.
»Na?«, fragte dieser Einmalige. »Bist du stumm? Macht das Fahren nicht Spaß?«
»Doch«, gab Jovana zu.
Er nahm das Gas weg, lächelte sie an. »Du bist ein komisches Mädchen.«
Er streichelte ihr Knie, später hielt er an und versuchte sie zu küssen. Sie saß steif und angsterfüllt auf ihrem Sitz, wehrte sich verzweifelt und fing an zu weinen, als er fester zugriff. Da lachte er und meinte, sie sei wohl doch noch eine dumme Göre. Und fuhr nach Ahlsen zurück.
Eine dumme Göre, das wusste sie sowieso. Hässlich dazu und unbeliebt: Keiner mochte sie. Sie hatte keine Freundin wie die anderen Mädchen. Die Jungen schauten sie nicht an. Nicht zu begreifen, was diesen Peter bewogen hatte, sie in sein Auto zu holen. Zunächst tat er es auch nicht wieder.
Sie sah ihn erstmals wieder aus der Nähe im Winter, kurz vor Weihnachten. Er kam ins Kaufhaus Moorwald, um Einkäufe zu machen. Sie war gerade in der Nähe, als er eintrat, er grinste ihr zu, sie versuchte, nach seinen Wünschen zu fragen, und stotterte dabei. Dann kam Gertrud Moorwald, die Tochter des Hauses. Und sie durfte nur noch stumm assistieren, herbeiholen, was er wünschte, ihm die Ware vorlegen. Er sah sie nicht einmal an dabei, lachte und schäkerte mit Gertrud. Erst als sie ihm die Waren einpackte, geruhte er, sie wieder zu bemerken.
»Na du! Immer noch so schüchtern? Wollen wir wieder einmal eine Spritztour zusammen machen?«
Sie schwieg, sah ihn großäugig an. Er war der Held ihrer Träume, der Prinz aus dem Märchen.
Er hatte einen plötzlichen Einfall, beugte sich zu ihr und flüsterte, denn Gertrud kam schon wieder herbeigesegelt:
»Wollen wir morgen Abend tanzen gehen? In Ebenstadt ist ein schickes Lokal. Morgen Abend, beim linken Turm, ja?«
Sie war noch nie zum Tanzen gewesen. Nicht vorstellbar, wie sie es fertigbringen sollte, abends fortzugehen.
Aber es war ganz einfach. Der nächste Tag war ein Sonnabend, die Eltern gingen zu Bekannten zu einer Geburtstagsfeier. Schon um fünf Uhr verschwanden sie. Jovana hatte den Auftrag, ihre jüngeren Geschwister ins Bett zu bringen; sie besorgte das in Windeseile, die Kinder lagen, trotz ihres Protestes, schon um halb sieben im Bett. Viel Auswahl bei der Garderobe war nicht möglich. Sie entschied sich für ein hellblaues, kurzärmeliges Kleid, es war eigentlich ein Sommerkleid, aber es schien ihr für einen Tanzabend am ehesten geeignet. Und es stand ihr gut, das wusste sie. Um sieben Uhr war sie beim linken Turm auf dem Marktplatz. Sie hatte ja keine Ahnung, welche Zeit er vorgesehen hatte, für das Rendezvous. Morgen Abend – das war alles gewesen. Das konnte um sieben, um acht oder um neun sein. Wann ging man denn zum Tanzen?
Es war kalt, sie fror in ihrem dünnen Mantel. Dann schneite es sogar ein wenig. Sie stand und wartete. Halb acht, acht, er kam nicht. Um halb neun ging sie, kehrte nach ein paar Schritten noch einmal um und wartete bis neun. Dann ging sie nach Hause ins Bett und weinte.
Im folgenden Jahr, Ende Mai, gefiel es ihm zum dritten Mal, von ihr Notiz zu nehmen. Es war wie beim ersten Mal. Sie ging inzwischen ins Büro zu Rechtsanwalt Kuntze und tippte Schriftsätze.
Wieder hielt ein Auto neben ihr, wieder sagte er: »Komm!«
»Lass mich in Ruhe!«, rief sie zornig, denn sie hatte das vergebliche Warten am Turm in der Winternacht nicht vergessen. – Aber natürlich saß sie dann doch neben ihm, er brauste davon, es war wie damals, aber diesmal ging er die Sache zielbewusster an. Er steuerte in einen Waldweg, hielt an und begann sofort, sie zu küssen. Das konnte er genauso gut wie Auto fahren. Sie lernte es diesmal schnell. Sie war auch nicht mehr so voller Abwehr. »Du hast einen tollen Mund«, flüsterte er.
Das war das erste Kompliment, das sie in ihrem Leben bekam. Es bewirkte, dass sie allen Widerstand aufgab. Er streichelte ihre Brust, er knöpfte ihr die Bluse auf, er griff ihr unter den Rock, er ließ ohne große Umstände und Umwege Nummer auf Nummer das Repertoire eines wohlgeübten Verführers abrollen, und alles war für sie neu und einmalig, und es bestand nicht die geringste Aussicht, dass sie dagegen aufkam. Sie wollte auch nicht, es war viel zu schön.
Er verführte sie also, ohne auf großen Widerstand zu stoßen, es war ein bisschen schwierig im Auto, aber nicht für Peter, er war daran gewöhnt. Sie war verängstigt und entzückt in einem, siebzehn Jahre alt; kein Mensch, der sie je gewarnt oder aufgeklärt hätte.
Das Erstaunliche jedoch geschah danach. Normalerweise wäre dieses Abenteuer für Peter nur eins unter vielen gewesen, hätte er dieses Mädchen genauso schnell vergessen wie jedes andere. Aber seltsamerweise fasste er eine ziemlich heftige, andauernde Neigung zu ihr. Er liebe sie, behauptete er. Kümmerte sich kaum mehr um andere Mädchen. Sie gingen miteinander, wie man im Ort sagte. Es verhalf Jovana zu einer gewissen Bedeutung. Plötzlich fand man sie gar nicht mehr so hässlich und unscheinbar. Wenn Peter sie begehrenswert fand, musste wohl etwas an ihr dran sein.
Ein Jahr hatte das gedauert. Ein stürmisches, aufregendes, herrliches Jahr. Jovana kam erstmals ein wenig aus Ahlsen heraus. In umliegende Orte zum Tanz, in die Kreisstadt, sogar in die nächstgelegene Großstadt. Sie lernte endlich, endlich ein Theater kennen, Lokale, eine Bar. Sie war unbeschreiblich glücklich.
Die Frau ihres Vaters sagte: »Der heiratet dich sowieso nicht. Bilde dir das nicht ein. Geld geht zu Geld. Der wird dich sitzenlassen, womöglich mit einem Bams.«
Ihr Vater war, wie immer, hilflos und ratlos. Aber sie wäre sowieso nicht zu belehren gewesen.
Nun hatte Peter, der Schöne, geheiratet. Die Tochter vom Kaufhaus Moorwald. Geld geht zu Geld.
Sie bekam es vor gar nicht zu langer Zeit ziemlich schmucklos und ohne Umschweife von ihm mitgeteilt. Das mit der Gertrud sei schon lange abgesprochen. Er könne das auch nicht mehr ändern. Aber zwischen ihnen bleibe alles wie bisher. Sie sei es, die er liebe.
Das konnte, konnte nicht wahr sein. All seine Zärtlichkeiten, seine Worte, seine Küsse, seine Liebkosungen. Alles Lüge!
Durchaus nicht, sagte er. Er liebe sie ja. Er müsse die Gertrud nur eben heiraten.
Heute hatte er sie geheiratet.
Und da saß nun dieser fremde Mann neben ihr auf dem Baumstamm und fragte so einfach: »Was bedeutet Ihnen dieser Junge, der da heute geheiratet hat?«
Zu viel verlangt, sachlich darauf zu antworten.
»Ich hasse ihn«, rief sie mit Emphase.
»Bisschen viel Hass für ein so junges Geschöpf«, meinte Steffen gelassen. »Sie hassen die Gegend, die Stadt und den jungen Mann. Hassen ist anstrengend und macht hässlich, das sollten Sie sich vor Augen halten.«
Er betrachtete sie von der Seite. Wieder fand er Gefallen an ihrem Profil, es drückte Entschiedenheit aus und, auch wenn sie es noch nicht wusste, Selbstbewusstsein. Bei alledem aber wirkte es sehr kindlich. O ja, man konnte sehr gut hassen, wenn man so jung war. Und das Leben noch so ernst nahm.
»Wie alt bist du?«, fragte er. Es fiel ihm nicht auf, dass er sie duzte.
»Was hat das damit zu tun?«, sagte sie bockig.
»Womit?«
Sie warf ihm einen raschen ärgerlichen Blick zu. Spitzfindigkeiten im Dialog war sie nicht gewohnt.
»Achtzehn.«
»Nun wohl. Jung und hübsch, mit ganz besonders hübschen Füßen ausgestattet, wie ich sehe. Es wird noch andere Männer auf der Welt für dich geben als diesen Jüngling.«
Sie blickte ihn gespannt an. »Sie finden mich hübsch?«
»Aber ja.«
»Ich bin hässlich.«
»Aber nein. Wer sagt das? Fand das dieser junge Mann auch?«
»Nein. Er nicht. Er war der Erste, dem ich gefiel.«
»Das langt ja auch. Viel früher brauchtest du nicht anzufangen. Es spricht für seinen Geschmack, dass du ihm gefallen hast. Mir scheint, du bist keine Durchschnittsware. Umso weniger verstehe ich seine Heirat. Ich hatte Gelegenheit, die Braut aus der Nähe zu sehen. Mir wärst du lieber. Du solltest ihn nicht hassen, du solltest ihn bedauern.«
Und nun erlebte er etwas Erstaunliches: den strahlenden Triumph ihres Lächelns.
Das Gesicht ihm zugewandt, zog sie ein wenig die Oberlippe hoch, ihre Zähne, weiß und makellos, wurden sichtbar, sie bog den Kopf zurück, dieser merkwürdige Mund öffnete sich, ihre Augen strahlten auf. Das Mädchen lächelte.
»Ich bedaure ihn nicht. Ich weiß, dass er sie nicht liebt. Es ist nur das Geld. Aber er wird unglücklich sein. Unglücklich. Und das soll er auch sein.«
Fasziniert beobachtete Steffen das Schauspiel, das sich ihm bot. Selten hatte er ein so ausdrucksvolles Gesicht gesehen. Es konnte hässlich und schön sein, kümmerlich und unbedeutend und erhellt von strahlendem Triumph, voller Glanz und Kühnheit. Er kannte es nur traurig, trostlos, verzweifelt, von Schreck aufgerissen, von Hass verzerrt. Und nun dieses leuchtende Lächeln, während sie zugleich eine Art Fluch aussprach.
Dies war ohne Zweifel eine erstaunliche kleine Person. Unwillkürlich dachte er, dass dieser junge Mann wohl doch den leichteren Weg gewählt hatte. Dieses Mädchen, einmal zur Frau geworden, würde gewiss keine einfache Partnerin sein.
Immer noch mit diesem Lächeln auf den Lippen fuhr sie fort:
»Er denkt, es geht so weiter wie bisher. Er heiratet die Dicke, und mich trifft er heimlich. Bei seinen Spritztouren, wie er es nennt. Das hat er mir vorgeschlagen! Wie finden Sie das?«
Steffen lächelte amüsiert. Sie hatte ihn offenbar als Zuhörer und Ratgeber akzeptiert. »Reichlich naiv, würde ich sagen. Der junge Mann scheint dich schlecht zu kennen.«
»Er kennt mich nicht«, wiederholte sie befriedigt. »Sie kennen mich alle nicht. Ich werd’s ihnen zeigen. Sie denken, ich bin dumm und hässlich. Sie lachen mich aus, weil er die Gertrud geheiratet hat, sie denken, ich bin traurig. Ich bin nicht traurig. Ich werde allen ins Gesicht lachen. Ja. Lachen werde ich.«
Sie warf den Kopf in den Nacken, dass ihre hellbraunen Haare flogen, und lachte. Noch war Verzweiflung in diesem Lachen, aber mehr noch Trotz und Kraft.
»Sehr schön«, meinte Steffen, »so gefällst du mir besser. Hättest du dein Rendezvous mit dem Zug eingehalten, dann wärst du jetzt wirklich hässlich. Und dumm sowieso. Und sie würden alle mit Recht denken, du seist traurig gewesen. Aber so, wie die Dinge liegen, kann der Schutzengel ja nun getrost von dannen ziehen.«
Sie blickte ihn überrascht an. »Sie wollen gehen?«
Nun lachte auch er. »Was dachtest du? Ich war im Begriff, nach Hause zu fahren. Ich kann nicht stundenlang mit dir am Waldrand sitzen.«
»Wohin fahren Sie?« – »Nach Hamburg.«
»Nach Hamburg«, wiederholte sie respektvoll. »Eine richtige große Stadt.« Und ohne Übergang rief sie voll Energie: »Nehmen Sie mich mit!«
»Wie?« Steffen starrte sie perplex an. »Ich soll dich mitnehmen? Jetzt? Einfach so?«
»Ja. Ich will hier nicht mehr bleiben. Ich möchte fort.«
»Dagegen ist nichts einzuwenden. Ein Ortswechsel wäre bestimmt das Beste für dich. Ich habe auch durchaus den Eindruck, dass du hier in diesem Ahlsen nicht ganz am richtigen Platz bist. Aber so, aus dem Stand …« Er wies mit einer sprechenden Handbewegung über das rote Röckchen, die nackten Beine. »Hast du denn keine Familie?«
»Doch. Meinen Vater und seine Frau. Und ihre Kinder.«
Die Art, wie sie die Familie aufgliederte, klang nicht nach besonders herzlichen Beziehungen.
»Na also, da kannst du doch nicht einfach auf und davon gehen. Du bist noch nicht mündig.«
»Die wäre froh, wenn ich weg bin. Sie kann mich sowieso nicht leiden.«
»Die Frau deines Vaters?«
Sie nickte.
»Und dein Vater?«
»Er tut nur, was sie sagt.«
»Aha.«
»Ja«, rief sie, ganz begeistert von ihrem Einfall, »ich fahre mit Ihnen nach Hamburg.«
Steffen stand auf und sagte mit Nachdruck, obwohl es ihm fast schwerfiel, diesen Enthusiasmus zu dämpfen: »Du fährst nicht mit mir nach Hamburg. Wie stellst du dir das vor? Am Ende würde man mich noch wegen Entführung Minderjähriger belangen.«
»Ich bin nicht minderjährig, nur noch nicht mündig«, stellte sie sachlich richtig, was ihn überraschte. Er wusste nichts von ihrer Tätigkeit in einem Anwaltsbüro.
»Wie auch immer, ich nehme dich nicht mit. Wenn du von hier fortgehen willst, was dir offenbar nicht schwerfallen wird, dann tue es. Aber mit Überlegung. Hast du denn etwas gelernt?«
»Ja«, erwiderte sie. Mehr nicht.
Er wartete auf eine nähere Erläuterung, aber sie blieb aus.
Für ihn wurde es Zeit. Langsam ging er den Weg zurück, den er vor einer halben Stunde so rasch gelaufen war. Sie schlenderte neben ihm her, das rote Röckchen wippte. Sie schwiegen, bis sie bei seinem Auto angekommen waren.
Er blieb stehen und lächelte sie an. »Du hast mir nicht einmal deinen Namen gesagt.«
»Jovana.«
Er war überrascht. »Hübsch. Ein ganz besonderer Name. Wie kommst du zu dem?«
»Von meiner Mutter. Sie hieß auch so.«
»Also, Jovana, dann wünsche ich dir alles Gute. Lass dich nicht unterkriegen. Man stirbt nicht an gebrochenem Herzen. Ein Mädchen wie du schon gar nicht. Ich verstehe ein wenig von Frauen, weißt du«, nun sein charmantes Lächeln, das unwiderstehliche, »ich würde sagen, du bist ein Mädchen mit Pfeffer. Du wirst dich bald wieder verlieben und geliebt werden.«
Sie hörte ihm großäugig zu, die Lippen ein wenig geöffnet, sie trank seine Worte förmlich. Dann ihr Lächeln, nicht weniger unwiderstehlich als das seine.
»Schade, dass Sie mich nicht mitnehmen.«
Fast kam es ihm im Moment auch so vor. Vielleicht deswegen tat Steffen Rau etwas vollkommen Blödsinniges, Sinnloses, ihm selbst Unverständliches. Er griff in den Wagen, wo neben dem Fahrersitz, wie immer, sein Notizbuch lag. Er nahm das Buch, riss ein Blatt heraus und schrieb mit seiner großen Schrift sechs Ziffern auf das weiße Blatt.
»Hier! Meine Telefonnummer. Wenn du wirklich mal nach Hamburg kommst, dann ruf mich an.«
Er – der nie und nimmer einem Mädchen oder einer Frau freiwillig seine private Nummer gab. Der berühmte Regisseur, dessen Nummer Gold wert war.
Allerdings schrieb er seinen Namen nicht dazu. Und dieses Mädchen vom Lande konnte nicht ahnen, wer er war. Er strich ihr leicht mit zwei Fingern über die Wange, sagte: »Leb wohl, Jovana«, und stieg ein.
Sie rührte sich nicht, sah ihn an, murmelte noch einmal:
»Schade!« und dann, als er bereits startete, etwas lauter: »Danke!«
Er hatte es gehört, lächelte und nickte, stieß den Wagen zurück und wendete. Dann fuhr er fort.
Sie stand und sah dem Wagen nach. Dann blickte sie hinab auf ihre Füße. Ganz besonders hübsche Füße.
Was für ein netter Mann! Ein Mann. Ein richtiger Mann. Nicht so ein dummer Junge wie Peter. Ihre Zungenspitze spielte an der Oberlippe. Wie es sein musste, von einem solchen Mann geliebt zu werden?
Was hatte er noch gesagt? Ein Mädchen mit Pfeffer. Sie schaute auf das Blatt in ihrer Hand, las die Zahlen laut, eine nach der anderen, faltete das Blatt und steckte es in die Tasche des roten Röckchens. Hinter ihr, durch den Wald, kam ein dumpfes Geräusch. Der Nachmittagszug nach Hamburg. Sie blieb stehen, bis der Zug kam und vorbeifuhr. Sie blickte ihm nach wie zuvor dem Auto.
Mit diesem Zug würde sie fahren. Eines Tages. Bald.
Dann machte sie sich auf den Weg, Ahlsen gegenüberzutreten.
Die Unterlippe vorgeschoben, bereit, der ganzen Welt zu trotzen, marschierte sie zurück. Sie hatte hübsche Füße, sie war ein Mädchen mit Pfeffer. Sie kannte einen Mann aus Hamburg, der sie beinahe mitgenommen hätte. Er hätte es gern getan, dessen war sie sicher. Immerhin hatte sie seine Telefonnummer. Er sah gut aus. Ein großer, schlanker, lässiger Mann. Ein Mann, wie sie noch keinen gesehen hatte.
Peter aber hatte die dicke Gertrud und würde sie behalten müssen. Das musste ein Spaß sein.
Während seiner Heimfahrt beschäftigte sich Steffen noch eine ganze Weile mit dem Erlebnis der letzten Stunden: spielerisch, gewohnt, in Drehbüchern zu denken, begann er die Geschichte weiterzuentwickeln. Angenommen, dies wäre ein Film, dann hätte der Mann das Mädchen natürlich mitnehmen müssen. Der Anfang einer Liebesgeschichte – und weiter? Vor allem musste der Mann etwas jünger sein als er, zwanzig, nein, man durfte nicht so kleinlich sein, fünfzehn, zehn Jahre jünger. Eine Aschenbrödelgeschichte also. Das Mädchen kommt in eine fremde Umwelt. Der Mann könnte ein Industrieboss sein und natürlich standesgemäß verlobt oder so etwas – und die Konflikte waren gegeben, aber die Liebe besiegt alles. Er verzog den Mund, das übliche Klischee. Nur komisch – dieses Mädchen Jovana passte da gar nicht hinein.
Dies, so fand Steffen Rau, war eine erstaunliche Tatsache. Wie hatte das kleine Luder es fertiggebracht, auf ihn so zu wirken, dass er sie in einem Durchschnittsfilm nicht unterbringen konnte.
Am Spätnachmittag kam er zu Hause an und traf Dorothy bei ihrer Teestunde.
»Du kommst spät«, sagte sie, »ich habe mir Sorgen gemacht.«
Er küsste sie auf die Wange. »Das tut mir leid, Liebling. Es gab keinen Grund für Sorgen. Ich habe einen kleinen Umweg gemacht.«
Sie servierte ihm seinen Tee, starken dunklen Tee, und obwohl er lieber Kaffee trank, hatte er sich im Zusammenleben mit ihr an die Teestunde gewöhnt. Er berichtete, sie hörte zu. Das Gespräch war wie immer leise, höflich, rücksichtsvoll. Er hatte das Zusammensein mit Dorothy immer sehr bewusst genossen, es war ein wohltuender Gegensatz zu der lauten, hektischen und oft brutalen Welt, in der sich seine Arbeit abspielte.
Dorothy, aus einer Hamburger Patrizierfamilie stammend, der Vater Stockhamburger, die Mutter Engländerin, hatte sich in den fast zwanzig Jahren, die er sie nun kannte, nie verändert. Sie war geblieben, wie sie war: eine schöne blonde Frau, schlank und hochgewachsen, von gemessener Liebenswürdigkeit, jedem lauten Ton, jeder zur Schau getragenen Gemütsbewegung zutiefst abgeneigt. Was ihn schon an dem jungen Mädchen entzückt hatte, die selbstverständliche Eleganz ihrer Haltung und ihrer Bewegungen, die distanzierte Kühle und Gelassenheit ihrer Umwelt gegenüber, all das fand er heute noch unverändert an ihr. Mehr, als er selbst wusste, hatte ihr Wesen auf ihn abgefärbt. Wenn man ihn den Regisseur mit den guten Manieren und den leisesten Tönen nannte, so war das mehr oder weniger ihr Einfluss. In seinen jungen Jahren hatte er weit mehr Temperament gezeigt, bei der Arbeit und auch sonst.
Dorothy war noch immer eine schöne Frau. Einer Frau, wie sie es war, konnte das Älterwerden nicht viel anhaben. Sie verbrauchte sich nicht mit Emotionen. Glücklicherweise jedoch besaß sie Humor, war intelligent und anpassungsfähig. Sie nahm an seiner Arbeit lebhaften Anteil, obwohl man sie in Filmkreisen selten zu sehen bekam. Als er noch am Theater inszenierte, hatte sie das mehr interessiert. Aber die Tochter aus einer Hamburger Kaufmannsfamilie war durchaus einverstanden mit den finanziellen Ergebnissen seiner Filmarbeit. Sie hielt es für wünschenswert, dass er Geld verdiente. Nicht zuletzt aus Prestigegründen ihrer Familie gegenüber, die ihrer Heirat natürlich erbitterten Widerstand entgegengesetzt hatte. Der Familie musste vorgeführt werden, dass auch Steffen ein reicher und angesehener Mann werden konnte mit dem, was er tat. Sie führte mit dem Steuerberater alle Finanzangelegenheiten und legte das Geld an, in Grundstücken und Beteiligungen. Steffen verstand davon nichts. Später einmal, so sagte sie manchmal, wenn ein Vermögen geschaffen sei, stünde nichts im Wege, dass er wieder Theaterinszenierungen machen würde, und im Geiste, auch sie hatte ihre Träume, sah sie ihn als Intendanten einer großen Bühne. Am liebsten natürlich sollte es das Hamburger Schauspielhaus sein.
Steffen lächelte zu solchen Träumen. Es waren die einzigen, die er an ihr kannte, und dass sie ihn betrafen, rührte ihn. Obwohl sie, genau genommen, sie selbst genauso betrafen. Die Geltung, die sie ihm verschaffen wollte, der Gesellschaft gegenüber, aus der sie stammte, würde auch ihr zugutekommen. Er vermied es, sie darauf hinzuweisen, dass es von dem Weg, auf den er geraten war, schwerlich eine Rückkehr in diese Gefilde gab. Jeder Mensch hat ein Recht auf seine Träume, fand er.
Nachdem er von Frankfurt und der Premiere berichtet hatte, erzählte er von Ahlsen und was er dort erlebt hatte. Es war angenehm, ihr etwas zu erzählen. Sie hörte aufmerksam zu, unterbrach nicht mit unnötigen Fragen, schweifte nicht zu anderen Themen ab, die ihr in den Sinn kamen.
Als er fertig war, sagte sie: »Das hört sich an wie der Anfang eines Films.«
Er lachte. »Genau das habe ich mir auf der Heimfahrt auch gedacht.«
»Dann hättest du das Mädchen allerdings mitbringen müssen.«
Sie konnte in seiner Welt mitleben, das bewies sie nun wieder einmal. Das war es, was ihre Ehe so gut und haltbar gemacht hatte.
»Und was hättest du dazu gesagt, wenn ich mit ihr hier hereingeschneit wäre?«
»Ich hätte dafür gesorgt, dass sie eiligst wieder ihrem Vater zugestellt wird.« – »Also auch kein brauchbarer Filmstoff.«
Das Leben war eben kein Film, nicht wenn man mit Dorothy verheiratet war.
»Man soll sich nicht in anderer Leute Leben einmischen«, sagte sie, und es klang ein wenig hochmütig. »Es kommt nichts Gutes dabei heraus, wenn man Schicksal spielen will.«
»Aber das habe ich bereits getan. Oder hätte ich sie laufenlassen sollen? Unter den Zug?«
»Das hätte sie gewiss nicht getan. So wie du sie geschildert hast. Noch eine Tasse Tee, Steve?« – »Ja, bitte.«
Dann habe ich sie nicht richtig geschildert, dachte er. Sie hat viele Gesichter. Und sie war echt verzweifelt. Sie wäre durchaus in der Lage gewesen, es zu tun. – Er war geneigt, noch einmal mit der Schilderung des Mädchens namens Jovana zu beginnen. Aber er ließ es sein. Für Dorothy war das Thema beendet. Sie sprachen nie mehr davon. Und Steffen vergaß die Begegnung im Laufe der nächsten Tage.
Ein Mädchen im Aufbruch
Nicht so Jovana. Das Erlebnis mit dem fremden Mann, die Erinnerung an das Gespräch mit ihm, war zurzeit das Einzige, das sie von ihrem Kummer ablenken konnte. Denn natürlich war die hochgemute Stimmung, mit der sie in das Städtchen zurückgekehrt war, rasch verflogen. Sie hatte den Tatsachen ins Gesicht zu sehen, der Schadenfreude, dem Spott, den Sticheleien ihrer Umgebung; und auch wenn sie den Kopf hoch trug und sich ihre Gefühle nicht anmerken ließ, war alles schwer zu ertragen.
Übrigens wusste sie einige Tage später, wer der Mann war. In einer Illustrierten – sie las jede Illustrierte, die sie erwischen konnte – war ein Bericht über die Frankfurter Premiere und unter anderem ein Bild von Steffen Rau. Auf dem Bild war er zusammen mit Britta Thorwald zu sehen, dieser wunderschönen Britta Thorwald, Star des neuen Films. Die Thorwald lachte ihn strahlend an, er, größer als sie, blickte mit seinem gewinnenden Lächeln, das Jovana ja nun auch kannte, wie es schien sehr liebevoll in ihre Augen.
Jovana saß starr, als sie das Bild entdeckte. Konnte das möglich sein? Hatte sie wirklich mit Steffen Rau gesprochen? Er war es, der ihr nachgegangen war? Aber ein Irrtum war nicht möglich, er war es wirklich. Natürlich war ihr sein Name wohlbekannt, sie ging leidenschaftlich gern und oft ins Kino, nur kannte man meist die Gesichter der Regisseure nicht. Sie begriff sofort, welche Kostbarkeit sie mit der Telefonnummer besaß. Und obwohl sie den Zettel mit der Nummer gut verwahrt hatte, schrieb sie zur Sicherheit die Zahl noch einmal in ein Buch und gleich noch einmal in einen Kalender. Alles, was er gesagt hatte – nun, da sie wusste, wer er war –, erhielt doppelte und dreifache Bedeutung. Immer wieder memorierte sie den Dialog mit ihm. Wenn ein Mann wie dieser ihr sagte, sie sei hübsch, einer wie er, der ständig von den schönsten Frauen umgeben war, dann bedeutete das etwas. Es war ein großer Trost in dieser elenden Zeit, die sie durchmachte.
Zu Hause: »Was habe ich dir immer gesagt? Der heiratet dich nicht. Jetzt hast du die Bescherung. Blamiert vor allen Leuten. Und wir dazu. Aber du wolltest ja nicht hören. Das Fräulein wusste es ja besser.« – Und so in diesem Stil ging es weiter. Ihr Vater sagte manchmal: »Lass sie doch in Ruhe. So etwas erlebt jeder mal.« Worauf sie, seine Frau, nur höhnisch lachte. »Jeder? Mir ist so was nie passiert. Schöne Blamage.«