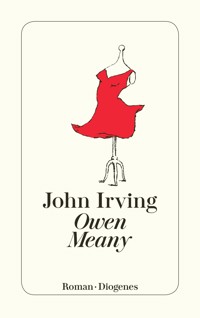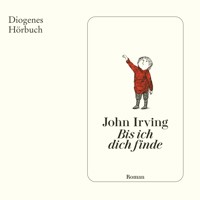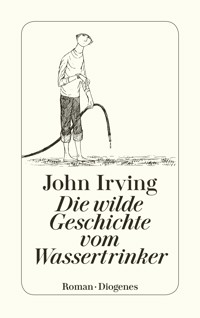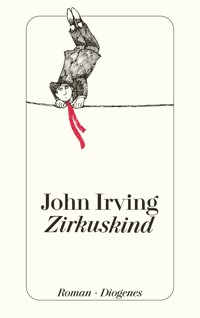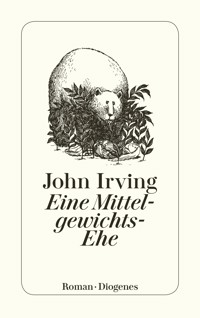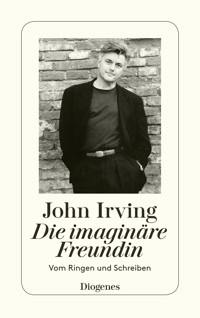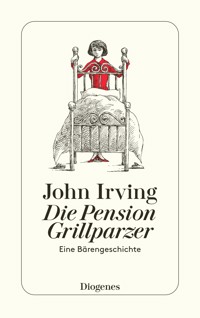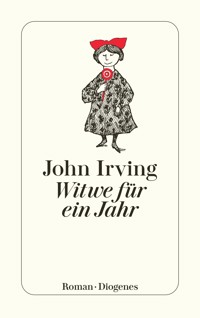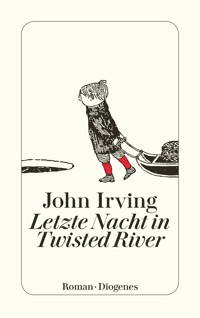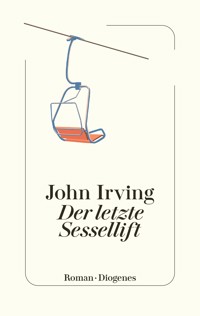
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1941 in Aspen, Colorado. Die 18-jährige Rachel tritt bei den Skimeisterschaften an. Eine Medaille gibt es nicht, dafür ist sie schwanger, als sie in ihre Heimat New Hampshire zurückkehrt. Ihr Sohn Adam wächst in einer unkonventionellen Familie auf, die allen Fragen über die bewegte Vergangenheit ausweicht. Jahre später macht er sich deshalb auf die Suche nach Antworten in Aspen. Im Hotel Jerome, in dem er gezeugt wurde, trifft Adam auf einige Geister. Doch werden sie weder die ersten noch die letzten sein, die er sieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1497
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
John Irving
Der letzte Sessellift
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Anna-Nina Kroll und Peter Torberg
Diogenes
Für Dean Cooke
Nein, muss ich sterben,
Grüß’ ich die Finsternis als meine Braut
Und drücke sie ans Herz!
William Shakespeare, Maß für Maß,III, 1.
1. AKTFrühe Anzeichen
1Ein nicht gedrehter Film
Meine Mutter gab mir den Namen Adam, Sie wissen schon, nach wem. Sie sagte immer, ich sei ihr Ein und Alles. Ich habe ein paar Namen verändert, aber nicht meinen und auch nicht den des Hotels. Das Hotel Jerome gibt es wirklich – ein großartiges Haus. Falls Sie je nach Aspen kommen, sollten Sie dort übernachten, wenn Sie es sich leisten können. Aber wenn Ihnen dort Ähnliches widerfährt wie mir, sollten Sie ausziehen. Geben Sie nicht dem Hotel Jerome die Schuld.
Ja, es gibt dort Gespenster. Und nein, damit meine ich nicht die, von denen Sie vielleicht schon gehört haben: den nicht angemeldeten Gast in Zimmer 310, ein ertrunkener Zehnjähriger, der vor Kälte zittert, schnell wieder verschwindet und nur nasse Fußspuren hinterlässt; den liebeskranken Silberschürfer, dessen nächtliches Schluchzen man hört, wenn er durch die Flure streift; das hübsche Zimmermädchen, das in einem nahe gelegenen Tümpel durchs Eis brach und (ungeachtet der Tatsache, dass es danach an einer Lungenentzündung starb) gelegentlich erscheint, um die Betten aufzudecken. Das sind nicht die Gespenster, die ich üblicherweise sehe. Ich sage nicht, dass es sie nicht gibt, aber mir sind sie kaum je begegnet. Nicht jedes Gespenst wird von allen gesehen.
Meine Gespenster sehe ich ganz deutlich – sie sind für mich ganz real. Ich habe ein paar ihrer Namen verändert, aber nichts von dem, was sie ausmacht.
Ich kann Gespenster sehen, aber nicht jeder kann das. Und die Gespenster selbst? Was ist ihnen eigentlich passiert? Ich meine, wie sind sie zu Gespenstern geworden? Nicht jeder, der stirbt, wird zum Gespenst.
Jetzt wird es kompliziert, denn natürlich ist nicht jedes Gespenst tot. In bestimmten Fällen kann man ein Gespenst und doch noch halb lebendig sein – es ist nur ein wesentlicher Teil von einem gestorben. Ich frage mich, wie viele dieser halb lebendigen Gespenster wissen, was in ihnen gestorben ist und ob es – seien sie nun tot oder lebendig – Regeln für Gespenster gibt.
»Mein Leben ist wie ein Film«, sagen manche, aber was meinen sie damit? Meinen sie etwa, ihr Leben sei zu unglaublich, um wahr zu sein? »Mein Leben ist wie ein Film« bedeutet, man hält Filme gleichzeitig für alles andere als realistisch und für mehr, als man von der Realität erwarten kann. »Mein Leben ist wie ein Film« heißt, man hält das eigene Leben für derart besonders, dass es als Filmstoff taugt; so besonders gesegnet oder verflucht.
Mein Leben ist ein Film, aber nicht aus den üblichen selbstgefälligen oder selbstmitleidigen Gründen. Mein Leben ist ein Film, weil ich Drehbuchautor bin. In erster Linie bin ich Schriftsteller, aber selbst wenn ich einen Roman schreibe, stelle ich mir alles bildlich vor – ich sehe die Geschichte ablaufen, als sei sie bereits verfilmt. Wie manche anderen Autoren auch habe ich die Titel und Plots von Romanen im Kopf, die ich zu meinen Lebzeiten nicht einmal mehr beginnen werde; wie Drehbuchautoren auf der ganzen Welt habe ich mir mehr Filme ausgedacht, als ich jemals schreiben werde; und wie viele habe ich Drehbücher geschrieben, die nie jemand verfilmen wird. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, mir nicht gedrehte Filme anzuschauen; die ganze Zeit tue ich das. Und mein Leben ist bloß ein weiterer dieser Filme.
Dein Roman wird veröffentlicht, dein Drehbuch verfilmt – diese Bücher und Filme vergisst man bald. Man liest die Verrisse wie die guten Besprechungen, gewinnt vielleicht sogar einen Oscar; nichts davon hat Bestand. Aber ein nicht gedrehter Film lässt einen niemals los; einen nicht gedrehten Film vergisst man nicht.
2Erste Liebe
Von Aspen hörte ich zum ersten Mal von meiner Mutter; sie war es, die in mir den Wunsch weckte, das Hotel Jerome zu sehen. Es ist meiner Mutter zu verdanken (oder ihre Schuld), dass ich nach Aspen gefahren bin – und es ist ihr zu verdanken (oder ihre Schuld), dass ich es so lange vor mir hergeschoben habe.
Ich dachte immer, meine Mutter würde das Skifahren mehr lieben als mich. Was wir als Kinder glauben, formt uns; was uns in der Kindheit und Jugend ängstigt, kann uns später auf Abwege führen, aber ich nehme es meiner Mutter nicht übel, dass sie das Skifahren ihre erste Liebe genannt hat. Sie hat ja nicht gelogen.
Meine Mutter war eine hervorragende Skifahrerin, auch wenn sie das selbst nie gesagt hätte. In meiner Kindheit hieß es immer nur, sie habe nie einen Wettkampf gewonnen; deshalb hielt sie ihre Fahrkünste seitdem für »eher mittelprächtig«. Meine Mutter war nicht verbittert, weil es mit dem Profisport nicht geklappt hatte, und arbeitete ihr Leben lang als Skilehrerin; am liebsten unterrichtete sie kleine Kinder und Anfänger. Ich hörte von ihr nie auch nur eine einzige Klage über ihre Körpergröße – von meiner Großmutter und Tante Abigail und Tante Martha, den älteren Schwestern meiner Mutter, dafür umso häufiger.
»Geschwindigkeit hat was mit Masse zu tun«, lautete Tante Abigails abschätziges Urteil. Abigail war eine kräftige Frau, vor allem um die Hüften, und wirkte in Skihose eher schwerfällig denn sportlich.
»Deine Mom war so ein kleines Ding, Adam«, teilte mir Tante Martha voller Verachtung mit. »Als Abfahrtsläuferin muss man mehr wiegen, als sie je auf die Waage gebracht hat. Ray war eindeutig Slalomfahrerin. Sie ist so eine, die mit einer Sache genug hat.«
»Sie war einfach nicht schwer genug!«, verkündete meine Großmutter in regelmäßigen Abständen; bei diesen spontanen Ausbrüchen reckte sie die geballten Fäuste gen Himmel, so als würde sie höhere Mächte dafür verantwortlich machen.
Die Brewster-Mädchen, auch meine Mutter, waren bekannt für ihre dramatischen Ausrufe, auch wenn meine Großmutter Mildred Brewster, eine geborene Bates, stets behauptete, dieses Faible fürs Drama sei eher typisch für die Bates als für die Brewsters.
Ich glaubte ihr – bei meinem Großvater Lewis Brewster zeigten sich die Anzeichen für eine dramatische Ader erst spät. Ich wusste, dass er früher Rektor der Phillips Exeter Academy gewesen war, wenn auch nur für kurze Zeit und mit bescheidenem Erfolg. Solange ich Rektor Brewster kannte – so wurde er am liebsten genannt, auch von seinen Enkelkindern –, war er schon im Ruhestand. Als ewiger Emeritus war der ehemalige Schulleiter finster und streng, fast katatonisch, offenbar dazu bestimmt, für immer zu leben. Nur wenig schien ihn zu berühren. Nur höhere Mächte würden ihn ins Grab bringen können.
Mein Großvater sprach nicht, wie er überhaupt selten etwas tat. Ich dachte immer, Lewis Brewster sei schon als Schuldirektor im Ruhestand zur Welt gekommen. Was auch gesagt wurde, Granddaddy Lew – eine Anrede, die er hasste – reagierte höchstens (wenn überhaupt) mit einem Nicken oder Kopfschütteln. Sich auf Kinder einzulassen, die eigenen inbegriffen, schien unter seiner Würde. War er gereizt, kaute er auf seinem Schnurrbart herum.
Als meine Mutter ihren Eltern mitteilte, sie sei schwanger, war ich logischerweise noch nicht auf der Welt. Noch bevor ich die Geschichte kannte, fragte ich mich, was Rektor Brewster wohl dazu zu sagen gehabt hatte. Ich kam am 18. Dezember 1941 zur Welt – eine Woche vor Weihnachten. Wie meine ledige Mutter nicht müde wurde zu betonen, kam ich zehn Tage zu spät.
3Näher bekannt
Meine Mutter war die Art von Kinogängerin, die es nicht lassen konnte, das Aussehen ihrer Bekannten mit dem von Filmstars zu vergleichen. Als der österreichische Skifahrer Toni Sailer bei den Olympischen Spielen 1956 drei Goldmedaillen gewann, sagte sie: »Toni sieht ein wenig aus wie Farley Granger in Der Fremde im Zug«, einem Hitchcock-Film, den wir gemeinsam gesehen hatten. Dass meine Mom ein Fan von Hitchcock war, wusste ich, nicht aber, ob sie mit »Toni« Sailer womöglich näher bekannt war.
»Toni ist in Aspen mal beinahe in einen offenen Minenschacht gestürzt!«, verkündete sie auf ihre exaltierte Art mit weit aufgerissenen Augen. Dann ließ sie sich ellenlang über all die Skilifte und neuen Pisten aus, die am Aspen Mountain gebaut und angelegt wurden. Die alten Minenhalden und verlassenen Gebäude würden planiert und abgerissen, sagte sie, aber noch immer gebe es hier und da offene Schächte.
Es ist auch unklar, ob meine Mutter Stein Eriksen, den norwegischen Skifahrer, kannte; ich weiß bis heute nicht, ob sie sich überhaupt je begegnet sind. Die Alpinen Skiweltmeisterschaften 1950 fanden in Aspen statt. »Stein lag nach dem ersten Lauf vorn« war noch längst nicht alles, was meine Mom über ihn zu sagen hatte. Und damit meine ich nicht nur ihre oft demonstrierte Kenntnis seiner berühmten Gegenschulter-Technik.
Nein, als wir uns zum ersten Mal Mein großer Freund Shane anschauten – 1953, ich war elf oder zwölf –, sagte meine Mutter, Stein sehe aus wie Van Heflin. »Aber Stein ist attraktiver«, vertraute sie mir an und nahm meine Hand. »Du wirst mal aussehen wie Alan Ladd«, versicherte sie mir flüsternd, denn wir saßen im Kino – im Ioka in Exeter –, und auf der Leinwand nahm die Gewalttätigkeit des Films ihren Lauf.
Ich wies sie später darauf hin, dass Alan Ladd blond sei; ganz gleich, welchem Filmstar ich ähneln würde, wenn ich erwachsen war, ich würde doch sicher meine braunen Haare behalten. »Ich meinte damit, du wirst auf dieselbe Art attraktiv sein wie Alan Ladd – gut aussehend und klein«, erwiderte meine Mom und drückte mir zur Betonung des Wortes klein die Hand.
Meine Tanten und meine Großmutter beklagten, dass meine Mutter nicht schwer genug war, um in einem Skirennen Chancen zu haben, aber ich glaube, sie selbst mochte ihre Körpergröße. Dass ich ebenfalls klein war, gefiel ihr. In jungen Jahren nahm ich mir also Alan Ladd zum Vorbild, den einsamen, aber romantischen Revolverhelden aus Shane, und ich stellte mir vor, ich könnte ein Held werden oder zumindest wie einer aussehen.
Gab es in Aspen eine wie auch immer geartete Begegnung zwischen Stein Eriksen und meiner Mom? Hat sie ihm überhaupt auch nur die Hand geschüttelt? Ich weiß, dass sie dort war; sie hat die Busfahrkarten aufgehoben, wenn auch nur für die Strecke von New York nach Denver. Sie war dort, aber sie fuhr nicht mal in die Nähe des Siegertreppchens. Zwei Österreicherinnen, Dagmar Rom und Trude Jochum-Beiser, siegten bei den Frauen. Stein Eriksen, der sich bis dato im internationalen Skizirkus noch keinen Namen gemacht hatte, wurde Dritter im Slalom der Herren. Die Amerikaner gewannen keine Medaille. Dass die Alpinen Skiweltmeisterschaften 1950 in Aspen stattfanden, lässt sich nachprüfen – meine Mutter allerdings war bei diesem Ereignis nicht zum ersten Mal dort.
4Entschlossen, nicht zu lernen
1941 wurden die Amerikanischen Abfahrts- und Slalom-Meisterschaften in Aspen abgehalten. Es war das Wochenende des 8. und 9. März, einen Monat vor dem neunzehnten Geburtstag meiner Mutter. Von dieser Reise hat sie keine Busfahrkarte aufgehoben – wenn es damals überhaupt schon Busse von New York nach Denver gab. Sie sagte, sie sei allein bis nach Denver gekommen; den Rest der Strecke sei sie »bei ein paar Leuten aus Vermont mitgefahren«.
Mitglieder des Mount Mansfield Ski Club vielleicht? Höchstwahrscheinlich Freunde, mit denen sie am Stowe Mountain Ski fuhr. Da hatte meine Mom das College bereits geschmissen, nach nicht mal einem Semester. »Ich habe Bennington ausprobiert«, wie sie es formulierte; sobald Schnee fiel, ging sie lieber Ski fahren.
Von Bennington aus fuhr meine Mutter mit Sicherheit zum nahe gelegenen Bromley Mountain. Dieses Skigebiet hatte 1938 ein Sohn der Brauerei-Dynastie Pabst eröffnet. Als meine Mom dort zum ersten Mal fuhr, dürfte es dort nur eine einzige Piste gegeben haben, an der Westseite des Berges, und ich habe keine Ahnung, was für einen Lift.
»Den ersten Schlepplift haben sie zwischen die Twister- und die East-Meadow-Abfahrt gebaut«, erzählte meine Mutter. Über die Jahre lernte ich wegzuhören, wenn sie ihre Skigebietsstatistiken herunterbetete.
Alle Brewster-Mädchen verbrachten die Sommer im Aloha Camp am Lake Morey in Fairlee, Vermont, angeblich das älteste Mädchencamp im ganzen Bundesstaat. Dort hatte meine Mom sich auch mit Skifahrerinnen aus Stowe angefreundet. Sie schmiss Bennington so schnell wie möglich wieder hin und hielt sich nicht lange in Bromley auf, zumindest nicht damals. Stattdessen verbrachte sie mithilfe ihrer Freundinnen aus dem Aloha Camp das erste Mal die Wintersaison in Stowe. Das blieb in den ganzen Vierzigern und bis in die Fünfziger so. Sie arbeitete im Skigebiet und erkundete den Mount Mansfield. Von da an erklärte sie die Skisaison zu ihrem »Winterjob«. Sowohl vor als auch nach meiner Geburt verbrachte sie die Winter in Stowe. Ich kam mir vor wie eine Skiwaise.
Bis zum Juli 1956, ich war vierzehn, lebte ich bei meiner Großmutter und dem Direx emeritus. Meine wichtigtuerischen Tanten machten ein Riesenaufheben um mich. Ich war ein uneheliches Kind, aber es wurde mit Argusaugen über mich gewacht. Mein Cousin und meine Cousine waren älter als ich, und so bestand kein Mangel an abgelegter Kleidung – hauptsächlich Jungssachen.
Genau genommen war meine Cousine Nora kein Junge. Aber sie war so ein Wildfang, dass sie Jungssachen trug, bis sie in Northfield, Massachusetts, aufs Mädcheninternat geschickt wurde. Mein Cousin Henrik war ein richtiger Junge – und auch ein richtiges Arschloch, wie sich herausstellen sollte. Tante Abigail und Tante Martha hatten zwei Norweger aus dem Norden von New Hampshire geheiratet; meine Onkel Johan und Martin Vinter waren Brüder. Die gesamte Familie Vinter war im Holzgeschäft – bis auf Onkel Johan und Onkel Martin, die in Exeter unterrichteten, was meinen Cousin Henrik zum Lehrerbalg machte, als er selbst dorthin ging. Sobald sie erwachsen waren, begannen Abigail und Martha, sich als Töchter eines ehemaligen Schuldirektors der Academy für die Junggesellen unter der Lehrerschaft zu interessieren.
Johan und Martin Vinter waren Skifahrer. Wie auch nicht? Schließlich bedeutete ihr Name »Winter« auf Norwegisch, und sie waren in North Conway aufgewachsen, wo der Skiort Cranmore Mountain 1937 den Betrieb aufnahm. Die beiden Brüder hatten nicht abgewartet, bis der erste Seillift aufgestellt wurde. Sie spannten sich schon vorher Steigfelle unter ihre Telemarkski, stapften den Berg hinauf und fuhren ab.
Durch die beiden Vinters kamen die Brewster-Mädchen, auch meine Mom, überhaupt erst zum Skifahren. Abigail und Martha und die beiden jungen norwegischen Lehrer nahmen meine Mutter im Boston & Maine mit, dem »Skizug«, wie meine Cousine Nora ihn nannte. An den Winterwochenenden fuhren sie alle zusammen von Exeter nach North Conway, wo sie am Bahnhof von Wagenladungen voller Vinters erwartet wurden. (Meine Mutter nannte die Norwegersippe immer »Wagenladungen voller Winter«.)
Und so kam der Abfahrtsski in die Gemeinde Exeter in der Küstengegend von New Hampshire, wo es gar keine Berge gibt. Als ich auf die Welt kam, war die Skisaison bereits Moms »Winterjob«. Von meinem vierten Lebensjahr an bekam ich jedes Jahr neue Skier, Stiefel und Stöcke geschenkt. Doch weder die bestmögliche Ausrüstung noch der Privatunterricht durch meine Mutter erzielten den erwünschten Erfolg.
Schon in den frühen, den prägendsten Jahren hatte ich beschlossen, das Skifahren zu hassen. Ich hätte lieber eine Mom gehabt, die daheimblieb, als eine, die jedes Jahr von Mitte November bis Mitte April in den Bergen war. Ich wollte lieber meine Mutter um mich haben, als dass sie mir das Skifahren beibrachte. Und wie sonst hätte ich als Kind und Teenager meinen Standpunkt deutlich machen können? Ich war entschlossen, das Skifahren nicht zu lernen.
Nur, wie hätte ich das als jüngster Spross einer ganzen Sippe von ausgezeichneten Skifahrern anstellen sollen? Es war unmöglich, es nicht zumindest ein wenig zu lernen. Ich kann also Ski fahren, aber ich schaffte es, schlecht Skifahren zu lernen. Kein Brewster und kein Vinter würde mich als guten Skifahrer bezeichnen. Ich bin ein absichtlich mittelmäßiger Skifahrer.
5Aber was genau geschah in Aspen?
Meine Mutter muss die Sechzehnjährige gekannt haben, die im März 1941 die Landesmeisterschaften der Frauen im Slalom am Aspen Mountain gewann. Marilyn Shaw war trotz ihrer Jugend keine Anfängerin; Stowes »Schneebaby«, wie sie genannt wurde, hatte es als jüngste Abfahrtsläuferin aller Zeiten in die Olympiamannschaft der USA geschafft. Dafür, dass die Olympischen Winterspiele 1940 wegen des Kriegs ausfielen, konnte sie nichts. Meine Mom jedenfalls, die mit Sicherheit in Stowe mit ihr Ski gefahren war, nannte Marilyn nicht beim Vornamen. Sie erwähnte sie nur selten, und wenn, dann nur als »das Shaw-Mädel«.
Beide waren sie Skifahrerinnen aus Vermont; sie mussten sich gekannt haben, und nicht nur vom Mount Mansfield. Meiner Mom zufolge waren sie beide von Sepp Ruschp trainiert worden, einem österreichischen Skilehrer. Meine Mutter verehrte Sepp Ruschp. »Er hat seine Prüfung in Sankt Christoph abgelegt, bei Hannes Schneider«, erklärte sie mir.
»Welche Prüfung?«, fragte ich.
»Das offizielle österreichische Landesskilehrerdings, Adam – sein Skilehrerdiplom!«, rief sie aus.
Wie konnte ich nur die Hannes-Schneider-Sepp-Ruschp-Verbindung vergessen? Den Stemmbogen, den Schwung, der am Arlberg erfunden wurde und der später den Telemarkschwung ablöste! Ich weiß noch, wie meine Mutter wehmütig meinte, auch der Stemmbogen würde eines Tages wieder abgelöst werden, und so kam es auch. Gegen Ende der Sechziger war der Parallelschwung bereits beliebter. Mit meinen altmodischen Stemmbögen würde ich aussehen wie ein Schneepflug beim Wenden, sagte meine Mutter damals. Und ich fuhr zu der Zeit auch wirklich kaum eleganter als ein Schneepflug.
Es waren die Carvingskier, die dem Stemmbogen Ende der Neunziger dann den Rest gaben – zumindest laut meiner Mutter. »Mit den neuen Skiern waren Parallelschwünge ein Kinderspiel«, behauptete sie. »Sogar für dich, Liebling«, fügte sie hinzu und drückte meine Hand.
Natürlich wusste ich, dass der Österreicher Hannes Schneider 1939 nach Cranmore Mountain in New Hampshire gekommen war; und Sepp Ruschp, der bei Schneider gelernt hatte, 1936 nach Mount Mansfield in Vermont. Auch Toni Matt, noch einer von Schneiders früheren Schülern – der Österreicher, der die Gipfelwand der Tuckerman Ravine (den Gletscherkar an der Südostseite des Mount Washington, New Hampshire) bei einer Schussfahrt mit einer Spitzengeschwindigkeit von 140 km/h hinuntergerast war und der 1941 bei den Landesmeisterschaften am Aspen Mountain sowohl die Abfahrt als auch die Kombination gewann –, war 1938 in die USA gezogen.
Doch meine Mom erwähnte Toni Matt nicht groß, wenn es um das Meisterschaftswochenende in Aspen ging. Stattdessen erfuhr ich alles über den »primitiven Boots-Schlepplift«; er brachte einen nur ein Viertel der Strecke hinauf. »Den Rest ging man im Treppenschritt«, sagte sie. Es war keine Beschwerde; Mom murrte auch nicht darüber, dass die Sportler beim Präparieren der Piste helfen mussten. »Alle packten mit an«, wie meine Mom es formulierte.
Über Jerome B. Wheeler bekam ich so viel zu hören, dass ich anfangs verwirrt war; ich hielt ihn für einen der Skiprofis. »Armer Jerome«, so begann meine Mutter meistens, wenn sie auf ihn zu sprechen kam. Nach allem, was ich von ihr über Roch Run gehört hatte – die erste Skiroute in Aspen, eine anspruchsvolle Abfahrt, benannt nach dem Schweizer Alpinisten und Lawinenexperten André Roch –, hielt ich den armen Jerome für einen Skifahrer, der am Roch Run gestürzt war und sich schwer verletzt hatte.
Doch meine Mutter meinte »den von Macy’s«, wie sie Jerome B. Wheeler auch oft nannte. (»Der von Macy’s«, dem berühmten New Yorker Kaufhaus, war dort immerhin Geschäftsführer.) Jerome B. Wheeler war in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts aus New York nach Aspen gekommen. Er investierte in die Silberminen, gründete Aspens erste Bank und finanzierte das erste Wasserkraftwerk. Zu dieser Zeit fand gerade ein Wettrennen zwischen der Colorado Midland Railroad und der Denver & Rio Grande Western Railroad statt, wer mit seiner Bahnstrecke als Erstes über die kontinentale Wasserscheide hinweg Aspen erreichen würde. Wheeler steckte 100000 Dollar in die Colorado Midland. Und als die Blütezeit Aspens begann und die Stadt florierte, ließ er ein Opernhaus und das Hotel Jerome bauen.
So wie meine Mom über ihn sprach, hätte man meinen können, sie wäre mit Jerome B. Wheeler auf Du und Du gewesen. »Er war ein Bürgerkriegsheld, musst du wissen, unter Sheridan«, sagte sie. »Jerome war Oberst, wurde aber zum Major degradiert, weil er irgendwelchen dämlichen Befehlen nicht gehorcht hat!«
»Was für Befehlen?«, fragte ich und rang die Hände.
»Keine Ahnung – dämlichen eben!«, verkündete sie. »Der arme Jerome überquerte die feindlichen Linien und rettete ein Regiment der Union – die Männer waren kurz vor dem Verhungern! Lass das Händeringen, Adam, die sind schon klein genug.«
»Armer Jerome«, war alles, was ich sagen konnte.
Sein Hotel erlebte ein paar glorreiche Jahre, doch der Silberboom verpuffte; nach der Abschaffung des Silberdollars und der Wirtschaftskrise von 1893 wurden die Minen stillgelegt. Wheelers Bank musste schließen. 1901 erklärte Jerome B. Wheeler seinen Bankrott; wegen ausstehender Steuern verlor er 1909 das Hotel. Das Wheeler Opera House fing 1912 Feuer. Der arme Jerome starb 1918.
In den »ruhigen Jahren«, als es mit dem großen Hotel bergab ging, wurde ein aus Syrien stammender ehemaliger Handelsreisender Barkeeper im Jerome. 1911 beglich Mansor Elisha die ausstehenden Steuern und erwarb damit das Hotel.
»So ein Jammer!«, rief meine Mom und meinte den armen Jerome und das Schicksal des Hotels. »Es ist zu einer schäbigen Pension verkommen, aber man sieht immer noch, was für ein erstklassiges Hotel es mal war!« Die Syrer, die es übernahmen, seien eine Familie von Heiligen gewesen, erklärte sie; die Elishas hätten die Einheimischen stets willkommen geheißen. »André Roch höchstpersönlich wohnte ganze fünf Wochen im Jerome«, sagte meine Mutter. Das bewies ihrer Meinung nach alles: Wenn der berühmte André Roch dort ganze fünf Wochen gewohnt hatte, dann musste das Hotel Jerome erstklassig gewesen sein.
Als während des Zweiten Weltkriegs die Skitruppen der Tenth Mountain Division nach Aspen kamen, um dort ein Gebirgsmanöver abzuhalten, schliefen die Soldaten im Jerome auf dem Boden. Ich erfuhr erst sehr viel später, dass auch viele Skifahrer aus Stowe sich der Tenth Mountain Division anschlossen. Waren das nicht Männer, die meine Mutter an den Hängen des Mount Mansfield gesehen haben müsste? Vielleicht gehörten auch die »Leute aus Vermont« dazu, die sie 1941 auf ihrem Weg von Denver nach Aspen mitnahmen. Darüber verlor sie nie ein Wort.
Toni Matt war auch bei der Tenth Mountain Division. Er war im Zweiten Weltkrieg Leutnant und auf den Aleuten stationiert. Als er 1941 die beiden Rennen in Aspen gewann, war er nicht verheiratet und nur ein paar Jahre älter als meine Mom; einundzwanzig oder zweiundzwanzig. Ich habe Fotos von Toni Matt; er sieht mir ein wenig ähnlich. Ich finde sogar, ich sehe Toni Matt erheblich ähnlicher als Alan Ladd, aber davon wollte meine Mutter nichts wissen.
»Aber Toni Matt hat dunkle Haare«, erklärte ich ihr, »und sein Gesicht ist runder als das von Alan Ladd, eher so wie meins. Außerdem ist Toni Matts Nase nicht so spitz wie die von Alan Ladd, und seine Augenbrauen sind nicht so buschig, sondern eher so wie meine.«
»Toni Matt sah nie gut aus, nicht wie Alan Ladd; für mich jedenfalls«, fügte sie noch abschätzig hinzu. »Nicht so wie du, Liebling.«
Als ich wieder einmal mit meiner Mom Toni Matt erörterte, nahm sie nur meine Hand und drückte sie. Dann schaute sie mir fest in die Augen und sagte: »Wenn du Toni Matts Sohn wärst, dann würdest du das Skifahren lieben. Toni ist die Tuckerman Ravine runter«, rief sie mir in Erinnerung. Sie wusste sogar noch die Zeit für das knapp sieben Kilometer lange Rennen vom Gipfel bis zum Fuß der Schlucht. »Sechs Minuten, neunundzwanzig Komma zwei Sekunden«, flüsterte sie und sah mir noch immer in die Augen. »Wenn Toni Matt dein Vater wäre, dann hätte dich niemand von den Skiern fernhalten können. Lass doch mal deine kleinen Hände in Ruhe, Liebling.«
Doch irgendwen musste meine Mom am Wochenende des 8. und 9. März näher kennengelernt haben. An jenem Wochenende, als Marilyn Shaw in Aspen die Landesmeisterschaften der Frauen im Slalom gewann, hat irgendjemand meine Mutter geschwängert. Der arme Jerome war es nicht. Im Jahr 1941 war Jerome B. Wheeler bereits ein Gespenst.
6Little Ray
In der Erinnerung an die Winter meiner Kindheit und frühen Jugend war meine Großmutter meine Mutter. Nana, so nannte ich Mildred Brewster, war meine Winter-Mom. Sie war die hingebungsvollste Fürsprecherin meiner Mutter und für eine Weile auch die einzige, wie mir schien.
»Niemand bittet darum, geboren zu werden«, hörte ich Nana oft sagen, dann rollten die schnaufenden Tanten Abigail und Martha mit den Augen und schnauften noch schwerer.
»Die Arme-Rachel-Nummer«, wie Tante Abigail es nannte.
»Jetzt geht das mit dem Walfänger wieder los«, flüsterte mir Tante Martha ins Ohr, »wäre er doch nur an uns vorbeigesegelt.« Ich aber liebte die Geschichte, wie meine Mutter zu ihrem Namen gekommen war. Mildred Brewster hatte englische und amerikanische Literatur am Mount Holyoke College studiert, einem Liberal-Arts-College für Frauen in Massachusetts; ihr Lieblingsroman war Moby-Dick, und deshalb hieß meine Mom Rachel.
Nanas Ausgabe lag stets auf dem Tisch neben ihrem Lesesessel. Schon als Kind fiel mir auf, dass Moby-Dick erheblich präsenter war als die Bibel; meine Großmutter wandte sich der Geschichte vom weißen Wal öfter zu als Jesus. »Eines Tages, wenn du alt genug bist, Schätzchen, werde ich dir das hier vorlesen«, sagte Nana und hielt das dicke Buch in beiden Händen. Aber so lange wartete sie dann doch nicht. Ich war gerade mal zehn, als sie mit dem Vorlesen anfing; bis sie damit fertig war, war ich zwölf, fast dreizehn. Der Roman zieht sich hin, aber die Kapitel sind kurz. Auch eine Seereise kann sich hinziehen, nur das Sinken nicht.
»Achte auf den Kannibalen, mein Schatz – Queequeg ist wichtig«, sagte Nana immer wieder. »Er ist nicht irgendein Harpunier, Queequeg ist kein Christ. Er wird nicht ohne Grund als abscheulicher Wilder bezeichnet – nicht nur, um deine Neugier zu wecken. Queequeg reist mit einem Schrumpfkopf, er ist über und über tätowiert. Und dann ist da noch sein Sarg. Vergiss bitte nicht Queequegs Sarg!«
Wie konnte ich den vergessen? Moby-Dick vorgelesen zu bekommen machte mich nervös. Ich war erleichtert, als ich entdeckte, dass an Queequeg gar nichts Abscheuliches war; Melville lässt ihm sogar durchgehen, dass er kein Christ ist. »Trotz all seiner Tätowierungen war er alles in allem doch ein reinlicher, schmucker Kannibale«, wie Melville es ausdrückt. Dass ich fast drei Jahre lang Moby-Dick vorgelesen bekam, veränderte mein Leben. Nicht nur, dass ich nun Schriftsteller werden wollte; meiner Cousine Nora zufolge formte und versaute diese Erfahrung mich für immer.
Meine Großmutter war eine unermüdliche Vorleserin, aber ich unterbrach sie ständig, stellte hunderterlei Fragen und interessierte mich ausschließlich für die falschen Dinge – wie zum Beispiel Walkotze oder wovon Walen überhaupt schlecht wird. Das Kapitel 92 mit dem Titel »Amber« wirft eine ganze Reihe von Fragen zum Magen-Darm-Trakt auf. Von Parfümeuren hochgeschätzt, ist Amber (in Melvilles Worten) »eine Essenz, welche aus dem schmählichen Darm eines kranken Wales stammt«. Nur Pottwale produzieren Amber. Ich ließ mir von meiner Großmutter erklären, was passieren würde, wenn ein Brocken Amber zu groß war, um durch die Gedärme des Wals zu passen. Nana gab sich große Mühe und sagte, dass der Wal einen solchen Brocken auskotzen müsste. Amber kann jahrelang im Wasser treiben, bis sie irgendwo an Land gespült wird. Es wurden schon bis zu fünfzig Kilogramm schwere Brocken gefunden – man stelle sich mal eine solche Menge an Walkotze vor! Das waren die Dinge, die mich ablenkten von dem, was in Moby-Dick wichtig war, und es trieb meine Großmutter schier in den Wahnsinn.
Eines aber verstanden Nana und ich gleichermaßen. Wir liebten Queequeg, den kannibalistischen Harpunier. Wir waren begeistert, dass er kein Christ war, denn das bedeutete, dass er alles tun konnte. Was immer ihm in den Sinn kam. Er konnte einen sogar fressen. Der Wilde aus der Südsee war das blanke Gegenteil eines verklemmten weißen Neuengländers. Und wie die so waren, das wussten Nana und ich ja bereits.
Als ich Moby-Dick Jahre später selbst las, behielt ich Queequeg genau im Blick. Meine Großmutter hatte recht: Nur so wird man Moby-Dick zu schätzen wissen. Keine noch so große Menge an Walkotze wird einen dann gegen dieses Werk aufbringen, das D.H. Lawrence »eines der merkwürdigsten und wunderbarsten Bücher der Welt« nannte.
Kein Christ zu sein hat eine erstaunliche Wirkung auf Queequeg. Eines Tages sucht ihn ein Fieber heim. Er kommt zu der Ansicht, dass er sterben wird. Queequeg hat recht, aber es wird nicht das Fieber sein, das ihn umbringt, und er wird auch nicht der Einzige an Bord der Pequod sein, der stirbt. Queequeg bittet den Schiffszimmermann, ihm einen Sarg zu bauen. Er probiert sogar, ob er hineinpasst. Doch Queequegs Fieber geht vorüber, und so benutzt er den Sarg als Kleiderkiste. Das ist nicht einfach ein unbedeutendes Detail! Kurz darauf geht eine Rettungsboje verloren. Queequeg bietet seinen Sarg als Ersatz an – er ist ein praktisch veranlagter Kannibale. Der Zimmermann macht sich an die Arbeit, nagelt den Deckel fest und dichtet die Fugen ab.
»Queequeg sieht die Welt anders als seine Schiffskameraden«, erklärte meine Großmutter. »Nur jemand wie er würde den Zimmermann darum bitten, ihm einen Sarg zu bauen.«
Ich hatte Mühe, dies damit zusammenzubringen, dass Queequeg kein Christ war. »Meint Melville, ein Christ würde nicht um einen Sarg bitten, solange er noch lebt?«, fragte ich meine Großmutter.
»Die, die ich kenne, nicht«, antwortete Nana. »Das passt eher zu dem, was sich ein Kannibale wünschen würde, finde ich.«
Nana und ich waren mit Moby-Dick schon weit fortgeschritten, als wir zu der Stelle kamen, an der Kapitän Ahab an Deck kommt und (meist bei sich) schrullige Bemerkungen dazu abgibt, ob so ein Sarg als Rettungsboje angemessen sei.
Als passionierte Studentin der Literatur unterbrach sich meine Großmutter häufig beim Vorlesen; sie wollte sichergehen, dass ich bestimmte Dinge bemerkt hatte. In dem Kapitel machte Nana eine Pause: »Ich hoffe, dir ist aufgefallen, Adam, dass es sich um denselben Zimmermann handelt, der auch Ahabs Beinprothese angefertigt hat.«
»Ist mir aufgefallen, Nana«, versicherte ich ihr.
Moby-Dick ist die Geschichte eines scheinbar unbesiegbaren Wals. Es ist auch die Geschichte uneingeschränkter Autorität – eines Mannes, der auf niemanden hört. Ahab, der Kapitän der Pequod, ist ganz besessen davon, Moby Dick zu erlegen. Der weiße Wal ist schuld daran, dass Ahab ein Bein verloren hat. Nana und ich wussten, dass er sich einfach damit hätte abfinden sollen.
Die Rachel, ein anderer Walfänger, ist Moby Dick begegnet und hat dabei ein Walboot mitsamt Besatzung verloren. Ob Ahab nicht bei der Suche nach den vermissten Seeleuten helfen könne? Auch der Sohn des Kapitäns der Rachel sei darunter. Nein, Ahab will nicht helfen; alles, was er will, ist, Moby Dick aufzuspüren und ihn zu töten.
Wir wissen, was geschehen wird. Ahab findet, wonach er sucht – der weiße Wal tötet ihn und versenkt die Pequod. Aber Augenblick mal. Es gibt einen Ich-Erzähler, Ismael. Was um alles in der Welt könnte denn Ismael retten? Haben Sie vergessen, dass Queequegs Sarg schwimmt? Wie gut, dass nicht alle an Bord Christen waren. Lassen Sie sich das eine Lehre sein: Treten Sie niemals eine Seereise ohne einen tätowierten Kannibalen an.
»Verstehst du, mein Schatz?«, unterbrach sich Nana. »Ahabs Weigerung, seinen Mitmenschen auf See zu helfen, besiegelt sein Schicksal und das aller Männer an Bord der Pequod, bis auf einen.«
»Ich verstehe«, sagte ich. Wie auch nicht? Ich hatte schließlich drei Jahre Zeit gehabt.
Der weiße Wal versenkt die Pequod. Alle ertrinken, bis auf Ismael – »und das große Leichentuch des Meeres wogte weiter wie vor fünftausend Jahren«, wie Melville schreibt. Das ist ziemlich deutlich.
Queequegs Sarg taucht als Rettungsboje aus dem Meer auf und treibt neben Ismael. Und Ismael sagt: »Am zweiten Tage stand ein Segel auf mich zu, kam näher, näher und nahm mich schließlich auf. Es war die umherirrende Rachel; auf der Suche nach ihren verschollenen Kindern fand sie nur eine weitere Waise.«
»Noch mal von vorn«, sagte ich zu meiner Großmutter, als sie geendet hatte.
»Wenn du alt genug bist, dann liest du es noch mal für dich«, entgegnete Nana.
»Das mache ich«, sagte ich und tat es auch – immer und immer wieder.
Nach dem Ende dieser ersten Lektüre fragte ich meine Großmutter noch: »Du hast meine Mom nach der umherirrenden Rachel benannt – nach einem Schiff?«
»Das muss ja nicht unbedingt etwas Schlimmes sein, Adam – manchmal kommt man eben vom Kurs ab. Und es ist ja nicht irgendein Schiff!«, rief Nana aus. »Die Rachel rettet Ismael. Nun, Schätzchen – um ehrlich zu sein, hat mich deine Mutter ebenfalls gerettet.«
»Warst du auf dem Meer? Bist du beinahe ertrunken, Nana?«
»Du lieber Himmel, nein!«, sagte Nana. Sie erklärte mir, dass Abigail, ihre Älteste, gerade auf die Mädchenschule in Northfield geschickt worden war; im Jahr darauf sollte auch Martha fortgehen. Was Nana meinte, war, dass die Geburt meiner Mutter sie davor bewahrte, mit Rektor Brewster allein zurückzubleiben. Der Direx emeritus war zwar nicht gerade ein Ausbund an Fröhlichkeit, aber ich fand nun nicht, dass er in dieselbe Kategorie gehörte wie das Ertrinken auf See.
»Ach«, mehr bekam ich nicht heraus. Wahrscheinlich klang ich enttäuscht.
Meine Mutter hatte sich dafür entschieden, fast die Hälfte des Jahres bei ihrem Winterjob zu verbringen statt mit mir. Ich weiß, dass Nana meine Enttäuschung spüren konnte, war doch Rachel für mich bestimmt kein Rettungsschiff gewesen.
»Hör mal, Schätzchen«, sagte meine Großmutter da. »Deine Mutter hat sich bei deiner Namenswahl auch etwas gedacht. Du bist schließlich nicht der erste Adam.« Nachdem sie so meine Aufmerksamkeit geweckt hatte, behauptete sie – sehr zu meiner Überraschung: »Du bist nicht nur der erste Mann in ihrem Leben, du wirst auch der einzige sein. Du bist alles für sie, Adam, zumindest was Männer angeht«, sagte Nana.
Das widersprach völlig dem frühesten Eindruck, den ich von meiner hübschen jungen Mutter hatte. In Liebesdingen noch gänzlich unschuldig, und lange bevor ich mich auf meine eigenen sexuellen Abwege begab, war ich davon ausgegangen, dass meine Mom gerne Single war. Und war sie das nicht deshalb, weil sie gerne Männer kennenlernte?
Ich war zehn, elf, zwölf, als meine Großmutter mir Moby-Dick vorlas, noch nicht mal ein Teenager. Doch Nana schien zu sagen, dass meine Mutter mit Männern nichts zu tun haben wollte – außer mit mir. Die größte Wahrheit, die ich damals kannte, lautete: Meine Großmutter war die beständigste Fürsprecherin meiner Mom; deshalb nahm ich ihr das nicht ganz ab.
Meine irrenden Tanten, und das meine ich im negativen Sinne, hatten voller Heimtücke Nanas Bemühungen untergraben, mir Liebe und Vertrauen zu ihrem Rettungsschiff Rachel einzuflößen.
»Little Ray«, so hatte Rektor Brewster meine Mutter genannt. Der Spitzname, den der Direx emeritus ihr gegeben hatte, war für mich weniger überraschend als die Tatsache, dass er früher einmal gesprochen hatte.
»Aber natürlich hat er gesprochen«, sagte Nana. »Wie könnte denn ein Schulleiter nicht sprechen? Außerdem war Rektor Brewster Lehrer, bevor er, auf seine Weise, Rektor wurde. Ach herrje, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie der Mann reden konnte!«
»Aber was ist denn mit ihm passiert, Nana? Wieso hat er damit aufgehört?« Ich muss wohl wieder mal die Hände gerungen haben.
»Wenn du alt genug bist, Adam –«, setzte Nana an und unterbrach sich dann. »Wenn du alt genug bist, dann wird es dir jemand erzählen«, sagte sie. »Bitte mach dir die Hände nicht kaputt, sie sind schon so klein.«
»Tante Abigail oder Tante Martha, vielleicht«, spekulierte ich.
»Jemand anderes, hoffe ich«, sagte meine Großmutter. »Little Ray selbst, vielleicht«, fügte sie leise und ohne große Überzeugung hinzu.
»Little Ray hat mit einer Sache genug, das habe ich dir ja schon gesagt«, erinnerte mich Tante Martha, als ich sie bat, ein paar fehlende Einzelheiten beizusteuern. Schon, aber damals war es um Moms Eignung als Skifahrerin gegangen; um ihre Größe. Jetzt deutete Martha an, dass allen drei Brewster-Mädchen eine Sache ausgereicht habe, dass sie alle genau ein einziges Kind haben wollten. Das war natürlich nichts als üble Nachrede. Aber von Tante Martha erwartete ich nichts anderes, und Tante Abigail war noch viel schlimmer; sie war die Erstgeborene und auch noch stolz darauf, die dumme Kuh.
»Little Ray war ein Unfall – ein ungeplantes Kind. Sie hätte gar nicht geboren werden sollen«, sagte Tante Abigail, als ich sie drängte, mir mehr zu erzählen.
»Eine Nachzüglerin«, pflichtete Tante Martha bei. »Es ist unschön, Adam, wie du die Hände ringst.«
Sie können sich vorstellen, wie verwirrend das für mich war. Meine Mutter war nach der Rachel aus Moby-Dick benannt worden, und sie hatte mich nach dem Kerl aus dem Garten Eden benannt.
Meiner Großmutter zufolge hatte meine Mom wirklich mit einer Sache genug, wenn auch keiner der von Tante Martha angedeuteten. Was Nana meinte, war, dass meine Mom nie wieder mit Männern zu tun haben wollte. Wollte sie damit etwa sagen, dass Little Ray das wirklich nur ein Mal gemacht hatte? Hatte das Rettungsschiff Rachel wirklich beschlossen, genau ein einziges Mal mit einem Mann zu schlafen – mit dem alleinigen Zweck, mich zur Welt zu bringen?
Ich muss schrecklich herumgestammelt haben, als ich meine Großmutter fragte, was es ihrer Meinung nach mit dem Namen Adam auf sich habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube kaum, dass ich sie klar und rundheraus danach gefragt habe: »Nana, willst du mir damit sagen, dass meine Mutter nur ein einziges Mal Sex gehabt hat, weil sie ein Kind wollte, ein einziges? Und jetzt, wo sie mich hat, wird sie es nie wieder tun?«
Können Sie sich vorstellen, Ihre Großmutter so etwas zu fragen? Nun, ich habe es getan, auch wenn ich mich nicht daran erinnere, wie ich es ausgedrückt habe.
Sehr gut hingegen kann ich mich an die Antwort erinnern. In gewisser Hinsicht hatte ich sie schon zu hören bekommen, als ich Nana bat, mir Moby-Dick noch einmal vorzulesen, die ganze Geschichte.
»Wenn du alt genug bist, Adam«, sagte Nana, »dann wird Little Ray dir die ganze Geschichte sicher lieber selbst erzählen.«
7Alles wegen Sex
Man darf nicht vergessen, erst war meine Mutter das Nesthäkchen der Brewsters und dann ich. Dass Little Rays Geburt angeblich ein Unfall gewesen war, wurde als Wegbereiter meiner eigenen ungeplanten Ankunft auf dieser Welt angesehen. Die dreifache Mutmaßung meiner Tanten: Little Ray und ich seien beide ungeplant gewesen; unsere Geburten hätten daher Chaos mit sich gebracht; dauerhaftes Unglück werde den Rest unseres Lebens überschatten.
Abweichend von dieser trostlosen, von Tante Abigail und Tante Martha unerschütterlich vertretenen Überzeugung hatte meine Großmutter (wenn auch nur für einen kurzen Augenblick) ein strahlendes Licht auf meine Geburt geworfen – was, wenn ich geplant gewesen war? Was, wenn es sich doch nicht um einen Unfall gehandelt hatte? Wenn Rachel Brewster mich hatte bekommen wollen, war dann nicht ich der einzige Grund für mein Dasein? Da ich eine Mutter hatte, die freiwillig sechs Monate im Jahr von mir getrennt verbrachte, können Sie vielleicht verstehen, warum ich mich an diese Hoffnung klammerte.
Es war nicht so, dass ich meine Mutter während der Skisaison gar nicht sah. Weihnachten und Neujahr verbrachte sie nie zu Hause, das waren in den Skigebieten die arbeitsreichsten Zeiten. Aber in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr kam sie nach North Conway, um mich zu besuchen, und dann wieder für die Frühlingsferien.
Weihnachten und Neujahr verbrachte ich in der zünftigen Gesellschaft der New-Hampshire-Norweger. Nicht alle Mitglieder der Familie Vinter waren fröhliche Menschen. Onkel Martin und Onkel Johan waren unerschütterliche Optimisten; kräftige Zupacker, die sich uns Kindern annahmen. Sie wachsten nicht nur unsere Ski, schliffen die Kanten und halfen uns mit den Stiefeln und Bindungen, sie munterten uns auch wieder auf, wenn wir müde, hungrig oder durchgefroren waren. Martin und Johan waren ungebrochen aktive und fröhliche Naturburschen, sie ähnelten kein bisschen den selbstmordgefährdeten Norwegern, an die man bei Ibsen denkt.
Aber sie waren Norweger, was mich zu der Überzeugung brachte, dass sie schon mal ein Stück von Ibsen gesehen oder gelesen haben mussten. Sie hatten ihre Kinder Henrik und Nora genannt. Wie sich später dank Noras Aufklärung herausstellte, war Henrik jedoch nicht nach dem Dramatiker benannt worden und sie selbst nun wahrhaftig nicht die Nora aus Ein Puppenheim. »Ich sag dir eins«, teilte Nora mir einmal unheilvoll mit, »wenn ich drei Kinder hätte, würde ich sie auch sitzenlassen. Schon bei einem wäre ich auf und davon.«
Nora hatte so ihre suizidalen Fjordspringermomente; sie war die pessimistische Norwegerin bei den Vinters. Nora war die Älteste von uns dreien, das erste und einzige Kind von Onkel Martin und Tante Abigail. Sie lag im ständigen Konflikt mit ihrer voreingenommenen Mutter und gewann so mein Herz. Ich glaubte, Nora wisse alles, und meist hielt sie mit ihrem Wissen mir gegenüber nicht hinter dem Berg. Die Brewster-Mädchen – Noras Mom, meine Mutter und Tante Martha – waren geschickt darin, Dinge vor uns Kindern und vor ihren eigenen Eltern zu verbergen. »Vielleicht sogar voreinander«, hatte Nora mir gegenüber mal angedeutet.
»Warum sollten sie etwas voreinander verbergen?«, fragte ich Nora. Sie war sechs Jahre älter als ich. Als Kind und als Teenager liebte ich sie nicht nur, ich vergötterte sie.
»Deine Mutter ist die Geheimnisvollste, sie ist ja auch die Klügste. Martha und meine Mom sind Hohlköpfe«, antwortete Nora.
Ich war zehn oder elf. Nora muss sechzehn oder siebzehn gewesen sein; sie hatte bereits ihren Führerschein. Wir lagen wie immer in den Sommerferien bei Little Boars Head am Strand. Zu hören, sie sei die Klügste, stellte alles auf den Kopf, was bisher über die Intelligenz meiner Mutter angedeutet worden war.
Meine Großmutter war zwar ihre größte Fürsprecherin, doch selbst sie blickte geringschätzig auf Little Rays mangelnde akademische Bildung herab. Abigail und Martha waren nach Northfield geschickt worden, meine Mom aber hatte sich geweigert.
»Also, um ehrlich zu sein, Adam«, sagte Tante Abigail, als sie das Thema mir gegenüber ausführte, »Little Ray war keine sonderlich gute Schülerin.«
»Wenn sie sich in Northfield beworben hätte, hätten sie sie nicht genommen«, hatte Tante Martha ihr beigepflichtet.
Mildred Brewster wollte, dass ihre Töchter dort auf die Schule gingen, wo auch sie gewesen war. Abigail und Martha wurden Northfield-Absolventinnen; sie besuchten auch das Mount Holyoke. Dass meine Mutter darauf bestand, auf die örtliche Highschool zu gehen, beschränkte auch ihre weiteren Bildungsmöglichkeiten auf das nähere Umfeld. Ich habe gelesen, dass das Robinson Female Seminary in Exeter, das 1867 gegründet wurde, sich zu Beginn hohe Ziele gesteckt hatte – es strebte als akademische Schule für Frauen ein ähnliches Niveau an wie die Phillips Exeter Academy für Männer. Die meisten Absolventinnen gingen dann allerdings nicht aufs College. 1890 fügte das Robinson Female Seminary zugunsten der Hauswirtschaftslehre Handarbeit und Kochen zum Lehrplan hinzu. Meine Mom verlor nie ein Wort über ihre Jahre auf der Highschool. Sie zeigte keinerlei Interesse an Nähen oder Kochen. Vielleicht hatte sie auf dem Robinson Female Seminary gelernt, Hauswirtschaft zu hassen.
Dass meine Mutter in Bennington in Rekordzeit durchfiel, bewies meinen Tanten endgültig, dass Little Ray nicht sonderlich begabt war. Dass meine Mom überhaupt erst nach Bennington gegangen war, reichte schon aus, um in Abigails und Marthas Augen als intellektuell unterlegen zu gelten.
Bennington gehörte nicht zu den geschätzten Seven Sisters, dem Siebengestirn von allesamt ursprünglich Frauen vorbehaltenen Liberal-Arts-Colleges im Nordosten der Vereinigten Staaten. Mir gegenüber wurde außerdem angedeutet, meine Mutter wiese womöglich »geistig gewisse Mängel« auf, so die Worte meiner Tante Abigail.
»Leicht beeinträchtigt«, war Tante Marthas zersetzerische Formulierung. Martha wollte darauf hinaus, dass meine Großmutter zu alt gewesen sei, um noch schwanger zu werden, zumindest habe Nana das geglaubt; das hieß, meine Mom hatte sie überrascht. Abigail und Martha mutmaßten des Weiteren, dass das Sperma des Direx emeritus nicht mehr »genug Pep« gehabt habe.
»Du kannst mir glauben, Adam«, sagte Nora in jenem Sommer (und das tat ich). »Es gibt Möglichkeiten, klug zu sein, ohne auf die besten Schulen und Colleges zu gehen. Deine Mutter ist die klügste aller Mütter.«
»Du willst doch nicht behaupten, dass sie klüger ist als Nana; Nana ist auch eine Mutter«, korrigierte ich sie. Mit zehn oder elf war ich meiner älteren Cousine nicht gewachsen; um ehrlich zu sein, würde ich Nora nie gewachsen sein.
»Doch, genau das meine ich«, entgegnete Nora. »Die Gleichmacherei beginnt mit Nana. Meine Mutter und Martha ziehen mit – sie sind Konformisten. Schafe!«, beharrte Nora. »Deine Mom nicht – sie tut nicht, was andere für richtig halten, bis heute nicht. Es ist dumm, sich so zu verhalten, wie es von einem erwartet wird. Deine Mom hat Eier, Adam, richtig dicke«, versicherte sie mir.
Nora war meine Vertraute, meine vertrauenswürdigste Informantin und meine Verbündete in einer gemeinsamen Sache: Wir beide hassten die erzwungenen Reisen in den Norden, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Ich musste mir ein Zimmer mit Henrik teilen, das erste und einzige Kind von Onkel Johan und Tante Martha. Er war zwei Jahre jünger als Nora und vier Jahre älter als ich, er war von Nora schikaniert worden, und wenn Nora mich nicht beschützen konnte, schikanierte er mich.
Dass ich seine zu klein gewordenen Unterhosen auftrug, schien ihm Grund genug, mich zu verachten. Ich trug die abgelegte Kleidung von beiden auf, Nora und Henrik, aber nicht Noras Unterhosen. Tante Abigail zwang sie, wenigstens Mädchenunterwäsche anzuziehen. Henrik fand, die sollte ich ebenfalls tragen, »vor allem die, in die Nora geblutet hat«. Als ich darauf hinwies, dass Noras Schlüpfer keinen Eingriff hätten, entgegnete Henrik, ich hätte ja auch »keinen nennenswerten Penis«. In Henriks Augen war ich ein Muttersöhnchen, das sich zum Pinkeln hinsetzen sollte wie ein Mädchen.
Nora teilte sich im Norden ein Zimmer mit wechselnden Vinter-Mädchen, ihrer weiblichen Verwandtschaft unter den Norwegern. Sie waren in Noras Alter und ganz und gar nicht burschikos, sondern vollkommen mädchenhafte Blondinen, die sich kleideten, um Jungs zu verführen. »Skischlampen« nannte Nora sie deswegen. Wenn sie sich darüber lustig machten, dass Nora sich wie ein Junge anzog, wurden sie von ihr vermöbelt.
»Wir sollten uns ein Zimmer teilen«, meinte Nora. »Wir würden schon keine Dummheiten machen; wenn du es auch nur versuchen würdest, würde ich dich windelweich hauen. Das ist wieder mal diese Brewster-Konformität; noch mehr von diesem Scheiß – was andere für richtig halten. Deine Mom wüsste es besser. Sie würde uns in einem Zimmer schlafen lassen. Ich wette, sie würde uns sogar in einem Bett schlafen lassen.«
»Meine Mom ist gar nicht oft genug da, um irgendwelche Regeln zu machen«, gab ich zu bedenken.
»Du musst dich mal damit abfinden, dass sie ›nicht oft genug da ist‹ – so ist deine Mutter nun mal«, erwiderte Nora.
Ich war etwa elf, als ich Noras Argumentation in dieser Sache akzeptierte. Wir hatten den Punkt mit der unabhängigen Denkweise meiner Mom hinter uns gelassen und spekulierten nun darüber, dass Nana womöglich nicht überrascht gewesen war, schwanger zu sein. Nora und ich glaubten nicht an einen Unfall. Nora meinte: »Die Aussicht, mit dem Direx emeritus allein zu sein, hat schwer auf Nana gelastet. Ich sag dir, Adam, Nana wusste ganz genau, was sie tat – die Schwangerschaft war Absicht. Wer wäre denn schon gern mit Rektor Brewster allein?«
»Vielleicht war er lustiger, als er noch gesprochen hat«, meinte ich.
»Ich erinnere mich noch daran«, sagte Nora. »Der Scheißschwätzer hat geredet wie ein Wasserfall!«
Ich nutzte die Gelegenheit und fragte Nora, was ich Nana vergeblich gefragt hatte: »Warum hat er damit aufgehört?«
»Deine Mom hat ihm nicht gesagt, dass sie schwanger ist – kann ich ihr nicht verdenken!«, verkündete Nora. »Sie war neunzehn, sie wollte nicht verraten, wer dein Vater war, und sie hatte nicht die Absicht zu heiraten.«
»Aber Nana hat sie es erzählt, oder?«, fragte ich Nora, die nickte.
»Und Nana hat es dem Direx emeritus gesagt. Wie ich Nana kenne«, fuhr Nora fort, »war das eine lange Geschichte – wenn auch nicht die ganze.«
»Die Moby-Dick-Fassung«, sagte ich, und Nora nickte wieder. »Und dann hat Rektor Brewster aufgehört zu sprechen?«
»Nicht ganz«, entgegnete Nora. »Der Direx emeritus fing an zu schluchzen, er konnte gar nicht mehr aufhören. Und als er sich schließlich unter Kontrolle hatte, rief er: ›Nicht Little Ray!‹ Danach war er fertig mit dem Sprechen und hat einfach aufgehört«, erzählte mir Nora.
»Warum gibt es in unserer Familie so viele Geheimnisse, Nora?«, fragte ich.
»Warum ringst du deine Hände so? Macht doch nichts, dass sie klein sind. Wenn du alt genug bist, Adam, wirst du auch Geheimnisse haben«, antwortete meine ältere und weisere Cousine.
Es gab noch einen weiteren Grund, warum Nora und ich Seelenverwandte waren: unsere gemeinsame Weigerung, Ski fahren zu lernen, auch wenn wir uns einer ganzen Reihe von Skilehrern (darunter meine Mom) auf ganz unterschiedliche Art widersetzten.
Vor einem unter Cousins und Cousinen recht verbreiteten Vergehen schreckten Nora und ich zurück: Wir hatten niemals Sex miteinander. So mutig waren wir nicht, aber wir waren Komplizen. Unsere Entschlossenheit, in einer skiverrückten Familie das Skifahren nicht zu lieben, war unsere – zaghaftere – Art der Rebellion; es war, was Nora und ich taten, anstatt miteinander zu schlafen.
Ich war vierzehn, fast fünfzehn, als Nora Folgendes zu mir sagte. Man muss bedenken, dass Nora da bereits über zwanzig war. »Falls du noch nicht alt genug bist, um das zu verstehen, Adam, dann wirst du es bald sein«, sagte sie. »Die Probleme, die wir damit haben, Brewsters zu sein, haben alle mit Sex zu tun.«
Wenn ich abends einschlief und dabei versuchte, nicht an Sex zu denken, sah ich mich in der Saloonszene in Shane, in der der gut aussehende, aber kleine Alan Ladd dem größeren Ben Johnson einen Hieb verpasst, der ihn durch die Schwingtüren schleudert.
Wenn ich dann immer noch nicht schlief und an nichts anderes als Sex dachte, stellte ich mir stattdessen die Szene mit der Schießerei vor, in der Jack Palance erschossen und unter den einstürzenden Fässern begraben wird.
»Shane, pass auf!«, konnte ich Brandon De Wilde rufen hören. In meinem dunklen Schlafzimmer hörte ich den Schusswechsel, die darauffolgende Stille und dann die einsetzende Musik. Meine Gedanken kreisten aber natürlich weiter um Sex – so als sei es Sex gewesen, wovor Brandon De Wilde Shane hätte warnen wollen.
8Hast du sie gesehen?
Vielleicht wäre eine kleine Geografiestunde hilfreich. Stowe liegt im nördlichen Vermont, näher an Montreal als an Exeter. North Conway liegt im Norden New Hampshires, näher an Maine als an Vermont. Und Exeter liegt im Südosten von New Hampshire, näher an der Küste und sogar an Boston als an Vermont. In New England sind die Straßen nach Norden und Süden ein wenig besser als die nach Osten oder Westen; in den Fünfzigern und Sechzigern waren sie aber alle nicht sonderlich gut. »Und wenn es schneit«, sagte meine Großmutter immer, »dann kommt man nirgendwo mehr hin, egal, von wo.«
Das war der Grund, warum meine Mom mich in der Skisaison nicht besuchte. Von Stowe nach Exeter und zurück war es ziemlich weit, und irgendwo unterwegs schneite es sicher. Aber die Strecke von Stowe nach North Conway war machbar, wenn auch nicht einfach. Meine Mom tauschte dann immer mit einer der Skilehrerinnen am Cranmore Mountain. Die Skilehrerin aus Cranmore freute sich über den Tapetenwechsel (und die Gelegenheit, am Mount Mansfield neue Pisten zu fahren), und meine Mutter unterrichtete für sie in Cranmore. Auf diese Weise verlor keines der Skigebiete in den beiden arbeitsreichsten Wochen der Saison eine Lehrerin. Und meine Mutter hatte jeden Winter zwei Wochen Zeit, mir das Skifahren beizubringen.
Während der Grundschule, in der Mittelschule und bis kurz vor dem Abschluss schaffte ich es, Skianfänger zu bleiben. Meist gab es in den entsprechenden Kursen meiner Mutter nur kleine Kinder, ich aber rasierte mich bereits und fuhr schon Auto.
Die Mühe, die das machte – die Belastung, die es für meine Mom und mich bedeutete –, dass ich auf Skiern nicht endlich besser wurde, erforderte viel Geduld. Der Schlüssel war, freundlich und zuversichtlich zu bleiben. Wir waren nie unglücklich miteinander. Und am Abend waren wir besonders aufmerksam zueinander. Ich liebte diese zwei Wochen im Winter, in denen ich nicht Skifahren lernte; in denen ich Stürze inszenierte und meinen absolut adäquaten Stemmschwung zu einem lausigen Pflugschwung verkommen ließ. Ich glaube, meine Mutter liebte sie ebenfalls; nicht ein einziges Mal verlor sie die Geduld oder zeigte leiseste Anzeichen von Enttäuschung. »Ach, Adam – es geht besser, wenn du dein Gewicht auf den Talski bringst, Liebling. Ich weiß, es ist schwer zu merken.«
Nein, war es nicht; es war schwer, absichtlich so zu tun, als hätte ich es vergessen. Ich fuhr so langsam und in fast rechtem Winkel zum Hang, dass ich manchmal einfach stehen blieb, selbst an steilen Stellen. Andere Skifahrer brüllten mich an, weil ich ihnen den Weg versperrte. Ließ meine Mom die Anfänger in einer Schlange die Piste hinunterfahren, reihte ich mich als Letzter ein. Bis ich unten ankam, standen die Achtjährigen schon wieder am Lift an. In jenen Jahren, als alle Eltern Angst vor der Kinderlähmung hatten, fragten andere Mütter meine Mom, ob ich sie gehabt habe oder vielleicht irgendeine andere Behinderung.
»Nein, nein«, antwortete meine Mom fröhlich. »Mein lieber Adam findet nur das Skifahren potenziell gefährlich. Adam war schon immer zögerlich.«
Nora wiederum war kein bisschen zögerlich; sie hielt ihren Anfängerstatus erbittert aufrecht, indem sie so waghalsig wie möglich fuhr.
»Ziel ist es, die Kontrolle zu behalten, Nora«, erklärte meine Mom ihr vergeblich – Kontrolle war niemals Noras Ziel. Sie stürzte sich bergab; sie raste davon. Ganz gleich, wie steil der Berg auch war, Nora fuhr niemals im rechten Winkel dazu; sie richtete ihre Skispitzen hangabwärts aus und schoss los.
»Umwege sind nicht so mein Ding, Ray«, sagte Nora zu meiner Mom.
»Meine liebe Nora«, entgegnete diese freundlich, »ich bin eher in Sorge, dass das Anhalten nicht so dein Ding ist.«
Nora war sportlicher als ich, und sie war mutiger; sie fuhr so lange Schuss, bis sie stürzte. Während meine Mom makellose Bögen zog und uns Anfänger anwies, es ihr gleichzutun und ihr wenn möglich zu folgen, zischte Nora an meiner Mutter vorbei.
»Kontrolle, Nora!«, rief Mom hinter ihr her. »Ach, das liebe Mädchen«, sagte meine Mutter und wandte sich an die Achtjährigen. »Nora ist dazu geboren, alles auf ihre Art zu machen. Ich hoffe nur, sie tut sich oder anderen nicht weh. Auf Skiern ist es besser, die Kontrolle zu behalten.«
Nora machte sich keine Gedanken darüber, ob sie sich oder anderen weh tun würde. Sie war dem gewachsen. Sie war ein schweres Kind gewesen; sie war ein stämmiges Mädchen, aus dem eine stämmige Frau werden würde. Ihr erklärter Hass auf das Skifahren hatte mit der Bekleidung begonnen. Skihosen würde Nora nie mögen.
»Wenn du Kinder kriegst, wirst du froh sein über deine üppigen Hüften«, hatte ihre Mutter zu ihr gesagt. Tante Abigail hatte üppige Hüften und einen opulenten Busen. Aber Nora hatte mit ihren Hüften andere Pläne; Kinder kriegen gehörte nicht dazu.
Auf Skiern konnte Nora gut das Gleichgewicht halten oder zurückerlangen, und ihr Gewicht half ihr dabei, schnell zu fahren; wenn Nora also die Kontrolle verlor, kam sie dennoch sehr weit den Berg hinunter, bis sie stürzte. Nur sicher wenden oder bremsen konnte sie so nicht. Aber Sicherheit war auch nicht ihr Stil.
Wenn Nora merkte, dass ihr ein Sturz bevorstand, suchte sie sich einen Kerl aus und fuhr ihn um. So stürzte sie gern: mit einem jungen Mann unter sich. Stets handelte es sich um eine Sportskanone, genau jene Art von Volltrottel, die sie an ihren Cousin Henrik erinnerte.
Kurz bevor Nora das Gleichgewicht verlor, ging sie plötzlich in die Hocke und schlang einem Skifahrer, der ihren Unwillen erregt hatte, ihre starken Arme um die Hüften. Ich habe erlebt, wie Nora Kerle aus ihren Bindungen riss, wie sie Skifahrer von ihren Brillen und Handschuhen befreite. Große Schneebrocken, die sich durch die Wucht des Sturzes gelöst hatten, glitten den Hang hinunter. Und stets landete der Kerl unter Nora und polsterte ihren Sturz ab. Dann lag er schreiend oder vor Schmerz japsend da oder aber regungslos, wie tot.
Manchmal, wenn Nora befürchtete, sie habe jemanden umgebracht, nahm sie ihre Skimütze (später ihren Helm) ab und drückte ein Ohr an die kalten Lippen des reglosen Skifahrers, um zu prüfen, ob er noch lebte. »Man kann hören oder spüren, ob der Wichser noch atmet«, erklärte sie mir. »Atemstillstand kann man nicht vortäuschen, Adam – jedenfalls nicht für lang.«
Wenn sie auf Skiern stand, mochte Nora ihr Gewicht. Im Haus der Norweger in North Conway gab es eine professionell wirkende Waage, so eine, wie sie auch Boxer und Ringer benutzen. Sie stand in ihrer ganzen Wuchtigkeit im oberen Flur; für die Badezimmer war sie zu groß. Ich weiß nicht, ob sportlich veranlagte Norweger alles zum Ritual erheben, Onkel Martin und Onkel Johan aber schon. An jedem Neujahrsmorgen wurden wir Kinder im oberen Flur gewogen. Das galt für alle: die Norwegerinnen (die mädchenhaften Blondinen), Nora, Henrik und mich. Stets wurden wir in unseren Pyjamas gewogen. Nora war immer die Schwerste.
In ihrem letzten Schuljahr wog Nora 77 Kilogramm, abzüglich Pyjama. Als Henrik ausgewachsen war, war er größer als sie, über eins achtzig; Nora war eins achtundsiebzig, Tendenz steigend. Wen sie in vollem Tempo umfuhr, den traf es gewaltig.
Bei diesen Zusammenstößen brachen Beine, allerdings nicht die von Nora. Knie mussten operiert werden, aber nie waren es ihre. In den Tagen der Lederskistiefel, der Holzskier mit Kabelbindung – den sogenannten ›Bärenfallen‹ –, waren es häufiger die unteren Gliedmaßen, die zu Schaden kamen – aber nicht ein einziges Mal die von Nora. Meine ersten Skier waren natürlich aus Holz. Ich glaube, sie stammten von der Paris Manufacturing Company (aus South Paris, Maine), und sie hatten eine Kandaharbindung. Vielleicht waren es aber auch Noras erste Skier. So vieles aus der Vergangenheit – aus meiner Vergangenheit – weiß ich von meiner Cousine.
Onkel Martin und Onkel Johan blieben bis zuletzt Telemarker mit freien Fersen; sie liebten ihre nordischen Skier mit den zu Nippeln zulaufenden Spitzen. Ich erinnere mich, dass sie noch in den Siebzigern telemarkten. Die meisten Alpinskifahrer wechselten in den Sechzigern zu den Sicherheitsbindungen, die den ganzen Schuh umfassten.
»Diese alten Kabelbindungen sind für so manche Unterschenkelspiralfraktur verantwortlich«, sagte meine Mom immer.
Solche Frakturen waren bei Noras Opfern nicht selten – ebenso wie die üblichen Oberkörperverletzungen bei solchen harten Zusammenstößen bei vollem Tempo. Verrenkte Schultern und Schlüsselbeinbrüche waren normal, wenn auch nicht bei Nora. Und wenn Nora sich an einem festklammerte und auf einem landete, dann konnte es auch zu Rippenbrüchen und Gehirnerschütterungen kommen. Sicherheitsbindungen waren deswegen so viel sicherer, weil sie beim Sturz aufgingen und sich der Ski vom Fuß lösen konnte. Aber Skier haben scharfe Kanten, und wenn zwei Skifahrer zusammenstoßen, kann es schon mal Schnittwunden im Gesicht geben. Nora war stolz auf ihre Narben.
Einmal ging ihre genähte Augenbraue nachts wieder auf, und das Blut lief aufs Kissen; am Morgen klebte ihr Gesicht am Bezug. Die Blondinen kreischten angeekelt oben im Flur herum. Ein andermal brach Nora sich die Nase; sie war damit auf das Brustbein eines Kerls gefallen, als sie ihn in die Hügelflanke donnerte. Sein Brustbein war angeknackst – wohl eine schwerere Verletzung als eine gebrochene Nase.
»War doch nur ein Haarriss«, sagte Nora und zuckte mit den Schultern. »Schau mich mal an – ich hab zwei Veilchen. Nicht mal ’n Perversling würde sich so für mich interessieren«, fügte sie hinzu und zeigte auf ihr Brillenhämatom.
Ich hatte den Eindruck, dass Nora ihre Verletzungen mochte, fast so sehr, wie Arschlöcher umzufahren. Zum einen hatte sie dann eine gute Ausrede, nicht Ski zu fahren, wenn sie verletzt war. Zum anderen gefiel es ihr, ein wenig aufsehenerregend auszusehen. Mir war nie aufgefallen, dass Nora irgendjemandes Interesse auf sich ziehen wollte, nicht mal das von einem Perversling. Als man sie nach Northfield geschickt hatte, hatte sie umgehend »per Haarschnitt Stellung bezogen«, wie ihre Mutter es nannte.
»Das ist ein Bürstenschnitt«, erklärte Nora; sie achtete sorgfältig darauf, es nicht wie einen Ausruf der dramatischen Brewster-Mädchen klingen zu lassen. »Wenn Jungs sich die Haare so schneiden lassen, ist das doch auch keine Riesensache.«
Manche Kerle hielten Nora für einen Kerl. Wenn sie einen langen Skianorak trug, der ihre Hüften verbarg, oder einen extraweiten Pullover, in dem ihre Brüste verschwanden, dann verliehen ihr das vorstehende Kinn und die breiten Schultern etwas Maskulines. Und auf Skiern konnte sie sogar wie ein Mann laufen. Ohne Skier waren ihre Hüften im Spiel, und sah man die oder ihre Brüste, war jedem sofort klar, dass Nora eine Frau sein musste.
Und was diese Sportskanonen anging, die auf der Piste unter ihr lagen – man stelle sich mal deren Überraschung vor, wenn sie das Bewusstsein wiedererlangten, während Nora ein Ohr an ihre zittrigen Lippen drückte. Ich nehme an, dass die zweifelhafte erotische Verwirrung dieser Situation im starken Gegensatz stand zu Noras Bürstenschnitt und dem hübschen, aber kantigen Gesicht, dem prominenten Kinn und dem schmallippigen Grinsen, das bei Nora als fieses Lächeln durchging.
Doch ich übertreibe ein wenig mit dem Heldenbild, das Nora für mich abgab. Ja, sie half mir, die Winterreisen in den Norden zu ertragen. Aber ungeachtet ihrer rebellischen Mätzchen ragten für mich doch vor allem die zwei Wochen heraus, in denen meine Mutter und ich zusammen waren – und ganz besonders unsere Nächte.
»Oh, prima, eine Pyjamaparty, Adam!«, rief meine Mutter auf ihre Kleinmädchenart. »Bist du aufgeregt?«