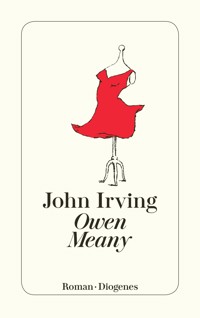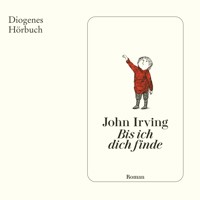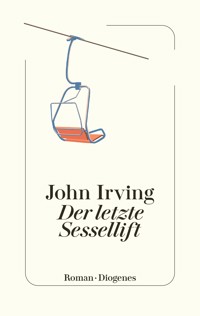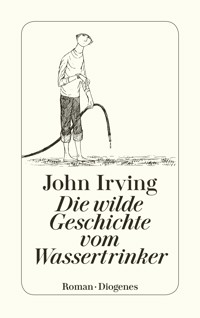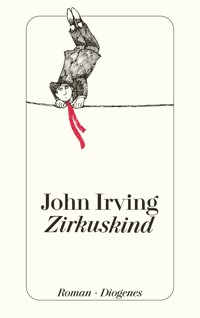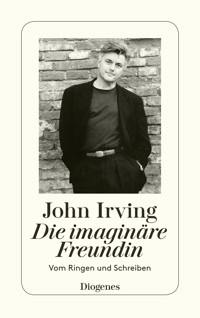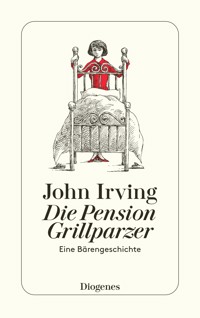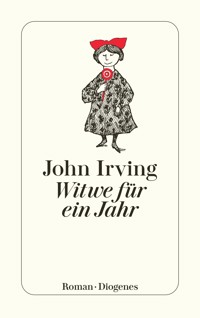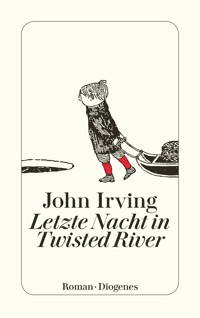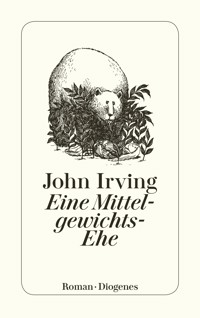
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Paare beschließen, es einmal mit Partnertausch zu versuchen. Ein mittelgewichtiger Versuch, mit dem schwergewichtigen Problem der Ehe fertigzuwerden und wieder gefährlich zu leben. Anfangs scheint auch alles zu klappen, doch dann entpuppt sich einer der Vier als Spielverderber, die Vierecksgeschichte entwickelt sich zunehmend zu einem Kampf hinter verschlossenen Türen, mit schmerzlichen Folgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
John Irving
Eine Mittelgewichts-Ehe
Roman
Aus dem Amerikanischen vonNikolaus Stingl
Titel der 1974 bei Random House, New York,
erschienenen Originalausgabe:
›The 158-Pound Marriage‹
Copyright © 1973, 1974 by
John Irving
Die deutsche Erstausgabe erschien 1986
im Diogenes Verlag
Umschlagillustration von
Edward Gorey
Mit freundlicher Genehmigung des
Edward Gorey Charitable Trust, New York
Für IMF
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 21605 9 (27.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60127 5
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] »Wir waren damals zu viert, nicht bloß zu zweit, und in unserer Vierergruppe floß der Rebensaft in Strömen, floß und strömte und schäumte wie vielleicht niemals wieder.
John Hawkes, ›The Blood Oranges‹
»Es war höchst erstaunlich, wie sie das einfädelten, und ich glaube, in den Augen Gottes wäre es besser gewesen, wenn sie einander die Augen ausgekratzt hätten. Aber sie waren ›ordentliche Leute‹.«
[7] Inhalt
1. Der Engel namens »Das Lächeln von Reims« [9]
2. Kundschafterberichte: Edith (Klasse bis 57Kilo) [33]
3. Kundschafterberichte: Utsch (Klasse bis 61Kilo) [56]
4. Kundschafterberichte: Severin (Klasse bis 72Kilo) [80]
5. Ausgangsstellungen [106]
6. Wer ist oben? Wo ist unten? [139]
7. Karnevals Streit mit dem Fasten [165]
8. Der Ringerhallen-Liebhaber [204]
9. Das Zweitplazierten-Syndrom [236]
[9] 1.
Der Engel namens»Das Lächeln von Reims«
Meine Frau Utschka (deren Namen ich vor einiger Zeit zu Utsch verkürzt habe) könnte einer Zeitbombe Geduld beibringen. Mit etwas Glück hat sie mir ein bißchen beigebracht. Utsch, so könnte man sagen, lernte unter Zwang Geduld. Sie wurde 1938, im Jahr des Anschlusses, in Eichbüchl, Österreich, geboren – einem kleinen Dorf außerhalb der proletarischen Stadt Wiener Neustadt, die eine Autostunde von Wien entfernt liegt. Als sie drei war, wurde ihr Vater als bolschewistischer Saboteur umgebracht. Es ist unbewiesen, daß er Bolschewist war, aber er war ein Saboteur. Bis zum Ende des Krieges wurde Wiener Neustadt zur größten Landebahn in Europa und zum unfreiwilligen Standort der deutschen Messerschmitt-Fabrik. Utschs Vater wurde 1941 umgebracht, als man ihn dabei erwischte, wie er auf der Rollbahn von Wiener Neustadt Messerschmitts in die Luft sprengte.
Die örtliche SS-Standarte von Wiener Neustadt stattete Utschs Mutter in Eichbüchl einen Besuch ab, nachdem Utschs Vater erwischt und umgebracht worden war. Die SS-Männer sagten, sie seien gekommen, um das Dorf vor der »Saat des Verrats« zu warnen, die in Utschs Familie offenbar reichlich aufging. Sie sagten den Dorfbewohnern, sie sollten Utschs Mutter sehr genau im Auge behalten, um sicherzugehen, daß sie keine Bolschewistin war wie ihr verstorbener Mann. Dann vergewaltigten sie Utschs Mutter und stahlen aus dem Haus eine hölzerne Kuckucksuhr, die Utschs Vater in Ungarn gekauft hatte. Eichbüchl liegt ganz dicht an der ungarischen Grenze, und der ungarische Einfluß ist überall erkennbar.
[10] Einige Monate nachdem die SS abgezogen war, wurde Utschs Mutter erneut vergewaltigt, und zwar von einigen Männern aus dem Dorf, die, als man sie wegen ihrer Gewalttat verhörte, behaupteten, sie hätten sich an die Anweisungen der SS gehalten: Utschs Mutter sehr genau im Auge zu behalten, um sicherzugehen, daß sie keine Bolschewistin war. Sie wurden nicht unter Anklage gestellt.
1943, als Utsch fünf war, verlor Utschs Mutter ihre Stelle in der Klosterbibliothek im nahegelegenen Katzelsdorf. Man deutete an, daß sie Jugendlichen entartete Bücher andrehen könnte. Tatsächlich war sie des Bücherdiebstahls schuldig, aber dessen bezichtigten sie sie nie, noch kamen sie je dahinter. An das kleine Steinhaus, in dem Utsch geboren wurde – am Ufer eines Flusses, der durch Eichbüchl fließt –, schloß sich ein Hühnerstall an, den Utschs Mutter versorgte, und ein Kuhstall, den Utsch seit ihrem fünften Lebensjahr täglich ausmistete. Das Haus war voller gestohlener Bücher; es war eigentlich eine theologische Bibliothek, obwohl sich Utsch ihrer eher als einer Kunstbibliothek erinnert. Die Bücher waren riesige, plakatgroße Register der Kirchen- und Kathedralenkunst – Bildhauerei, Architektur und Kirchenglas – von einiger Zeit vor Karl dem Großen bis zum späten Rokoko.
Am frühen Abend, wenn es dunkel wurde, half Utsch ihrer Mutter die Kühe melken und die Eier einsammeln. Die Dorfbewohner bezahlten die Milch und die Eier mit Wurst, Decken, Kohl, Holz (selten Kohle), Wein und Kartoffeln.
Glücklicherweise war Eichbüchl weit genug von dem Messerschmitt-Werk und der Landebahn in Wiener Neustadt entfernt, um den meisten Bombenangriffen zu entgehen. Bei Kriegsende warfen die alliierten Flugzeuge auf diese Fabrik und diese Landebahn mehr Bomben ab als auf jedes andere Ziel in Österreich. In der verdunkelten Nacht lag Utsch in dem Steinhaus bei ihrer Mutter und hörte das Rums! Rums!
[11] Rums! der in Wiener Neustadt fallenden Bomben. Manchmal flog ein angeschossenes Flugzeug niedrig über das Dorf, und einmal wurde zur Blütezeit Haslingers Apfelgarten bombardiert; die Erde unter den Bäumen war mit Apfelblütenblättern dichter als Hochzeitskonfetti übersät. Das geschah, bevor die Bienen die Blüten befruchtet hatten, und so war die Herbst-Apfelernte ruiniert. Frau Haslinger wurde vorgefunden, wie sie mit einer Heckensichel auf sich einhackte, im Mostkeller, wo man sie mehrere Tage lang einschließen mußte – gefesselt in einer der großen, kühlen Apfelhorden, bis sie wieder zur Besinnung kam. Während ihres Eingesperrtseins, behauptete sie, sei sie von einigen Männern aus dem Dorf vergewaltigt worden, aber man hielt das für ein Hirngespinst aufgrund ihrer Geisteszerrüttung beim Verlust der Apfelernte.
Es war kein Hirngespinst, als die Russen 1945, als Utsch gerade sieben war, nach Österreich kamen. Sie war ein hübsches kleines Mädchen. Ihre Mutter wußte, daß die Russen schrecklich zu Frauen und freundlich zu Kindern waren, aber sie wußte nicht, ob sie Utsch als Frau oder als Kind betrachten würden. Die Russen kamen durch Ungarn und von Norden her und wüteten besonders in Wiener Neustadt und Umgebung, wegen des Messerschmitt-Werkes und all der hohen Offiziere der Luftwaffe, die sie dort vorfanden.
Utschs Mutter brachte Utsch in den Kuhstall. Es waren nur noch acht Kühe übrig. Sie ging zur größten Kuh hinüber, deren Kopf in ihrem Fanggatter feststeckte, und schnitt ihr die Kehle durch. Als die Kuh tot war, machte sie den Kopf vom Fanggatter los und wälzte die Kuh auf die Seite. Sie schnitt den Bauch der Kuh auf, zog die Eingeweide heraus und säbelte den Anus heraus und bedeutete Utsch sodann, sich zwischen den ausgehöhlten Rippenbögen der großen Kuh hinzulegen. Sie stopfte so viele von den Innereien in die Kuh zurück, wie hineinpaßten, und brachte den Rest nach [12] draußen in die Sonne, wo sie Fliegen anlocken würden. Sie schloß die aufgeschlitzten Bauchlappen der Kuh wie einen Vorhang um Utsch; sie sagte Utsch, sie könne durch den herausgeschnittenen Anus der Kuh atmen. Als die Gedärme, die in der Sonne gelegen hatten, Fliegen anlockten, brachte Utschs Mutter sie in den Kuhstall zurück und verteilte sie auf dem Kopf der toten Kuh. Mit den um ihren Kopf schwirrenden Fliegen sah die Kuh so aus, als sei sie schon lange tot.
Dann sprach Utschs Mutter durch das Arschloch der Kuh mit Utsch. »Rühr dich nicht und mach keinen Mucks, bis jemand dich findet.« Utsch hatte eine mit Kamillentee und Honig gefüllte, große, schlanke Weinflasche und einen Strohhalm. Davon sollte sie trinken, wenn sie durstig war.
»Rühr dich nicht und mach keinen Mucks, bis jemand dich findet«, sagte Utschs Mutter.
Utsch lag zwei Tage und zwei Nächte lang im Bauch der Kuh, während die Russen das Dorf Eichbüchl verwüsteten. Sie schlachteten alle anderen Kühe im Stall, und sie brachten auch ein paar Frauen in den Stall, und sie schlachteten dort außerdem ein paar Männer, aber der toten Kuh mit Utsch darin kamen sie nicht zu nahe, weil sie meinten, die Kuh sei schon lange tot und ihr Fleisch sei verdorben. Die Russen benutzten den Stall für eine Menge Scheußlichkeiten, aber Utsch machte keinen Mucks und rührte sich nicht im Bauch der Kuh, wo ihre Mutter sie untergebracht hatte. Selbst als ihr der Kamillentee ausging und die Innereien der Kuh trockneten und um sie herum hart wurden – und all die glitschigen Gedärme an ihr festklebten –, rührte Utsch sich nicht und machte keinen Mucks. Sie hörte Stimmen; es war nicht ihre Sprache, und sie gab keine Antwort. Die Stimmen klangen angewidert. Die Kuh wurde angestochen; die Stimmen stöhnten. An der Kuh wurde gezerrt und geruckt; die Stimmen grunzten – manche Stimmen würgten. Und als die Kuh hochgezogen wurde – die Stimmen machten hau ruck! –, glitschte Utsch in einer klebrigen Masse heraus, die in den [13] Armen eines Mannes mit schwarzem Schnurrbart und rotem Stern an seiner grau-grünen Mütze landete. Er war Russe. Er fiel mit Utsch in den Armen auf die Knie und schien ohnmächtig zu werden. Andere Russen um ihn herum nahmen ihre Mützen ab; sie schienen zu beten. Jemand brachte Wasser und wusch Utsch. Ironischerweise waren sie die Sorte Russen, die freundlich zu Kindern waren, und hielten Utsch keineswegs für eine Frau; tatsächlich hielten sie sie zunächst für ein Kalb.
Nach und nach wurde klar, was geschehen war. Utschs Mutter war vergewaltigt worden. (Fast jedermanns Mutter und Tochter waren vergewaltigt worden. Fast jedermanns Vater und Sohn waren umgebracht worden.) Dann hatte eines Morgens ein Russe beschlossen, den Stall niederzubrennen. Utschs Mutter hatte ihn angefleht, es nicht zu tun, aber ihre Verhandlungsposition war schwach; sie war schon vergewaltigt worden. So war sie gezwungen gewesen, den Russen mit einem Feldspaten umzubringen, und ein anderer Russe war gezwungen gewesen, sie zu erschießen.
Nach und nach reimten die Russen es sich zusammen. Das mußte das Kind dieser Frau sein, die nicht gewollt hatte, daß der Stall niedergebrannt wurde, und zwar weil… Der Russe, der die glitschige Utsch mit den Armen aufgefangen hatte, als die verwesende Kuh auf einen Lastwagen geworfen wurde, kam darauf. Außerdem war er Offizier, ein Georgier von den Ufern des aalglatten Schwarzen Meeres; man hat dort eigenartige Redewendungen und haufenweise Slangausdrücke. Einer davon ist utsch – Kuh. Ich habe mich erkundigt, und die einzige Erklärung ist, daß utsch für verschiedene saloppe Georgier das Geräusch imitiert, das eine Kuh macht, wenn sie kalbt. Und utschka? Na, das ist natürlich ein Kalb, und so nannte der georgische Offizier das kleine Mädchen, das ihm aus dem Leib der Kuh geboren wurde. Und es ist ja wohl klar, daß eine Frau Mitte Dreißig keine Utschka mehr sein kann, also nenne ich sie Utsch.
[14] Ihr wirklicher Name war Anna Agathe Thalhammer, und nachdem der georgische Offizier die Geschichte von Utschs Familie in dem ehrbaren Dorf Eichbüchl gehört hatte, nahm er seine Utschka mit nach Wien – einer prima Stadt zum Besetzen, mit Konzerten und Gemälden und Theatern und Heimen für Kriegshinterbliebene.
Wenn ich daran denke, wie oft ich Severin Winter diese Geschichte erzählt habe, könnte ich mir die Zähne einschlagen! Wieder und wieder habe ich ihm gesagt, daß er begreifen muß, daß Utsch vor allem treu ist. Geduld ist eine Form der Treue, aber das hat er an ihr nie begriffen.
»Severin«, pflegte ich zu sagen, »sie ist aus demselben Grund verletzlich, aus dem sie stark ist. Worauf sie auch immer ihre Liebe richtet, sie wird Vertrauen haben. Sie wird länger aushalten als man selbst, sie wird mit einem auskommen – ewig –, wenn sie einen liebt.«
Es war Utsch, die die Postkarten fand. Es war in dem Sommer, den wir, schlecht beraten, in Maine verbrachten, von Regen und stechenden Insekten heimgesucht, als Utsch vom Antiquitätenfloh gebissen wurde. Ich habe ihn als einen Sommer in Erinnerung, der von vergammelten Möbeln, Überbleibseln aus Amerikas kolonialer Vergangenheit, verschandelt war – ein Tick, von dem Utsch bald wieder abkam.
Es war in Bath, Maine, wo sie in irgendeinem schmutzigen Lagerhaus, das für »seltene Antiquitäten« Reklame machte, die Postkarten fand. Es war in der Nähe der Werft; sie konnte Nietgeräusche hören. Der Besitzer des Antiquitätenladens versuchte, ihr eine Kutscherpeitsche zu verkaufen. Utsch deutete an, in seinen alten Augen habe ein Blick gelegen, der sie bat, die Peitsche an ihm auszuprobieren, aber sie ist Europäerin, und ich weiß nicht, ob viele Amerikaner auf so etwas stehen. Vielleicht in Maine. Sie lehnte die Peitsche ab und blieb in der Nähe der Tür des Lagerhauses, wo sie, immer gefolgt von dem alten Mann, aufmerksam [15] herumstöberte. Als sie in einem staubigen Glaskasten die Postkarten sah, erkannte sie sofort Europa. Sie bat darum, sie ansehen zu dürfen. Sie waren alle von Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg. Sie fragte den alten Mann, wie er sie bekommen hatte.
Er war im Ersten Weltkrieg amerikanischer Soldat gewesen, Angehöriger der Armee, die den Sieg in Frankreich feierte. Die Postkarten waren die einzigen Souvenirs, die ihm geblieben waren – alte Schwarzweißfotos, manche in Sepiatönen, schlechte Qualität. Er sagte ihr, die Fotos seien in Schwarzweiß genauer. »Ich erinnere mich in Schwarzweiß an Frankreich«, sagte er zu Utsch. »Ich glaube nicht, daß Frankreich damals in Farbe war.« Sie wußte, die Fotos würden mir gefallen, und so kaufte sie sie – über vierhundert Postkarten für einen Dollar.
Ich brauchte Wochen, um sie durchzusehen, und ich sehe sie heute noch durch. Da gibt es Damen mit langen schwarzen Kleidern und Herren mit schwarzen Regenschirmen, Bauernkinder in den traditionellen costumes bretons, Pferdegespanne, das Auto der Frühzeit, die Lastwagen der französischen Armee mit ihren Hecks aus Segeltuchplane und in den Parks umherschlendernde Soldaten. Da gibt es Szenen aus Reims, Paris und Verdun – vor und nach den Beschießungen.
Utsch hatte recht; genau solche Sachen kann ich gebrauchen. In jenem Sommer in Maine recherchierte ich noch für meinen dritten historischen Roman, der in Tirol zur Zeit von Andreas Hofer spielt, dem Bauernhelden, der Napoleon zurückschlug. Damals hatte ich keine Verwendung für Frankreich während des Ersten Weltkrieges, aber ich wußte, eines Tages würde ich Verwendung dafür haben. In ein paar Jahren vielleicht, wenn die Menschen auf den Postkarten – sogar die Kinder in costumes bretons – mehr als alt genug sein werden, um tot zu sein, dann werde ich sie vielleicht aufgreifen. Ich finde, es hat keinen Sinn, historische Romane über Menschen zu schreiben, die noch nicht tot sind; das ist eine [16] Maxime von mir. Geschichte braucht Zeit; ich sträube mich dagegen, über Menschen zu schreiben, die noch am Leben sind.
Für Geschichte braucht man eine Kamera mit zwei Objektiven – das Teleobjektiv und eins für Nahaufnahmen mit tiefenscharfer Feineinstellung. Das Weitwinkelobjektiv kann man vergessen; es gibt keinen Winkel, der weit genug wäre.
Aber in Maine dachte ich nicht über Frankreich nach. Ich verarztete infizierte Insektenstiche und bangte mit der. Bauernarmee von Andreas Hofer, dem Helden von Tirol. Ich verzweifelte über Utschs Verzweiflung angesichts der zerklüfteten Klippen von Maine, der Gefahren der Gewässer von Maine; unsere Kinder waren damals in einer gefährlichen Phase (wann sind sie das eigentlich nicht?) – sie waren beide Nichtschwimmer. Utsch hatte das Gefühl, sie seien im Auto oder in Antiquitätenläden am sichersten, und ich wollte keinen weiteren Stich von einer Kriebelmücke, einem Grünauge oder einem Salzwasser-Moskito herausfordern. Ein Sommer an der Küste von Maine, den wir mit Stubenhocken verbrachten.
»Warum sind wir überhaupt hierhergekommen?« fragte mich Utsch. »Warum?«
»Um wegzukommen«, wagte ich zu sagen.
»Von was?«
Es ist eine Ironie, jetzt daran zu denken, aber bevor wir Edith und Severin Winter kennenlernten, gab es eigentlich nichts, wovon wir hätten wegkommen müssen. In jenem Sommer in Maine kannten wir Edith und Severin noch nicht.
Mir fällt ein Beispiel für die Nahaufnahme ein. Ich habe mehrere Vorher-nachher-Fotos der Kathedrale von Reims. Darunter sind zwei vom linken Eingang des Westportals – Nahaufnahmen des Engels namens »Das Lächeln von Reims«. Vor der Beschießung der Kathedrale lächelte der Engel tatsächlich. Neben ihm streckte ein hoffnungsloser Saint-Nicaise den Arm aus – die Hand am Gelenk [17] abgetrennt. Nach dem Bombardement hatte der Engel namens »Das Lächeln von Reims« keinen Kopf mehr. Sein Arm war am Ellbogen abgetrennt, aus seinem Bein war, vom Oberschenkel bis zur Wade, ein Steinbrocken herausgerissen. Der hoffnungslose, vorwarnende Saint-Nicaise hatte die andere Hand, ein Bein, sein Kinn und seine rechte Wange verloren. Nach dem Beschuß war sein zerstörtes Gesicht für sie beide bezeichnend, ganz so, wie das Lächeln des Engels einmal seinen Trübsinn überstrahlt hatte. Nach dem Krieg ging in Reims die Rede, daß die joie de vivre im Lächeln des Engels in Wirklichkeit die Bomben auf ihn gezogen hätte. Die klugen Menschen von Reims geben, etwas subtiler, zu verstehen, es sei sein grämlicher Gefährte, jener verdrießliche Heilige, gewesen, der es nicht habe ertragen können, neben solcher Verzückung wie der des Engels finster dreinzuschauen; er sei es gewesen, der die Bomben auf sie beide lenkte.
In dieser Gegend Frankreichs heißt es gemeinhin, die Moral des »Lächelns von Reims« sei: Wenn Krieg herrscht und du steckst drin, dann freu dich nicht; du beleidigst sowohl den Feind als auch deine Verbündeten. Aber diese Moral des »Lächelns von Reims« ist nicht sehr überzeugend. Die guten Leute von Reims haben nicht diesen Blick fürs Detail wie ich. Solange das Lächeln und der Kopf des Engels intakt sind, leidet der Heilige neben ihm. Sobald sein Lächeln und der Rest seines Kopfes ihn verlassen haben, wirkt dieser Heilige – trotz neuer, eigener Wunden – zufriedener. Die Moral des »Lächelns von Reims« lautet meiner Ansicht nach, daß ein unglücklicher Mann keine glückliche Frau ertragen kann. Saint-Nicaise hätte dem Engel mit oder ohne Hilfe des Ersten Weltkriegs das Lächeln, wenn nicht gar den Kopf genommen.
Und dieser gottverdammte Severin Winter hätte Edith mit mir oder ohne mich angetan, was er ihr angetan hat!
»Hab Geduld«, pflegte Utsch in den ersten Runden ihres Kampfes mit meiner Sprache zu sagen.
Okay, Utsch. Ich sehe die Nahaufnahmen der Beschießung [18] von Reims. Die Teleaufnahme ist immer noch unklar. Es gibt da eine lange, breite, von der Kathedrale aus fotografierte Ansicht der zerschossenen Stadtviertel, aber weder ich noch die gescheiten Leute von Reims haben daraus eine Moral abgeleitet. Wie ich schon riet, vergiß den Weitwinkel. Ich sehe auch Edith und Severin Winter nur in Nahaufnahme. Wir Verfasser historischer Romane brauchen Zeit. Hab Geduld.
Severin Winter – dieses schlichte Gemüt, dieser sture Preuße! – hatte sogar ein Stück Geschichte mit Utsch gemeinsam, soweit das überhaupt eine Rolle spielte. Die Geschichte lügt bisweilen. So zählt man zum Beispiel die Enthauptung des Engels namens »Das Lächeln von Reims« und die übrigen der Kathedrale von Reims beigebrachten Schäden zu den menschlichen Greueln des Ersten Weltkrieges. Wie schmeichelhaft für einen Engel! Wie bizarr für eine Skulptur! Den Verlust von Kunstwerken für etwas Ähnliches zu halten wie die Vergewaltigung, Verstümmelung und Ermordung von Französinnen und Belgierinnen durch die boches! Der einer Statue namens »Das Lächeln von Reims« zugefügte Schaden läßt sich mit dem Aufspießen von Kindern auf Bajonette nicht ganz vergleichen. Die Menschen achten die Kunst zu hoch und die Geschichte nicht genug.
Ich sehe Severin Winter – diesen schmalzigen Liebhaber, diesen Opernnarren – immer noch vor mir, wie er in seinem von Pflanzen überwucherten Wohnzimmer stand wie ein gefährliches Tier, das einen botanischen Garten durchstreift, und zuhörte, wie Beverly Sills Donizettis ›Lucia‹ sang.
»Severin«, sagte ich, »du verstehst sie nicht.« Ich meinte Utsch.
Aber er hörte nur Lucias Wahnsinn. »Ich finde, Joan Sutherland bringt diese Partie besser«, sagte er.
»Severin! Wenn diese Russen nicht versucht hätten, die Kuh wegzuschaffen, wäre Utsch dringeblieben.«
[19] »Sie hätte Durst bekommen«, sagte Severin. »Dann wäre sie rausgeklettert.«
»Sie hatte bereits Durst«, sagte ich. »Du kennst sie nicht. Wenn dieser Russe den Stall niedergebrannt hätte, wäre sie geblieben.«
»Sie hätte gerochen, daß der Stall brennt, und hätte zu entkommen versucht.«
»Und wenn sie gerochen hätte, daß die Kuh brät«, sagte ich, »Utsch wäre geblieben, bis sie selber gar gewesen wäre.«
Aber Severin Winter glaubte mir nicht. Was kann man von einem Ringertrainer schon erwarten?
Seine Mutter war Schauspielerin, sein Vater war Maler, sein Trainer sagte, er hätte ein Großer werden können. Vor mehr als zehn Jahren war Severin Winter bei den Big-Ten- Meisterschaften auf der Michigan State University Zweiter in der Klasse bis 71Kilo. Er rang für die University of Iowa, und Zweiter bei den Big Ten war das Höchste, was er bei einem größeren Wettkampf oder einer Landesmeisterschaft je erreichte. Der Mann, der ihn im Finale der Big-Ten-Meisterschaft besiegte, war ein magerer, raffinierter Spezialist für Beingriffe namens Jefferson Jones von der Ohio State; er war ein Schwarzer mit einem knöchelharten Schädel, Handflächen von der Farbe blauer Flecken und einem Paar Knie wie Türknäufe aus Mahagoni. Severin Winter sagte, Jones habe eine Beinklammer so hart ansetzen können, daß man überzeugt gewesen sei, sein Becken habe jene seltsam weit auseinanderstehenden, spitzen Knochen eines Frauenbeckens. Wenn Jones einen mit einem Einsteiger mit Halbnelson – zugewandtes Bein doppelt gehäkelt, abgewandter Arm im Halbnelson – herumgerissen habe, behauptete Severin, habe er einem irgendwo nahe der Wirbelsäule die Blutzirkulation abgeschnitten. Und nicht einmal Jones war gut genug für eine Landesmeisterschaft; er gewann nie eine, obwohl er zwei Jahre hintereinander Meister der Big Ten wurde.
Severin Winter kam einem Landesmeistertitel niemals [20] nahe. In dem Jahr, in dem er Zweiter bei den Big Ten wurde, kam er bei den nationalen Titelkämpfen auf Platz sechs. Er wurde im Halbfinale vom Titelverteidiger von der Oklahoma State geschultert und im zweiten Durchgang der Trostrunde von einem künftigen Geologen von der Colorado School of Mines erneut geschultert. Und beim Kampf um den fünften Platz verlor er gegen Jefferson Jones von der Ohio State wiederum eindeutig nach Punkten.
Ich verbrachte einmal einige Zeit mit dem Versuch, mit den Ringern zu sprechen, die Severin Winter besiegt hatten; mit einer Ausnahme erinnerte sich keiner von ihnen daran, wer er war. »Na ja, man erinnert sich nicht an jeden, den man besiegt hat, aber man erinnert sich an jeden, der einen selbst besiegt hat«, sagte Winter gern. Doch ich stellte fest, daß Jefferson Jones, Ringertrainer an einer High-School in Cleveland, sich sehr gut an Severin Winter erinnerte. Insgesamt hatte Winter in einem Zeitraum von drei Jahren fünfmal gegen Jefferson Jones gerungen; Jones hatte ihn jedesmal besiegt.
»Der Junge ist einfach nicht an mich rangekommen, wissen Sie«, sagte Jones zu mir. »Aber er war einer von denen, die ständig angriffen. Er griff einen einfach ständig an, wenn Sie wissen, was ich meine. Man drückte ihn in die Bauchlage, und er strampelte sich ab wie ein steifer alter Hund, um wieder auf Hände und Knie zu kommen. Man drückte ihn einfach wieder in die Bauchlage, und er kam wieder hoch. Er griff einfach ständig an, und ich hab einfach ständig die Punkte gemacht.«
»Ja, aber war er denn überhaupt gut?« fragte ich.
»Na ja, er hat mehr gewonnen als verloren«, sagte Jones. »Bloß an mich ist er nicht rangekommen.«
Ich spürte bei Jefferson Jones eine Einstellung, die Severin häufig auf mich ausstrahlte. Das Ego eines Ringers scheint noch lange, nachdem er für seine Gewichtsklasse zu schwer geworden ist, in Form zu bleiben. Vielleicht neigen sie wegen ihrer früheren Gewichtmacherei zu Übertreibungen. So ist es [21] beispielsweise irreführend, Winter die Heldentaten seiner Vorfahren schildern zu hören.
Seine Mutter war die Wiener Schauspielerin Katrina Marek. Soweit stimmt seine Geschichte. Katrina Mareks letzte Vorstellung im Ateliertheater in Wien fand am Donnerstagabend, den 10.März 1938 statt. Die Zeitungen behaupteten, sie sei eine »verblüffende« Antigone gewesen, was zu dieser Zeit eine passende Rolle für sie gewesen zu sein scheint; sie dürfte als Kostüm weite Gewänder benötigt haben, denn sie war im achten Monat mit Severin schwanger. Die Freitagsvorstellung wurde wegen ihres Nichterscheinens abgesagt. Das wäre dann der schwarze Freitag, der 11.März 1938, gewesen, der Tag, an dem der Anschluß beschlossen wurde, der Tag, bevor die Deutschen in Österreich einmarschierten. Katrina Marek erfuhr die Neuigkeit frühzeitig und brachte sich und ihren Fötus rechtzeitig außer Landes.
Sie nahm ein Taxi. Anscheinend stimmt sogar so viel von Winters Geschichte. Sie nahm tatsächlich ein Taxi – sie, ihr Fötus und eine Mappe mit Zeichnungen und Gemälden ihres Mannes. Die Gemälde, Öl auf Leinwand, waren von den Keilrahmen abgenommen und zusammengerollt worden.
Severins Vater, der Künstler, kam nicht mit. Er gab Katrina die Zeichnungen und Gemälde und sagte ihr, sie solle bis zur Schweizer Grenze das Taxi nehmen, einen Zug nach Belgien oder Frankreich nehmen, ein Schiff nach England nehmen, nach London gehen, die zwei oder drei Maler in London ausfindig machen, die seine Arbeit kannten, sie bitten, in London ein Theater ausfindig zu machen, das die österreichische Schauspielerin Katrina Marek engagieren würde, und jedem, der einen Beweis verlangte, wer sie sei, die Zeichnungen und zusammengerollten Leinwände zeigen. Sie sollte sagen: »Ich bin Katrina Marek, die Schauspielerin. Mein Mann ist der Wiener Maler Kurt Winter. Ich bin ebenfalls Wienerin. Sehen Sie, ich bin schwanger…« Aber [22] das konnte zweifellos jeder sehen, selbst wenn sie als Antigone kostümiert war.
»Krieg bloß das Baby nicht, ehe du in London bist«, sagte Kurt zu Katrina. »Du wirst keine Zeit haben, ihm einen Paß zu besorgen.« Dann küßte er sie zum Abschied, und sie fuhr am schwarzen Freitag, dem Tag, bevor die Deutschen einfuhren, aus Wien hinaus.
Unglaublicherweise erfaßte die erste Verhaftungswelle der Gestapo allein in Wien sechsundsiebzigtausend Menschen. (Da stiegen Katrina Marek und der ungeborene Severin Winter gerade in St.Gallen in einen Zug nach Ostende.) Und der Vater, der zurückblieb? Laut Severin blieb sein Vater zurück, weil er sich der Revolution verschrieben hatte, weil es immer noch etwas gab, was ein Held tun konnte. Beispielsweise fuhr jemand den wagemutigen, kriminellen Zeitungsverleger Lennhoff bei Kittsee über die ungarische Grenze – nachdem er von den Tschechen abgewiesen worden war. Wieder wurde ein Taxi benutzt. Kurt Winter hätte Lennhoffs Leitartikel über den deutschen Putsch noch zur Mittagszeit lesen und trotzdem ungestraft davonkommen können; Hitler war zur Mittagszeit erst in Linz. »Das war ganz schön knapp«, hat Severin Winter zugegeben. Das erste Mal, als er die Geschichte erzählte, hörte es sich so an, als sei sein Vater der Fahrer des Taxis gewesen, das Lennhoff nach Ungarn fuhr. Später wurde das verworren. »Nun ja, er hätte der Fahrer sein können«, sagte Winter. »Ich meine, er brauchte einen gewichtigen Grund, um zurückzubleiben, oder?«
Und dann die Sache mit dem Tiergarten. Da habe ich die Fakten überprüft, und sie ist zumindest belegt. 1945, kurz bevor die Russen Wien erreichten, wurde der gesamte Tiergarten aufgegessen. Natürlich waren, als die Menschen hungriger wurden, hier und da schon kleine Gruppen von Plünderern, zumeist nachts, mit einer Antilope oder einem Zebra entwischt. Wenn die Menschen am Verhungern sind, ist es [23] irgendwo albern, all dieses Wild zu versorgen. Doch die Reservisten der Armee waren in dem großen, weitläufigen Tier- und botanischen Garten auf dem Gelände von Schloß Schönbrunn Tag und Nacht auf Wache. Winter hat angedeutet, die Reservisten hätten den armen Menschen die Tiere als Rationen zugeteilt, immer eins aufs Mal – eine Art Schwarzmarkt-Zoo, ihm zufolge. Aber dann wird die Geschichte zweifelhaft. Spät in der Nacht des 1.April 1945, zwölf Tage bevor die Sowjets Wien einnahmen, versuchte irgendein Schwachkopf, alle Tiere herauszulassen.
»Mein Vater«, sagte Winter einmal, »liebte Tiere und war genau die richtige Sorte Pfundskerl für den Job. Er war ein glühender Antifaschist, und es muß seine letzte Tat für den Untergrund gewesen sein…«
Denn natürlich wurde der arme Schwachkopf, der diese Tiere herausließ, sofort aufgefressen. Schließlich waren die Tiere auch hungrig. Die befreiten Tiere brüllten so laut, daß die hungrigen Kinder aufwachten. Der Zeitpunkt war so gut wie jeder andere, um das letzte Vieh in Wien zu schlachten; die Sowjets waren schon in Budapest. Welcher vernünftige Mensch würde der russischen Armee einen Zoo voller Essen überlassen?
»Und so ging der Plan in die Hose«, hat Winter gesagt. »Anstatt sie freizulassen, brachte er sie um, und sie fraßen ihn zum Dank dafür auf.«
Nun ja, falls ein solcher Plan je existiert hat und falls Winters Vater mit dieser Zoopleite überhaupt mehr zu tun hatte als mit Lennhoffs Flucht. Falls er zurückblieb, warum dann nicht Heldentum als Grund angeben?
Utsch sagt, sie könne Severins Regung nachempfinden. Das glaube ich gern! Ich habe mir einmal meine eigenen Gedanken über Utschs und Severins ähnliche Vorfahren gemacht. Was, wenn Utschs Vater, der Saboteur von Messerschmitts in Wiener Neustadt, es mit zweien getrieben und ein Doppelleben geführt hätte? Was, wenn er in Wien, wo er den flotten, [24] jungen Künstler mimte, diese junge Schauspielerin angebufft, mit einem Haufen Zeichnungen und Gemälde eine Vaterschaftsklage abgebogen, die Messerschmitts in die Luft gejagt hätte, gefaßt, aber nicht umgebracht worden wäre (er entkam irgendwie), keine Lust gehabt hätte, zu einer vergewaltigten Frau nach Eichbüchls zurückzukehren, sich am 1.April 1945 besonders schuldig gefühlt und versucht hätte, mit der Befreiung des Tiergartens seine Sünden zu sühnen?
Sie sehen, wir Verfasser historischer Romane müssen uns für das, was hätte geschehen können, ebensosehr interessieren wie für das, was geschehen ist. Meine Version würde Severin Winter und Utsch zu Verwandten machen, was Teile ihrer späteren Verbindung erklären würde, die für mich merkwürdig bleiben. Aber manchmal beruhigt mich der Gedanke, daß sie einfach ihre Kriegsgeschichten gemeinsam hatten. Zwei Schwergewichtler aus Mitteleuropa mit ihrer gebündelten Wurstigkeit! Wenn Utsch ärgerlich war, reduzierte sie die Welt gern auf einen Orgasmus. Severin Winter traute der Welt selten viel mehr zu. Aber wenn ich es mir überlege, hatten sie mehr als einen Krieg gemeinsam.
So sind beispielsweise diese zusammengerollten Leinwände und Zeichnungen, die Kurt Winter Katrina Marek gab, sehr verräterisch. Den ganzen Weg nach England über sah sie sie nicht ein einziges Mal an, doch am britischen Zoll war sie verpflichtet, die Mappe zu öffnen. Es waren alles Akte von Katrina Marek, und es waren alles erotische Akte. Das überraschte Katrina ebensosehr, wie es den Zollbeamten überraschte, denn Kurt Winter war an Akten oder irgendeiner anderen Form von erotischer Kunst nicht interessiert. Am bekanntesten war er durch ziemlich regenbogenfarbige Koloristenarbeiten und durch einige erfolglose Variationen von Schiele und Klimt, zwei österreichischen Malern, die er zu sehr nachahmte und bewunderte.
Katrina stand verlegen am Zollschalter, während ein interessierter Zollbeamter eingehend jede Zeichnung und jedes [25] Gemälde in der Mappe ihres Mannes betrachtete. Sie war hochschwanger und sah vermutlich sehr mitgenommen aus, aber der Zollbeamte, der sie (für eine der Zeichnungen als Bestechungsgeld) gnädig nach England hereinließ, sah sie wahrscheinlich mehr, wie Kurt Winter sie gesehen hatte – weder schwanger noch angegriffen.
Und von den Malern, die Katrina helfen sollten, in London Arbeit als Schauspielerin zu finden, wurde natürlich nicht erwartet, daß sie sich verpflichtet fühlten, diesen Dienst aus Achtung für die Kunst von Kurt Winter zu leisten. Er schickte keine Kunst nach England; er schickte eine österreichische Schauspielerin mit kümmerlichem Englisch, schwanger, anmutslos und verschreckt, in ein englischsprachiges Land, wo es niemand gab, der sich um sie kümmerte. Was er ihr in der Mappe mitgab, war Reklame für sie selbst.
Maler und Galeriedirektoren und Theaterintendanten sagten zu Katrina: »Äh, Sie sind hier das Modell, nicht wahr?«
»Ich bin die Frau des Malers«, sagte sie dann. »Ich bin Schauspielerin.«
Und sie sagten: »Ja, aber auf diesen Gemälden und Zeichnungen, da sind sie das Modell, richtig?«
»Ja.«
Und trotz ihres Neunmonateumfangs, der Severin Winter war, sahen sie sie anerkennend an. Man kümmerte sich gut um sie.
Severin wurde im April 1938 in einem guten Krankenhaus in London geboren. Ich war auf der Party zu seinem fünfunddreißigsten Geburtstag und hörte zufällig, wie er Utsch, als er völlig betrunken war, erzählte: »Mein Vater war ein miserabler Maler, wenn du’s genau wissen willst. Aber in anderer Hinsicht war er ein Genie. Außerdem wußte er, daß meine Mutter eine miserable Schauspielerin war, und er wußte, wir würden in London alle verhungern, wenn wir zusammen dort hingingen. Also setzte er meine Mutter ins beste Licht, [26] in dem er sie sich vorstellen konnte, und entfernte sich aus dem Gesamtbild. Und es war auch ihr bestes Licht«, sagte er zu Utsch. Er legte die Handfläche flach auf Utschs Bauch, ein Stückchen unter dem Nabel. Er war betrunkener, als ich ihn je gesehen hatte. »Und es ist bei uns allen das beste Licht, wenn du’s genau wissen willst.« Damals war ich erstaunt, daß Utsch ihm beizupflichten schien.
Severins Frau Edith hätte ihm nicht beigepflichtet. Sie hatte zartere Knochen. Sie war die schickste Frau, die ich je gekannt habe. Sie – und was man sich von ihr vorstellte – hatte so viel natürlichen, guten Geschmack, daß es stets ein Schock war, Severin neben ihr zu sehen, der wie ein tapsiger, schlecht dressierter Bär neben einer Tänzerin aussah. Edith war eine ungezwungene, hochgewachsene, anmutige Frau mit sinnlichem Mund und den überzeugendsten, reifsten Bewegungen in ihren knabenhaften Hüften und langfingrigen Händen; sie hatte schlanke, seidige Beine, war so klein- und hochbrüstig wie ein junges Mädchen und ebenso achtlos mit ihrem Haar. Sie trug alle ihre Kleider so lässig, daß man sie sich darin schlafend vorstellen konnte, bloß daß man sich lieber erst gar nicht vorstellte, sie schliefe in irgendwelchen Kleidern. Als ich sie kennenlernte, war sie fast dreißig – seit acht Jahren die Frau von Severin Winter, der seine Kleider so trug, als seien sie alle härene Hemden von der falschen Größe; ein Mann, dessen Kleinheit einen wegen seiner Breite oder dessen Breite einen wegen seiner Kleinheit verblüffte. Er war ein Meter siebzig groß und vielleicht neun Kilo über seiner früheren 71-Kilo-Gewichtsklasse. Seine Rücken- und Brustmuskeln wirkten wie in Platten übereinandergeschichtet. Seine Oberarme schienen dicker zu sein als Ediths herrliche Oberschenkel. Sein Hals war eine Belastungsprobe für das bestgemachte Hemd der Welt. Er kämpfte gegen einen kleinen, fast unmerklichen Bauch, in den ich ihn gern knuffte, weil er ihm so bewußt war. Er fühlte sich so stramm und zähledrig an wie ein Football. Er hatte einen wuchtigen, [27] helmförmigen Kopf mit einer dichten, dunkelbraunen Haarmatte, die auf seinem Kopf saß wie die Strickmütze eines Skifahrers und wie eine geschorene Mähne knapp über die Ohren quoll. Er hatte ein Blumenkohlohr, und das verbarg er gern. Er hatte ein keckes Jungenlächeln, einen kräftigen Mund mit weißen Zähnen, darunter einen eigenartigen, schiefgeschlagenen unteren Zahn – aus dem, fast bis aufs Zahnfleisch, ein keilförmiger Splitter herausgebrochen war. Seine Augen waren groß und braun und standen weit auseinander, und auf seinem Nasenrücken war ein Knubbel, der nur auffiel, wenn man links von ihm saß, und, wo seine Nase ein weiteres Mal gebrochen gewesen war, eine Delle, die man nur sah, wenn man ihn direkt von vorn anblickte.
Er sah nicht nur wie ein Ringer aus, sondern das Ringen war für ihn eine ständige Metapher – häufig eine gemischte, da er sowohl romantisch als auch praktisch veranlagt war. Seine Gebärden waren die eines dressierten Wilden; er war grob und ritterlich; er hielt viel auf Würde, wirkte aber oft lächerlich fehl am Platze. Bei unseren Fakultätskonferenzen stand er im Ruf zweisprachiger Beredsamkeit, einer streitbaren Überzeugung, daß das Bildungswesen den Dilettanten und »Gegenwartsaposteln« anheimfalle, des Grundsatzes, daß die »Kenntnis der elenden Vergangenheit« unerläßlich sei und daß für jeden Graduierten eines College mindestens drei Jahre einer Fremdsprache obligatorisch sein sollten. (Er war Dozent für Deutsch.) Selbstredend stichelte man gegen ihn, aber man stichelte vorsichtig. Er war ein zu athletischer Debattierer, als daß man ihn leichtfertig provozierte; er hatte den Sarkasmus zu schmerzhafter Schärfe entwickelt und besaß die zweifelhafte Fähigkeit, in einer Welt (wie dem akademischen Ausschuß), wo Weitschweifigkeit eine Tugend ist, jedermann totzureden. Außerdem war es trotz seiner Zugehörigkeit zur Deutschen Abteilung wohlbekannt, daß er der Ringertrainer war. In der Hinsicht war er geradezu stur, besonders Fremden gegenüber. Wenn er [28] vorgestellt wurde, gab er nie zu, daß er an der Deutschen Abteilung lehrte.
»Sind Sie an der Universität?«
»Ja, ich trainiere die Ringer«, pflegte Severin Winter zu sagen. Einmal sah ich Edith zusammenzucken.
Aber er schüchterte nie durch körperliche Gewalt ein. Auf einer Party für neue Fakultätsmitglieder hatte er Streit mit einem Bildhauer, der einen kräftigen Flaken in Winters irreführenden Football von einem Bauch schlug. Obwohl der Bildhauer einen Kopf größer war als Winter und fünf Kilo schwerer, ließ sein Schlag seinen Arm abprallen wie Totgewicht von einem Trampolin. Winter rührte sich kein bißchen. »Nein, nein«, sagte er ungeduldig zu dem Bildhauer. »Sie müssen Ihre Schulter in den Schlag legen, Ihr Gewicht von den Fersen wegverlagern…« Es gab keine Andeutung von Vergeltung; er spielte den Trainer, eine harmlose Rolle.
Sein Beharren auf dem Sportleben – mit dem er mehr als ein paar Freunde langweilte – ließ mich einmal argwöhnen, er sei überhaupt nie ein guter Ringer gewesen, und als man mich daher bat, an der University of Iowa über den historischen Roman zu lesen, dachte ich mir, ich könnte ja einmal Winters früheren Trainer aufsuchen. Ich hatte plötzlich die Vorstellung, Jefferson Jones von der Ohio State könnte einen Gegner, den er in fünf Kämpfen fünfmal besiegt hatte, erfunden haben.
Ich hatte keine Schwierigkeiten, den Trainer zu finden, der als Ruheständler in irgendeinem ehrenamtlichen Job im Sportinstitut herumbiesterte, und fragte ihn, ob er sich an einen 71-Kilo-Mann namens Severin Winter erinnere.
»Ob ich mich an ihn erinnere?« sagte der Trainer. »Doch, der hätte ein Großer werden können. Er hatte alles drauf, und den Willen, und er griff einen ständig an, wenn Sie wissen, was ich meine.«
Ich sagte ja.
»Aber die großen Kämpfe hat er versiebt«, sagte mir der [29] Trainer. »Psychisch hat er eigentlich nicht versagt. Man kann’s nicht als Verkrampfen bezeichnen – das eigentlich nicht. Aber er machte einen Fehler. Er machte nur große Fehler«, befand der Trainer, »und nicht zu viele. Bei den großen Kämpfen ist allerdings ein Fehler genug.«
»Das glaube ich gern«, sagte ich. »Aber in einem Jahr wurde er doch Zweiter bei den Big Ten, in der Klasse bis 71Kilo?«
»Stimmt«, sagte der Trainer. »Aber die Gewichtsklassen haben sich seit damals geändert. Das ist heute nämlich die 72-Kilo-Klasse. Früher waren’s 56, 59, 62, 67, 71 und so weiter, aber heute sind’s 54, 57, 61, 64, 68, 72 und so weiter – wissen Sie.«
Ich wußte es nicht, und es war mir völlig egal. Jeder sagt, das akademische Leben sei ein einziges, langes Gebet ans Detail, aber was ein Leben voller endloser, langweiliger Statistiken angeht, ist der Sport kaum zu übertreffen.
Gelegentlich tadelte ich Winter wegen seiner großen Liebe. »Als ehemaliger 71-Kilo-Mann muß es schön sein, Severin, sich mit einem Gebiet zu beschäftigen, das sich in zehn Jahren um ein Kilo verändert hat.«
»Was ist mit der Geschichte?« sagte er dann. »Um wieviel Kilo hat sich die Zivilisation verändert? Ich würde schätzen, um ungefähr hundert Gramm seit Jesus und ungefähr fünfzehn Gramm seit Marx.«
Winter war ein gebildeter Mann, sein Deutsch war natürlich perfekt, und offensichtlich war er ein guter Lehrer – obwohl einiges dafür spricht, daß Muttersprachler nicht immer die besten Lehrer ihrer Sprache abgeben. Er war ein guter Ringertrainer, aber wie er den Job bekam, war reiner Zufall. Er wurde eingestellt, um Deutsch zu unterrichten, aber er versäumte nie ein Ringertraining und wurde ziemlich rasch inoffizieller Assistent des Cheftrainers, eines klotzigen Schwergewichtlers aus Minnesota, der damals, als Winter für Iowa rang, sowohl Big-Ten- als auch Landesmeister gewesen [30] war. Der Ex-Schwergewichtler starb kurz darauf an einem Herzinfarkt, als er gerade das Ansetzen eines Achselwurfs demonstrierte. (Winter sagte: »Ich fand, er sah so aus, als würde er ihn ganz falsch ansetzen.«) Mitten in der Saison vom Verlust des Trainers überrascht, bat das Sportinstitut Winter, einzuspringen. Er erzählte Edith, es sei sein heimlicher Ehrgeiz gewesen. Seine Mannschaft beendete die Saison so stark, daß er fürs nächste Jahr als Cheftrainer verpflichtet wurde, was ein nur geringes, nie angesprochenes Ärgernis unter den kleinlicheren Angehörigen der Fakultät erregte, die ihm das doppelte Gehalt neideten. Nur seine Feinde in der Abteilung für Sprache und Literatur behaupteten je, Winter widme wegen seiner neuen Arbeitsbelastung seinen Deutschstudenten nicht genügend Zeit. Natürlich wurde diese Verstimmung ihm gegenüber nie geäußert. Tatsächlich stiegen die Einschreibungen in Deutsch sprunghaft an, da Winter von jedem Mitglied der Ringermannschaft verlangte, daß er sein Fach belegte.
Winter behauptete, das Ringen helfe ihm als Deutschlehrer. (Doch er pflegte zu behaupten, es helfe ihm bei allem, was er tue – ja, er behauptete es laut und in unterschiedlicher Gesellschaft, die Hand auf Ediths glattem Hintern, wobei er sie unversehens anschubste und ihren Drink zum Schwappen brachte: »Damit klappt eben alles ein bißchen besser!«)
Ihre Zuneigung zueinander wirkte echt, wenn auch seltsam. An dem ersten Abend, an dem Utsch und ich bei ihnen aßen, fuhren wir sehr von ihnen angetan nach Hause.
»Gott, ich finde, er sieht aus wie ein Troll«, sagte ich zu Utsch.
»Ich glaube, dir gefällt, wie sie aussieht«, sagte Utsch.
»Er ist beinahe grotesk«, sagte ich, »wie ein riesiger Zwerg…«
»Ich kenne dich«, sagte Utsch; sie legte ihre schwere Hand auf meinen Oberschenkel. »Du stehst auf ihre Sorte, auf den Knochen im Gesicht – die Lebensart, würdest du sagen.«
[31] »Er hat fast keinen Hals«, sagte ich.
»Er sieht sehr gut aus.«
»Du findest ihn attraktiv?« fragte ich sie.
»O ja, mehr als das. Und findest du sie auch attraktiv?«
»O ja, mehr als das«, sagte ich. Ihre kräftige Hand drückte mich; wir lachten.
»Weißt du was?« sagte sie. »Er macht die ganze Kocherei.«
Ich würde sagen, daß Severin beim Zubereiten von Essen kein Wilder war – nur beim Essen. Nach dem Essen saßen wir in ihrem Wohnzimmer; ihr Sofa stand im Bogen um einen Kaffeetisch, wo wir Brandy tranken. Winter plünderte immer noch das Obst und den Käse, warf Trauben ein, zersäbelte Birnen – Brocken von Brie auf Brot und Klumpen von Gorgonzola. Er trank weiter seinen Tischwein, um auf seinen Brandy nachzuspülen. Utsch war schläfrig. Sie legte ihren bloßen Fuß auf den Tisch, und Winter ergriff ihn am Knöchel und betrachtete ihre Wade, als sei sie auszubeinendes Fleisch.
»Seht euch dieses Bein an!« rief er. »Seht euch den Umfang der Fessel an, die Breite des Fußes!« Er sagte zu Utsch etwas auf deutsch, das sie zum Lachen brachte; sie war überhaupt nicht böse oder verlegen. »Seht euch diese Wade an. Aus diesem Holz sind Bauern geschnitzt«, sagte Winter. »Das ist der Fuß der Äcker! Das ist der Fuß, der die Armeen hinter sich ließ!« Er sprach weiter deutsch; er billigte eindeutig Utschs stämmigen Körper. Sie war kleiner als er – nur ein Meter fünfundsechzig groß. Sie war rundlich, breithüftig, vollbrüstig, mit einer Wölbung am Bauch und muskulösen Beinen. Utsch hatte ein Hinterteil, auf dem ein Kind sitzen konnte, wenn sie stand, aber sie hatte kein Fett an sich; sie war zäh. Sie hatte jenes breite Gesicht Mitteleuropas: hohe Wangenknochen, ein wuchtiges Kinn und einen breiten Mund mit dünnen Lippen.
Utsch sprach deutsch mit Severin; es war angenehm, ihrem singenden Wiener Dialekt zuzuhören, doch ich [32] wünschte, ich könnte sie verstehen. Als er ihr Bein losließ, ließ sie es auf dem Tisch liegen.
Ich griff zur Kerze und gab Edith Feuer, dann mir selbst. Weder Utsch noch Severin rauchten. »Ich höre, Sie schreiben«, sagte ich zu Edith.
Sie lächelte mich an. Natürlich wußte ich da, woher ihr Lächeln stammte und wohin wir uns alle bewegten. Ich hatte zuvor nur ein ebenso zuversichtliches Lächeln wie Ediths gesehen, und Ediths Lächeln war noch unbekümmerter und verlockender als das auf der Postkarte von dem Engel namens »Das Lächeln von Reims«.
[33] 2.
Kundschafterberichte: Edith (Klasse bis 57Kilo)
Edith Fuller verließ die Prep School in der obersten Klasse, um mit ihren Eltern nach Paris zu gehen. Das waren die New Yorker Fullers, und mit dem Umzug war kein Streit verbunden; Edith freute sich wegzugehen, und ihr Vater sagte, sie solle ihre Zeit nicht mit Bildung vergeuden, wenn sie in Paris leben könne. Sie ging dort auf eine gute Schule, und als ihre Eltern nach New York zurückkehrten, beschloß sie, in Europa herumzureisen. Als sie in die Staaten zurückkehrte, um aufs College zu gehen, zeigte ihre Mutter Enttäuschung darüber, daß Edith »ihre natürliche Schönheit auf unnatürliche Weise unterdrücke, bloß um wie eine Schriftstellerin auszusehen«. Auf dem Sarah Lawrence College sah Edith zwei Jahre lang wie eine Schriftstellerin aus – was die einzige Reiberei mit ihren Eltern verursachte, die es je gab. Tatsächlich sah sie in Wirklichkeit so aus, als reise sie immer noch in Europa herum; daß sie Schriftstellerin war, hatte nichts damit zu tun. Als ihr Vater plötzlich starb, verließ sie das Sarah Lawrence und zog zu ihrer Mutter nach New York. Da sie keinen Grund sah, ihre Mutter noch mehr aufzuregen, nahm sie sich wieder der Pflege ihrer »natürlichen Schönheit« an und stellte fest, daß sie trotzdem noch schreiben konnte.
Edith war dabei behilflich, ihrer Mutter einen Job zu finden – nicht daß irgendeiner von den New Yorker Fullers je einen Job gebraucht hätte, aber ihre Mutter brauchte etwas zu tun. Einer von Ediths Freunden leitete die Abteilung für Neuerwerbungen des Museum of Modern Art, und da sowohl Edith als auch ihre Mutter Möchtegern-Hauptfächler in Kunstgeschichte gewesen waren (keine von ihnen schloß je [34] das College ab) und es in der Abteilung für Neuerwerbungen interessante ehrenamtliche Arbeit gab, ließ sich die Sache ohne weiteres einrichten.
Alle Freunde von Edith hatten interessante Jobs der einen oder anderen Art. Sie hatte sich nie mit College-Studenten verabredet, als sie auf dem College war; sie gefiel und fand Gefallen an älteren Männern. Der Freund vom Modern war damals vierunddreißig; Edith war einundzwanzig.
Sie verbrachte sechs Monate in New York und leistete ihrer Mutter Gesellschaft. Eines Abends forderte sie sie auf, sich mit ihr einen Film anzusehen, aber ihre Mutter sagte: »Ach, ich kann beim besten Willen nicht, Edith. Ich habe viel zuviel zu tun.« So fühlte Edith sich berechtigt, nach Europa zurückzukehren.
»Bitte glaub nicht, du müßtest wie eine Schriftstellerin aussehen, Liebes«, sagte ihre Mutter zu ihr, aber darüber war Edith hinaus. In Paris hatten die Fullers von ihrem Europajahr-Aufenthalt noch Freunde; sie konnte ein Zimmer in jemandes schönem Haus haben; sie konnte schreiben; und nachts gäbe es interessante Dinge zu unternehmen. Sie war ein ernsthaftes junges Mädchen, das nie jemandem Sorgen gemacht hatte, sie ließ in Amerika keinen ernsthaften Freund zurück, und sie eilte nicht nach Europa, um einen kennenzulernen. Sie hatte nie einen ernsthaften Freund gehabt, und obwohl sie, wie sie mir später erzählte, tatsächlich gedacht hatte – im Hinterkopf, als sie New York verließ –, es sei vielleicht an der Zeit, »die Erfahrung zu machen, sich wirklich in jemanden zu verlieben«, wollte sie zuerst mit ihrer Schreiberei ein gutes Stück vorwärtskommen. Sie gab zu, daß sie keine Ahnung gehabt habe, wohin diese Schreiberei führen würde, ebensowenig wie sie sich »groß damit abgab, mir vorzustellen, wie dieser erste, wirkliche Liebhaber sein würde«. Sie hatte zuvor erst mit zwei Männern geschlafen, einer davon war der Mann, der beim Modern war. »Ich habe es nicht getan, um Mami den Job zu verschaffen«, erzählte mir Edith. »Sie hätte den Job [35] von ganz allein gekriegt.« Er war verheiratet, er hatte zwei Kinder, und er sagte zu Edith, er wolle wegen ihr seine Frau verlassen. Edith hörte auf, mit ihm zu schlafen; sie wollte nicht, daß er seine Frau verließ.
In Paris brauchte sie einen Tag, bis man sie auch schon einlud, das üppige Gästezimmer und Studio im Hause eines der Pariser Freunde ihrer Eltern so lange zu benutzen, wie sie Lust hatte zu bleiben. Bei ihrem ersten Einkaufsbummel kaufte sie sich eine luxuriöse Schreibmaschine mit französisch-englischer Tastatur. Sie sah zwar nicht wie eine Schriftstellerin aus, aber es war ihr mit einundzwanzig immerhin schon so ernst.
Anfangs verbrachte sie eine Menge Zeit damit, die Briefe ihrer Mutter zu beantworten. Ihre Mutter war begeistert von all den Forschungsprojekten, die man ihr übertrug. Sie war dafür zuständig, »abzurunden«, was die Sammlung »Moderne Richtungen« genannt wurde. Das Museum of Modern Art besaß die meisten bedeutenden Vertreter jeder bedeutenden und unbedeutenden Richtung des zwanzigsten Jahrhunderts, aber es fehlten ihm noch einige unbedeutende Maler, und Ediths Mutter suchte verfügbare Gemälde unbedeutender Künstler mehr oder weniger bedeutender Schulen. Edith hatte von keinem der Maler, von denen ihre Mutter so gefesselt war, je gehört. »Aber ich empfand meine eigene Schriftstellerei als so unbedeutend«, erzählte sie mir, »daß ich so etwas wie rührseliges Mitgefühl für alle diese Unbekannten hatte.«
Wir müssen ähnliche Eltern gehabt haben. Meine Mutter begann gleichzeitig mit der Veröffentlichung meines ersten historischen Romans ein brennendes Interesse für unbedeutende Romanliteratur zu entwickeln. Die meisten historischen Romane sind natürlich ziemlich schlecht, aber meine Mutter fühlte sich gezwungen, sich in meinem Gebiet »auf dem laufenden zu halten«. Ich hatte noch nie irgendwelche [36]