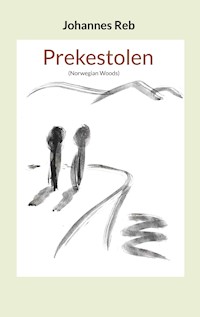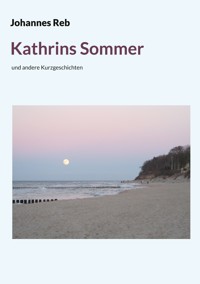Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Sprache: Deutsch
Inhalt: Genua 1515 - der Kaufmann Giovanni Starna verzweifelt bei seiner Geliebten Barbara über das Elend seines behinderten Kindes, einem "Teufelskind". Der Barbara steht als heilkundiger Frau das Schicksal der Hexenverfolgung bevor, aber zuvor sieht sie die Zukunft der Geburtsmedizin und der Starna-Ärzte durch Aufklärung und Wissenschaft voraus Wesel/Rhein 1939 - der Chefarzt des städtischen Krankenhauses, Heribert Starna, ist als Mitglied der SS und der NSDAP überzeugt von der Erbgesundheitslehre und der Neuen Deutschen Heilkunde. Als er aber eine junge, an Epilepsie leidende Patientin auf den Weg in eine Tötungsanstalt überweist kommen ihm Zweifel. Seinen Weg überlässt er dem Schicksal.. Lauenburg/Elbe 2060 - der alt gewordene Allgemeinarzt Alexander Starna sitzt am Sterbebett seines vertrauten Patienten und blickt auf sein Arztleben zurück. Die Bilanz fällt zwiespältig aus, und doch erfüllt ihn Dankbarkeit und Demut. Die Starna-Ärzte stehen in diesen 500 Jahren in den Strömungen und Widersprüchen ihrer Zeit, suchen nach heilsamen Wissen und Handeln - und scheitern nicht selten, persönlich und beruflich. Bis der "letzte Starna" eine innere Verbindung mit der Weisheit der heilkundigen Ur-Ahnin spüren kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch
Inhalt:
Genua 1515 - der Kaufmann Giovanni Starna verzweifelt bei seiner Geliebten Barbara über das Elend seines behinderten Kindes, einem "Teufelskind". Der Barbara steht als heilkundiger Frau das Schicksal der Hexenverfolgung bevor, aber zuvor sieht sie die Zukunft der Geburtsmedizin und der Starna-Ärzte durch Aufklärung und Wissenschaft voraus.
Wesel/Rhein 1939 - der Chefarzt des städtischen Krankenhauses, Heribert Starna, ist als Mitglied der SS und der NSDAP überzeugt von der Erbgesundheitslehre und der Neuen Deutschen Heilkunde. Als er aber eine junge, an Epilepsie leidende Patientin auf den Weg in eine Tötungsanstalt überweist kommen ihm Zweifel. Seinen Weg überlässt er dem Schicksal.
Lauenburg/Elbe 2060 - der alt gewordene Allgemeinarzt Alexander Starna sitzt am Sterbebett seines vertrauten Patienten und blickt auf die moderne, technischunpersönliche Medizin und sein eigenes Arztleben zurück. Die Bilanz fällt zwiespältig aus, und doch erfüllt ihn Dankbarkeit und Demut.
Die Starna-Ärzte stehen in diesen 500 Jahren in den Strömungen und Widersprüchen ihrer Zeit. Sie suchen nach heilsamen Wissen und Handeln - und scheitern nicht selten, persönlich und beruflich. Bis der "letzte Starna" eine innere Verbindung mit der Weisheit der heilkundigen Ur-Ahnin spüren kann.
Über den Autor:
Unter dem Pseudonym Johannes Reb schreibt der Autor Romane, Gedichte, Kurzgeschichten und Essays. 2010 ist sein Roman "Norwegian Woods" erschienen. Im wirklichen Leben ist er als Arzt und Psychotherapeut tätig. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder und ein Enkelkind.
Einige Aspekte aus "Der letzte Starna" gehen auf Anregungen und Geschichten seiner weiteren Familiengeschichte zurück, ohne dass im Konkreten einzelne Ereignisse und Persönlichkeiten identifizierbar wären.
Den Vorfahren in Dankbarkeit, den Nachkommen in Zuversicht
Widmung
Dieses Buch ist drei Arzt-Philosophen und Medizinhistorikern gewidmet, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Prof. Dietrich von Engelhardt, Prof. Gerhard Baader (+ 2021) und Prof. Klaus Dörner (+ 2022). Die Begegnungen und Gespräche mit ihnen – mal lang und begleitend, mal kurz und klar – haben meine Beschäftigung mit dem Arztsein wesentlich geprägt und beeinflusst. Dieses Buch würde es ohne sie nicht geben. Danke.
Johannes Reb
Inhalt
Intro: SCHÖPFUNG
0.1 Mitteilung aus dem Off: Wie alles begann
0.2 Traum
Buch I: AUFKLÄRUNG
1.0 Einführung
1.1 Genua 1515 (Giovanni Starna und Barbara)
1.2 Genua 1535 (Giovanni und Antonio Starna)
1.3 Ala am Gardasee 1660 (Luigi Starna)
1.4 Halle/Saale 1680 – 1860 (Antonio, Martin, Anton Starna)
1.5 Halle/Saale 1852 (Anton Ludwig Martin und Karl August Starna)
1.6 Greifswald in Pommern 1870 (Karl August Starna)
1.7 Greifswald 1870 (Karl August Starna)
1.8 Frankfurt an der Oder 1922 (Ludger Starna)
1.9 Frankfurt/Oder - Berlin 1925 (Ludger und Heribert Starna)
Buch II: FINSTERNIS
2.0 Einführung
2.1 Stettin 1930 (Johann-Wilhelm Starna und sein Sohn Heribert)
2.2 Berlin 1933 (Johannes und Heribert Starna)
2.3 Wesel/Rhein 1938 (Heribert Starna)
2.4 Wesel 1938 (Heribert Starna und Patient Heinrich W.)
2.5 Wesel 1938 (Heribert Starna und Patientin Gerda K.)
2.6 Wesel 1939 (Heribert Starna und Patientin Sabine Bersch)
2.7 Brandenburg 1941 (Heribert Starna)
2.8 Brandenburg 1.3.1942 (Heribert Starna)
2.9 Landstraße in Werder (Heribert Starna)
2.10 Polen 1939 (Johannes Starna)
2.11 Irgendwo in Norddeutschland 1945 (Johannes Starna)
Buch III: NEBEL
3.0 Einführung
3.1 Braunschweig 1959 (Geburt Joachim Starna)
3.2 Wahndorf/Eifel 1967 (Wilhelm und Joachim Starna)
3.3 4 Zwischenstücke
3.4 Wahndorf/Eifel 2000 (Wilhelm und Joachim Starna}
3.5 Lauenburg 2006 (Alexander, 11 Jahre)
3.6 Lauenburg 2015 (Joachim Starna)
3.7 Lauenburg 2017 (Joachim Starna)
3.8 Hamburg 2018 (Joachim Starna und Familie Schmeden)
3.9 Lauenburg 2020 (Alexander Starna mit seinem Vater Joachim)
3.10 Göttingen 2021 (Alexander, 26 Jahre)
3.11 Lauenburg 2028 (Alexander Starna und Johann Roth)
3.12 Lauenburg 2032 (Alexander Starna und Johann Roth)
3.13 Postkarten von Sabine an Alexander 2023-2033
3.14 Lauenburg 2060 (Alexander Starna)
Anmerkungen
Intro: SCHÖPFUNG
0.1 Mitteilung aus dem Off: Wie alles begann
Alles dunkel. Schwärze. Völlige Lichtlosigkeit überall. SieEr: Ein körper- und gefühlloses Etwas. Kein Bewusstsein. Doch:
Bewusstsein von Bewusstlosigkeit. Keine physikalischen Koordinaten. Kein Gewicht und keine Schwerelosigkeit. Alles beherrschende Indifferenz und Chaos. Schöpfung vor der Schöpfung. Nur Gott, einsam und traurig. Und ebenso lichtlos. Er sprach: Es werde Licht, aber es funktionierte nicht. Das Wort war nicht klar genug. Das Chaos verstand nicht, es wusste nicht, was Licht sein sollte. Es verstand nichts außer sich selbst und seine Geliebte, die Indifferenz. Am Anfang herrschten Chaos und Indifferenz über die Welt, und Gott hatte keine Chance bei ihnen, er konnte nichts ausrichten. Schließlich gaben Chaos und Indifferenz ein wenig nach, sie hatten Mitleid mit Gott, denn sie merkten, dass er es gut meinte.
Chaos: „Na gut, lass ihn ein wenig von seiner Ordnung zulassen, er wird schon wissen, wie das geht, er soll halt gucken, dass er nichts kaputt macht“.
Und Gott freute sich und schuf die bekannten Phänomene, die man überall nachlesen kann, in sieben Tagen. Chaos und Indifferenz waren einverstanden, sie fanden es lustig, sich in all den Dingen, die Gott geschaffen hatte, einzunisten. ErSie wurde auch erschaffen, teilte sich in zwei Geschlechter auf und nannte sich Mensch, ging aufrecht und erfand alle möglichen Dinge, unter anderem Krieg und Verhütungsmittel und klimaschädliche Gase, auch Schönes wie Blasinstrumente und Kinofilme. Nur mit dem Licht, das war den beiden Alten eher zu grell, das störte sie. Eines schönen Tages, sie wollten sich gerade zu einem netten Schäferstündchen zurückziehen, leuchtet Gott doch tatsächlich mit seinem Licht mitten auf sie drauf und begann, eine kleine Predigt zu halten, Sünden des Fleisches und so, sie verstanden zwar, dass er nur übte, weil das eine Rede an die Menschen werden sollte, nicht an sie, aber es nervte sie trotzdem. Indifferenz wurde richtig wütend, was bei ihr wirklich selten vorkommt, aber so ist das dann, wenn man sich selbst vergisst, dann ist sogar die Indifferenz höchstpersönlich nicht mehr indifferent, sondern auf höchst klare Art und Weise empört. In ihrer Wut darüber, durch dieses lästige Licht so bloß gestellt worden zu sein, entschied sie, dass von nun an Schluss sein sollte mit dem Unfug.
Erstmal passierte daraufhin nichts. Erst nach einer ganzen Weile merkte ErSie, dass seine Umgebung ihre Konturen verlor. Und Gott konnte auch nicht mehr so klar auf seine Spielzeuglandschaft schauen, wie er das gewohnt war. Er wollte sich schon beschweren, aber ein sehr, sehr strenger Blick von Chaos hielt ihn doch zurück. Und so breitete sich der Nebel in der Welt aus und hüllte alles ein.
SieEr fand sich in dem Nebel nicht mehr zurecht, dauernd stieß er irgendwo an und tat sich die Füße weh. Sie beschwerte sich bei Gott darüber und verlangte, dass er sich um die gute Ordnung kümmern müsse, schließlich habe er sieihn auch geschaffen. Gott war inzwischen auch ein wenig in die Jahre gekommen und nicht mehr ganz so kreativ wie zu Beginn. Er war sogar rechtschaffen müde geworden, zumal er zugeben musste, dass er sich auch immer wieder schmerzhaft die Füße gestoßen hatte und selbst keine Lust mehr hatte, sich darum zu kümmern. Aber da Gott natürlich unendlich weise war und ist, hat er einfach den Nebel zu einer Herausforderung erklärt, die es zu bewältigen gälte, zu einer zu lösenden Aufgabe anstelle einer abzuschaffenden Lästigkeit.
Chaos und Indifferenz schmunzelten vor sich hin und flüstern: Ist er nicht wunderbar, unser Gott? Wie die Eltern! Und zwinkerten sich zu. Und so blieb es beim Alten. Überwiegend musste ErSie im Nebel wandeln. Manchmal knipste Gott das Licht an, wenn Chaos und Indifferenz gerade nicht hinschauten (was oft genug vorkam, es war ihnen letztlich ja auch nicht soo wichtig), aber oft merkte SieEr das gar nicht rechtzeitig. Es war verwirrend. Es kam auch vor, das ErSie im Nebel ein Licht zu erkennen glaubte, was zur Orientierung dienen sollte, und es war nur ein Irrlicht. Schließlich fing SieEr an, Bücher über das Leben und die Existenz und die Gottesvermutung zu schreiben. ErSie hoffte, durch das Schreiben einen Weg aus der Verwirrung zu finden und sich im Dasein orientieren zu können. Aber es wurden so viele Bücher und sie waren so unterschiedlich und führten zu völlig verschiedenen Lehren und Schulen innerhalb der Nachkommen von SieEr, das es im Grunde zur klammheimlichen Freude von Chaos und Indifferenz nur zur Verstärkung des allumfassenden Nebels beitrug. Es gab einfach keine Orientierung mehr. Gott legte zwar weiterhin seine Spuren und setzte Zeichen, wo er nur konnte, um auf das Licht hinzuweisen, aber es war zu spät. Der Nebel und die Orientierungslosigkeit darin wurden zur allumfassenden und grundlegenden Existenzbedingung der Menschheit.
0.2 Traum
Das Schlimmste war – nein, ob es schlimm war oder einfach nur erstaunlich, erschreckend oder beeindruckend, spielte gar keine so rechte Rolle, das waren spätere Zuschreibungen und Kommentare, die ja bekanntermaßen und unausweichlich alles, was geschieht, beeinflussen und verändern, weil man nicht beschreiben kann, ohne zuzuschreiben – also das merkwürdige und herausragende unter all den Merkwürdigkeiten war, dass „er“ kein Geschlecht hatte. Auch falsch, wieder nein, natürlich hatte er im Wortsinne von natürlich „Geschlecht“, aber es gab keine Ordnung, in die dieses Phänomen von Geschlechtlichkeit, das „er“ an sich wahrnahm bzw. das „er“ wahrzunehmen suchte, hätte eingeordnet werden können, und das nahm seine Aufmerksamkeit für eine Weile voll in Anspruch. Eine große, alles überflutende Welle von Irritation und Orientierungslosigkeit breitete sich in „ihm“ aus, wie eine Schockwelle, die ihren Ursprung in einer elementaren tektonischen Verschiebung mit Freisetzung von vorher in irgendeiner Art von Festigkeit gebundener Energie hatte, die nun irgendwie heimatlos geworden war und doch den Gesetzen der Wellenphysik gehorchend sich konzentrisch ausbreitete, bis sie an einen Widerstand geriet. Ein Widerstand, an dem entweder die Welle oder der Widerstand oder beides zerbricht und die Energie sich eine neue Form sucht.
„Er“ war zu dieser Welle geworden, dieser Orientierungslosigkeit, und gleichzeitig war er dieser Körper, an dem die Welle aufprallen würde, und voller Spannung und Erwartung wartete er auf den Augenblick, an dem das passieren würde.
Die Erwartung war die eines Zerberstens, eines Platzens, einer völligen Auflösung der Form, jeder Form, bis hin zur völligen Formlosigkeit wie eine Seifenblase, die zerplatzt.
„Er“ erkannte sich als Blase, als gewaltige Blase, sich ausdehnend und zusammenziehend in einem Rhythmus, der sich völlig unabhängig von ihm selbst vollzog, fast als ob diese Blase von einem Wesen geatmet würde, wobei „ihm“ sofort klar war, das „Atmung“ wiederum eine völlig reduktionistische, absolut unzutreffende und auf geradezu erbärmliche Weise banale Analogisierung mit anthropoformen Vorgängen und deren Beschreibungen darstellte, aber was sollte „er“ tun, er hatte nur diese eine Sprache, und selbst in diesem Zustand, diesem metageschlechtlichen, blasenhaften und nahezu körperlos sich wellenförmig bewegenden und atmungsartig pulsierenden Zustand hatte „er“ nur diese Sprache, die gleiche, die „er“ in einer früheren Daseinsform bereits einmal gekannt hatte.
Es fühlte sich wie Fallen an. Pulsierend und dem pulsierenden Rhythmus ausgesetzt wurde zögerlich, wie von einem winzigen kleinen Rucken durchsetzt, aus dem Schweben ein Fallen. Die Blase geriet unter Druck, „er“ fühlte sich wie in einem Raumschiff, das „ihm“ nur zu einem kleinen Teil gehorchte, und mit „seinen“ Monitoren und seinem die Kugel vollkommen umfassenden Sehfähigkeit, als ob „er“ nur Auge, sogar nur Netzhaut sei, nahm „er“ wie unter Vergrößerung wahr wie die Blase winzige Dellen bekam. Einschläge kamen von außen, nicht erkennbare Objekte schlugen auf der glasigen Haut ein, dehnten sie ein wenig nach innen, wurden abgefedert und flogen, scheinbar (es war nicht zu sehen, nur zu vermuten) wieder in den Außenraum zurück, der durch nichts (NICHTS) durchaus treffend charakterisiert war. Die Objekte waren nicht zu erkennen, aber es blieben zunehmend winzige Dellen von diesen Kollisionen zurück. Als Rundumnetzhaut und zerebraler Zoom- und Vergrößerungskapazität mit mentaler Verarbeitungspotentialität – so beschrieb „er“ sein Selbstbild im Moment – reagierte „er“ mit Unruhe.
Und noch bevor „er“ es mit dem, was „er“ Bewusstsein zu nennen er sich angewöhnt hatte, registriert hatte, war schon einer anderen geistigen Instanz klar geworden, dass die unsichtbaren „Objekte“ in die Blase eindrangen, ein für „ihn“ nicht erkennbarer Diffusionsvorgang, wie durch eine semipermeable Membran, wie es sein rudimentäres Sprachbewusstsein benennen wollte, kamen sie hinein. Sein Netzhaut-Bewusstsein sah sie nicht, und doch waren sie da. Oder es. Fragmente von etwas, was von draußen aus dem NICHTS gekommen war. Sein kleines Bewusstsein war überfordert von der Frage nach dem Verhältnis von ETWAS und NICHTS, so dass es die Frage vergaß, aber nie mehr vergaß, dass es etwas vergessen hatte. Das Fallgefühl verstärkte sich. Die Dellen wurden mehr und größer. Eine Trübung entstand, und im Innern der Blase setzte sich eine Art Sedimentierung oder Staubschicht ab.
Zu der sich ausbreitenden Welle der Irritation und Orientierungslosigkeit, die zusammen mit der Blasenhaftigkeit des Daseins und der rhythmischen Pulsation einen Status von Normalität erreicht hatte, kam jetzt irreguläre, unvorhersehbare impulsive Unruhe dazu, wie kleine Vulkanausbrüche oder Peitschenhiebe eines ungeduldigen und unberechenbaren Antreibers. Anders gesagt: Angst breitete sich aus. „Er“ vertraute auf einmal den Pulsationen und Wellen und Transparenzen und Bewußtseinsaggregatzuständen nicht mehr, und mit dem Maß an Vertrauensverlust stieg der Eindruck von Fallen weiter an. Mit diesem sich verstärkenden Fallen geschah um „ihn“ herum etwas erneut Außergewöhnliches, Erschreckendes und geradezu Grauen Erregendes: In diesem NICHTS entstand Licht, sein Netzhautbewusstsein, das vorher ohne Licht sehr gut hatte wahrnehmen können, war geblendet, blind von Licht. Es dauerte eine lange Weile, bis das Netzhautbewußtsein außerhalb der Blase durch die Trübungen, Schatten und Sedimentablagerungen an der Blasenwand Strukturen wahrnehmen konnte. Diese Strukturen wurden zu menschlichen Gesichtern. „Er“ wusste, was menschliche Gesichter sind, auch wenn „er“ sich nicht erinnern konnte, woher, und „er“ vermutete, seine Blase würde vielleicht von außen aus dem NICHTS heraus betrachtet, auch ein Gesicht darstellen, aber vor allem „spürte“ er mit einer neuen Bewusstseinsmodalität eine Art Vertrautheit und Verwandtschaft mit diesen Gesichtern, die Grauen und Freude zugleich in „ihm“ auslösten.
Alle Gesichter schauten ihn an. Einzelne waren winzig klein, andere größer, es gab auch riesige, deren Dimensionen er gar nicht mit einem Blick erfassen konnte, seine Rundumnetzhaut war auf einmal überfordert. Es zeigte sich, dass die größeren aus mehreren kleineren zusammengesetzt waren, und die ganz großen wiederum aus Konglomeraten gebildet waren, und er malte sich aus, dass im Maßstab der Unendlichkeit des NICHTS sich ein unendliches Antlitz ausbreiten würde, in dessen Sphäre „er“ schwebte. Beziehungsweise: Fiel. Stürzte. Flog.
Auf etwas zu. Er erkannte ein Gebirge. Die Gesichter um „ihn“ herum bekamen Ausdruck. Traurige, sehnsüchtige, glückliche, wütende, herrische, teilnahmslose, desinteressierte, klare und herzliche, verzerrte, schöne und ebenmäßige, gütige und böse, liebevolle und lieblose. Dann bemerkte er, dass die Trübungen an der Blasenwand auch aus Gesichtern bestanden. Manche entstellt, von allen nur vorstellbaren Verletzungen, Entartungen und Verstümmelungen jeder nur denkbaren Herkunft. Manche waren innerlich leer und hohl, andere voller Ausdruck. Dankbare, demütige, frohe, lachende. Verlorene, einsame, verzweifelte. Gierige, lüsterne, besessene. Ruhige, friedliche. Alle, alle, alle schauten “sein“ Netzhautbewusstsein an.
Es bildeten sich in seinem Konstruktionsbewusstsein zwei Entitäten mit Übergangszonen dazwischen. Eine weibliche und eine männliche. Endlich sah er, was Geschlechtlichkeit war, es beglückte ihn und verwirrte ihn zugleich, denn es war nie eindeutig, nie klar, ständig ging etwas ineinander über. Aber dafür war keine Zeit. Die Entitäten wechselten sich ab auf ihren Funktionsebenen. Steuerpult, Hebel, Knöpfe, Schalter, Monitore, Algorithmen und Tastaturen, Hundertschaften von Assistenten.
Ohnmächtiges und orientierungsloses Agieren an Geräten und Instrumenten zur Aktivierung und Steuerung von jeder Art von Prozessen. Demgegenüber (und darin verschränkt und eingewoben, gelegentlich konflikthaft verstrickt und gelähmt) Augen, Herzen und Hände, die Wärme, Liebe und Anteilnahme ausstrahlten, Verbundenheit und Hoffnung und Vertrauen und Demut und Dankbarkeit und Glück. Die beiden Entitäten versuchten alles. Aber sie waren überfordert. Ohnmacht und Orientierungslosigkeit überrollten sie. Sie simulierten Steuerung und Anteilnahme, aber es funktionierte nicht. Es konnte nicht. Sie wussten es. Reklamierten ihre Ohnmacht bei „ihm“. „Er“ schaute ratlos ins Leere.
Die Blase stürzte auf das Gebirge zu. Es raste auf sie zu, sie rasten gegenseitig aufeinander zu. Das Gebirge bestand aus Dingen, je näher „er“ kam, desto deutlich waren sie zu erkennen. Es waren Gegenstände, riesige Haufen von Gegenständen. Spitze, scharfe, zusammengefügte oder auseinander gebrochene Gegenstände.
Kreuze, Stangen, Stäbe, Kreise, gebogene und gerade, scharfe und stumpfe. Symbole und Zeichen von Gemeinschaften und Glaubensrichtungen, Herrschaften und Ideologien aller Zeiten und aller Richtungen der menschlichen Geschichte, außerdem Waffen aller Art, zusammengeschoben zu diesem gewaltigen Gebirge, auf das „seine“ Blase jetzt zuraste. Und oben, auf den Gipfeln, staken Kirchturmspitzen, Halbmonde, Äskulapstäbe, Hakenkreuze und vieles andere . Die Blase stürzte darauf zu. Es war so weit. Die Blase würde auf ihren Widerstand treffen. Ihre Zeit war zu Ende.
„Er“ hielt inne, wurde starr vor erschreckter Erwartung, sein Herz-Bewusstsein schlug und sprang. Und im Moment des Zusammentreffens und Zerberstens öffneten sich die Brustkörbe der Entitäten und ihre Herzen sprangen heraus und verschmolzen zu einem glühenden Herzklumpen, der mit einer alles versengenden Hitze auf dem Gebirge unter sich aufschlug.
Buch I: AUFKLÄRUNG
1.0 Einführung
Das Buch „Aufklärung“ erzählt die Geschichte der Starna-Ärzte vom vierzehnten bis ins zwanzigste Jahrhundert. Jeder einzelne von ihnen ist geprägt und herausgefordert durch die stetig voranschreitende Aufklärung und Modernisierung in den Wissenschaften und der Medizin insbesondere. Der erst bekämpfte, dann zögerlich und schließlich immer leidenschaftlicher verfolgte Fortschrittsglaube an die menschliche Fähigkeit, durch Erkenntnis und Vernunft zum besseren der Menschheit beizutragen hat auch die Ärzte der Familie Starna bewegt. Zu Beginn wird der erste Starna, Giovanni, mit dem Heilwissen und der Sehergabe seiner als Hexe verfolgten, heilkundigen Geliebten konfrontiert. Sein Sohn Antonio studiert am ersten anatomischen Theater in Padua und reist mit Paracelsus zu dessen Patienten und Vorlesungen. Generationen später träumt Luigi Starna von einer Heilkunde, die in Analogie zu den sich immer schneller entwickelnden Handelsvernetzungen in Europa auf der Verbindung allen durch objektive Anschauung erworbenen Wissens über den Körper und seiner Funktionen beruht. Später wird die Verknüpfung medizinischen und staatspolitischen Denkens während der Restauration Gegenstand einer leidenschaftlichen Diskussion zwischen Anton Ludwig Starna und seinem Sohn Karl-August. Dieser erlebt als Frauenarzt schließlich die wissenschaftliche Revolution durch den Darwinismus als medizinische Herausforderung, der er sich stellen will. Sein Neffe Ludger Starna schließlich wird mit den Vorboten der NS-Medizin konfrontiert.
1.1 Genua 1515 (Giovanni Starna und Barbara)
Das ist Ketzerei!
Der Kaufmann Giovanni Starna hatte sich durch die Gassen geschlichen und war in einem Nebeneingang verschwunden. Er war erwartet worden. In einem dunklen, aber trockenen und warmen Gemach, ausgekleidet mit vielerlei Tüchern und Bildern, sitzt er jetzt einer Frau gegenüber. Sie ist ein paar Jahre jünger als er. Er ist nicht das erste Mal hier, aber heute liegt eine besondere Spannung in der Luft, er weiß nicht warum. Vielleicht der Scirocco.
Er schaut die Frau an. Sie heißt Barbara. Früher einmal hat er sie geliebt, leidenschaftlich. War das vorbei? War da nicht immer noch diese Glut? Aber es war klar, dass er standesgemäß heiraten würde. Jetzt war sie ihm eine vertraute Freundin geworden, er holte sich Rat bei ihr wie manche andere auch. Sie galt als Hure und Hexe. Er hatte auch Angst vor ihr. Sie war eine weise Frau.
Kannst Du immer noch in die Zukunft schauen?
Ja.
Was sagt sie dir? Was wird geschehen?
Du musst genauer fragen. Und ehrlich von dir fragen. Schau mich an dabei.
Unser Kind ist blöde. Es ist verrückt. Vielleicht vom Teufel besessen. Es wäre besser, wenn es gar nicht geboren wäre. Wir dürfen es um der Liebe des Herrn willen nicht ertränken, aber manchmal täte ich es am liebsten. Dir darf ich das sagen, du sagst es nicht weiter. Du wirst selbst irgendwann ertränkt werden, weil du eine Hexe bist. Aber du sagst die Wahrheit, ich weiß das.
Woher weißt du das?
Ich sehe das in deinen Augen. Sie sind klar. Sie sind auf andere Art traurig als unsere Augen es sind. Deine Traurigkeit ist klar, so wie deine Angst und dein Zorn klar sind. Deshalb sagst du die Wahrheit, und deshalb fürchten die Menschen dich, und deshalb wirst du sterben müssen. Aber das weißt du alles, und niemand kann s verhindern.
Vielleicht hast du recht, vielleicht nicht. Es ist nicht deine Sache. Was willst du wissen?
Was wird aus dem Teufelskind werden? Und wird es in Zukunft mit diesen Kindern anders sein? Was will der Herrgott mit denen anfangen?
Wie heißt dein Kind? Wie alt ist es? In welchem Zeichen ist es geboren, und wie – wie viel Blut hat es gekostet, wie viel Wasser, wie viel Schmerz?
Es hat keinen Namen bekommen, der Pfarrer wollte es nicht taufen. Wir nennen es nur den Balg. Es ist jetzt drei Jahre und fünf Monate alt. Es lallt und schreit und dreht die Augen schräg und immer läuft der Schleim aus dem Mund. Aber wenn wir ihm das Kreuz unseres Erlösers zeigen, läuft es ganz rot an und wird noch lauter, und wenn wir das Kreuz wegnehmen, wird es still. Einmal hat es das Kreuz sogar angespien. Die Geburt war schwer. Es wollte gar nicht herauskommen. Die Frau ist fast gestorben vor Schmerz. Ich habe mehr Branntwein getrunken als je zuvor, um nichts hören zu müssen.
Dein Kind hat nicht genug Luft bekommen. Es hat falsch gelegen im Bauch. Es ist nicht besessen. Aber es ist zu schwach für dieses Leben und wird bald sterben. Gebt ihm einen christlichen Namen und tauft es selbst, wenn der Pfarrer es nicht tun will. Nehmt Wasser und sprecht euer Vaterunser und sagt den Namen und tupft das Wasser auf die Stirn. Dann ist die Seele gerettet. Und gebt ihm auch zu trinken und Brei zu essen und zeigt ihm ein freundliches Gesicht.
Du bist eine Hexe. Wir sollen dem Teufelskind ein freundliches Gesicht zeigen? Dann sind wir selbst des Teufels. Und ohne den Segen der heiligen Kirche sollen wir taufen? Das ist Ketzerei!
Schau mir in die Augen! Du weißt, dass ich die Wahrheit sage, aber du willst sie nicht hören. Aber ich werde dir noch mehr sagen.
Bevor die Häscher mich holen und ertränken werden als Gesandte des Teufels, obwohl ich selbst eine Heilige bin, eine Heilerin, die um das Heil weiß, werde ich dir sagen, was ich sehe. Ich kann durch deine Augen in die Zukunft sehen. Es werden deine Nachfahren sein, dein Blut und dein Geist, der das bewirkt, was ich nur sehen kann. Es wird noch lange dauern, wie immer in der Welt, bis verstanden werden wird. Und solange müssen wir sterben, und bevor wir sterben, sagen wir die Wahrheit. Es wird die Zeit kommen, da werden Ärzte den Leib der Gebärenden untersuchen mit ihren Händen und tasten wie das Kind liegt und werden mithilfe von Zangen die Lage verbessern, und dann wird ein Kind wie Eures gesund zur Welt kommen. Aber andere werden weiterhin beschädigt und defekt sein und nicht leben können ohne die Liebe und Fürsorge der anderen, und viele werden sterben, manche durch Vernachlässigung, Hunger und Elend, andere durch rohe Gewalt, und wieder andere durch gezielte Tötung. Und später werden Maschinen den Leib durchleuchten und alles sehen, was in ihm ist, nichts wird mehr heilig bleiben. Die Maschinen sehen bis in die tiefsten Gebiete der Leiber der Menschen, sie lösen alles auf in immer kleinere Dinge, und erklären die Gründe für die Krankheiten. Und es werden kleine Kugeln gegeben werden, die diese Krankheiten heilen werden, aus vielerlei Zusammensetzung. Und man wird mit dem scharfen Messer den Leib der Frau aufschneiden können, ohne dass sie daran stirbt, und das Kind herausnehmen und den Leib wieder verschließen, und alle werden danach gesund sein. Und es wird kommen, dass man die defekten Kinder erkennen wird, schon lange vor der Geburt, und der Frau die defekte Frucht ihres Leibes nehmen kann, ohne dass sie verbluten muss daran. Und es werden wieder Menschen fragen: Warum habe ich so ein Teufelskind? Warum werde ich damit bestraft? Und andere werden sagen: Danke, Herr, für das Geschenk dieses Lebens, das mich lehrt, demütig zu sein und mich nicht für den Maßstab aller Dinge zu halten.
Genug, Frau, genug. Was redest du da für gefährliches Zeug. Ich werde dich nicht verraten, aber du weißt, dass alles, was du da sagst, Häresie ist und Blasphemie. Gotteslästerei. Du verspottest die Güte unseres Herrn.
Ja, in euren Augen und den Augen der Mächtigen ist es Häresie. In den Augen des Herrn ist es das nicht, sondern Liebe. Liebe zu den Menschen. Ich spotte nicht seiner, sondern ich verstehe ihn, mehr als du. Ich bin die Maria-Magdalena von Genua, wenn du es so hören willst.
Die Sünderin! Die Hure!
Ja, genau die. Aber höre – ich sehe noch etwas. Ich habe Antonio, deinen Sohn, großgezogen. Er wird bald zu Dir kommen, du musst ihn bei dir aufnehmen, wenn sie mich mitnehmen. Er wird einmal ein Arzt werden. Wenn du ihn mit Güte und Freundlichkeit erziehst, wird er ein guter Arzt werden können und einen Schritt in die Zukunft tun. Wenn du ihn mit Gewalt und Hass erziehst, wird er den Menschen mit Verachtung begegnen und die Heilkunde zu ihrem Schaden anwenden. Es sind immer beide Seiten im Menschen. Tu du als guter Christ das deine dazu, das das Gute mehr wird.
Barbara … Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du erschreckst mich und machst mir Angst. Ich will das alles nicht hören und nicht wissen. Ich spüre das Unheil schon auf uns zu kommen. Jemand wird uns verraten. Ich kann mich vielleicht freikaufen, aber dich nicht. Ich bin Kaufmann! Ich mache Geschäfte und verdiene Geld.
Ich denke nicht über das Wohl der Menschen nach. Nur wenn sie etwas kaufen sollen, sage ich ihnen, dass die Ware ihr Leben glücklicher und besser machen wird. Vielleicht werden wir einmal unsere Waren nach Norden bringen und dort eine Handelsniederlassung gründen. Ich hatte einen Traum: Eine Weinstube mit unserem guten Wein und Öl und Kräutern in Sachsen, das ist es, was ich für die Zukunft wünsche. Und Söhne und Töchter, die das Erbe der Familie respektvoll weitertragen als gute Starnas. Meinetwegen auch als Ärzte, obwohl mich das nicht besonders interessiert. Aber jetzt fürchte ich mich. Wovon sprichst du da? Ich glaubte, eine schöne Geliebte zu haben, und nun habe ich eine vom Teufel besessene gotteslästerliche Hexe, die ich dennoch liebe und begehre, und durch die ich und meine Familie vernichtet werden. Du bist mein Heil und du bist mein Verderben, ich werde selbst ganz wahnsinnig davon.
Mein Liebster, beruhige dich doch! Ich kann nicht alles in der Zukunft sehen, und deine persönlichen Fantasien sind auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ja, meinetwegen, es wird vielleicht eine Weinstube geben bei den Sachsen, und vielleicht wird einmal in 500 Jahren ein Starna noch einen Kerzenleuchter von dort auf seinem Nachttisch stehen haben, wenn er über seinen Notizen sitzt. Es wird ein Nachfahre Antonios sein, wenn du ihm deinen Namen gibst. Aber andere, viel wichtigere Dinge werden geschehen. In ein paar Jahren wird ein kluger Mönch in deinem zukünftigen Sachsen ein unerhörtes Papier an eine Kirchentür nageln und mit der Erkenntnis, dass die Erlösung des Menschen nicht erkauft werden kann sondern geschenkt wird, eine Umwälzung aller Verhältnisse auslösen, die die ganze Welt, auch deine, verändern wird. Und diese Veränderung wird mit unendlich viel Leid und Blutvergießen bezahlt werden. Ich weiß nicht, warum das so sein muss, aber es ist so. In deiner Bibel ist es als die Geschichte des Sündenfalls beschrieben: Erkenntnis wird mit der Mühe der Arbeit und dem Schmerz der Geburt bezahlt, oft auch mit dem Leben. Immer wieder, immer wieder, immer wieder.
Ich kann es sehen, aber glaub mir, verstehen kann ich es auch nicht.
Aber jetzt geh zu Deiner Frau und deinen Kindern, tu mit deinem Balg wie ich dir gesagt habe. Lass dich einmal anschauen von ihm und lass das Licht seiner Seele, die hinter der Teufelsfratze wohnt, in dir aufleuchten. Das Licht, mein Liebster, wohnt in allen!
Vergiss das nicht, niemals. In den Kranken und Verrückten und Besessenen ebenso wie in den Dummen und den Bösen, den Gemeinen und den Mächtigen, in den Juden und den Arabern genauso wie in den Christen – in jedem schlagenden Menschenherz wohnt das Licht, direkt neben den dunklen Schatten. Das Gute wird nicht dadurch mehr, dass man das Kranke und Schlechte bekämpft. Das Gute vermehrt sich dadurch, dass man das Licht auch in der Dunkelheit erkennt und ansieht.
Aber das verstehst du nicht, ich sehe es in deinen ungeduldigen Augen.
Nein, ich verstehe es nicht. Ich will es auch nicht verstehen. Vergib mir, Du Schöne. Vergib mir, Verruchte.
Ja, ja. Ich vergebe Dir, natürlich tue ich das. Sei Antonio ein guter, demütiger Vater. Erzähl ihm einmal von dem, was ich dir gerade gesagt habe, das reicht. Und jetzt komm zu mir, schau mich noch einmal an. Und küss mich und umfasse meinen Leib, ich will noch einmal dir gehören ...
Sie liebten sich innig und leidenschaftlich. Eine ganze Stunde verging, sie lagen wohlig erschöpft auf den Laken.
Dann klopfte es an der Tür. Laute, herrische Stimmen, die keinen Widerspruch dulden. Waffenklirren: Wo ist die Hexe Barbara?
Sie schaut ihn an, er antwortet nicht, aber eine Träne rollt ihm an der Wange herab.
Danke, flüstert er. Ich werde mein Kind nicht ertränken. Ich werde es – Barbara nennen. Und Antonio …
Wenn du meinst. Nun geh. Und schau nicht zu, wenn sie mich in den Fluss werfen und die Probe machen. Nimm den Armreif, den du mir einmal gegeben hast, und diesen Opal dazu und gib ihn weiter an Antonio, wenn es einmal Zeit ist. Ich habe getan, was ich konnte, und ich werde wiederkommen und weiter tun, was ich kann. Und das solltest du auch tun. Geh, Giovanni, mein Liebster. Dein Gott sei mit dir!
Als Giovanni Starna über die Hintertür durch den Hof huschte, hörte er noch, wie vorne die Tür aufgerissen wurde, er hörte das Brüllen der Männer und Barbaras Schreien. Er schlug die Hände vor die Augen und stürzte davon. Ich kann sie nicht retten, ich kann nicht dazwischen gehen, sie würden mich nur mitnehmen und ebenfalls dem Verhör der Inquisition unterwerfen. Er wusste, was das bedeutet, er hatte die Werkzeuge gesehen. Er wankte davon durch die dunklen Gassen, schluchzend und verzweifelt und ohnmächtig.
Über eine Stunde schlich er durch die Gassen Genuas. Dunkle Gestalten begegneten ihm, hohläugige Huren und finstere Schiffsleute, hungrige Knechte und hagere Laufburschen, aber niemand bedrohte ihn. Schließlich kam er an die Kaimauern am Meer und schaute aufs Wasser, seitwärts im Osten schien ganz zart das erste Morgendämmern. Die Augen waren trocken geworden, aber in der Seele fühlte er sich leer. In der Tasche fühlte er auf einmal den Armreif und den Opal, und er hörte ihre Worte vor seinem inneren Ohr: Das Licht, mein Liebster, wohnt doch in Allen.
Vor ihm schimmerte das im Osten auftauchende Morgengrau sanft silbrig auf den leichten Wellen des ligurischen Meeres. Etwas Friedvolles zog kurz in ihn ein, wurde aber sofort unterbrochen von der furchtbaren Vorstellung dessen, was Barbara jetzt gerade durchmachen musste. Und doch blieb ein kleiner Fetzen dieses Friedens da. Er fasste den Reif, zog ihn aus der Tasche, und murmelte leise vor sich hin: Ja, Liebste, ich werde versuchen, was du mir aufgetragen hast.
1.2 Genua 1535 (Giovanni und Antonio Starna)
Gab es einen Zusammenhang?
Antonio!!! Verdammt noch mal, Antonio! Komm gefälligst her. Du hast kein Recht, dich so zu benehmen.
Ja, Vater, was willst du von mir? Was ist geschehen? Warum schimpfst du so mit mir?
Antonio! Seit 20 Jahren versuche ich dir ein guter Vater zu sein, und du dankst es mir so. Ein undankbarer Balg bist du, eine Missgeburt, ein Nichtsnutz. Was soll das nun schon wieder mit dieser Trinkerei nachts in den Lokalen am Hafen? Und du treibst dich bei den Huren herum, als ob du da zuhause seiest anstatt hier bei uns, wo du hingehörst. Du ruinierst den Ruf der Familie! Führ dich wie ein Starna auf und nicht wie ein Lump!
Antonio hielt seinen Kopf gerade und schaute seinem Vater gerade ins Gesicht. Er war vor einigen Wochen fünfundzwanzig Jahre alt geworden. Er könnte und sollte auch nach dem Wunsch des Vaters heiraten und seine Rolle im Handelshaus übernehmen. Er sollte zum Nachfolger aufgebaut werden, schließlich war er der Erstgeborene. So waren die Regeln der Tradition, die heiligen Gesetze der Familie. Er wusste nichts von seiner unehelichen Herkunft. Er hatte dem Vater ein guter Sohn sein wollen, er hatte sich bemüht, hatte fleißig die Berechnungen und Planungen, die Verhandlungen und Überlegungen eines Handelshauses gelernt.
Ja, er hatte sich bemüht, und er bemühte sich weiterhin. Aber es gelang ihm nicht. Er wusste nicht, woran es lag, aber es gelang ihm nicht, die Anerkennung des Vaters zu gewinnen. Oder besser: er gewann schon die Anerkennung, wenn er sich anstrengte, aber er gewann niemals sein Vertrauen. Er spürte das tiefe Misstrauen des Vaters ihm gegenüber. Es war unverständlich, es wurde auch nicht ausgesprochen, aber es war immer zu spüren. Dies Misstrauen durchzog alles, er konnte tun, was er wollte. Früher hatte ihn das in große Verzweiflung und Angst gestürzt und zu noch größeren Anstrengungen getrieben, jetzt aber war er wütend.
Was ist passiert? Was hast du gehört, wer hat dir was berichtet, Vater?
Das wagst du zu fragen, Bursche? Du fragst mich nach Beweisen, als ob du der Richter seiest? Du bist nicht der Herr hier, das bin ich, und du hast mir Folge zu leisten, so ist das nun mal! Es ist mir zugetragen worden, und es schädigt den Ruf des Hauses. Der junge Starna treibt sich bei den Huren und Verbrechern herum, sagt man. Mit so einem können wir keinen Handel machen, sagt man. Der lernt Betrug, Lügerei und Bestechung, mit dem muss man später vorsichtig sein, sagt man.
Die Stimme des alten Giovanni Starna zitterte vor Empörung, aber auch vor Verunsicherung. Dieser klare und gerade Blick, der ihm da entgegensah, traf ihn ins Mark. Er wollte diesen Blick nicht sehen. Er wollte sich nicht daran erinnern, er wich ihm aus so oft er konnte, und versuchte ihn durch Gewalt und Drohung zu unterdrücken. Aber wie es schien, wurde er nur immer klarer und stärker. Und wenn er nur noch einen einzigen Augenblick länger in die Augen seines Sohnes schauen würde, würde er erkennen, wer ihn da anschaute.
Verschwinde aus meinen Augen!! Und wehe dir, du bist nicht am Nachmittag ordentlich gekleidet und wach bei der Besprechung der Bilanzen des letzten Halbjahres. Ich erwarte deinen Bericht.
Ja, Vater. Ich habe die Zahlen erhoben und überprüft, und ich werde es berichten. Aber ich will dich etwas fragen. Ich bin jetzt kein kleiner Junge mehr, ich bin erwachsen, und es ist mein Leben, nicht deines. Ich bin nicht dein Leibeigener, Vater. Warst du nie bei den Huren und Waschfrauen, und Zuhältern, Knechten und Fischern im Hafen, Vater, als du jung warst? Es ist eine andere Welt, ja, aber sie ist nicht verlogener und verderbter als deine hier in deiner Kaufmannsvilla. Ich brauche dich nicht zu fragen, denn ich weiß es ja. Du warst da unten, und es hat dir gefallen. Es gibt da unten ein Mädchen, die kannte einmal eine Frau, die ihr wie eine Mutter war, bis die Häscher der Kirche sie als Hexe abholten und in den Fluss warfen. Sie kannte dich. Man erinnert sich hinter vorgehaltener Hand an dich, und man spricht dort unten mit Respekt von dir, weil du sie anständig behandelt hast. Vater, ich bin da unten, weil ich meiner Lust nachgeben kann und will, ja, das ist vielleicht Sünde, aber es ist die Art von Sünde, die alle begehen und alle verstehen. Und ich bin dort, weil ich nach dir suche. Nach dem Vater, der mir näher ist als der, der jetzt gerade mit dieser selbstgerechten Empörung vor mir steht.
Du wagst es, so mit deinem Vater zu sprechen? Wer glaubst du wer du bist?
Giovanni war ein wenig leiser geworden. Sein Blick war völlig verunsichert, aber mehr noch war er erstaunt über das, was er hörte. Nichts war verborgen geblieben, obwohl er sich noch so sehr bemüht hatte. Er spürte, wie sich die Schultern senkten, wie sein Kopf ein wenig nach vorne fiel, wie er kleiner und gebeugter dastand, und gleichzeitig, das war wirklich das erstaunlichste und unverständlichste an dieser ganzen absurden Szene, spürte er eine merkwürdige warme Strömung in seinen Eingeweiden, die sich ausbreitete und ihn irgendwie erleichterte.
Ich will dir sagen, was ich glaube. Ich glaube, ich bin kein Kaufmann und werde nie einer werden. Mich interessieren die Menschen mehr als die Geschäfte. Ich will den Magister machen und dann an die medizinische Fakultät von Padua gehen. Etwas in mir ist anderes als bei dir, ganz anders. Ich verstehe es selbst nicht.
Ich fühle mich dir vertraut und fremd zugleich. Etwas von mir ist da unten im Hafen zuhause, verstehst du? Da unten bin ich dir näher als hier. – Aber Vater, was ist mit dir?
Giovanni hatte plötzlich angefangen am ganzen Körper zu zucken. Aus der warmen Strömung war ein Krampfen geworden. Seine Gesichtszüge wirbelten in einem merkwürdigen Geflatter herum, die Arme pendelten unkoordiniert nach vorn und hinten, und er sank auf einmal mit einem merkwürdigen Grunzen zu Boden. Die Haut wurde blass, als ob ihm alles Blut aus den Adern gewichen sei, und auch Antonio wurde blass und starr vor Schreck schaute er auf den zu Boden sinkenden Vater vor ihm. Giovanni richtete den Blick auf seinen Sohn. Dieser beugte sich zu ihm, strich ihm über den Kopf und die Hände, schrie nach den Dienern, nach Wasser, nach Kissen. Langsam ebbte der Krampf ab, etwas Blut rann aus Giovannis Mund, er hatte sich auf die Zunge gebissen.
Die Diener trugen ihn in sein Gemach, dort fiel er in einen tiefen Schlaf, aus dem er nach zwei Stunden erwachte. Antonio hatte die ganze Zeit an seiner Seite gesessen.
Antonio, mein Sohn. Was war das? Ich bin ganz durcheinander, ich muss mich erst ordnen. Verzeih mir. Ja, ich weiß wieder, worum es ging. Wovon du vorhin gesprochen hast, und du hast Recht. Ich habe versucht es zu verhindern, ich wollte die Wahrheit nicht anerkennen, ich wollte das Leben in meine Vorstellung zwingen, und das ist nicht gelungen. Und jetzt, bevor mich der Schlag Gottes endgültig abberuft und ich vor meinem Herrn stehen und Rechenschaft abgeben muss, will ich dich freigeben.
Aber kümmere dich um die Mutter und die Geschwister. Übergib den Stab der Starnas an deinen Bruder, bevor du nach Padua gehst. Du bleibst dennoch der Älteste, der Erbfolger, ich kann das nicht ändern.
Vater!! Nein, Vater, nein, bitte …
Antonio hatte Tränen in den Augen, voller Angst und Verzweiflung und Erschütterung sank er auf die Knie und nahm die Hand des Vaters in seine.
Vater! Du darfst jetzt nicht sterben, nein. Das wollte ich nicht! Ja, ich verspreche dir alles, ich werde es in deinem Sinne tun, Vater, bitte.
Hör mich an. Ja, ich war da unten, und es gab eine Frau, die ich mehr geliebt habe als deine Mutter.
Nein, soweit würde er nicht gehen und ihm sagen, dass sein Sohn von einer Hure geboren wurde. Damit würde er nicht leben können, das hätte auch Barbara nicht gewollt. Plötzlich ist ihm zumute, als ob sie ihm von innen zuflüsterte: Nein, Liebster, das will ich nicht. Die Zeit ist noch nicht reif dafür. Aber erzähl ihm von mir, und sag ihm, was ich dir geraten habe. Erzähl ihm von dem Licht. Du hast es viel zu lange vermieden, hast dich dagegen gewehrt. Jetzt ist die letzte Chance, überhaupt etwas zu sagen, auch wenn es unterdrückt bleibt von seiner unerfüllten Sehnsucht nach dem väterlichen Vertrauen.
Junge, hör mir zu. Die Frau war eine Hure, ja, und sie war eine Hexe, die dafür bestraft wurde, aber sie war auch eine weise Frau, eine Hellseherin, und sie hat mir von dem Licht erzählt, das in jedem Menschen leuchten kann, wenn man ihn freundlich anschaut. Ich habe sie geliebt, aber ich konnte sie nicht schützen, und ich habe dann versucht, mich selbst vor der Erinnerung zu schützen. Und du hast mich an sie erinnert, ich weiß nicht warum.
Verzeih mir. Höre! In der Schatulle auf dem Tisch in meiner Schreibstube liegt ein goldener Reif. Den hat mir Barbara gegeben, bevor sie geholt wurde. Nimm ihn an dich und bewahre ihn, und gib ihn an deinen Sohn weiter.
Giovanni Starna starb nicht sofort, aber der Anfall ließ ihn geistig beeinträchtigt zurück. Antonio kümmerte sich um das Handelshaus, er besprach mit der Mutter und dem jüngeren Bruder die Pflege des Vaters und die Geschäftsübergabe, des nachts holte er eine Heilerin aus dem Hafenviertel, die er kennen gelernt hatte auf seinen Streifzügen, an das Bett des Vaters, und tagsüber war eine Magd immer bei ihm, gelegentlich kamen der Priester und der Arzt zu ihm und zur Mutter. Dann übergab er seinem Bruder Giorgio schließlich schrittweise die Verantwortung für das Handelshaus, und mithilfe kluger Berater und alter Freunde des Vaters regelte der die Geschäfte erfolgreich. In der Nachbarschaft und in der Stadt war zuerst viel geredet und geschwatzt worden über den alten Starna und seinen Sohn und man schaute ihm abfällig hinterher, als man aber sah, dass Antonio sich entschieden hatte, sich klar um alles kümmerte, keinen Zweifel an seiner Fürsorge für den kranken Vater aufkommen ließ und seine Mutter bei allem unterstützte betrachtete man ihn wieder als einen würdigen Starna-Sohn. Zwei Monate später schlief Giovanni Starna friedlich ein.
Antonio fragte sich, was es wohl mit diesem Schlag des Vaters auf sich gehabt hatte. Hatte die große Aufregung und das verborgene Geheimnis damit zu tun, die große Angst? Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch einen Schlag bekommt? Was erschlägt ihn da?
Und warum? Das Bild der erst wütenden, dann unsicheren Empörung des Vaters in diesem Streit stand ihm noch lange vor Augen. Wie die Empörung dann plötzlich umschlug in etwas anderes, ganz Neues, es war wie eine Erleuchtung gewesen, aber zugleich auch ein Untergang. Was hatte es damit auf sich? Gab es einen Zusammenhang?
Ein Jahr später ging Antonio nach Padua, um Medizin zu studieren und Arzt zu werden. Er studierte fleißig und lernte die medizinischen Lehren des Aristoteles, des Hippokrates und des Galenus kennen und verinnerlichte die Systematik der Humoralpathologie. Zugleich war er Zeuge eines Aufbruchs der Medizin in die Moderne. Der junge Andreas Vesalius, fünf Jahre jünger als er selbst, war gerade als Anatom nach Padua berufen worden und hielt seine Aufsehen erregenden Vorlesungen im berühmten anatomischen Theater direkt an den sezierten Leichen.
Immer wieder betonte Vesalius die Notwendigkeit der direkten Forschung durch Beobachtung am menschlichen Körper anstelle philosophisch-religiöser Spekulationen, und er räumte mit vielen Irrtümern der Lehre von Galenus auf, ohne aber diese insgesamt zu kritisieren. Antonio geriet in den Sog dieser neuen Richtung, aber er blieb zwiegespalten. Für kurze Zeit war er mit Vesalius befreundet, konnte aber die Anfeindungen und Vorwürfe der Gotteslästerei nicht lange mittragen und wandte sich verunsichert wieder von ihm ab. Erst die spätere Begegnung mit dem berühmten Paracelsus bei einer seiner Vorlesungen in Padua beeindruckte ihn nachhaltig. In der Bewertung der Gemütsbewegungen und der Überzeugungen ging Paracelsus deutlich weiter und war radikaler als das, was die alte Vier-Säfte-Lehre z.B. über den cholerischen oder sanguinischen Typus und die Folgen einer Disharmonie zu sagen hatte. Ihn trieb immer noch die Frage um nach den Ursachen des plötzlichen Schlages, den sein Vater getroffen hatte und dessen direkter Zeuge und Verursacher er selbst gewesen war, um. Paracelsus vertrat die neue Ansicht, dass die Medizin auf Beobachtung und Erfahrung beruhen müsse, das spekulative geschlossene System des Galenus hindere nur daran, und dazu zählten - völlig ungehörig - auch die Erfahrungen der einfachen Baader oder der so genannten Hexen.
In Antonios Herz pochte es deutlich, als er das hörte, und er musste an seine Zeit in den dunklen Hafenvierteln in Genua zurückdenken. Wie dankbar war er für die letzten Offenbarungen seines Vaters gewesen, und doch war etwas im Dunklen geblieben, ein letztes Geheimnis nicht geklärt worden. Antonio schloss sich Paracelsus für eine Weile an. Dessen unbedingte Leidenschaft für die Medizin und seine Liebe zu Gott und den Menschen beeindruckte ihn tief. Seine ungestillte Sehnsucht nach Antworten auf seine Fragen konnte der Lehrer aber auch nicht befriedigen. Bei ihren Diskussionen über die Entstehung und Heilung von Krankheiten schaute der Lehrer Antonio immer wieder milde an und sagte schmunzelnd: „Hab Geduld, die Zeit der Erkenntnis wird kommen. Gott wird uns schrittweise in die Geheimnisse seiner Schöpfung Einblick gewähren. Wir sind dazu berufen. Aber du musst deinen eigenen Weg gehen, deine eigenen Erfahrungen sammeln und klug bedenken, und vielleicht fügst du der Medizin ein weiteres kleines Kapitel hinzu. Aber deine Hauptaufgabe als Arzt ist immer die Menschenliebe. Das ist die einzige wirkliche Medizin! Vergiss das nie.“
Nach einer Weile trennte sich Antonio von Paracelsus und zog für ein paar Jahre als Wanderarzt in den fruchtbaren Ebenen des Po umher, fast immer geschätzt und geachtet für seine ruhige und klare Art und sein sicheres medizinisches Urteil. Schließlich kehrte er nach Genua zurück, wo er sich niederließ, eine Frau nahm und eine Familie gründete. Das Verhältnis zwischen ihm und seinem Bruder Giorgio blieb immer ein wenig angespannt, was vor allem an einer unerklärlichen leichten Überlegenheit lag, die Giorgio an dem Bruder zu spüren schien und die zu einer gewissen Fremdheit zwischen ihnen führte. Antonio und seine Frau Emilia bekamen vier Söhne und drei Töchter, während Giorgios Ehefrau zu dessen großem Kummer kinderlos blieb, nachdem ihr erstes Kind zu früh zur Welt gekommen und kurz nach der Geburt gestorben war.
Zwei der Söhne Antonios traten noch zu Giorgios Lebzeiten in dessen Lehre und arbeiteten sich in die eigene Welt eines Handelshauses ein. Sie lernten die neuen Handelsbeziehungen mit dem Norden nach den großen religiösen und politischen Umwälzungen des Jahrhunderts kennen und nutzen. Die Zeit der rivalisierenden päpstlichen und kaiserlichen Macht über ganz Europa stand vor seiner größten und letzten Zerreißprobe.
Insbesondere die neuen protestantischen Reichsstände in den deutschen Fürstentümern des Habsburgerreichs Karls des V. interessierten die Söhne Antonios an, und so wurde der alte Traum Giovannis erneut geträumt. Aber es sollte über 300 Jahre dauern, bis es wieder einen Arzt in der Familie Starna geben sollte.
1.3 Ala am Gardasee 1660 (Luigi Starna)
Der Handel ist die Wahrheit der Religion
Luigi Starna stand an der Brüstung seiner Villa und schaute auf den großen Innenhof. Fuhrwerke fuhren ein und aus, Fässer wurden über den Hof gerollt, Tuchballen und große Kisten wurden hin und her getragen. Mit Stolz und Freude sah er auf diese Bewegung von Waren, dieses hin und her von Gütern. Der Handel war das Schönste und Größte, was die Menschheit zustande gebracht hatte, und er war einer von denen, die den Handel betrieben. Er hatte die Handelsstation hier in Ala aufgebaut und den Handel über die Alpen in die nördlichen Länder vorangetrieben. Sein Vater, der alte Bertoldo Starna, hatte ihm bereits als jungem Mann geraten, eine Niederlassung nahe der Alpen zu gründen, um von dort aus die schwierige Passage über die Pässe durch das Gebirge in Angriff zu nehmen. Der Vater, Enkel von Giovanni-Antonio und Urenkel von Antonio Starna, hatte es noch von Genua aus versucht, aber der Weg war zu lang, zuviel ging unterwegs verloren. Es gab viele Diebe und Räuber auf der langen Strecke an der ligurischen Küste entlang und durch die Po-Ebene bis zum Alpenrand an den großen Seen. Aber die Vision des Vaters war immer lebendig geblieben und hatte sich auf ihn, den Sohn, übertragen: Handel treiben mit dem Norden. Bertoldo Starna hatte stets mit leuchtenden Augen von den reichen Städten im Norden erzählt, von den alten römischen Siedlungen im Rheintal bis hin zu den holländischen Hafenstädten auf der einen Seite und den bayrischen und sächsischen Städten als Stationen auf dem Weg nach Osten ins große russische Reich auf der anderen.
Handel! Für Bertoldo war Handel das verbindende Element der Menschheit und der Antrieb des Fortschritts. Und Bertoldo wollte den Handel nach Norden ausweiten, an das alte Netzwerk der Hanse anknüpfen, das war seine Vision für das Handelshaus Starna. Diesen Traum hatte er von seinem Ahnvater Giovanni geerbt.
Aber die Zeiten waren unruhig und gefährlich gewesen. Die Reformation und ihre Folgen hatten die Länder im Norden zuletzt in diesen wahnsinnigen 30jährigen Krieg getrieben, der erst vor wenigen Jahren durch den westfälischen Frieden beendet worden war. Zwar war Krieg kein Hinderungsgrund für den Handel gewesen, dennoch hatten sich die Starnas mit der Idee der Ausweitung der geschäftlichen Aktivitäten nach Norden zurückgehalten. Bertoldo war ein vorsichtiger und gewissenhafter Kaufmann. Er hatte seine Vision, aber er dachte in langen Perspektiven von Generationen. Und dass er ihn, seinen dritten Sohn Luigi, zur Gründung der Niederlassung in Ala veranlasst hatte, war eben nur ein Baustein seiner weitsichtigen Planung.
Luigi atmete tief ein und aus. Jedes Mal, wenn er an seinen Vater dachte, war er berührt. Diese visionäre Kraft! Er selbst fühlte diese Vision auch in sich, aber er hatte immer das Gefühl, nicht so stark darin zu sein wie der Vater. Vielleicht war das der Grund, weshalb er noch nicht den Schritt über die Alpen hatte machen können.
Ohne den klaren Auftrag des Vaters wäre es nicht gegangen.
Luigi war ein nachdenklicher und aufgeschlossener Mann. Er liebte die Künste und die Wissenschaften, er liebte die wunderbare Zeit, in der er lebte und in der ständig neue Entdeckungen gemacht wurden, alte Systeme zerfielen und Neues entstand. Die Unruhen, Aufstände und Kriege im Norden hatten ihm keine Angst gemacht wie manchen seiner frommen Zeitgenossen in den letzten hundert Jahren. Er hatte darin immer die Entwicklung und den Fortschritt erkannt und gesehen. Aber, das gestand er sich inzwischen ein, er selbst war kein visionärer und mutiger Mann, der eine solche Veränderung vorangetrieben hätte. Er nahm daran Anteil, und er versuchte so viel wie möglich zu erfahren von den Dingen, die an den Königs- und Fürstenhöfen wie an den Universitäten diskutiert und verhandelt wurden. Er wusste von den Grausamkeiten der Inquisition und durchschaute sie als Dokument eines letzten Aufbegehrens der Autorität der Papstkirche vor ihrem Zerfall. Er erfuhr von den Entdeckungen der Medizin und hatte von dem Flamen Andreas Vesalius und dem Engländer William Harvey und den vielen anderen des letzten Jahrhunderts gehört, die in Padua und Venedig gelehrt hatten und das eineinhalb Jahrtausende geltende System der Humoralpathologie des Galenus überwunden hatten mit ihrer Wissenschaft der genauen Beobachtung der konkreten Phänomene. Und er hatte Sympathien für die Nachfahren dieses Martinus Luther, die der unfassbaren Korruption der Papstkirche etwas entgegensetzt hatten. Eine – nein, viele neue Glaubenslehren, die vermehrt „protestantisch“ genannt wurden, waren entstanden und hatten etwas über Gott zu sagen gehabt, was wirklich unerhört gewesen war: Gott sähe den einzelnen Menschen an, es stünde kein Klerus zwischen ihnen. Kein Ablass, keine Steuer, keine Beichte vor einem Priester war notwendig für die Erlösung von der Sündenlast, allein ein tiefer Glaube an die heilige Schrift und den Erlöser Jesus Christus, ein aufrichtiger Geist, eine reuige Seele und ein ehrliches Herz. Die Gnade Gottes werde nicht verdient oder verwirkt, sondern geschenkt. Unerhört! Und wunderbar.
Luigi schauderte, als er darüber nachdachte. Hier in Ala galt die katholische Lehre unverändert und unumstößlich. Hier gab es keine Fürsten, die die neue Lehre aus politischen Gründen eingeführt hatten. Und doch waren die Auswirkungen zu spüren, auch hier. Und als Kaufmann hatte er seine Ohren ja sowieso überall. Seine Händler brachten ihm immer wieder Nachrichten aus allen Städten und Gebieten.
Er atmete tief durch. Tief in ihm schlummerte ein Gedanke, den er noch nie ausgesprochen hatte, aber den er immer häufiger ins Bewusstsein holte. Der Handel würde die zukünftige Religion der Menschheit sein. So wie Harvey den Blutkreislauf im Körper des Menschen beschrieben hatte, so würde der Handel in Zukunft der äußere Blutkreislauf der Menschen aller Gesellschaften und Völker sein, und nicht der Glaube und die Hoffnung auf eine ferne jenseitige Erlösung. Und er, Luigi Starna, Sohn von Bertoldo Starna, würde einer der Pioniere dieser neuen Religion des diesseitigen Lebens sein. Er würde seinen Sohn Antonio über die Alpen schicken! Er würde, mit manchen anderen, in die Fußstapfen der Fugger in Bayern und der Hanse an der Ostsee treten und den Handel in den nordischen Ländern mit italienischen Waren bereichern.
Er zitterte leicht. Auf einmal durchfuhr ihn das, was ihm immer zu fehlen schien und dessen Mangel ihm sein Vater oft vorgeworfen hatte: eine Vision. Die Welt ist wie ein großer Körper, der Handel ist wie der menschliche Blutkreislauf, die Sehnsucht nach Entwicklung und Vervollkommnung dieses Körpers, seine Heilung von jedweden Gebrechen der Armut und der Idiotie, ist wie das schlagende Herz.
Signore Starna? Ihr Vater hat nach Ihnen gerufen. Sie sollen nach Genua reisen, er möchte mit Ihnen sprechen. Hier ist das Schreiben, es ist eben gerade mit den Transporten aus Genua angekommen.
Die Stimme seines Dieners hatte ihn aus den Gedanken gerissen. Er schaute hoch und blickt in das Gesicht des Mannes vor ihm.
Matteo, Grazie. Ich werde mit der Signora sprechen, sag ihr Bescheid. Und bereite dann die Reise vor, ich werde morgen früh abreisen.
Luigis Körper straffte sich und er richtete sich auf. Leonarda würde es verstehen und ihm raten, so bald wie möglich zu fahren. Und er wusste sein Haus bei ihr in guten Händen. Er ging zu ihren Räumen hinüber und klopfte an die schwere Tür.
Luigi! Mein Liebster! Ach, ich habe schon von Matteo gehört. Dein Vater ruft nach dir. Es ist so weit, nicht wahr? Ihr habt euch zwei Jahre nicht gesehen. Er wird wissen, dass sein Ende naht und er seine Geschäfte ordnen muss, obwohl doch im Grunde schon alles längst geordnet ist, wie bei euch Starnas üblich. Komm her, mein guter Mann, ich liebe dich und will dich noch einmal nah bei mir haben, bevor du abreist. Was wirst du ihm berichten? Was mag er dir zu sagen haben? Ach, ich bin ja nur ein Weib, das von euren Geschäften nichts versteht, und doch interessiert es mich brennend. Wie wird es hier mit uns weitergehen, wenn Bertoldo die Geschäfte in Genua nicht mehr führt? Du weißt, ich halte nicht so viel von deinem Bruder Giacomo, der dort der Nachfolger sein wird. Vielmehr: Ich gebe nicht sehr viel auf eure Bruderliebe, wenn ihr im Geschäftlichen zu Konkurrenten werden solltet. Und so viel habe ich begriffen, seit ich mit dir lebe, mein Liebster: Im Geschäftlichen ist jeder der Konkurrent des anderen. Ihr habt die Religion auf die Erde geholt, so hast du es einmal gesagt, und damit habt ihr die Demut und die Liebe verloren. Ihr handelt beide, Giacomo genauso wie du, um des Gewinnes willen, auch wenn ihr immer behauptet, der Gewinn sei nur dann vorteilhaft und von Dauer, wenn er allen Beteiligten eines Geschäftes jeweils auf ihre eigene Art zukomme.
Liebste Leonarda, du bist nicht nur schön und voller Anmut, sondern auch klug und weise, was wie du weißt einer Frau eher zur Gefahr wird. Aber du weißt dich auf wunderbare und geschickte Weise immer dann zu zügeln, wenn es darauf ankommt, den Männern zu schmeicheln, und hinter den Kulissen hältst du die Fäden in der Hand.
Luigi schaute sie voller Wärme, aber auch mit einem leichten Argwohn an. Sie hatte recht, wie so oft. Und doch war er derjenige, der die Geschäfte führen musste. Und es tat seinem Ruf nicht gut, wenn unter der Hand gemunkelt wurde, dass er eigentlich unter dem Pantoffel seiner Frau stünde. Der Handel war, genau wie der Krieg und die Politik, Männersache. Und da kam es nicht darauf an, ob man recht hatte oder nicht, sondern ob man es schaffen und durchsetzen konnte. Das Recht liegt beim Erfolg, die Wahrheit ist der Gewinn. Männer, die nicht erfolgreich sein konnten, mussten zurücktreten, das galt überall. Und doch, wenn er seine Leonarda jetzt so anschaute, entbrannte er wieder vor Sehnsucht und Liebe nach ihr, obwohl sie sich schon so viele Jahre kannten und sie ihm bereits sechs Kinder zur Welt gebracht hatte und diese ihre deutlichen Spuren an ihr hinterlassen hatten. Wie gerne würde er in einer Zeit leben, in der eine Frau die Geschäfte führen und er sich den Wissenschaften und den Künsten würde widmen können.
Nein, daran, sich um die Kinder und den Hof zu kümmern und das Hausgesinde mit seinem Klatsch und Tratsch anzuleiten, dachte er nicht.
Liebste, ich werde morgen früh abreisen. Ich bringe dir schönes Tuch und Schmuck aus Genua mit, aber ich werde eine Weile dortbleiben. Pass mir auf die Kinder auf, vor allem auf Antonio, er ist mir etwas zu temperamentvoll mit seinen 15 Jahren. Ich werde mit meinem Vater alles besprechen, und alles Weitere liegt in Gottes Hand.
Eine Woche später ritt Luigi Starna mit seinen zwei Gefolgsleuten auf dem väterlichen Hof in Genua ein. Hier war er groß geworden, hier hatte er alles gelernt und mit allen Sinnen aufgesogen, was es über das Geschäftsleben und den Handel zu lernen gab. Hier hatte er als kleiner Junge mit seinen Brüdern und Schwestern zwischen all den Waren gespielt, die Gewürze und Kräuter aus fernen Ländern gerochen, Tuche gefühlt und die Fässer mit Wein und Öl gesehen. Metalle und Werkzeuge, Keramiken und geflochtene Körbe, fein gedrechselte Möbel und Holzgegenstände, vieles, deren Sinn und Bedeutung sich ihm nicht erschloss und er doch fasziniert gewesen war von der Vielfalt und dem Reichtum der Formen, Farben und Gerüche, die all diesen Dingen innewohnte.
All dies hatte er aufgesogen und in sich aufgenommen, und jetzt beim Einritt in diesen Handelshof, dieses kleine Welttheater, diesen Umschlagplatz für alles, was den Menschen zu Diensten sein konnte und dieser Zeit der wunderbaren Erfindungen immer weiter gedieh, überströmte ihn das alte Glück und die alte, kindliche Sicherheit und Geborgenheit dieser Welt wieder neu und es traten ihm ein paar Tränen in die Augen, die er schnell abzuwischen wusste.
Luigi, mein Sohn! Wie schön, dich zu sehen. Danke, dass du gekommen bist. Gebt die Pferde an die Leute ab und komm herauf, deine beiden Begleiter können beim Gesinde bleiben.
Sein Vater stand an der Brüstung über dem Hof und schaute von oben auf die Ankömmlinge herunter. Wie alt er geworden war, und doch wie sehr strahlte er immer noch diese Freude am Leben und an seiner Arbeit aus. Die Mutter war schon viele Jahre tot, gestorben im Kindbett beim siebten Mal, sie war verblutet, so hatten es die Ärzte gesagt, obwohl das sonst eher bei den ersten Geburten vorkommt. Luigi vermisste sie nicht, er hatte kaum eine Erinnerung an die Mutter. Sie war immer mit dem jeweils nächsten kleinen Kind beschäftigt gewesen. Er hatte eine Hebamme gehabt, die er heiß und innig geliebt hatte und an deren Brüsten er am liebsten für den Rest seines Lebens liegen geblieben wäre, wenn nicht das Leben selbst mit seinem Drang zur Bewegung und Entdeckung ihn davon weggetrieben hätte.
Komm herein, Luigi. Giacomo kommt später dazu, zuerst will ich mit dir unter vier Augen sprechen. Du weißt, worum es geht. Ich spüre, dass meine Kräfte schwinden und meine Zeit zu Ende geht, auch wenn es dir nicht so erscheinen mag. Ich will rechtzeitig die Dinge ordnen, du weißt es. Aber bevor wir über die Aufteilung und die zukünftige Zusammenarbeit zwischen dir und Giacomo unter dem Dach des Handelshauses der Gebrüder Starna reden, will ich dir etwas zeigen.
Bertoldo stand auf und ging mit deutlich beschwerlichen Schritten zu der großen Truhe herüber, die schon immer der Hort der großen Geheimnisse des Vaters gewesen war. Er hob den Deckel an und nahm eine Schatulle heraus, die er zurück an den Tisch trug, an dem die beiden saßen.
Diese Schatulle enthält die Geschichte unserer Familie, jedenfalls ein wesentliches Stück davon. Du sollst es mitnehmen und in Ehren halten. Giacomo bekommt das Haus und den Hof hier. Ich habe ihm von allem erzählt, es hat ihn nicht so interessiert. Er ist mehr der Mensch der Gegenwart, weißt du, na ja, du kennst ihn ja.