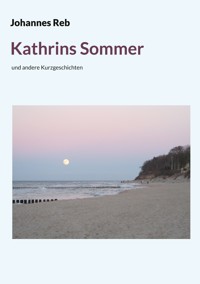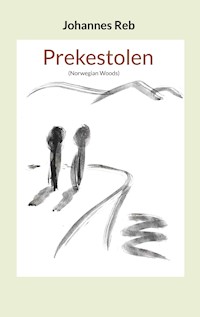
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Bildhauer Lutz Vonholtz lebt seit Jahrzehnten in Norwegen, als er 1995 von einem Journalisten mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird, die er eigentlich hinter sich lassen wollte. Als Kriegskind in Weimar aufgewachsen verliebt er sich in den 60er Jahren in Marianne, die die Invasion der Alliierten in der Normandie als junge Frau erlebte. Ihre Ehe scheitert trotz Liebe und Leidenschaft katastrophal und Lutz findet sich Anfang der 70er unter mysteriösen Umständen in Norwegen gestrandet wieder. Während er dort sein Überleben organisert, versucht er sich in seinem Tagebuch über sich und seine Anteile an der Katastrophe klar zu werden. Warum mussten Marianne und die Kinder sterben? 20 Jahre später sucht ihn der Journalist auf, um den vermeintlichen Familienmord als Sensationsgeschichte zu enthüllen. Zwischen den beiden Männern entfaltet sich eine spannungsgeladene eskalierende Beziehung um die Frage nach Schuld und Verantwortung, die schließlich in einem dramatischen und vielschichtig überraschenden Höhepunkt auf der berühmten Felsplattform 'Prekestolen' über dem Lyse-Fjord mündet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch:
Der Bildhauer Lutz Vonholtz lebt seit Jahrzehnten in Norwegen, als er 1995 von einem Journalisten mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird, die er eigentlich hinter sich lassen wollte.
Als Kriegskind in Weimar aufgewachsen verliebt er sich in den 60er Jahren in Marianne, die die Invasion der Alliierten in der Normandie als jungeFrau erlebte. Ihre Ehe scheitert trotz Liebe und Leidenschaft katastrophal und Lutz findet sich Anfang der 70er unter mysteriösen Umständen in Norwegen gestrandet wieder. Während er dort sein Überleben organisert, versucht er sich in seinem Tagebuch über sich und seine Anteile an der Katastrophe klar zu werden. Warum mussten Marianne und die Kinder sterben?
20 Jahre später sucht ihn der Journalist auf, um den vermeintlichen Familienmord als Sensationsgeschichte zu enthüllen. Zwischen den beiden Männern entfaltet sich eine spannungsgeladene eskalierende Beziehung um die Frage nach Schuld und Verantwortung, die schließlich in einem dramatischen und überraschenden Höhepunkt auf der berühmten Felsplattform 'Prekestolen' über dem Lyse-Fjord mündet.
Über den Autor:
Unter dem Pseudonym Johannes Reb schreibt der Autor Romane, Kurgeschichten, Gedichte und Essays. Der Roman ist erstmals 2010 unter dem Titel "Norwegian Woods" bei artislife/Hamburg erschienen, für die Neuauflage wurde er durchgesehen und geringfügig verändert.
Meiner lebensklugen Frau
und meinen wunderbaren Töchtern gewidmet
Norwegian Wood
I once had a girl
Or should I say
She once had me
She showed me her room
Isn’t it good?
Norwegian wood.
She asked me to stay and she told me to sit anywhere
so I looked around and I noticed there wasn’t a chair
And when I awoke
I was alone
This bird has flown
So I lit a fire
Isn’t it good?
Norwegian wood.
(John Lennon)
Inhalt
Vorspiel
Intro
Kapitel 1
Brief von Lutz Vonholtz
Weimar, Januar 1945:
Tagebucheintrag von Marianne Dubois
Vierville-sur-mer/Normandie, November 1944
Kapitel 2
BILD-Zeitung, 8.8.1970
Ingolstädter Kreiszeitung, 12.8.1970
BILD-Zeitung, 24.2.1971
Lutz’ Tagebuch
Kapitel 4
Ingolstädter Kreiszeitung, 3.3.1995
Ingolstädter Kreiszeitung 12.5.1995
Ingolstadt und Bergen, 1995
Zwischenspiel
Kapitel 5
Prekestolen I
Prekestolen II
Vorspiel
Es war in dem Jahr der Wahl von Barack Obama zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Eine neue Stimmung zog um die Welt, voller Erleichterung, Hoffnung und Zuversicht. Obwohl jeder den Unterschied zwischen Wunsch und Sachzwang kannte und wusste, dass früher oder später Ernüchterung und Enttäuschung folgen mussten, waren die Menschen in den meisten Teilen der Welt dankbar für diesem Wahlausgang, für dieses Zeichen. Es geht doch, schienen sie zu rufen. Mir ging es ähnlich.
Träume gehören wohl zu den stärksten Antriebsfedern im Weltgeschehen, auch wenn manche nicht ohne Berechtigung sagen: it’s the economy, stupid. Könnte es nicht auch heißen: it’s dream and hope, stupid? Oder sogar: it’s love, brother? Es bleibt ein Beigeschmack der Dialektik individueller und gesellschaftlicher Kräfte. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
Ich befand mich im Frühjahr auf einer literaturwissenschaftlichen Tagung in Frankfurt/Oder. Diese Stadt an der Grenze zu Polen ist, wie so viele andere auch, gezeichnet von den Hoffnungen und Verletzungen der Geschichte Europas. Einstmals blühende Handels-und Hansestadt, Garnisonsstadt des großen Friedrich, verkümmert im Schatten Berlins, Aufmarschstätte für Hitlers Polenfeldzug, DDR-Grenzstadt zum verbrüderten, dann Schengen-Grenzstadt zum nicht dazugehörigen Nachbarn, jetzt mühsam animierte Brückenstadt der Verständigung. Die Viadrina, deutsch-polnische Universität, Aushängeschild und Zukunftsbeschwörung, fragt in einem workshop der Tagung nach den Spuren der Geschichte in der postmodernen Erzählung. In Zeiten von Kon- und Dekonstruktivismus will sie zu einer geistigen Ortsbegehung zwischen Wunschfantasie und Dokumentation in der Literatur herausfordern.
Kluge Beiträge aus allen relevanten Fakultäten waren zu hören. Sie betonten in verschiedensten Stimmen Notwendigkeit wie Unmöglichkeit, Eindeutigkeit wie Zwiespältigkeit des gesellschaftlichen Auftrags an die Literatur, dem Menschen in seiner Zeit eine individuelle Stimme zu geben. Das Humanum wurde beschworen und relativiert, Ernsthaftigkeit und Ironie als streitende Geschwister des Geistes ins Feld geführte, alte Meister gestürzt und re-inthronisiert. Nach inspirierten Vorträgen und leidenschaftlichen Debatten war ich aufgewühlt, angeregt und zutiefst verwirrt.
In einer Kaffeepause machte ich die Bekanntschaft einer polnischen Studentin, die nicht ganz so verwirrt war wie ich. Wir verabredeten uns für den Abend in einem Restaurant an der Oder, sie wolle mir etwas erzählen. Am Ende ihrer Geschichte, die die Geschichte ihrer Familie voller Schmerz und Trauer, Schuld und Sehnsucht, Liebe und Lebenskraft war, fragte sie mich: „Ich möchte das alles aufschreiben. Nacherfinden, um den Träumen anderer etwas Nahrung zu geben. Vielleicht auch, um mich selbst vor den Gespenstern unserer Geschichte zu retten. Was hältst Du davon?“
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sie war nett, ihr Eifer rührte mich. Aber ich fand es auch lächerlich, vielleicht aus Neid auf ihren Enthusiasmus. Ich kam mir alt vor. Was wäre wahr, was erfunden? Was wäre hineinprojiziert, Eltern und Großeltern von sich in den Mund gelegt? Wovon ernähren sich unsere Träume eigentlich, wenn wir lesen? Ich stellte mir ein Kinderbuch vor, in dem ein Fantasietier von den Figuren der Lieblingsbücher eines Jungen mit Sätzen gefüttert wird und ihm, so gestärkt, hilft, gegen seine Gespenster zu kämpfen.
Sie lachte über meine Idee und fragte, woher das Tier denn wisse, was gute und was schlechte Gespenster sind. Ich riet ihr zu, ihre Geschichte aufzuschreiben, sie lächelte dankbar, sie hatte nichts anderes erwartet.
Am nächsten Tag machte ich mich an die Arbeit mit der Geschichte von Lutz Vonholtz.
Intro
Lutz Vonholtz, Beginn seines Tagebuches, Norwegen 1971
Wie soll ich dies hier anfangen? Ich will schreiben. Über mich. Wie ein Tagebuch. Nicht nur über meine jetzige Verfassung, sondern über die Vergangenheit. Ich muss schreiben, um mir klar zu werden über mich und mein Leben. Über das, was mein Leben hin und her geworfen hat. Seit einem Jahr bin ich nun hier in dieser Hütte in Norwegen. An der Küste, über die Felsbacken hinweg geht der Blick über den Skagerrak. Als ich vor 12 Monaten hier ankam, völlig am Ende von allem, habe ich mich gefragt, was denn jetzt werden soll aus mir. Ich war gestrandet und hatte alles verloren. Ich hatte in all den Tagen meiner eigenartigen Flucht hierher niemals weiter als bis zu diesem Moment gedacht. So war ich angekommen in Kristiansand, am 24. August letzten Jahres.
Kapitel 1
Brief von Lutz Vonholtz (15) an einen imaginären Freund. Weimar, 10.1.1945
Lieber Jo!
Ich schreibe dir diesen Brief, obwohl es dich gar nicht gibt. Ich muss aber jemandem schreiben, ich halte es anders kaum noch aus.
Der Krieg wird immer schlimmer. Ich habe dauernd Angst, aber ich darf es nicht zeigen. Von Papa haben wir seit Monaten nichts mehr gehört, vielleicht ist er tot, in Russland gefallen. Mama hat auch Angst davor, was soll dann werden? Man darf nicht darüber sprechen, es ist „Wehrkraftzersetzung“. In der Hitlerjugend und in der Schule müssen wir zuversichtlich sein und an Deutschlands Zukunft glauben. Das ist aber dumm, wenn schon so viele tot sind und dauernd Bomben fallen. Neulich ist das Nachbarhaus völlig zerstört worden. Es sieht komisch aus: Die Badewanne von Schneiders hängt in der dritten Etage halb in der Luft.
Was soll bloß werden, wenn das alles vorbei ist? Ich muss ja auch erwachsen werden. Nicht nur das mit den Mädchen ist merkwürdig, auch sonst alles. Mama sagt, ich sei pfiffig, da hat sie bestimmt Recht. Aber kann man von Pfiffigkeit leben? Die Erwachsenen kommen mir manchmal so vor, als ob sie noch genauso Kinder seien wie ich, nur in großen Hosen. Ich fühle mich nicht wie fünfzehn, obwohl ich neulich behauptet habe, ich würde gerne zum Volkssturm gehen und das Vaterland verteidigen wie ein ganzer Mann. Aber ich habe das nur gesagt, weil ich ein schlechtes Gewissen habe wegen einer anderen Sache. Zwei aus meiner Klasse sind schon beim Volkssturm umgekommen.
Ich vermisse Papa am allermeisten, aber das sage ich natürlich niemandem. Man sagt immer nur, dass man stolz ist auf die Väter an der Front. Ich bin natürlich auch stolz, trotzdem wäre es mir lieber, wenn er hier wäre. Papa kommt bestimmt zurück, dann hilft er mir und ich helfe ihm, und alles wird gut.
Alles Gute
Dein Lutz
Weimar, Januar 1945:
Das dumpfe Grollen am Himmel wurde langsam leiser, entfernte sich, kam noch einmal näher, entlud sich in explosiven Erschütterungen und verschwand dann völlig. Zurück blieben die Angst und die Zerstörungen. Eine Fabrik brannte, einige Häuser in den Straßen in der Nähe der Fabrik waren eingestürzt, wohl durch die Druckwelle, ebenso wie das Dach der Stadtkirche St. Peter und Paul. Entfernt waren Schreie zu hören, Angstschreie und Schmerzensschreie, bald übertönt von lautem Gebrüll, herrischen Befehlen und militärischen Stiefelschritten.
Lutz wusste nicht, was er tun sollte. Er war allein im Haus, die Mutter hatte die Nacht auf der Krankenstation verbracht, der Vater war – wie alle Väter – an der Front. Die Mutter schwieg und starrte auf irgendeinen Punkt an der Wand, wenn er sie nach ihm fragte.
Er war nicht, wie es Vorschrift war, mit Einsetzen der Sirenen in den Keller gegangen. Er war im Bett liegen geblieben, hatte sich die Decke bis zum Hals hochgezogen, dann über den Kopf. Hoffentlich sieht mich keiner aus der Gruppe, hatte er gedacht, sie würden mich für einen Feigling halten, für einen Befehlsverweigerer. Etwas Schlimmeres könne es für die deutsche Jugend und das deutsche Volk in dieser schweren, schicksalsträchtigen und dabei immer hoffnungsvollen und zukunftsfrohen Zeit nicht geben, so hatte sein Jungsturmführer noch am letzten Samstag getönt. Lutz schauderte und zog die Knie unter der Decke an bis zur Brust, zog sich zusammen wie ein schutzbedürftiges Kind, obwohl er mit seinen fast 16 Jahren schon als Mann galt und sich ausrechnete, in den nächsten Tagen zum Volkssturm eingezogen zu werden. Er hatte, als der Fliegeralarm losging und die Sirenen heulten, einfach nicht aufstehen können, wie gelähmt hatte er dagelegen. Die Wärme des Bettes schien die einzig mögliche und größte Sicherheit in der Welt darzustellen.
So war es Morgen geworden, seine Straße und sein Haus waren von den Bombenwürfen der Engländer in dieser Februarnacht nicht betroffen gewesen, sie hatten der Farbenfabrik im Nachbarviertel gegolten. Eigenartigerweise schien eine klare, herrliche Wintersonne, ein wunderschöner Tag kündigte sich an, wenn nicht Krieg herrschte, würde man jetzt Schlittschuhlaufen gehen mit den Kameraden.
Er schälte sich aus der Bettdecke und wusch sich an der Wasserschüssel. Das kalte Wasser tat ihm gut, er fühlte sich erfrischt und dankbar. Er machte sich etwas zu Essen, trank den Rest Milch, der noch auf dem Tisch stand, und ging aus dem Haus. Auf dem Weg zur Schule sah er, dass die Zerstörungen der Nacht vergleichsweise geringfügig geblieben waren – verglichen mit anderen Fliegerangriffen der vergangenen Wochen. Lutz empfand fast Sympathie für die Scherben und Trümmer zwischen den intakten Häusern, als ob gerade die Präsenz des Zerstörungswerkes seinen Heldenmut und seine Leidensbereitschaft, die ihn in der Nacht so schmählich verlassen hatten, wieder in Kraft zu setzen in der Lage wäre. Dies war auch dringend nötig, denn seine Verunsicherung war noch gesteigert worden durch etwas, was er wieder einmal getan hatte in der Nacht. Niemand durfte davon erfahren. Er selbst würde es am liebsten sofort ungeschehen machen. Er betrieb diese Sache erst seit kurzer Zeit und war unter merkwürdigen Umständen überhaupt erst darauf gekommen. Während er auf seinem morgendlichen Schulweg die Zerstörung seiner Heimatstadt mit einer eigenartigen Mischung aus Genugtuung und Entsetzen wahrnahm, dachte er an die letzte Versammlung der Hitlerjugend-Ortsgruppe. Einer der Braunhemden hatte in einem dieser Schulungsvorträge genannten Indoktrinationsereiferungen über „die verabscheuungswürdigsten und krankhaftesten, den gesunden Volkskörper gefährdenden Verhaltensweisen aus natürlich jüdischer Quelle“ gesprochen und auch die Masturbation genannt. Auf die mutige Nachfrage eines Pimpfen, was das denn überhaupt sei, hatte er dies notgedrungen, mit rotem Kopf, den er durch besonders gehässige und abfällige Rhetorik zu kompensieren versuchte, erstaunlich genau erklärt – jedenfalls genau genug. Alle hatten rote Köpfe bekommen, schämten sich ihrer Röte, fühlten sich durch sie vielleicht sogar verraten als potentielle Sympathisanten „jüdischbolschewistischer Masturbanten“, machten martialische Bemerkungen über diese Schweinereien und klatschten lauter Beifall als bei sonstigen Braunhemd-Belehrungen.
Nach der Veranstaltung im Jahnhaus am Sportplatz war er eigentümlich berührt nach Hause gegangen. Diese so genannte „Schweinerei“ war ihm nicht aus dem Kopf gegangen, hatte im Gegenteil seine Fantasie gegen seinen Willen aufgeheizt. Männlichkeit war ihm bisher nur als Heldentum und Kampfeskraft, Geschlecht nur als Rassebegriff, dessen Reinheit zu bewahren höchste Pflicht sei, begegnet. Dass Mann und Frau zueinander gehörten, um sich „fortzupflanzen“, wusste er natürlich, aber im Grunde hatte er nicht die geringste Ahnung, worum es dabei eigentlich ging. Die Eltern waren seit fünf Jahren durch den Krieg getrennt, er hatte sie nie als ein Liebespaar gesehen. Am wenigsten konnte er mit den seit längerem schon in den unpassendsten Momenten in und an ihm aufsteigenden Regungen seines Unterleibes anfangen. Es war ihm lästig und unheimlich. Und so war es in der Nacht nach dieser Jungvolk-Veranstaltung vor einigen Wochen dann folgerichtig geschehen, jüdisch-bolschewistisch hin oder her, hatte er gedacht, niemand weiß ja davon, er hatte es ausprobiert. Schließlich war es ihm auch nach einigen schmerzhaften Fehlversuchen gelungen. Wobei er über die Art und Weise dieses Gelingens völlig überrascht war. Davon hatte er wirklich keine Ahnung gehabt. Danach wurde die Masturbation zu einem regelmäßigen Bestandteil seiner Nächte. Er genoss die unmittelbare Erleichterung, aber am nächsten Tag schämte und verachtete er sich dafür. Dennoch machte er weiter, nicht zuletzt auch, weil er diese beruhigende und erleichternde Wirkung dankbar annahm: Sie reduzierte seine Angst, diese ganz unheldenhafte Angst, die ihn im Dunkeln beschlich. So war es auch am gestrigen Abend gewesen, er hatte es getan und war dann erleichtert und entspannt eingeschlafen. Sein letztes Fantasiebild war das eines nackten schönen Mädchens gewesen, das ihn anstrahlte, sich dabei ihre rechte Brust mit der linken und die Scham mit der rechten Hand bedeckte, und mit zärtliche Stimme flüsterte: „Komm, Lutz, zu mir ...“
Als die Sirenen des Fliegeralarms ihn aus dem Schlaf rissen, hatte er sie vergessen, aber die friedliche, liebevolle Wärme seines Bettes wollte er nicht verlassen.
Tagsüber, wenn ihm ins Bewusstsein trat, was er jeden Abend machte, wurde ihm unwohl. Er fand es verabscheuungswürdig und undeutsch. Insofern kam ihm die langsam fortschreitende Zerstörung seiner Heimatstadt durch die feindlichen Bombenangriffe wie auch die ahnungsvolle Bedrohung durch die Truppen, die längst die Reichsgrenzen überschritten hatten, wie ein Spiegelbild vor. Der Feind als Verkörperung des Bösen und Schlechten zerstörte ihn, seine Stadt, seine Welt. Lutz ahnte gleichzeitig, ohne dass es zu einem klaren Gedanken reifte, dass er dieses scheinbar demütigende Zerstörungswerk an sich selbst auch mit Lust betrieb, dass ihn niemand dazu zwang, dass es sich in ihm entwickelte und er es wie eine Befreiung genoss. Die Befreiung der Nacht tauchte als Zerstörung bei Tageslicht wieder auf. Die Zerstörung der großen deutschen Werte, an die er glauben wollte. Das aus Tagessicht schändliche Tun der Nacht an seinem Geschlecht schien ihn zu entwerten, er als Person wurde für sich zu Schmach und Schande. Um sich davon zu befreien, hatte er sich zum Volkssturm gemeldet, eine spontane Handlung, die er sofort wieder bereute. Da er aber glaubte, dass er kaum noch eingezogen werden würde, empfand er die fortschreitende Zerstörung seiner Stadt als persönlich berechtigte Strafe. All dies ging Lutz auf seinem Weg zur Schule in vagen Gedankennebeln durch den Kopf. Eine Art Hintergrundrauschen, mehr Empfinden als Erkennen.
Dann trat eine andere Empfindung vor dieses Rauschen seiner unreifen Seele. Eine klare und eindeutige: Er freute sich auf die Schule! Er würde klare Worte und eindeutige Anweisungen bekommen, wahrscheinlich würde ein Schülertrupp zusammengestellt werden, um Aufräumhilfe zu leisten.
Zwei Monate später war der Krieg für ihn zu Ende. Die Amerikaner waren in Weimar einmarschiert, und Lutz versuchte sich in dieser völlig veränderten Welt zurechtzufinden. Aus dem Osten kamen Tausende von Flüchtlingen, die irgendwo einquartiert werden mussten. Lutz war nicht mehr beim Volkssturm gewesen, was sich als Vorteil herausstellte, denn so musste er sich keiner unangenehmen Befragung durch die Amerikaner stellen. Als Jugendlicher ohne Nazi-Vergangenheit konnte er sich frei bewegen, was aber nichts anderes hieß, als den ganzen Tag unterwegs zu sein und auf die eine oder andere Art und Weise das Notwendigste für sich und seine Mutter zu organisieren. Er sah sie nur noch gelegentlich. Sie musste im Dauereinsatz Krankenversorgung leisten und bekam dafür Lebensmittelzuwendungen. Lutz schlug sich mit Schwarzmarktgeschäften durch. Er verhökerte Fundstücke, wie er es nannte, die er in den Häuserruinen fand. Mit den GIs kam er gut zurecht, deren unverkrampfte und fröhliche Art gefiel ihm. Er lernte schnell amerikanisch sprechen, zumindest soviel wie er brauchte, und hatte bald einige spezielle „Freunde“ für die er Gelegenheitsdienste erbrachte. Er genoss diese ganz andere Art und Weise, als junger Mann ernstgenommen zu werden. Er dachte schon nicht mehr an die erst so kurze Zeit zurückliegende Kriegszeit, an die Nazi-Propaganda, an seine Ängste und seine Fantasien. Er freute sich über dieses Abenteuer der Gegenwart voller Veränderung und Aufbruch, das das Schicksal ihm gerade ermöglichte.
Noch bis vor kurzem bei den Wehrmachts- und HJ-Aufmärschen hatte ihn das fast maschinenartige Zusammenwirken der einzelnen Soldatenkörper in einen großen gleichförmigen Ablauf begeistert. Welche Macht und uneinnehmbare Stärke hatte das ausgedrückt! Jetzt beeindruckten ihn die lockere Formation und die Kontaktaufnahme der in Weimar einmarschierenden GIs. Sie schauten den Leuten mit Neugier und Interesse in die Augen. Lutz hatte einen Soldaten wahrgenommen, vielleicht Anfang bis Mitte Zwanzig, der da neben einem Jeep marschierte, das Maschinengewehr locker über die Schulter gehängt, einen offenbar nicht so schweren Rucksack auf dem Rücken und allerhand Gerätschaft an der Koppel. Für einen Moment hatten sich ihre Blicke getroffen, dann war Lutz neben der Kolonne hergelaufen und hatte den Soldaten im Blick gehalten, bis er ihn an einer Straßenecke verlor.
Zwei Tage später waren sie sich wieder begegnet, und schließlich wurde Lutz so etwas wie ein Laufjunge für den Soldaten. Dieser männliche Freund tat ihm gut. Er war ein Vorbild in seiner draufgängerischen, fröhlichen und an allem interessierten Art, die so anders war als Lutz früheres martialisches Gehabe, mit dem er seine Unsicherheit überspielt hatte. Lutz sollte alles über Deutschland erzählen, dafür erzählte er Lutz von Amerika. Und von der alliierten Invasion in der Normandie, von einem Freund, der am Strand neben ihm im Wasser gestorben war, von den zähen Kämpfen und Schlachten auf dem Weg zur Befreiung Frankreichs und schließlich von der Eroberung Hitler-Deutschlands. Lutz hörte gebannt zu. Hier war ein Mensch, der sein Leben eingesetzt hatte, um Tausende von Kilometern von seiner eigenen Heimat entfernt Menschen und Länder von etwas Bösem zu befreien, was er selbst, Lutz, bis vor kurzem als den Inbegriff aller Tugend verstanden hatte. Und der ihm gegenüber nicht als Feind auftrat, sondern als interessierter Freund.
„Tell me about Normandy, Peter“, fragte er ihn.
„Why do you want to know?“
„It must have been tremendous. The landing I mean. Have you had a french girl there?“
„Oh boy, I wished I had. No, I couldn’t. But a friend of mine had. Yeah, she must have been wonderful.“
Und so gingen die ersten Nachkriegswochen für Lutz in einer seltsamen Mischung aus Geschichten, Botendiensten und Überlebensorganisation vorüber.
Drei Ereignisse traten in kurzer Zeit hintereinander in Lutz’ Leben, die zusammen diese Phase seines amerikanischen Traums, wie er es später nennen würde, beendeten. Bei ihrem Einmarsch hatten die Amerikaner auch das KZ Buchenwald auf dem Ettersberg befreit, und kurze Zeit später, am 16.April, aus einer Mischung schieren Entsetzens, erzieherischer Aufklärungsidee und hilflosem Strafwillens heraus, tausend Bürger der Stadt in das Lager geschickt, um sie mit den Leichen und ausgemergelten überlebenden Juden zu konfrontieren. Lutz Mutter musste mitgehen, sie erzählte später kein Wort davon, aber Lutz las aus ihrem Gesicht das blanke Entsetzen, die Fassungslosigkeit und den quälenden Versuch, durch Schweigen und Leugnung darüber hinwegzukommen. Für diesen gequält-leeren Ausdruck auf dem Gesicht seiner Mutter begann Lutz die Amerikaner zu hassen.
Dann kam der Vater zurück. Er war knapp der russischen Gefangenschaft entkommen, hatte sich durch die Ostgebiete gekämpft und war halb verhungert in Weimar angekommen. Zuerst erkannte ihn niemand. Als die erste Unsicherheit überwunden war und die Mutter den Vater endlich in die Arme geschlossen hatte, fühlte Lutz sofort, dass für ihn andere Zeiten anbrachen. Seine große Hoffnung und Sehnsucht, die er auf den Vater gesetzt hatte, verwelkte in wenigen Tagen. Er hatte sich ausgemalt, wie der Vater ihn, den jetzt groß gewordenen Jungen, mit Kameradschaft und liebevoller Achtung zur Seite nähme und sie beide gemeinsam als zwei Männer das Leben in die Hand nehmen würden. Aber es war völlig anders. Der Vater, innerlich durch erlittenes und anderen zugefügtes Leid im Feld verhärtet und vereinsamt, musste nach den Anstrengungen des Überlebenskampfes der letzten Monate eine Haltung finden, um nicht zusammenzubrechen. Lutz dachte später oft, allen wäre geholfen gewesen, wenn der Vater diesen Zusammenbruch zugelassen oder einfach gestorben wäre. Aber er ließ es nicht zu. Er nahm die Rolle des Familienführers ein, und mit der Gewalt gegen sich selbst, die ihn hatte überleben lassen, ging er nun gegen den neu beginnenden Lebensfrühling seines Sohnes vor, statt sich mit ihm zu verbünden. Er war schroff, streng, schweigsam, unnachgiebig, lieblos und ohne erkennbare Anteilnahme. Sein einziges Interesse galt dem Wiederaufbau der materiellen Existenz. Die fröhliche Lebenskraft, die Lutz an ihm so geliebt und die er in all den Kriegsjahren so vermisst hatte, war verschwunden.
Und schließlich, als drittes Ereignis, zogen die Amerikaner wieder ab und die Sowjets marschierten ein. Weimar gehörte von nun an zur sowjetisch besetzten Zone, und obwohl zunächst an dem allgemeinen Überlebenskampf alles gleich blieb, änderte sich doch die Atmosphäre schrittweise sehr.
Lutz entzog sich nach ersten unsicheren und erfolglosen Annäherungsversuchen dem väterlichen Zugriff soviel er konnte. Die Traurigkeit über die Enttäuschung kompensierte er so gut es ging durch eigene Abenteuer. An den Vater kam niemand mehr heran, er reagierte auf die meisten Menschen einsilbig und unwirsch. Als unglücklicherweise ein junger Kaderoffizier vorbeikam und ihn zu einer Parteiveranstaltung der neu gegründeten SED mitnehmen wollte – aus lauter gutem Willen und mit den Worten, er, Lutz’ Vater, sei doch selbst ein Opfer des Naziregimes und daher besonders prädestiniert –, da rastete bei Lutz’ Vater ein seit langem bereitstehender seelischer Haken ein. Er schlug den Offizier mit der bloßen Faust das Nasenbein in Trümmer, beschimpfte ihn als bolschewistische Judensau, spuckte ihm ins Gesicht und in einem Moment völligen Realtiätsverlustes schrie er ihn an: Dich bringe ich auch noch ins Gas!
Als das heraus war, trat eine unheimliche Stille ein, nur gestört durch das leise Stöhnen des Offiziers. Lutz’ Vater starrte ins Leere, dem Echo seiner eigenen Worte nachhörend, schmerzvoll verzogen sich die Mundwinkel im Moment der Erkenntnis und er flüsterte: „Das war’s jetzt. Ich habe es wohl verdient.“
Zwei Tage später wurde er von sowjetischen Soldaten abgeholt, kam völlig zerschlagen, mit verkrustetem Blut im Gesicht zurück, wurde erneut geholt. Sie brachten ihn ins jetzt von ihnen als politisches Gefängnis genutzte Lager auf dem Ettersberg.
Lutz hat den Vater nie wiedergesehen. Er hat ihn auch nicht vermisst. Oder, anders gesagt, er hatte ihn schon so lange vermisst, dass er jetzt keinen Mangel mehr fühlte. Etwas in seinem Herzen, wofür sonst Vaterliebe zuständig ist, war hart geworden, ohne dass er es richtig bemerkt hatte. Später entwickelte er Hassgefühle. Jedes Mal, wenn er an seinen Vater denken musste (er versuchte es zu vermeiden), empfand er Wut und Verachtung für die brutale Enttäuschung seiner Sehnsucht nach ihm. Er fühlte sich von ihm im Stich gelassen und um etwas Lebensnotwendiges betrogen. Diese Wut sollte lange als Hindernis zwischen ihm und seinem Leben stehen.
Im Zuge der sich neu ordnenden Verhältnisse hatte ihn sein Weg in eine Mechanikerlehre geführt, 1948 bekam er nach mehreren Gesinnungsüberprüfungen, die er mehr durch Treuherzigkeit und Frechheit als durch ideologische Festigkeit bestand, in Leipzig einen Studienplatz für Mathematik. Doch nach dem Vorfall mit seinem Vater war ihm klar geworden, dass er in der DDR auf Dauer nicht bleiben konnte, und zog 1950 in den Westen nach Frankfurt. Die Mutter, innerlich leblos geworden, blieb in Weimar. Lutz begann ein Architekturstudium, nebenher war er kreativ und improvisierend an Aufbauarbeiten und kleinen Geschäften beteiligt.
Er begann eine Liebschaft mit einer Studienkollegin, eine der wenigen Frauen, die Architektur studierten. Für kurze Zeit fühlte er sich als Mann glücklich, dann aber ging die Beziehung zu Ende, ohne dass er recht wusste, warum. Er hatte ein paar Kneipenbekanntschaften, las gerne in der Zeitung die politischen Kommentare und machte sich Gedanken über seine Zukunft, ohne dabei eine Vision zu haben.
Nachts lag er in seinem Zimmer in der Nähe der Paulskirchenruine und wälzte sich unruhig hin und her. Erinnerungen an die Bombennächte durchströmten ihn, an die Ängste und die Selbstberuhigung durch die Masturbation, an seine Scham darüber. An die Jungvolkführer, an den amerikanischen Soldaten, an seinen Vater. Ein Gefühl großen, grundlegenden Mangels durchzog ihn. Er sehnte sich nach etwas, ohne zu wissen, nach was. In seinen Träumen tauchte es manchmal als Tier am Horizont auf, als Pferd oder Löwe, und er rannte atemlos hinterher, mit Gewichten an den Füßen, bis er zusammenbrach.
Tagebucheintrag von Marianne Dubois (17), Vierville-sur-mer, Normandie, 13.11.1944
„Mon chere Journale intime! Heute Nacht werde ich vielleicht erwachsen. Ich weiß, das klingt ein wenig lächerlich, aber so fühlt es sich an. Etwas ganz Besonderes wird geschehen, mein Leben wird sich verändern. Morgen werde ich kein Kind mehr sein. Na ja, ich weiß, dass ich schon lange kein Kind mehr bin, aber das meine ich nicht. Ich meine: eine Frau werden … Ich habe auch Angst davor, ich kann mit niemandem darüber sprechen, mit Maman und Papa schon gar nicht. Aber ich will, dass es jetzt geschieht. Ich will, dass mein Leben anfängt.
Wie es danach wohl sein wird? Bald wird dieser schreckliche Krieg vorbei sein, und ich werde in einer neuen Welt leben. Wenn ich eine erwachsene Frau bin, kann ich tun was ich will. Und Männer sollen dazugehören zu meinem Leben. Ich habe so viele von ihnen gesehen in den letzten Monaten, auch so furchtbar viele tote Männer am Strand. Ich will einen lebendigen Mann, ich will selbst lebendig sein!!! Mit Kindern vielleicht und einem schönen Haus, ich weiß noch nicht.
Ob es schön wird heute Nacht? Ob es weh tut?“
Vierville-sur-mer/Normandie, November 1944
Leise schlich sie aus dem Haus. Vorsichtig schloss sie die Tür hinter sich, damit die Eltern nichts hörten, ging über den Rasen, um den Kies auf dem Weg zu vermeiden, und begab sich nach einem kurzen Stück Straße auf den schmale Pfad, der durch die Dünen hindurch und an den Felsklippen vorbei zum Strand führte. Sie fröstelte trotz der Erregung, die sie empfand, denn es war ein kalter Novemberabend, wolkenverhangen und feucht. Überall um sie herum war etwas zu hören, ein eigenartiges Gemisch von Geräuschen, die seltsame Klangkulisse eines Kriegsalltags, der ein wenig Atem holte und Raum ließ für Wind, Regen, Blätterrauschen und Wellenschlag. Draußen auf dem Meer die Signalhörner der Schiffe, von Land her Rattern von Panzerketten, das Schlagen nasser Zeltbahnen, metallisches Knarren und Klicken irgendwelcher Gerätschaften. Und Stimmen: Soldaten, die flüsterten, Soldaten, die grölten, Soldaten, die befahlen.
Ihr war das alles inzwischen vertraut geworden, sie bewegte sich in dieser kriegerischen Atmosphäre flink und behende und gleichzeitig ständig auf der Hut und fluchtbereit. Ganz im Gegensatz zu ihren Eltern, die mit einer Mischung aus Furcht, Hilflosigkeit und Trotz versuchten, das Geschehen um sie herum zu ignorieren, und so zu tun, als ließe sich wie ehedem ein kleiner Dorfladen betreiben. In der inneren Welt ihrer Eltern fand die schicksalsträchtige Wende im größten Weltkrieg aller Zeiten, die sich direkt vor ihrer Haustür abspielte, nicht wirklich statt. Sie lasen in der Zeitung von der Veränderung des Frontverlaufs und den Auswirkungen auf ihr Land, sie hatten mit den alliierten Soldaten täglich zu tun, aber sie waren nicht in der Lage, daraus etwas für ihr eigenes Verhalten abzuleiten. Wie die meisten Dorfbewohner lebten sie in einer Art Trance, als ob die Anerkennung der sie umgebenden Tatsachen sie völlig überfordern würde. Dabei waren sie durchaus wach und auch in der Lage, tägliche Geschäfte mit den Invasoren, die zugleich Befreier und Zerstörer waren, zu machen.
Marianne aber, mit ihren 17 Jahren, hatte diese neue Realität aufgesogen wie ein trockener Schwamm, von dem Augenblick an, als am frühen Morgen vor 5 Monaten diese Geräuschkulisse mit einer unglaublichen Welle von dumpfem, kriegerischen Grollen vom Meer her und aus der Luft begonnen hatte.
Während sie langsam und vorsichtig den jetzt steilen Pfad abwärts stieg, zogen einige Erinnerungen aus dieser Zeit vor ihrem Auge vorbei. Sie hatte alles wie in einem Rausch erlebt, wie einen gewaltigen, großen Traum voller Gefahr, voller Gewalt, voller Tod, Sterben, Heldentum und Elendigkeit, voller Dramatik – und voller Genuss. Die Invasionstage selbst, diese unglaubliche Ansammlung massivsten Gewaltpotentials, der unaufhörliche Geschützdonner der deutschen Abwehrbatterien, bis sie irgendwann langsam eine nach der anderen erstarben, der Donner der Schiffsgeschütze, die schiere Unzahl der sich langsam und unaufhaltsam annähernden Schiffe, die Wasserfahrzeuge, von denen schließlich nur jedes zehnte überhaupt den Strand erreichte, und dennoch Massen und Massen von Soldaten an Land brachten, sich bewegende und bewaffnete Menschenleiber, die Schreie, das Blut, das gefärbte Wasser, der rote Sand ...
Es war völlig unerwartet über sie gekommen. Noch am Abend zuvor hatte Marianne mit dem netten deutschen Offizier gescherzt, der am Zaun stehengeblieben war. Sie war ein unvoreingenommenes Mädchen. Die Deutschen hatten hier bei ihnen niemandem etwas Böses getan, außer dass sie ihr Land besetzt hatten. Es war mehr so etwas wie Politik, dass die Deutschen jetzt das Sagen hatten. Und dieser gut aussehende Mann, Leutnant mit 23 Jahren, gefiel ihr gut. In seinem grauen Feldmantel und der schwarzen Lederkoppel sah er apart aus, besonders sprachen sie seine warmen, braunen Augen an. Sie hatte mit ihm geflirtet, ihm gespielt schüchtern zugelächelt, nachdem sie ihn im Laden der Eltern bedient hatte. Sie hatte längst gemerkt, dass Männer, vor allem Soldaten, ihre Brüste unter dem Pullover wahrnahmen, ihr auf die Lippen schauten, gelegentlich verstohlen auf den Hintern, und dass den Männern gefiel, was sie sahen. Sie hatte zuerst nicht gewusst, wie sie damit umgehen sollte, es war ihr anfangs unangenehm und peinlich gewesen, aber später genoss sie es, ohne sich weitere Gedanken zu machen, genoss die Bewunderung und benutzte diese Wirkung, forderte sie heraus, spielte mit ihr. Sie spürte eine neue Macht und Freiheit darin, die sie bisher nicht gekannt hatte. Ihrem Vater jedoch gefiel das nicht, er wurde übellaunig und abweisend, wenn sie bediente und deutsche Soldaten im Laden waren. Böse flüsterte er über die „Boches“, etwas von „Collaboration horizontale“. Aber da er sich vorsehen musste vor den Deutschen, kam es zu einer eigenartigen Mischung aus Überhöflichkeit und Unfreundlichkeit, die ihr an ihrem Vater ganz fremd war.
An diesem Vormittag aber, am Tag vor der Invasion, als der deutsche Soldat in den Laden trat, war der Vater nicht da. Der Leutnant lächelte sie freundlich an, sie lächelte zurück, mit allem Charme und dem Wechsel zwischen Schüchternheit und Koketterie, zu dem selbstbewusste und noch unerfahrene, aber ahnungsvolle Mädchen fähig sind. Am Nachmittag hatte sie ihn in den Dünen in der Nähe seiner Geschützstellung auf und ab gehen sehen und war ihm dort wie zufällig entgegengegangen. Er hatte sie freundlich angesprochen, in diesem eigenartigen Französisch, das die Deutschen sprechen, und sie angelächelt.
Am nächsten Morgen kam der Invasionsdonner und sie sah ihn nie wieder.
Jetzt, wo sie den Pfad zum Strand herunterging, um den Amerikaner zu treffen, erinnerte sie sich an diese Szene wie an etwas aus einem anderen Leben.
Es war so unglaublich viel geschehen seitdem. Die Invasion! Später wurde sie zur Befreiung, aber in diesen Tagen war es die Invasion: Die ungeheure, gewalttätige Kriegsmaschine, die da mit ihrem Donner und Dröhnen über das Meer und aus der Luft auf ihren kleinen Heimatort zukam und mit einem gewaltigen Blutzoll schwerfällig, aber unaufhaltsam alles überrannte. Sie bekam nach den ersten Tagen von dem weiteren Verlauf außer Gerüchten nichts mehr mit, denn nachdem die Invasionsarmeen der Alliierten die Küste erobert und ihre ersten Brückenköpfe hinter den Dünen errichtet hatten, lag ihr Dorf, Vierville, bereits hinter der Front. Die Deutschen hatten sich zurückgezogen, waren tot oder gefangen, und auf einmal mussten sie sich auf die Amerikaner einstellen. Alle Gebäude, die nur irgendwie nach dem Bombardement brauchbar geblieben waren – tatsächlich war etwa die Hälfte des Dorfes bei der Landungsschlacht schwer beschädigt worden –, wurden zunächst von ihnen belegt. Der kleine Laden von Mariannes Eltern war in diesen Tagen so etwas wie ein Kuriositätenkabinett innerhalb eines großen Horrorszenarios geworden, ein chaotisches Durcheinander von Tauschhandel und Diebstahl, Einkauf gegen Dollar, amerikanischen Zigaretten und chewing-gum, oder schlichter dreister Beschlagnahmung durch Gefreite, die sofort durch höherrangige Offiziere rückgängig gemacht wurde. Die Eltern waren apathisch und taten, was von ihnen verlangt wurde. Marianne aber spürte deutlich die archaischen Plünderungs- und Vergewaltigungsimpulse der Eroberer, auch wenn sie kontrolliert wurden durch die große amerikanische Mission, die jeder Soldat hier im Herzen zu haben schien. Und wenn sie doch nicht völlig kontrolliert werden konnten, so waren es doch Ausnahmen, die, wenn sie den Offizieren bekannt wurden, zu drastischen Strafen führten. Marianne fühlte diese neue Ordnung der Freiheit innerhalb des großen Gemetzels der ersten Tage mit einem eigentümlichen, sehnsuchtsvollen Gruseln. Sie beobachtete alles mit glühenden Augen. Hier direkt vor ihren Augen entfaltete sich ein neues, ungeheuerliches Szenario: Amerika kam an Land und eroberte es. Das amerikanische Versprechen vom Recht auf Glück und Freiheit eroberte sie. Während die Kämpfe um den Cotentin und um Caen tobten, war ihr Dorf bereits Teil der neuen Welt, des neuen Europa, von dem noch niemand sprach, das niemand ahnte, und das doch in ihrem jugendlichen Herzen schon Platz nahm.