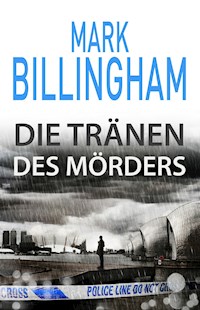9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Der neue Thriller von Spiegel-Bestseller-Autor Mark Billingham als deutsche Erstausgabe
Er gilt als einer der gefährlichsten Serienkiller Englands. Niemand weiß, wie viele Menschen er tatsächlich umgebracht hat; niemand weiß, wo die Knochen seiner Opfer vergraben sind. Seit einigen Jahren sitzt Stuart Nicklin in einem Hochsicherheitsgefängnis. Bis er der Polizei einen Deal anbietet: Er führt sie an die Stätte seiner Untaten – unter einer Bedingung: Detective Inspector Tom Thorne, der ihn einst zu Fall brachte, muss das Unternehmen leiten. Thorne weiß, dass er zu einem Himmelfahrtskommando antritt, denn Nicklin ist ein Meister der psychologischen Manipulation. Auf einer einsamen walisischen Insel merken Thorne und sein Team schon bald, dass der Killer ein perfides Netzt spinnt, dem keiner entkommen kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Ähnliche
MARK BILLINGHAM
DER MANIPULATOR
THRILLER
Aus dem Englischen
von Irene Eisenhut
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Er gilt als einer der gefährlichsten Serienkiller Englands. Niemand weiß, wie viele Menschen er tatsächlich umgebracht hat; niemand weiß, wo die Knochen seiner Opfer vergraben sind. Seit einigen Jahren sitzt Stuart Nicklin in einem Hochsicherheitsgefängnis. Bis er der Polizei einen Deal anbietet: Er führt sie an die Stätte seiner Untaten – unter einer Bedingung: Detective Inspector Tom Thorne, der ihn einst zu Fall brachte, muss das Unternehmen leiten. Thorne weiß, dass er zu einem Himmelfahrtskommando antritt, denn Nicklin ist ein Meister der psychologischen Manipulation. Auf einer einsamen walisischen Insel merken Thorne und dessen Team schon bald, dass der Killer ein perfides Netzt spinnt, dem keiner entkommen kann …
Der Autor
Mark Billingham, geboren 1961 in Birmingham, ist einer der erfolgreichsten britischen Thrillerautoren. Berühmt wurde er mit seiner Serie um den eigenwilligen Ermittler Tom Thorne, für die er mit dem Sherlock Award ausgezeichnet wurde. Mark Billingham erhielt zahlreiche Krimipreise, unter anderem den BCA-Award sowie den Theakston’s Award. Er lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in London und in Florida.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die OriginalausgabeTHEBONESBENEATH
erschien 2014 bei Little, Brown (London)
Der Heyne Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 08/2015
Copyright © 2014 by Mark Billingham
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Tamara Rapp
Umschlagillustration: Nele Schütz Design unter Verwendung von © shutterstock/Jesse Kelpszas
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN: 978-3-641-16784-4V002
www.heyne.de
Für das kleine Mädchen, aufgewachsen in der Nähe
eines Leuchtturms, der ihr über die Cardigan Bay zuwinkte, was sie nie vergaß.
PROLOG
WIESO BIN ICH HIER?
Er hatte sie für Einbrecher gehalten.
Nicht verwunderlich unter den Umständen. Als er das alarmierende Geräusch zersplitternden Glases hörte, riss er die Augen auf und schlich im Bademantel nach unten. Die beiden dunklen Gestalten erschienen ihm in seiner winzigen weißen Küche völlig fehl am Platz.
Rückblickend betrachtet, war die Stille, die beide umgab, irgendwie eigenartig gewesen. Ohne das geringste Anzeichen von Panik hatten sie dagestanden, als gäbe es keinen Grund zur Eile. Als schienen sie nur auf ihn zu warten.
Alles verdammt klar, im Nachhinein betrachtet.
Er hatte geglaubt zu wissen, wonach sie suchten. Er bemerkte etwas in ihren großen, leeren Augen und vermutete, dass sie vielleicht wussten, womit er seinen Lebensunterhalt verdiente. Dass sie glaubten, es könnte irgendwo Stoff herumliegen.
»Wenn ihr’s auf Drogen abgesehen habt, vergesst es«, hatte er gerufen. »So was bewahre ich nicht zu Hause auf!« Er hatte einen Schritt auf sie zu gemacht, sich auf das trübe grünliche Licht zubewegt, um sicher zu sein, dass sie einen guten Blick auf ihn hatten.
Die Digitaluhr auf dem makellosen Edelstahlherd hatte 02:37 gezeigt.
»Jetzt macht schon, haut einfach ab! Ich leg mich wieder hin, und wir tun so, als wäre das hier nie passiert, okay?«
Daraufhin hatte er die Andeutung eines Lächelns in dem blassen, kapuzenumrahmten Gesicht des Größeren bemerkt und gesehen, wie der Kleinere ihm zunickte. Schockiert hatte er festgestellt, dass es sich um die angespannten, scharfen Gesichtszüge eines Mädchens handelte – ein hoher Wangenknochen, volle Lippen und etwas Glitzerndes an der Nase.
Verdammt, nur ein Junkie-Pärchen.
Auf der Suche nach ihrem Drogenglück.
Er hatte geglaubt, es mit ihnen aufnehmen zu können, und beschlossen, es zumindest zu versuchen. Also hatte er sie angeschrien und war auf sie zugestürzt, um einen von ihnen oder beide zu Boden zu reißen. Der glatte Holzblock mit den teuren japanischen Messern stand zu weit weg, deshalb griff er nach der Weinflasche, die er nur wenige Stunden zuvor geleert hatte. Doch da schloss sich eine Hand um seinen Arm. Im nächsten Moment beugte sich der Junge vor und zog ihn zu sich, seine Sportschuhe quietschten auf dem Fliesenboden, als er sein Gewicht verlagerte und wieder sicheren Stand fand. Er spürte einen warmen Atemhauch auf seinem Gesicht und drehte sich mühsam um, gerade noch rechtzeitig, um zu registrieren, wie die Hand des Mädchens aus der Tasche ihrer Kapuzenjacke auftauchte. Kleine weiße Finger umklammerten einen Griff.
Fingernägel mit abgeblättertem schwarzem Nagellack.
Kein Messer, etwas anderes …
Sie streckte den Arm aus – beugte sich fast träge zu ihm vor – und er machte sich auf den Hieb, den Schmerz gefasst. Stattdessen spürte er einen entsetzlichen Stromschlag, der ihn zu Boden riss. Und über sein eigenes Schreien hinweg hörte er einen der beiden sagen: »Wenn du brav bist, werden wir dir nichts tun.«
Er hatte immer noch Muskelkrämpfe von dem Elektroschock, als ihm ein feuchter Lappen aufs Gesicht gedrückt wurde. Ihm blieb nichts anderes übrig, als in der Dunkelheit weiter zu atmen.
Wann war das gewesen? Vor vierundzwanzig Stunden? Vor sechsunddreißig?
In einem Raum ohne Fenster ein genaues Zeitgefühl zu behalten, ist ausgeschlossen. Er hat geschlafen, aber da man ihm Beruhigungsmittel gegeben hat, weiß er nicht, wie lange. Somit sind es nur Mutmaßungen, die sich darauf stützen, wie häufig sie ihm Essen bringen oder einer der beiden mit dem Elektroschocker herumfuchtelt, während der andere die Handschellen aufschließt, damit er in einen Plastikeimer pinkeln kann. Oder wann das Brummen des Verkehrs in der Ferne zu- und wieder abnimmt.
Er ist in einem Kellerraum, da ist er sich ziemlich sicher.
Von dem dreckigen Teppich geht ein feuchter Geruch aus, und die Ziegelsteinwände sind grau gestrichen. Abgesehen von einer Kommode in einer Ecke stehen noch ein paar schäbige Stühle herum, doch den größten Teil des Raums nimmt ein Bett ein, auf dem er mit ausgestreckten Armen und Beinen liegt, mit Kabelbinder an die metallene Umrahmung gefesselt.
Die meiste Zeit ist er allein. Er ist sich nicht einmal sicher, ob die Tür ein Schloss hat. Nicht dass es eine Rolle spielt, denn dass er sich aus dem Staub macht, ist ziemlich unwahrscheinlich, zumal immer mal wieder einer von beiden den Kopf zur Tür reinsteckt. Er ist sich nicht ganz sicher, wessen sie sich vergewissern, aber trotzdem dankbar dafür.
Es scheint ihnen auf jeden Fall wichtig zu sein, dass er noch lebt.
Anfangs war sein Mund zugeklebt, doch der Junge hat ihm das Klebeband abgenommen. Jetzt versucht er, sie in ein Gespräch zu verwickeln, wenn sie ihm etwas bringen. Fish and Chips oder Tee oder sonst was.
Wieso bin ich hier?
Hört mal, ihr habt den Falschen, ich schwör’s!
Verdammt, was glaubt ihr nur, wer ich bin …?
Während der ganzen Zeit hat keiner der beiden etwas gesagt. Außer einmal, da hat der Junge den Kopf geschüttelt, als hätte er die Nase voll von dem Gequatsche, und meinte, er solle ruhig sein. Genau genommen hat er ihn darum gebeten und ihm noch nicht mal den Mund wieder zugeklebt, was er hätte tun können.
Sie sind stets höflich, sogar mehr als das.
Normalerweise schaut nur einer herein, außer sie bringen ihm gemeinsam etwas, Tabletts oder Eimer. So weiß er, dass irgendetwas nicht stimmt, als beide zusammen hereinkommen und eine Zeit lang nebeneinander in den schäbigen Stühlen sitzen.
»Was ist los?«, fragt er.
Der Junge trommelt sich mit den Fingern auf die Knie. Er sieht das Mädchen an, die sich seines Blicks bewusst ist, ihn aber erst nach einer Weile erwidert. Der Junge reißt die Augen auf, nickt, und schließlich zieht das Mädchen ihre Hand aus der Tasche ihrer Kapuzenjacke.
Er hebt den Kopf vom Bett, um zu sehen, was vor sich geht, und dieses Mal ist sofort klar, was sie da in ihren kleinen weißen Fingern hält.
Er weiß sehr genau, wie ein Skalpell aussieht.
Das Mädchen steht auf und schluckt. Sie holt Luft und sieht dabei aus, als würde sie sich wirklich größte Mühe geben, eine ernste Miene zu machen. Ernst genommen zu werden.
»Und jetzt …«, sagt sie, »jetzt werden wir dir wehtun.«
DER ERSTE TAG
MIT EINEM WORT, MIT EINEM BLICK
1
Willst du zuerst die gute oder die schlechte Nachrichthören?
Das hatte ihn Detective Chief Inspector Russell Brigstocke damals gefragt, während er Kekse in sich hineinstopfte. Er stellte seine Geduld auf eine harte Probe. Saß fröhlich auf dem Rand seines Krankenbetts, als wären sie alte Kumpel, die ein kleines Schwätzchen miteinander hielten. Als wäre Thorne nicht vor ein paar Tagen fast verblutet. Als hinge seine sogenannte Karriere nicht gerade am seidenen Faden.
Brigstocke überbrachte das Urteil.
Gute Nachricht, schlechte Nachricht.
Jetzt, sechs Wochen später, blickte Tom Thorne in den Rückspiegel und beobachtete, wie die riesigen Metalltüren hinter ihm zuglitten, während er das Auto in der reservierten Lücke auf dem Gefängnisparkplatz abstellte. Er blickte zu Dave Holland auf dem Beifahrersitz und bemerkte die Besorgnis im Gesicht des Sergeant. Auch ihm musste sie anzusehen sein; er konnte spüren, wie sein Magen sich zusammenzog und ein Schmerz ihn durchzuckte, stechender als der immer noch latent vorhandene von seiner Schusswunde.
Wie ein Schrei, der sich über ein langes, lautes Stöhnen erhob.
War diese ganze Gute-Nachricht-schlechte-Nachricht-Nummer normalerweise nicht eine Art Witz?
Die gute Nachricht: Sie werden berühmt!
Die schlechte Nachricht: Man wird eine Krankheit nach Ihnen benennen.
Oder umgekehrt. Die schlechte Nachricht: Ihr Blut wurde überall am Tatort gefunden!
Die gute Nachricht: Sie haben einen niedrigen Cholesterinspiegel.
So oder so war es ein Witz, jedenfalls normalerweise …
Thorne stellte den Motor des siebensitzigen Ford Galaxy ab und blickte an dem Gefängnisgebäude hoch. Mauern, Stacheldraht und ein Himmel von der Farbe nassen Asphalts. Hier gab es bestimmt nichts zu lachen, schon gar nicht an einem trostlosen Montagmorgen in aller Herrgottsfrühe, Anfang November. Nein, der Grund, weshalb sie hier waren, war nicht einmal ansatzweise lustig.
»Er will, dass du ihn dorthin bringst«, hatte Brigstocke gesagt, damals, vor sechs Wochen in dem Krankenhauszimmer, als der Schmerz noch um einiges heftiger war und Thorne das Gefühl hatte, ihm würde jedes Mal eine heiße Klinge in die Seite gestoßen werden, wenn er sich in seinem Rollstuhl zurücklehnte.
»Ich?«
»Ja, du! Das ist eine seiner Bedingungen.«
»Er stellt Bedingungen?«
Brigstocke schob sich den Rest eines Keks in den Mund. Als er antwortete, landeten Krümel auf der Decke. »Die Sache ist … kompliziert.«
Ein paar Minuten zuvor hatte Brigstocke Thorne verkündet, dass er trotz der abgeschlossenen Untersuchung, die nicht nur zum Verlust seiner Stelle, sondern vielleicht sogar zu einer Anklage hätte führen können, wieder zum Morddezernat zurückberufen sowie seine Degradierung zum uniformierten Polizisten auf wundersame Weise aufgehoben wurde und er nach vier grässlichen Monaten in Südlondon wieder auf die richtige Seite des Flusses zurückkehren würde. Er blieb weiterhin Inspector, doch jenes eine Wort, um dessen Eliminierung er so sehr gekämpft hatte, würde wieder vor seiner Berufsbezeichnung stehen.
Detective.
»Ich vermute mal, das ist die gute Nachricht«, sagte Thorne.
Brigstocke nickte, und es entstand eine ziemlich lange Pause. Als der DCI dann begann, ihm den Grund für diese unerwartet positive Wendung zu erklären, konnte er Thorne nicht mehr so recht in die Augen blicken. In dem Moment, als er den Namen des Mannes erwähnte, versuchte Thorne, ihn zu unterbrechen, doch Brigstocke hob eine Hand und bestand mit fester Stimme darauf, dass Thorne ihn zumindest ausreden ließ, bevor er seine berechtigten Einwände vorbrachte.
»Er spielt Spielchen«, warf Thorne ein, als Brigstocke eine kurze Atempause einlegte. »Wie immer.«
»Für uns passt alles. Der Zeitraum, der Ort.«
»Ist mir egal, was alles passt. Er hat was vor.« Thorne fuhr mit seinem Rollstuhl ein paar Zentimeter vor und zurück und wünschte sich nichts sehnlicher, als noch an die Morphiumpumpe angeschlossen zu sein. »Jetzt komm schon, Russell, du weißt genau, wie er ist. Was zum Teufel denkt ihr euch nur dabei?«
»Wir denken, dass er uns in der Hand hat«, erwiderte Brigstocke.
Thorne hörte sich Brigstockes Ausführungen an. Besagter Mann – ein verurteilter Mörder, der gerade mehrere lebenslange Haftstrafen ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verbüßte – hatte vor sechs Monaten Kontakt zur Mutter eines Jungen aufgenommen, der vor fünfundzwanzig Jahren verschwunden war. Mit fünfzehn Jahren. Der Mann behauptete, diesen Jungen gekannt zu haben, da sie damals beide Bewohner einer experimentellen Einrichtung für Problemjugendliche gewesen waren. Nach mehreren Monaten gab er in einem Brief an die Frau schließlich zu, ihren Sohn ermordet und die Leiche verscharrt zu haben.
»Das glaube ich ihm in der Tat«, sagte Thorne. »Aber das ist bisher auch das Einzige, das Sinn macht.«
Brigstocke ging über seine Bemerkung hinweg und fuhr fort. Er schilderte die mehrfachen verzweifelten Besuche und Anrufe der Frau, bei denen sie den Mörder gebeten hatte, den Ort, an dem er ihren Sohn verscharrt hatte, zu offenbaren. Sie hatte daraufhin die Medien kontaktiert und ihrem Abgeordneten geschrieben mit der dringenden Bitte, sich für sie einzusetzen. Beide Seiten hatten auf den Häftling eingewirkt, bis er schließlich einer Zusammenarbeit zugestimmt und der Polizei versprochen hatte, sie an den Ort zu bringen, wo der Jugendliche begraben lag.
Nach seinen Ausführungen blickte Brigstocke ihm wieder in die Augen, aber nur für einen Augenblick. »Und er will, dass du ihn begleitest.«
Danach kam es zwischen den beiden zu einem kleinen Schlagabtausch, bis Brigstocke Thorne aufforderte, den Mund zu halten und ihm zuzuhören, Thorne jedoch mehr dazwischenrief, als dass er zuhörte, und Brigstocke ihm schließlich erklärte, dass seine Wunde aufplatzen würde, wenn er sich nicht beruhigte.
»Was sollen wir denn verdammt noch mal tun?« Brigstocke hatte die Kekse aufgegessen, zerknüllte die Packung und versuchte, sie in den metallenen Papierkorb zu werfen. »Sag’s mir, Tom! Der Abgeordnete macht der Polizeipräsidentin Stress. Die Sache steht in allen Zeitungen. Diese Frau muss wissen, was ihrem Sohn zugestoßen ist, um … damit abschließen zu können … oder was auch immer. Und soweit ich die Sache beurteilen kann, gibt es keinen vernünftigen Grund, nicht dorthin zu fahren.«
»Doch. Er.«, wandte Thorne ein. »Er ist der Grund.«
»Wie schon gesagt, wir haben die Daten und Unterlagen geprüft, und es sieht so aus, als würde er die Wahrheit sagen.« Brigstocke trat in die Ecke des Zimmers, hob die Packung auf und ließ sie in den Papierkorb fallen. »Er war definitiv in dem Zeitraum da, den er angegeben hat, und genau in dieser Zeit ist auch der Junge das letzte Mal gesehen worden.«
Thorne schob sich in seinem Rollstuhl zurück zum Bett. »Er macht nur das, was er machen will. Und dann hat er einen triftigen Grund. Ansonsten macht er gar nichts. Nie!« Er hob sich vorsichtig aus dem Rollstuhl aufs Bett und winkte ab, als Brigstocke ihm helfen wollte. Seine Miene war wie aus Stein. »Nie.«
»Also, was glaubst du?«, fragte Holland ihn jetzt. Er löste seinen Sicherheitsgurt, drehte sich um und griff nach hinten zu seinem Mantel und den Handschuhen. »Ein paar Tage?«
»Ja«, meinte Thorne. Es würde ein paar Tage dauern, bis sie entweder die Leiche finden würden oder sich herausstellte, dass sie allesamt verarscht worden waren. Auch Thorne griff nach hinten und zog seinen Mantel und die Aktentasche mit den ganzen Unterlagen von der Rückbank.
»Nett, mal aus London rauszukommen«, sagte Holland.
»Stimmt.«
»Ich meine, es wäre schön, wenn wir nicht … du weißt schon, was ich meine!«
Willst du zuerst die gute oder die schlechte Nachrichthören?
In Brigstockes Büro im Becke House, ein Tag nach Thornes Entlassung aus dem Krankenhaus. Die Vorbereitungen waren bereits getroffen, Genehmigungen und Protokolle eingeholt.
Der Streit ging weiter.
»Lass uns noch mal diese ›Bedingungen‹ durchgehen, ja?« Thorne hatte seine Lederjacke über einen Stuhl geworfen und saß gegen eine Wand gelehnt. »Nur damit ich nichts falsch verstehe. Wieso ist er derjenige, der hier die Bedingungen stellt?«
Brigstocke stand auf und ging um seinen Schreibtisch herum. »Wie oft noch?«
»Ich weiß«, erwiderte Thorne. »Der Abgeordnete, die trauernde Mutter, dass er uns in der Hand hat.« Er schüttelte den Kopf. »Hat er sonst noch Wünsche? Vielleicht eine spezielle Automarke oder ein besonderes Modell? Irgendein bevorzugter Belag auf seinen Sandwichs?«
»Es hat sich nichts geändert.«
»Jetzt mach mal ’nen Punkt. Die Bedingungen …«
»Nun, außer dir, offensichtlich.«
»Ja, außer mir.« Thorne atmete aus und blies dabei die Wangen auf. »Hast du dir schon mal überlegt, warum ich mitsoll?« Er blickte Brigstocke an und riss die Augen in gespielter Neugier auf. »Das frage ich mich nämlich gerade.«
»Du bist derjenige, der ihn geschnappt hat«, sagte Brigstocke. »Er hat irgendwie Respekt vor dir. Vielleicht vertraut er dir.«
»Er will mit mir spielen«, erklärte Thorne. »Das will er.«
»Du bringst ihn dorthin, findest die Leiche, und dann bringst du ihn wieder zurück.« Brigstocke lehnte sich gegen den Schreibtisch. »Das ist alles.«
Thorne betrachtete den Teppich und strich sich kurz über die Narbe am Kinn. Dann sagte er: »Was hat er denn für ein Problem mit der Presse?«
»Ganz einfach, er will sie nicht dabeihaben.«
»Sie scheint ihn doch früher nie gestört zu haben«, entgegnete Thorne. »Da hatte er weder gegen die Bücher noch gegen die verdammten Filmberichte was einzuwenden. Nach allem, was man so hört, ist seine Zelle mit Zeitungsausschnitten zugekleistert.«
Brigstocke zuckte mit den Achseln. »Sieh mal, er weiß, dass wir an dem Fall dran sind, seit die Mutter zur Presse gegangen ist. Er ist einfach nicht scharf darauf, überall Hubschrauber zu sehen, so wie damals, als sie Ian Brady zurück zum Moor gebracht haben.«
Thorne seufzte auf.
»Wir haben der Presse Bescheid gegeben, dass die Sache läuft. Damit müssten wir sie vom Hals haben. Wenngleich sie natürlich nicht den genauen Zeitpunkt oder den Ort wissen.« Brigstocke begann, vorsichtig mit den Zähnen an einem eingerissenen Fingernagel herumzukauen. »Das sollte aber auch kein Problem sein, solange ein freundlicher Pressesprecher sie mit allen Informationen füttert, die sie haben wollen, wenn alles abgeschlossen ist.«
»Erzähl mir was von seinem Freund.«
Brigstocke spuckte den abgesplitterten Fingernagel aus. »Na ja, er sagt, dass er sich um einiges sicherer fühlen würde, wenn er einen anderen Häftling mitnehmen könnte. Dass ihm so eher kein ›Unfall‹ passieren könnte. Vermutet wohl, dass es zu viele von uns gibt, die Sarah McEvoy noch nicht vergessen haben.«
»Das ist völliger Schwachsinn.
»Hat er aber gesagt.«
Auch Thorne hatte die Polizeibeamtin, die bei der Festnahme des Mannes getötet wurde, über dessen Forderungen sie gerade sprachen, natürlich noch nicht vergessen. Er erinnerte sich an das Blut auf dem Asphalt und die Euphorie im Gesicht des Mannes, kurz bevor er sie ihm gewaltsam ausgetrieben hatte. »Und? Ist dieser Kerl sein Lover oder was?«
»Möglicherweise«, antwortete Brigstocke.
»Na gut, aus welchem Grund er auch immer dabei sein soll, ich will alles wissen, was wir über ihn rausfinden können.«
»Offensichtlich …« Brigstockes Handy summte in seiner Hosentasche. Er nahm es heraus, wies den Anruf ab und steckte es wieder ein. Entweder war das Gespräch nicht so dringend, oder er wollte nicht, dass Thorne mithörte. »Pass mal auf, Tom! Ich weiß, dass bei diesem Einsatz so gut wie nichts normal ist. Die üblichen Vorgehensweisen werden größtenteils den Bach runtergehen. Das fängt ja schon an mit diesem dämlichen Ort, wohin du ihn bringen sollst. Der bereitet uns schon jetzt … logistische Albträume. Was ich damit andeuten will, ist, dass du vielleicht häufig spontan reagieren musst.«
Thorne nickte bedächtig, drehte sich um und griff nach seiner Jacke. »Ich hab auch ein paar Bedingungen«, erklärte er.
Brigstocke wartete stumm.
»Ich stelle den Rest des Teams zusammen«, sagte Thorne und stand auf. »Nicht du und nicht der Chief Superintendent. Und sobald ich oder irgendein anderer glaubt, dass es keine Leiche zu finden gibt, sondern dass es den Scheißkerl lediglich antörnt, uns alle für dumm zu verkaufen, werde ich ihn und seinen Freund ohne eine Sekunde zu zögern wieder einbuchten. In Ordnung?« Brigstocke öffnete den Mund, doch Thorne war noch nicht fertig. »Und ich will nichts davon hören, wie viel Stress die Sun oder Daily Mail der Polizeipräsidentin machen. Abgeordnete und sogar trauernde Mütter sind mir egal. Und ich schere mich einen Dreck darum, ob er uns in der Hand hat oder nicht.«
»O Gott, ist das kalt«, sagte Holland. Er schlug seine behandschuhten Hände gegeneinander, während er um das Auto herumstapfte. Mit hochgezogenen Schultern nickte er in Richtung des Gefängniseingangs. »Ich hoffe, jemand hat schon Teewasser aufgesetzt.«
Thorne brummte vor sich hin, vielleicht sogar irgendetwas Zustimmendes, doch in Wahrheit konnte er an kaum etwas anderes denken als an den Grund, weswegen er nach einer schlaflosen Nacht heute Morgen in aller Frühe aufgestanden war und die Sonne auf der Fahrt zu dem hundert Meilen entfernten Gefängnis Long Lartin hatte aufgehen sehen. An kaum etwas anderes als an den Mann, der ihn hierhergebracht hatte.
Sie gingen auf das erste von vielen Toren zu. Schritte erklangen auf dem Asphalt, kleine Atemwolken stiegen aus Mündern und Nasen.
Und jenseits der Mauer wartete geduldig dieser Mann.
Sie griffen gleichzeitig nach ihren Dienstausweisen.
Der Mann, bei dem sich Thornes Magen unwillkürlich zusammenzog.
»Na, dann mal los!«, sagte Holland.
Die schlechte Nachricht – das war Stuart Nicklin.
2
Es gab Tee und dazu Kekse aus einer schicken Dose, die sie dankbar annahmen, wenngleich man sie ihnen nicht besonders überschwänglich anbot. Holland versuchte, ein Lächeln aufzusetzen, kam sich aber eher blöd dabei vor, und als er sich wegdrehte, schnitt er eine Grimasse in Thornes Richtung. Er ging mit seiner Tasse hinüber zum Sofa am anderen Ende des langen schmalen Büros und überließ es Thorne, sich um den ganzen Papierkram zu kümmern, den die Frau auf dem Schreibtisch ausbreitete.
Bei diesem Anblick machte Thorne ein genauso langes Gesicht wie sein Gegenüber.
Das Auftreten der stellvertretenden Direktorin von Long Lartin konnte man mit äußerstem Wohlwollen als geschäftsmäßig bezeichnen, wenngleich Thorne sich sicher war, dass sowohl die Gefangenen als auch die Wärter eine andere Beschreibung dafür hatten. Abgesehen von der Tatsache, dass Theresa Colquhoun keine gefühlsbetonte Person war, wurde auch ziemlich schnell klar, dass sie es nicht eilig hatte. Sie war vom Gefängnisdirektor beauftragt worden, die abschließenden, notwendigen Formalitäten für eine Gefangenenübergabe zu erledigen, was das Ausfüllen ziemlich vieler Anträge bedeutete. Gefahrenanalysen mussten vervollständigt und Leitfäden zum Übergabeprotokoll verteilt und sorgfältig durchgelesen werden. Sie hatte Bedenken im Hinblick auf die Vereinbarungen, die in dieser Sache zwischen der Metropolitan Police und der obersten Gefängnisbehörde getroffen worden waren, und sie ließ diese auch Thorne detailliert wissen, als sie den Tee eingoss. Dennoch war sie entschlossen, die ihr übertragene Aufgabe mit einer Genauigkeit auszuführen, die in Thornes Augen an Zwanghaftigkeit grenzte.
»Diese Angelegenheit ist schon fraglich genug«, sagte sie und tippte mit einem manikürten Fingernagel gegen ein Foto von Stuart Nicklin, das oben auf einer Akte klemmte. »Wir wollen doch keine Fehler machen, bevor wir überhaupt angefangen haben, oder?«
Colquhoun war ungefähr Ende fünfzig, eine große, hagere Frau, die sich scheinbar alle Mühe gegeben hatte, ihr Erscheinungsbild nicht in irgendeiner Form femininer zu gestalten. Ihr graues Haar war fest zusammengebunden, ihr Make-up betonte ihre strengen Züge. Nur ihre Stimme schien im Widerspruch zu dem Eindruck zu stehen, den sie erwecken wollte – oder den sie glaubte, erwecken zu müssen. Sie war fast tonlos und so leise, dass Thorne zweimal nachfragen musste.
Nicht dass das Gespräch besonders aufregend gewesen wäre.
Das Ausfüllen der beiden Formularsätze – ein Satz pro Gefangenen – wurde mit einer kleinen Pause gefeiert, in der man miteinander plauderte. Belanglose Fragen nach Thornes und Hollands Fahrt von London nach Long Lartin an jenem Morgen. Die Strecke, das Verkehrsaufkommen, das Wetter währenddessen.
Dann wandte man sich wieder der Arbeit zu.
Sie sagte: »Selbst wenn diese Häftlinge in Ihre Obhut übergeben worden sind und sich nicht mehr auf dem Gelände von Long Lartin befinden, bleiben sie trotzdem weiter Häftlinge und unterliegen damit meiner gesetzlichen Verantwortung. Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, wäre es mir lieber, sie würden abends immer zurückkehren, aber da die räumliche Entfernung das nicht zulässt, müssen sie in eine angemessene Einrichtung gebracht werden.«
»Das weiß ich, darauf hätten Sie mich nicht hinweisen müssen«, sagte Thorne.
»Wie ich bereits gesagt habe, am besten, man klärt die Dinge direkt am Anfang.«
»Wir werden auf sie aufpassen.«
Colquhoun hatte gerade begonnen, darüber zu sprechen, wie zu verfahren war, wenn einer der Häftlinge unverhofft krank wurd, als auf Hollands Handy eine SMS einging. Sie blickte ihn an wie eine verärgerte Bibliothekarin.
Holland las die Nachricht. »Der zweite Wagen mit der Verstärkung ist da«, erklärte er.
»Sag ihnen, dass es nicht mehr lange dauert!«, meinte Thorne, den Blick immer noch auf die stellvertretende Gefängnisdirektorin gerichtet.
Auch wenn Thorne es Colquhoun wirklich nicht schwermachte, konnte sie seine wachsende Ungeduld spüren, seinen Wunsch, sich endlich in Bewegung setzen zu können. »Meine Beamten bereiten die Häftlinge gerade auf die Abfahrt vor«, erklärte sie, lächelte verbissen und rückte einige Papiere zurecht. »Wir haben sie aus naheliegenden Gründen erst in letzter Minute darüber informiert, dass die Übergabe heute stattfindet.«
»Sicher«, sagte Thorne.
»Natürlich wäre es schön, wenn sie bereits vorher abfahrbereit gewesen wären, aber das hätte die Sicherheit gefährdet, denken Sie nicht auch?«
»Sicher.«
Eigentlich hatte sich Thorne in den letzten Wochen gedacht, dass Vorgehensweisen wie diese hier für jemanden wie Stuart Nicklin nicht mehr als eine nette kleine Herausforderung waren. Es war natürlich vernünftig, den Häftlingen keine Möglichkeit zu geben, Details über ihren Aufenthalt außerhalb des Gefängnisses weitererzählen zu können, doch war es gewiss kein idiotensicheres System, und Nicklin war kein gewöhnlicher Gefangener. Im Laufe seiner Gefängnisjahre hatte er eine erschreckende Fähigkeit darin entwickelt, Informationen zu sammeln und beliebig viele Quellen zu unterhalten, auf die er zurückgriff, wenn der passende Moment gekommen war.
Als Thorne ihn vor fünf Jahren das letzte Mal gesehen hatte, hatte Nicklin ihm nicht nur vergnügt dazu geraten, die Preise seiner Versorgungsunternehmen zu vergleichen und das überzogene Konto im Auge zu behalten, sondern auch zu überlegen, ob er nicht vielleicht die Ausgaben für seine Take-away-Essen reduzieren wollte.
»Ich glaube, ich kenne Sie jetzt ziemlich gut«, hatte er damals gesagt.
Irgendeinen zwielichtigen Typen dazu zu kriegen, einen Mülleimer zu durchwühlen, war keine große Kunst, doch Nicklin hatte überdies unter Beweis gestellt, dass er fähig war, sich Telefonnummern, Adressen und Daten zur Person seines Interesses zu besorgen und deren Bewegungsprofile zu erstellen.
Dieses Wissen im Hinterkopf ließ im Hinblick auf die für diesen Einsatz vorab getroffenen Sicherheitsmaßnahmen nicht allzu viel Vertrauen aufkommen. Es gab genügend Menschen in der Gefängnisverwaltung, die schon seit Tagen über die Einzelheiten und den genauen Zeitpunkt Bescheid wussten, wann Thorne Stuart Nicklin abholen wollte. Die Beamten sämtlicher Polizeitruppen, durch deren Zuständigkeitsbereiche sie fahren würden, waren bereits benachrichtigt worden und hatten Beschreibungen sowie aktuelle Fotos der Häftlinge erhalten.
Es gab genügend … Quellen.
Glücklicherweise dauerte es nur noch wenige Minuten, bis die Formalitäten erledigt waren. Danach rief Colquhoun einen ihrer leitenden Vollzugsbeamten an und erklärte Thorne, dass die Gefangenen in Kürze zu den Fahrzeugen gebracht werden würden. Schließlich stand sie auf, trat langsam um den Tisch herum und schüttelte ihm die Hand. Das wirkte etwas eigenartig, als würde sie ihm Glück wünschen. Als fände sie, er könne es gebrauchen.
Holland wanderte zurück zum Schreibtisch. Er dankte Colquhoun für den Tee und die »besonderen Kekse«.
Sie drehte sich um, griff nach der Dose und hielt sie ihm hin. »Nehmen Sie sie mit!«, sagte sie.
Überrascht von der unerwarteten Großzügigkeit zögerte Holland erst kurz, nahm aber dann die Dose. »Danke!«
»Wie lange werden Sie brauchen, drei oder vier Stunden?«
»Es könnten auch fünf werden«, meinte Thorne. »Je nachdem.«
»Genug Zeit, um sich gegenseitig kennenzulernen.« Sie blickte Thorne an. Ein eingeübter Gesichtsausdruck von Mitgefühl, der ein gewisses Maß unverhohlener Neugierde nicht verbergen konnte. »Obwohl, ich nehme mal an, Sie und Nicklin …«
»Ja«, sagte Thorne.
Ich glaube, ich kenne Sie ziemlich gut.
»Diese Kekse sind also nur für uns?«, fragte Holland lächelnd und wedelte dabei mit der Dose in Richtung Thorne. »Oder müssen wir sie teilen?«
»Nun ja, ich bin mir sicher, meine Beamten würden nicht nein sagen.« Die stellvertretende Gefängnisdirektorin setzte sich wieder hinter ihren Schreibtisch. Sie rückte ein gerahmtes Foto zurecht, dessen Motiv Thorne von seinem Platz aus nicht in den Blick bekam. »Die Häftlinge werden natürlich Handschellen tragen, also liegt es ganz bei Ihnen.« Sie schaute zu Dave Holland auf, und zum ersten Mal an diesem Morgen lag ein richtiges Lächeln auf ihrem Gesicht. »Wollen Sie Stuart Nicklin wirklich mit Keksen füttern?«
3
Jeffrey Batchelor hob einen Unterarm, vergrub sein Gesicht im Stoff des dicken braunen Pullis mit Rundhalsausschnitt und roch daran. Endlich wieder wie ein normaler Mensch gekleidet, betrachtete er sich in dem schmalen Spiegel auf der Rückseite der Tür und blickte dann zu dem leitenden Gefängniswärter hinüber, der erst vor fünf Minuten eine Leibesvisitation an ihm vorgenommen hatte.
»Fühlt sich komisch an«, sagte er.
»Wen wundert’s?«, meinte Alan Jenks. »Ist ja auch das erste Mal, dass du wieder deine eigenen Klamotten trägst, seitdem du hier drinnen bist, oder?«
Batchelor nickte. »Ja, stimmt.«
Das erste Mal seit acht Monaten. Seit zweihundertsechsunddreißig Tagen. Er zeigte mit dem Finger auf Jenks und lachte kurz auf. »Und das erste Mal, dass ich Sie nicht in Uniform sehe.«
Jenks begutachtete sich ebenfalls im Spiegel. Er trug eine Jeans, die gleiche wie Batchelor, ein Jeanshemd und darüber einen schwarzen Pullover. »Na ja, es ist eben nicht erwünscht, allzu deutlich zu zeigen, was vor sich geht«, sagte Jenks. »Sie haben es lieber unauffällig«, und malte mit seinen Fingern Anführungszeichen für das letzte Wort in die Luft. Dann zeigte er mit dem Kopf zur Tür und zu dem Raum auf der anderen Seite des Empfangs, wo zwei seiner Kollegen den anderen Gefangenen für die Abfahrt vorbereiteten. »Er auf jeden Fall. Er ist derjenige, der hier das Sagen hat, wenn du mich fragst.« Er nickte verschwörerisch. »Glaubst du nicht auch?«
Batchelor zuckte mit den Achseln, als wäre seine Meinung, wie auch immer geartet, kaum relevant. Natürlich hatte er eine, aber er wusste, dass es besser war, sie für sich zu behalten, soweit es Stuart Nicklin betraf.
Das hatte er gelernt, noch bevor er dem Mann überhaupt begegnet war.
»Ich meine, du bist sein Freund«, sagte Jenks.
»Nicht wirklich.«
»Na gut, was auch immer.«
»Ich bin’s nicht.«
»So oder so, ist ja egal.«
»Es ist aber nicht so.«
Jenks musterte den Gefangenen kurz. Dann lächelte er, als wäre er nicht davon überzeugt, und wandte sich ab. Er griff nach oben in einen offenen Metallschrank, zog ein Paar D-Typ-Handschellen heraus, drehte sich wieder um und ließ sie an den Fingern baumeln. »Na ja, nicht ganz so einfach, unauffällig zu bleiben, wenn man mit den Scheißdingern herumläuft.«
»Wohl eher nicht.«
Jenks trat mit routinierter Geste auf ihn zu. »Wird nicht unbedingt danach aussehen, als würden wir eine Kaffeefahrt machen, oder?«
Batchelor schloss die Augen und streckte die Arme aus.
Am Abend zuvor hatte er in seiner Zelle aufgeblickt und Nicklin im Eingang stehen sehen, der ihm zugewinkt hatte, als gäbe es überhaupt keinen Grund zur Besorgnis, als würde er nur mal kurz vorbeischauen. Er hatte das Buch hingelegt, das er gerade las, und war aufgestanden.
»Alles klar?«
Batchelor hatte daraufhin genickt, der Mund viel zu trocken, um schnell eine Antwort auszuspucken.
»Du hast es dir doch nicht noch mal anders überlegt, oder?«
»Nein, bin nur ein bisschen aufgeregt«, hatte er schließlich geantwortet.
Nicklin hatte kurz aufgelacht, heiser und schrill, und war über die Schwelle getreten. »Das solltest du auch sein, Jeffrey«, hatte er gesagt und seine Stimme zu einem Flüstern gesenkt. »Wir fahren nämlich in die Ferien.«
Jetzt zuckte Batchelor zusammen und holte Atem, als die Handschellen zweimal abgeschlossen wurden und das Schnappschloss seine Haut quetschte.
»Entschuldigung«, sagte Jenks.
»Kein Problem, Mr. Jenks«, entgegnete Batchelor. »Nicht Ihre Schuld.«
Das erste Mal wieder in Handschellen, seit er vor zweihundertsechsunddreißig Tagen aus diesem Mannschaftswagen gestiegen war.
Thorne stand neben dem zweiten Wagen – einem Ford Galaxy, das gleiche Modell wie das von ihm und Holland – und sprach durch das halb offene Fenster mit dem Fahrer, DSSamir Karim, und der Frau, die neben ihm auf dem Beifahrersitz saß. Nach ihrer Ankunft am Zielort würde Karim für die Sicherung der Beweisstücke zuständig sein, während Wendy Markham als zivile leitende Kriminaltechnikerin dabei war. Vorausgesetzt natürlich, es gab tatsächlich irgendeinen Tatort und sie fanden Beweisstücke.
»Ich habe genauso wenig Ahnung wie du«, sagte Thorne.
»Beweisstück eins … null Komma nix«, sagte Karim grinsend.
Thorne blickte Markham an, die einigermaßen zufrieden wirkte. Vielleicht freute sie sich auch einfach nur wie Holland, mal aus der Stadt herauszukommen. Thorne fiel dafür nichts Abgelegeneres ein als ihr Ziel.
Karim kicherte. »Besser gesagt: Beweisstück eins, nichts als Scheiß!« Im Hinblick auf seine Witze schien Karim schmerzfrei zu sein, was in gleicher Weise auch auf seine Leidenschaft als Zocker zutraf. Er nahm regelmäßig Wetten auf Todeszeitpunkte oder die Dauer von Haftstrafen an, freute sich aber ebenso darüber, wenn es sich um die grässlichsten Details von Mordfällen handelte. Seit er dem Team angehörte, war er, wie nicht anders zu erwarten, scharf darauf gewesen, über die Chancen zu diskutieren, die Leiche zu finden, nach der sie suchten, und darüber, wie viele Stunden sie eventuell danach graben mussten.
Im Moment sprach Thorne lieber über die Route.
Während die Sicherheit in anderen Bereichen ihm gewisse Kopfschmerzen bereitete, war er zuversichtlich, dass dieser Teil des Einsatzes geheim gehalten worden war. Die Fahrt, deren genaue Strecke nur ihm und Karim bekannt war, würde überwacht und die beiden Fahrzeuge in Echtzeit über Satellit verfolgt werden.
Sie gingen noch einmal den Weg durch.
»Mach dir keine Gedanken, das ist alles hier drin«, sagte Karim und klopfte sich gegen den Kopf, um anzudeuten, dass er die Informationen abgespeichert hatte. Als wäre das Navi für ihn überflüssig. Genau wie die von Thorne besorgte Karte, die er jederzeit hinuntergeschluckt hätte, wäre sie nicht laminiert gewesen.
Thorne blickte auf seine Uhr. »Wenn wir je von hier wegkommen sollten.« Seit fast eineinhalb Stunden waren sie nun schon im Gefängnis. Er wollte längst auf dem Weg sein. »Ich hab keine Ahnung, warum wir uns so früh aus dem Bett gequält haben.«
»Vielleicht können wir auf der Straße wieder etwas Zeit reinholen«, meinte Karim.
»Eher nicht«, entgegnete Thorne. Die Autos würden zwar über Funk miteinander in Verbindung stehen, aber es war wichtig, obendrein Sichtkontakt zu halten. »Und fahr immer schön mit gleichem Tempo auf der Innenspur, wenn’s geht, okay, Sam? Komm mir ja nicht auf die Scheißidee und versuch zu überholen!« Er blickte wieder auf seine Uhr. »Es wird so lange dauern, wie es dauert.«
»Keine Sorge!«, sagte Karim. »In Gesellschaft geht die Zeit doch viel schneller rum, oder?«
»Wenn du meinst.« Thorne dachte daran, wer in seinem und Hollands Auto mitfuhr, und stellte fest, dass sie eindeutig die Arschkarte gezogen hatten. Als er sich umdrehen wollte, um zurück zu seinem Wagen zu gehen, traf sein Blick den von Wendy Markham. Ihrer Miene konnte er ablesen, dass es ihn insgesamt betrachtet tatsächlich hätte schlimmer treffen können. Vier oder fünf Stunden mit Sam Karim in einem Auto mochten die Kriminaltechnikerin dazu bringen, sich ihren eigenen Tatort zu schaffen.
Als er auf der Fahrerseite einstieg, war Thorne froh, dass Holland den Motor angelassen hatte. Er zog die Handschuhe aus, beugte sich hinüber zum Handschuhfach und warf sie hinein.
»Fast als wären sie dafür konzipiert worden«, meinte Holland. Er war bereits dabei, die Kekse zu verdrücken, und bot Thorne die Dose an.
Thorne schüttelte den Kopf. Er war seit mehr als vier Stunden auf den Beinen. Obwohl er nur eine Tasse Tee getrunken hatte – besonders leise, um Helen und Alfie nicht zu wecken –, verspürte er keinen Hunger. Jetzt nahm er eine Bewegung am anderen Ende des Geländes wahr, blickte auf und sah einen Beamten über den Hof gehen, der sich alle Mühe gab, einen furchterregend wirkenden Deutschen Schäferhund unter Kontrolle zu halten. Er beobachtete Hund und Halter, die an zwei weiteren Beamten vorbeispazierten auf ihrem Weg zu dem Personalcafé, einem aufgemotzten Baucontainer, getauft auf den prägnanten Namen The Long Latté.
Holland beugte sich vor, um das Radio leiser zu drehen. Sie hatten auf der Fahrt von London Nachrichten und Sport gehört. Gerade war eine Diskussion mit telefonisch zugeschalteten Hörern im Gange, in der es um die Frage ging, ob die königliche Familie ihr Geld wert war oder nicht. John aus Ascot meinte, durch sie kämen viele Touristen ins Land, und deshalb wären sie jeden Penny wert, wohingegen Frank aus Halifax fand, sie wären stinkfaule Parasiten, was an sich schon schlimm genug wäre. Darüber hinaus wären sie aber auch noch stinkfaule deutsche Parasiten.
»Wir müssen über das Musikprogramm reden«, sagte Holland.
»Ach ja?«
»Bei einer Vierstundenfahrt auf jeden Fall.«
»Vielleicht sogar eine Fünfstundenfahrt.«
»Na, dann ist die Auswahl ziemlich wichtig, würde ich sagen.«
»Aha.«
»Es steht nichts darüber in den Einsatzrichtlinien.«
»Das muss ein Versehen sein.«
»Drei Seiten zur Gefahrenanalyse … eineinhalb Seiten zur Vorgehensweise bei der ›Toilettenpause‹, aber nichts zum musikalischen Unterhaltungsprogramm.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob wir groß Gelegenheit dazu haben werden. Wir sind ja hier nicht auf einer Vergnügungsreise.«
»Aber wir müssen doch wissen, was das Protokoll dafür vorsieht.«
»Ich denke, ich werde einfach mein Handy anschließen.«
»Wie bitte, deine Musik?«
»Ich hab einiges von Johnny Cash und Willie Nelson dabei«, sagte Thorne. »Und mit einer Playlist von Hank Williams kommen wir locker bis nach Wales.«
Holland lehnte sich in seinem Sitz zurück und schüttelte den Kopf. »O Gott, ich weiß, wir reden hier von Menschen, die wirklich furchtbare Dinge getan haben, aber selbst diese Häftlinge haben grundlegende Menschenrechte, dessen bist du dir schon bewusst, oder?«
»Sehr witzig, zum Totlachen«, sagte Thorne mit steinernem Gesicht, obwohl er die kleine Kabbelei genoss. Das mochte für die beiden für eine Weile die letzte Gelegenheit sein, über irgendetwas zu lachen.
Holland griff nach einem letzten Keks, verschloss die Dose und stellte sie in den Fußraum. Er blickte Thorne an.
»Also, warum du?«, fragte er.
Thorne hatte Brigstocke die gleiche Frage gestellt, so wie auch Helen ihm, als er ihr erzählte, was los war. In den vergangenen sechs Wochen hatte Thorne sich immerzu dieselbe Frage gestellt. Noch bevor er Holland sagen konnte, dass ihm kein einziger Grund einfiel, der ihm nicht eine Heidenangst einjagte, öffnete sich das Tor, und der einzige Mann, der die Antwort wusste, tauchte auf.
Da war es wieder. Dieses Zwicken in der Magengegend.
Jeffrey Batchelor ging voraus, ein Gefängniswärter in Zivil neben ihm her. Er blickte zum Himmel auf, zu den Bäumen jenseits der Tore, als wäre er leicht überrascht darüber, dass es sie immer noch gab. Nicklin folgte ihm auf den Fersen. Der Beamte neben ihm hatte seine Hand ausgestreckt, wie um ihn sanft zu führen, ohne dabei jedoch seine Schulter zu berühren.
Thorne und Holland stiegen aus.
Nicklin lächelte, als er Thorne entdeckte, und nickte. Tut mir leid, ich bin ein bisschen spät dran, aber Sie wissen ja, wie so was läuft. Nur seine Schritte wurden ein wenig schneller, als er sich näherte, und sein Lächeln breiter, bis es sich in ein Grinsen verwandelt hatte. Wären nicht die Handschellen gewesen, hätte es ausgesehen, als wäre es sein sehnlichster Wunsch, weit die Arme auszubreiten, um endlich umarmt zu werden.
4
Bis zur ersten von mehreren Autobahnen waren es noch fünfundzwanzig Meilen. Die Strecke bis dahin würde über enge, kurvenreiche Straßen verlaufen. Wie schnell sie vorankamen, hing von den Autofahrern vor ihnen ab, die es nicht besonders eilig zu haben schienen. Sie waren auf die Gnade vor sich hintuckender landwirtschaftlicher Fahrzeuge angewiesen und konnten weder Blaulicht noch Sirene einschalten, außer bei einem wirklichen Notfall. Nicht dass Thorne dieser Autofahrt überhaupt mit Freude entgegengesehen hätte, aber dieses Teilstück war das, was ihm am meisten Kopfschmerzen bereitete.
Dort waren sie wie auf einem Präsentierteller.
Sein Blick wanderte kurz zum Seitenspiegel und dem zweiten Ford Galaxy hinter ihnen.
In den vergangenen Tagen – und vor allem den Nächten – hatten ihn dunkle Fantasien verfolgt. Traktoren, die aus dem Nichts erschienen und über ihre Fahrspur rollten. Lastwagen mit bewaffneten Männern, die aus unsichtbaren Wegen hinter ihnen sprangen. Das Innere des Wagens blutgetränkt, während eine Vogelscheuche hämisch auf sie heruntergrinste und die Gefangenen weggeschafft wurden. Es war eher unwahrscheinlich, dass ihnen dergleichen in einem bebauten Gebiet oder auf der M54 bei sechzig Meilen in der Stunde passierte. Nein, wenn, dann hier. Mitten im verfluchten Nichts, in der Nähe des Gefängnisses, oder später, kurz vor ihrem Ziel. Auf ruhigen Landstraßen, die nicht überblickt werden konnten, meilenweit entfernt von der nächsten Überwachungskamera. Natürlich wusste Thorne ganz genau, dass es nicht passieren würde, doch er ließ zu, dass seine Fantasie verrücktspielte. Egal wie unwahrscheinlich es auch war, es blieb das Worst-Case-Szenario.
Und genau daran dachte man eben, wenn es um Stuart Nicklin ging.
Thorne blickte in den Rückspiegel.
Nicklin saß direkt hinter ihm auf der dreisitzigen Rückbank, einen freien Sitz zwischen sich und dem Hauptvollzugsbeamten, Chris Fletcher. Batchelor und Alan Jenks, der leitende Vollzugsbeamte, hockten zusammen auf den beiden Sitzen dahinter. Man hatte die Gefangenen angeschnallt, da sie weiterhin Handschellen trugen, ihre Hände lagen im Schoß. Die Gefängnishandschellen waren durch starre Speedcuffs ersetzt worden: Das stabile Metallstück, das die beiden Ringe miteinander verband, war so angelegt worden, dass die Handgelenke der Gefangenen übereinander fixiert waren. Dadurch war es ihnen unmöglich, die Arme nach vorne um den Hals einer Person zu werfen und sie mit den Handschellen zu erwürgen.
Sie hatten Long Lartin vor zwanzig Minuten verlassen und kurvten immer noch durch die offene Landschaft von Worcestershire. Auf den Feldern, die sich rechts und links der Bruchsteinmauer und der hohen silbrig glänzenden Hecken bis hin zum Horizont erstreckten, lag immer noch Reif.
Es war in diesen zwanzig Minuten noch kein Wort gefallen, bis Nicklin schließlich das Schweigen brach. Er beugte sich abrupt vor, wie um die restlichen Insassen aufzuschrecken, und steckte den Kopf so weit wie möglich zwischen die beiden Vordersitze.
Dann sagte er: »Das ist nett.«
Stuart Anthony Nicklin, mittlerweile zweiundvierzig Jahre alt, war mit sechzehn der Schule verwiesen worden, zusammen mit einem Jungen namens Martin Palmer. Der Rauswurf erfolgte aufgrund sexueller Nötigung eines Mitschülers. Wie sich später herausstellte, hatte Nicklin etwa zur gleichen Zeit auch ein fünfzehnjähriges Mädchen ermordet. Das war noch bevor er von zu Hause weglief und für mehr als fünfzehn Jahre verschwand.
»Die Landschaft«, sagte Nicklin. »Die Gegend.« Er blickte Fletcher an und drehte sich zu Batchelor und Jenks um. »Einfach alles.«
Nicklin war mit Anfang dreißig als eine völlige andere Person wiedergekehrt. Ein Mann mit neuem Namen und neuem Gesicht, der praktisch nicht wiederzuerkennen war, selbst für Martin Palmer nicht, zu dem er wieder Kontakt aufgenommen hatte. Trotz der Jahre, die vergangen waren, hatte Nicklin nichts von seiner Macht über den früheren Komplizen eingebüßt. Er manipulierte ihn geschickt und schürte in ihm eine solche Angst, dass Palmer Nicklins kranke Fantasien in einem dreimonatigen Blutrausch auslebte. Gemeinsam brachten sie mindestens sechs Menschen um. Männer und Frauen. Erstochen, erschossen, erdrosselt, erschlagen. Auch wenn Nicklins Hand vielleicht nicht immer die Waffe oder das Messer gehalten hatte, war es für alle, die den Fall verfolgt hatten, offensichtlich, dass die Morde auf ihn zurückzuführen waren.
Und das erfüllte ihn mit Stolz.
Das Ganze endete an einem kalten Februarnachmittag auf einem Schulhof. Der Mann, der durch seine Angst dazu getrieben worden war zu morden, und eine Polizistin waren tot. Vier Monate später, nach einem der größten Prozesse jüngerer Zeit, begann für Nicklin ein weiteres Leben. Das Leben eines der berüchtigtsten Serienmörder in einem britischen Gefängnis.
»Das ist es, was man vermisst.« Nicklin wies mit dem Kopf nach draußen. »Einfache, schöne Dinge. Bäume, ein blauer Himmel und eine Straße, die wie ein schwarzes Band vor einem liegt.« Er lehnte sich zurück, lachte und hob seine gefesselten Hände, um sich an der Nase zu kratzen. »Selbst der Geruch von Kuhscheiße …«
Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass Nicklin fast zehn Jahre glücklich verheiratet gewesen war und einen festen Arbeitsplatz gehabt hatte, bevor er und Palmer begonnen hatten zu morden. Was er jedoch in der Zeit davor gemacht hatte, in diesen »verlorenen« Jahren, konnte nie ganz geklärt werden. Später fand man heraus, dass er, direkt nachdem er weggelaufen war, einige Zeit als Strichjunge im Londoner West End gearbeitet hatte. Es war in jener Zeit – er war immer noch ein Teenager und der Schritt, sich als Person neu zu erfinden, lag noch vor ihm –, dass man ihn in eine Einrichtung für Problemjugendliche schickte, die auf einer kleinen Insel vor der nordwestlichen Küste von Wales lag, nachdem er zum x-ten Male wegen Straßenprostitution verurteilt worden war.
Tides House war ein Experiment, und es scheiterte.
Es war weder eine Anstalt für jugendliche Straftäter noch ein Kinderheim, sondern irgendetwas dazwischen; etwas anderes, dessen Schwerpunkt auf dem geistigen Erwachen und täglichen Besinnen lag. Ein Ort, an dem ein Kind, dessen Zukunft düster aussah, sich vielleicht noch ändern und wachsen konnte. Ein Ort, der ständig in der Kritik reaktionärer Kräfte in Parlament und Presse stand. Tides House schloss seine Pforten nach nur drei Jahren. Außer zerstörten Karrieren und verfallenden Gebäuden blieb nicht viel von dem übrig, was auf den Einsatz der Menschen hindeutete, die hinter diesem Projekt gestanden hatten. Nicklin lernte dort, während seines Aufenthalts vor fünfundzwanzig Jahren, Simon Milner kennen, einen fünfzehnjährigen Jungen, der bereits mehrfach beim Autodiebstahl erwischt worden war.
Jenen Jungen, dessen Leiche sie nun zu finden hofften.
»Die Umgebung wird noch viel schöner«, sagte Nicklin. »Glauben Sie mir! Wenn Sie Landschaften mögen, dann warten Sie nur mal ab, bis wir da sind.«
Thorne spähte erneut in den Rückspiegel. Nicklin schien so weit wie möglich nach links gerückt zu sein, um in Thornes Sichtachse zu sitzen, sodass sich ihre Blicke treffen mussten.
»Wir fahren nicht wegen der Landschaft dorthin«, entgegnete er.
Nicklin schnaubte und zuckte mit den Achseln. »Sie würden wohl lieber Sozialwohnungen durchsuchen, was, Tom? Den Scheißhaufen irgendwelcher Hunde ausweichen, während Sie den Garten irgendeines Prolls umgraben. Oder vielleicht doch lieber einen Steinbruch trockenlegen?«
Thorne umklammerte das Lenkrad etwas fester. Er wusste, dass er das nicht zum letzten Mal tat. Er und Holland warfen sich einen Blick zu, und ihm fiel ein, dass sie erst seit zwanzig Minuten mit Nicklin zusammen in diesem Auto saßen.
Thornes Handy summte, eine SMS.
Er griff nach unten zu dem Getränkehalter in der Mitte, wo das Telefon steckte, tippte die PIN ein und las die SMS von DI Yvonne Kitson.
Wie läuft’s? Bin auf dem Weg, um mit der Exfrau zu reden.
Er blickte wieder in den Spiegel, als er von hinten ein leises Kichern hörte.
»Glauben Sie nicht, Sie sollten besser auf die Straße achten?« Nicklin schüttelte den Kopf und wandte sich Fletcher zu. »Was sagen Sie dazu?« Der Gefängniswärter erwiderte nichts. »Da schauen Sie nur mal kurz nach unten auf Ihr Telefon für diese wichtige SMS von wem auch immer, und im nächsten Moment taucht aus dem Nichts ein Traktor auf und rollt direkt vor uns über die Straße …«
Schon wieder krallten sich Thornes Hände ins Lenkrad. Um sich zu entspannen, rief er sich etwas in Erinnerung. Ein lebendiges, wunderbares Bild entstand vor seinem geistigen Auge, das die Verspannung in seinem Nacken und den Schultern sofort löste. Sein Kiefer lockerte sich, die Mundwinkel wanderten nach oben.
Er erinnerte sich an einen kalten Februarnachmittag. Das Echo eines Schusses hallte immer noch durch die Luft, und ein überraschter Blick lag auf einem zerstörten Gesicht. Dieser in seiner ganzen Perfektion eingefrorene Moment, kurz nachdem Thorne Nicklin den Gewehrkolben in den Mund gerammt hatte. Zersplitterte Zähne, die sich durchs Zahnfleisch bohrten. Volle Lippen, die aufgesprungen waren wie faules Obst, und in Fetzen herunterhingen.
Weit aufgerissene Augen und Blut, das ihm an den Fingern herunterlief.
»Herrgott noch mal«, sagte Nicklin und beugte sich wieder vor. »Wir wollen doch in einem Stück ankommen, oder?«
Thornes Augen blieben auf die Straße gerichtet, das angedeutete Lächeln immer noch auf den Lippen. »Ich werde mein Bestes tun«, sagte er.
5
Vielleicht lag es an der Zeit und den jüngsten Enthüllungen über Jimmy Savile, aber selbst als anständig gekleidete Frau in den Vierzigern war es ihr unangenehm, sich vor einer Grundschule herumzudrücken. Sollte sie besser auf und ab schlendern oder auf einer Stelle stehen bleiben? Was wirkte unauffälliger? Yvonne Kitson vermutete, dass sie nicht ganz so viel Argwohn erregte wie ein Mann und bestimmt um einiges weniger als ein DJ und berühmter TV-Moderator aus den Siebzigern.
Trotzdem fühlte sie sich ausgesprochen unwohl in ihrer Haut.
Sie wartete seit nunmehr fünfzehn Minuten. Mehrere Personen hatten sie bereits mit Blicken durchbohrt, darunter ein Paar mittleren Alters, eine Passantin mit einem Kinderwagen und ein Lehrer mit feistem Gesicht. Er hatte sie eine geschlagene halbe Minute vom anderen Ende des Schulhofs her angestarrt, und sie hatte zurückgestarrt. Am liebsten wäre sie durch das Tor marschiert, hätte ihm ihren Dienstausweis vor die Nase gehalten und ihn mit den Worten angeschrien: »Außerdem habe ich drei Kinder, du kleiner mieser Wichser.«
Eine sehr verlockende Aussicht, aber äußerst dumm und natürlich ungerechtfertigt. Dumm, da es höchstwahrscheinlich das Treffen zunichtegemacht hätte, weshalb sie hergekommen war. Ungerechtfertigt, weil der Lehrer nur seinen Job machte. Die Menschen, die sich Kinder als Opfer aussuchten, sahen und traten völlig unterschiedlich auf. Nicht alle waren so einfach zu erkennen wie Jimmy Savile.
Oder, besser gesagt, nicht zu erkennen.
Was für eine entsetzliche Ironie es doch war, dass einer der schlimmsten Pädophilen, den es in der Geschichte des Landes gegeben hatte und der ungestraft davongekommen war, tatsächlich so ausgesehen hatte, wie es der landläufigen Vorstellung entsprach, dachte Kitson.
Es verstrichen noch ein paar Minuten, bevor eine Frau, von der Kitson vermutete, dass es diejenige war, auf die sie gewartet hatte, die Schule verließ und über den Schulhof ging. Sie blieb kurz vor dem Tor stehen. Gerade so lange, um eine Zigarettenpackung aus der Jackentasche zu ziehen und in Richtung eines kleinen Parks auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu nicken. So, als wollte sie wortlos und eher zu sich selbst sagen: »Da drüben!«
Kitson blieb noch eine halbe Minute an ihrem Platz stehen, bevor sie ihr folgte. Sie setzte sich auf das eine Ende der Bank, an deren anderem Ende sich die Frau gerade eine Zigarette anzündete. Kitson wusste aufgrund der Akte, die sie gelesen hatte, dass sie neununddreißig war, doch sie sah etwas älter aus. Ihr Haar war schulterlang und braun, sie trug eine Brille mit breitem schwarzem Gestell. Wie Kitson steckte sie in einem dunklen Rock und Jackett.
Sie hätten beide Lehrerinnen sein können. Oder Polizeibeamtinnen.
»Warten Sie schon lange?«,
»Etwa eine Viertelstunde«, erwiderte Kitson.
Die Frau machte keine Anstalten, sich dafür bei Kitson zu entschuldigen. Stattdessen zog sie mehrmals an ihrer Zigarette und sagte dann: »Hat die Pädo-Streife Sie unter die Lupe genommen? Ein kleiner Lehrer mit feistem Gesicht?«
»Ja«, antwortete Kitson und lachte.
»Wollen Sie eine?« Die Frau bot ihr eine Zigarette an.
Kitson schüttelte den Kopf. »Danke übrigens, dass Sie eingewilligt haben, sich mit mir zu treffen.«
»Hatte ich eine Wahl? Ich muss Sie doch alle bei Laune halten.« Sie warf Kitson einen kurzen Blick zu und nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette. »Es muss nur einen Polizisten geben, der im Pub rumquatscht. Oder einen, der einen falschen Namen erwähnt, und schon fällt das Kartenhaus in sich zusammen.«
»Ja, durchaus möglich«, erklärte Kitson.
»Es hat zehn Jahre gedauert, um das hier aufzubauen.«
Kitson nickte zur Schule. »Was glauben die, warum Sie rausgegangen sind?«
Sie wedelte mit der Zigarette. »Deshalb. So wie immer. Was bedeutet, dass wir ungefähr fünf Minuten Zeit haben. Das kommt mir sehr entgegen, denn länger möchte ich mich mit Ihnen nicht unterhalten.« Sie führte die Zigarette zum Mund, nahm sie dann wieder weg. »Und über ihn möchte ich noch nicht mal fünf Sekunden sprechen.«
»Es ist hübsch hier«, sagte Kitson. Die Schule lag am Rand von Huntingdon in Cambridgeshire, ungefähr siebzig Meilen entfernt von London. Weit genug weg. »Schön grün.«
Die Frau nickte und rauchte.
»Sind die Kinder nett?«
Ein weiteres Nicken. »Ich hatte Glück«, sagte sie und schnaubte dann über den Aberwitz ihrer Worte.
Die Frau, die einmal Caroline Cookson geheißen hatte, arbeitete immer noch im selben Beruf wie vor zehn Jahren, als ihr Leben völlig aus den Fugen geriet. Doch das war das Einzige, was geblieben war. Alles andere hatte sich verändert. Ihr Name, ihr Akzent, ihre Haarfarbe und ihre Frisur. Sie hatte eine neue Identität erhalten und war umgezogen, nachdem das gesamte Ausmaß der Gräueltaten ihres Mannes ans Licht gekommen war. Des Mannes, der sich damals Cookson nannte, in Wahrheit aber Stuart Nicklin hieß.
»Ich weiß nicht, wie ich Sie ansprechen soll«, sagte Kitson.
»Ich heiße Claire Richardson.«
Die Beamten, die für das Zeugenschutzprogramm von Caroline Cookson zuständig waren, hatten Kitson einen Namen, eine Telefonnummer und die Adresse einer Schule gegeben, an der »Claire Richardson« arbeitete. Darüber hinaus wusste Kitson allerdings nichts. Hatte sie noch einmal geheiratet? Hatte sie Kinder?
Die Beamtin fragte nach.
»Keine Kinder«, antwortete Claire. »Ich habe seit ein paar Jahren einen Freund.«
»Wie schön für Sie.«
»Ja. Er hat bisher noch niemanden umgebracht … Das ist echt ein Vorteil, wissen Sie.« Sie zog ein letztes Mal an ihrer Zigarette, ließ die Kippe auf den Boden fallen und drückte sie mit dem Stiefel aus. »Obwohl … beim letztenMal hatte ich auch keine Ahnung, nicht?«
Kitson lachte, weil sie sich dazu verpflichtet fühlte.
Claire blickte sie an und griff nach einer weiteren Zigarette. »Ich hab es nicht gewusst. Ein paar Zeitungen haben behauptet, ich hätte es gewusst, aber das hat nicht gestimmt. Mir wird immer noch schlecht, wenn ich nur daran denke, was er getan hat.«
Kitson versicherte ihr, dass sie ihr glauben würde; auch dazu fühlte sie sich verpflichtet.
Sie erklärte ihr den Grund ihres Kommens und betrachtete die Frau, die sich eine weitere Zigarette anzündete. Sie versuchte, nicht auf Claires Finger zu starren, die leicht zu zittern schienen. Sie erzählte von dem Gefangenentransport, der gerade stattfand, und erläuterte, warum sie bis zu dessen Durchführung hatte warten müssen, um mit ihr und noch einigen anderen Personen sprechen zu können. »Wir versuchen dadurch, das Risiko so gering wie möglich zu halten, dass etwas durchsickert.«
»Gut, und was wollen Sie nun von mir?«
»Weshalb macht er das?«
Claire wandte sich zu Kitson, starrte sie ungläubig an und schüttelte den Kopf. »Fragen Sie das im Ernst? Wie zum Teufel kommen Sie darauf, dass ich das wissen könnte?«
»Wir haben einfach nur gedacht, Sie hätten vielleicht eine Idee, das ist alles«, erwiderte Kitson. »Weil er Ihnen schreibt. Die Gefängnisleitung hat uns von den Briefen erzählt, und so haben wir uns gefragt, ob er irgendwas erzählt hat.«
»Ich bekomme diese Briefe nicht zu sehen«, erklärte Claire. »Zwischen mir und dem Zeugenschutzteam gibt es eine Vereinbarung. Die Briefe werden abgefangen. Und vernichtet.« Sie öffnete einen Mundwinkel, und eine Rauchfahne stieg heraus. »Na ja, das sagen sie zumindest. Vielleicht lesen sie sie auch zum Spaß. Oder verdienen sich ein paar Mäuse dazu, indem sie sie auf eBay einstellen. Ehrlich gesagt, interessiert es mich einen Dreck. Mir ist völlig egal, was er zu sagen hat!«
»Was, glauben Sie, was in den Briefen steht?«
»Ich habe Ihnen doch schon erklärt, dass es mir egal ist!«
»Sind Sie kein bisschen neugierig?«
»Nicht im Geringsten.« Sie wandte sich wieder Kitson zu. »Ich habe ihn ein einziges Mal gesehen. Vor fünf oder sechs Jahren. Da schrieb irgendein Journalist ein Buch, und ich hab gewusst, dass er rumschnüffeln würde. Um das zu verhindern, bin ich zu ihm gefahren. Ich war mir sicher, dass nur er das verhindern konnte. Dass er irgendein … Druckmittel hatte oder sonst was. Es war das einzige Mal.« Sie schluckte und zog tief an ihrer Zigarette. »Das einzige Mal.«
»Was hat er gesagt?«, fragte Kitson.
»Er wollte mir begreiflich machen, dass er mich immer noch liebt.« Claire beugte sich langsam vor und schob ihre Füße unter die Bank. Sie sah angewidert aus. »Dass er mich vermisst. Ach ja, und kurz bevor ich gehen wollte, meinte er, dass der Sex mit mir immer dann am besten gewesen sei, wenn er zuvor jemanden umgebracht hatte. Der Gedanke an seine Taten, all diese reizenden Details, hätten ihn noch mehr erregt und steifer werden lassen, während wir miteinander vögelten, sagte er, und er würde mir das jetzt alles erzählen, weil er meinte, ich würde es gerne wissen. Weil er meinte, es würde mich anmachen. Weil es ihn anmachte, da in dem Besucherraum.« Sie ließ die nur halb gerauchte Zigarette fallen und stand auf. »Deshalb: nein. Ich bin nicht neugierig.« Claire drehte sich um. Auch Kitson stand auf. »Tut mir leid, dass Sie Ihre Zeit verschwendet haben«, sagte sie.
»Schon gut«, erwiderte Kitson. »Ich glaube, so wird es mir den ganzen Tag ergehen. Tatsache ist nämlich, dass ich dem Polizisten, dem man aufgehalst hat, Ihren Exmann zu dieser Leiche zu bringen, gerade einen Gefallen tue … na ja, mehrere Gefallen. Genau genommen ist es derselbe Polizist, der ihn geschnappt hat.«
»Thorne«, sagte Claire.
Kitson war für einen Augenblick überrascht, doch dann begriff sie, dass die Frau Tom Thorne natürlich kannte. »Genau«, sagte sie.
»Wir sind uns nur einmal richtig begegnet. Ich wurde nach der Verhaftung meines Exmanns von einem anderen Beamten vernommen. Thorne kam anschließend herein und fragte mich, ob alles mit mir in Ordnung ist.« Sie ging zurück zur Straße.
Kitson folgte ihr. »Kann nicht leicht gewesen sein, das alles durchzustehen.«
»Für mich war es einfacher als für andere.«
Kitson wusste, wovon sie sprach. Jemand hatte ihr gegenüber erwähnt, dass zusätzliche Stühle in den Gerichtssaal gebracht werden mussten, damit die Angehörigen sämtlicher Opfer Platz fanden.
»Ich hab ewig nicht gewusst, was ich von ihm halten sollte«, sagte Claire. »Von Thorne, meine ich. Es war komisch, denn irgendwie hat er mich gerettet, denke ich, gleichzeitig aber mein Leben zerstört. Hört sich merkwürdig an, oder?«
»Eigentlich nicht.«
»Ich war mir nie sicher, ob ich ihn mögen oder hassen soll.«
»So geht es vielen«, sagte Kitson.
6
Kurz vor elf Uhr bogen die Autos auf die M5, eine kurze und landschaftlich nicht so reizvolles Strecke, die durch das Black Country führte. Sie fuhren an West Bromwich, Dudley, Walsall und Wolverhampton vorbei, bevor die Autobahn einen Bogen in Richtung Westen machte und zur M54 wurde. In fünfundzwanzig Meilen würden sie Shropshire erreichen, aus drei Fahrspuren würde eine Fahrspur werden, und die Fahrgeschwindigkeit würde sich unweigerlich wieder verlangsamen, was vermutlich der Hauptgrund für die lange Reise und ihre sorgfältige Planung war. Von den mehr als zweihundert Meilen waren es weniger als fünfzig Meilen Autobahn.
Die Unterhaltung war bisher etwas steif verlaufen. Die Gefangenen hatten den Anblick der mitunter eindrucksvollen Landschaft genossen, während Thorne aus Angst davor, etwas zu verpassen, was hinter ihm geredet wurde, sich bemüht hatte, nicht zu sehr in ein Gespräch mit Holland verwickelt und dadurch abgelenkt zu werden. Die beiden Wärter hatten bisher den größten Teil der Unterhaltung bestritten. Thorne vermutete, dass Jenks und Fletcher miteinander befreundet waren. Das Gespräch zwischen den beiden wirkte entspannt und ungezwungen, vielleicht sogar entspannter und ungezwungener als im Gefängnis, wo es aufgrund des Umfelds unklug war, zu viele persönliche Informationen preiszugeben. Wo Klappmesser und gespitzte Zahnbürsten nicht die einzigen Waffen waren.
Die beiden Männer waren Mitte bis Ende dreißig, Jenks glatt rasiert mit einer dunkelblonden Vokuhila, während Flechter kurz geschorenes Haar und einen gepflegten Ziegenbart hatte. Beide waren kräftig gebaut. Fletcher, der ältere der beiden, war kleiner und breiter. Seine Statur deutete nicht nur auf die regelmäßige Einnahme von Anabolika hin, sondern schrie förmlich danach. Er sprach mit einem nicht zu überhörenden Birminghamer Akzent, während Jenks eindeutig aus der Gegend der Themsemündung stammte. Kent, vermutete Thorne, oder North Essex.
Beide redeten gern.
Bisher hatte Thorne erfahren, dass Mrs. Fletcher im Monat zuvor einen kleineren Eingriff hatte vornehmen lassen müssen, während Jenks Probleme mit seinem Wagen gehabt hatte. Fletcher war Fan von Aston Villa, und Jenks hatte Eintrittskarten für einen Auftritt eines berühmten Comedians kurz vor Weihnachten gekauft. Jetzt sprachen sie davon, wo sie mit ihren Familien nächstes Jahr Urlaub machen wollten. Familie Jenks würde nach Orlando fahren – »natürlich der Kinder wegen« –, während die Fletchers sich auf Barcelona geeinigt hatten, da er endlich einmal das Nou-Camp-Stadion sehen wollte und seine Frau »so ’ne komische Vorliebe für alte Kirchen« hatte.