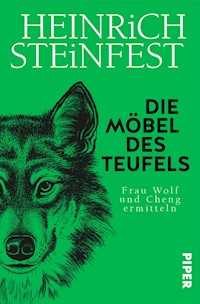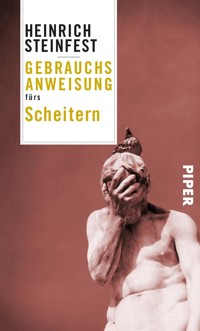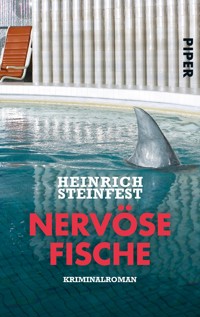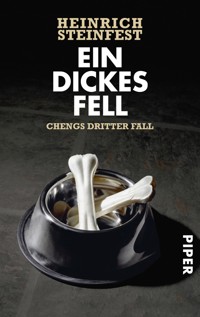9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eigentlich wollte Szirba, ein Auslandswiener in Stuttgart, nur seiner unschuldigen Obsession nachgehen, doch er hat die Rechnung am falschen Ort gemacht. Denn Stuttgart ist weitaus gefährlicher als vermutet: Szirba wird angeschossen und als leicht verletzter Zeuge eines Verbrechens ins Spital eingeliefert. Und muss bald feststellen, dass man ihn lieber tot sehen möchte. Seine Flucht entwickelt sich zum tragisch-komischen Parforceritt durch eine unwirkliche Stadt. Der andere Mann heißt Jooß. Er ist der Killer …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
3. Auflage Februar 2011
ISBN 978-3-492-95806-6
© 2008 Piper Verlag GmbH, München Erstausgabe: Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach 2001 Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagfoto: Busse Yankushev / plainpicture
Ich glaube, dass ich ein Supermann bin,
den man nicht verletzen kann. Meine Familie
sieht das aber anders.
Larry Holmes bei seinem Rücktritt im Alter von 46 Jahren
ich tauchte
in die schweren silbernen vorhänge
des januars
der eiswind
Lustig in die Welt hineingegen Wind und Wetter
Mut!, Winterreise, Franz Schubert/Wilhelm Müller
1| Der Wiener
Da stand er wieder. Seit ich vor anderthalb Jahren nach Stuttgart gezogen war, beobachtete ich ihn. Diesen Herrn, der wohl auf das Pensionsalter zuging, tatsächlich ein Herr, wie ich mir einen vorstellte: stets elegant gekleidet, jedoch ohne eine Spur von Auffälligkeit, ein Klassiker von einem Menschen, dessen gerade Körperhaltung und hagere Gestalt ihn größer erscheinen ließen. Wenn man sein längliches Gesicht betrachtete, konnte man sich gut ein Monokel darin vorstellen, aber wenn ihm überhaupt etwas Dandyhaftes anhaftete, dann war es der schmale Schnurrbart, der wie ein dunkel eingefärbter Balken die beträchtlich aufragende Nase unterstrich, darunter sich eine Summe aus dünnen Lippen und einem Sockel von einem Kinn ergab. Und wirklich erschien mir sein Gesicht wie eine Rechnung, die stimmte.
Freilich war es nicht physiognomische Algebra, die mein Interesse erregte, sondern der Umstand, dass dieser Mann einer Leidenschaft frönte, der ich selbst anhing. Die meisten Leute würden wohl weniger von einer Leidenschaft sprechen, eher von einer Zwangsneurose. Oder sie würden sogar so weit gehen, meine Handlung als eine merkwürdige Form von Verbrechen zu bezeichnen. Ein verbrecherisches Tun mittels Umkehrung. Man könnte sagen: ein Abgabedelikt. Wissenschaftlich gesehen, handelt es sich wohl um das verwandte Gegenstück zur Kleptomanie, um den krankhaften Trieb der Zuführung, Vermehrung, Komplettierung.
In einem Alter, da andere Kinder in einer Art krimineller Sozialisation begannen, sich in Supermärkten und Warenhäusern um Süßigkeiten und Kleinstspielzeug zu bereichern und solcherart die Dramatik eines rechtlosen Daseins zu erfahren, sperrte ich mich gegen diverse Anstiftungsversuche. Weniger aus Angst oder gar moralischen Zweifeln – es lag mir einfach nicht. Und als ich einst im Schlepptau meiner diebischen Freunde in einer Süßwarenbude stand, wie es sie damals noch gab und die zumeist von nahezu blinden älteren Damen geführt wurden, da überkam es mich. Ich griff in die Tasche, zog ein zuvor legal erstandenes Stück Kaugummi heraus und deponierte es – mit denselben Mitteln der Vertuschung, mit der die anderen stahlen – in einer Schachtel, in der sich ebenfalls Kaugummis befanden. Was für ein Erlebnis! Endlich hatte auch ich meine gewohnheitsverbrecherische Ader entdeckt. Was gleichzeitig einen Ausbruch aus der Normalität bedeutete. Mir wurde bewusst, dass ich anders war. Dabei erschien mein Tun mir in keiner Weise weniger anstößig als ein Diebstahl. Störend empfand ich jedoch, dass es gleichsam folgenlos blieb. Schließlich besteht ein Reiz derartiger Unternehmungen darin, dass die Tat später entdeckt wird, ohne sie jedoch mit dem eigentlichen Täter in einen Zusammenhang bringen zu können. Ein völlig unentdecktes Vergehen hingegen besitzt die Wirkung eines Bildes, das nie gemalt wurde. Weshalb ich auf die Idee verfiel, in den Regalen der Märkte und Geschäfte Produkte unterzubringen, die dort nichts verloren hatten, also möglicherweise auffallen würden. Das ist nun ein entscheidender Punkt. Würde man etwa einen Schuh zwischen Schokoladetafeln stellen, wäre dies eine bloße Karikatur des eigenen Triebes, zudem eine wirkliche Unart, da Schuhe in der Nähe von Nahrungsmitteln nichts zu suchen haben. Es geht vielmehr darum, eine mitgebrachte Schokolade unter die angebotene Schokolade zu schwindeln, wobei jedoch die Marke der hinzugelegten Tafel in dem betreffenden Geschäft gar nicht verkauft wird. Da meine Verwandtschaft dem gehobenen Mittelstand angehörte und mich zu diversen feierlichen Anlässen mit qualitativ eher hochstehender Ware versorgte, war es mir vergönnt, selbige in Billigläden unterzubringen. Missverständnisse drängten sich auf. Und tatsächlich wurde ich einmal ertappt, als ich versuchte, ein von meiner Tante mütterlicherseits in England erstandenes Modellauto in einer Anhäufung von Matchbox-Autos abzulegen. Der Unterschied zwischen dem sehr fein gearbeiteten Winkelmann-Lotus-59-Cosworth, den ich noch immer in der Hand hielt, und den anderen Gefährten war natürlich eklatant, wollte dem in seinem Eifer blinden Warenhausdetektiv jedoch nicht auffallen. Mir selbst fehlte sowohl die rhetorische Gabe als auch der Wille, ihn darauf aufmerksam zu machen. Ich verhielt mich ordnungsgemäß, brach in Tränen aus und flehte ihn an, meine Eltern aus dem Spiel zu lassen. Selbige erschienen eine Stunde später in dem kleinen Raum, in den man mich gesetzt hatte. Der Detektiv sprach von Anzeige. Mein Vater beachtete ihn nicht einmal, verlangte den Geschäftsführer zu sprechen, als wolle er sich über eine Nachlässigkeit beschweren. Das war seine Art, mit Subalternen umzugehen, die selten ihre Wirkung verfehlte. Der Geschäftsführer erschien. Mein Vater benötigte ein paar Minuten, dann konnten wir gehen. In solchen Dingen war er ungemein souverän.
Da meine Eltern Ende der Sechzigerjahre auf der Höhe der Zeit zu sein pflegten, ersparten sie mir Predigten und Sanktionen, nicht jedoch den Besuch eines Psychologen. Seine Freundlichkeit und grundsätzliche Bereitschaft, meine angebliche Fehlleistung zu tolerieren und als das Signal eines Sprachlosen zu begreifen, sowie die Art dieses Mannes, mich wie einen Erwachsenen zu behandeln, der ich ja nicht war, waren mir nicht geheuer. Was mich dazu veranlasste, an diesem Ort der Beichte, der Sündenerkenntnis und Sündenvergabe (so verstand ich ihn), nicht von meiner Leidenschaft zu sprechen und auf dem Spannungsmoment eines Diebstahls zu bestehen. Und gleichzeitig darauf zu beharren, es nie wieder tun zu wollen. Mir schien, dass ich den Psychologen mit einem solchen Gelöbnis enttäuschte.
Dass man zu Hause nunmehr verstärkt bemüht war, auf mich einzugehen, empfand ich als Belastung. Auch dass mein Umfeld (offensichtlich auf Empfehlung des Psychologen) sich dazu zwang, mich nicht mehr mit exklusiven Geschenken einzudecken, mir dieserart also das notwendige Material für meine Arbeitsweise vorenthielt. Glücklicherweise nahm der Druck der Einfühlsamkeit, der auf mir lastete, bald wieder ab und die Gabenfreudigkeit der Verwandtschaft wieder zu, da sie schlichtweg begriff, dass es zu wenig war, bloß sich selbst mitzubringen.
Ich möchte behaupten, dass ich durchaus normal aufwuchs, in dem Sinn, dass ich beim Fußball nicht im Tor stehen musste, meine Freizeit zusehends dem anderen Geschlecht widmete (ohne dabei zu gesunden, im Gegenteil) und schließlich ein Studium absolvierte, und zwar Architektur, als Kompromiss zwischen brotloser Schöngeistigkeit und der väterlichen Empfehlung, das Abenteuer des Welthandels kennenzulernen. Mein geheimer Trieb blieb unentdeckt, was mir als der eigentliche Kern eines jeden wirklichen Triebes erscheint: unentdeckt zu bleiben. Aber eben nicht unausgelebt. Freilich versuchte ich Steigerungen, weg vom reinen Warenhausdelikt, teils riskante Manöver, etwa indem ich die gut bestückte Glaskugelsammlung der Mutter einer Freundin um zwei passende Exemplare bereicherte. Als ich das nächste Mal zu Besuch kam, waren die beiden Stücke verschwunden. Doch geredet wurde davon nicht. Den meisten Leuten schienen solche Entdeckungen peinlich, als zweifelten sie an ihrem Verstand. Auch geriet ich nie in Verdacht, zumindest in keinen, welcher ausgesprochen wurde. Mein Meisterstück, wenn ich das sagen darf, war sicherlich die Unterbringung einer kleinen Handzeichnung von Wilhelm Busch in einer Münchner Galerie (deren Namen ich verständlicherweise nicht nennen kann). Ich riskierte wahrlich Kopf und Kragen, als ich in einem unbeobachteten Moment einen Nagel in die Wand schlug, dort, wo nahe einer Ecke noch genügend Raum war, und die gerahmte, monogrammierte und betitelte Zeichnung platzierte, ein Original, das meine Großmutter mir als einziges Stück vermacht hatte. Eine Fälschung wäre für mich nicht infrage gekommen. Unbehelligt verließ ich die Galerie. Und erdreistete mich, sie tags darauf nochmals aufzusuchen. Das Bild hing an derselben Stelle, nun wiederum durch den Galeristen komplettiert, der neben dem Bild eine Nummer angebracht beziehungsweise selbiges in seine Preisliste aufgenommen hatte. Übrigens ein Betrag, der mich kurz an meiner Handlung zweifeln ließ. Aber das war es wert gewesen. Der Preis entsprach der Tat. Zu dem Galeristen ist zu sagen, dass er wohl zu jenen Geschäftsleuten gehörte, die es verstehen, ein Geschenk anzunehmen. Oder eben einer war, der die eigene Vergesslichkeit nicht weiter tragisch fand. Eine Aktion in dieser Größenordnung wiederholte ich nicht. Dazu fehlte es mir an Kapital wie an Risikobereitschaft.
Sieben Uhr abends. Der Mann stand vor den Kochbüchern. Ich war gespannt, was für einen Band er dazulegen würde. Natürlich etwas, das mit Kochen zu tun hatte. Er verhielt sich stets korrekt, keine Übertreibungen, eben nicht der Schuh in der Schokolade. Also keine Philosophie zwischen Schauspielerporträts, keine Naturwissenschaft zwischen Lyrik, wenngleich er zu einer gewissen Ironie neigte, indem er einmal mittels eines dünnen Buches von Klaus Mann in die massive Phalanx der gesammelten Werke Karl Mays eingebrochen war, oder jüngst, als er einen Band, der das Verhältnis zweier führender sozialdemokratischer Politiker romanhaft behandelte, mit Ian McEwans Schwarze Hunde abgedeckt hatte. Diesbezüglich war ihm einiges zuzutrauen. Auch dass er jetzt ein seltenes, wertvolles Exemplar von »Kochen mit Blausäure« aus seiner Tasche ziehen und zwischen »Kochen mit Kindern« und »Kochen mit dem Wok« deponieren würde.
Das Geschäft befand sich in der Halle des Hauptbahnhofs, die Dependance einer großen Verlagsbuchhandlung. Jetzt im Januar ein durchaus gemütlicher, weil gut beheizter Ort. Auch ein moderner Ort, wo es nicht einfach war, unbezahlte Ware hinauszuschmuggeln. Aber es gab ja Leute, die es andersherum versuchten. Hier hatte ich den Mann das erste Mal gesehen, vor eineinhalb Jahren, in der zweiten Woche meines Aufenthalts. Es sollte mein erster Versuch in dieser neuen Stadt sein, etwas zuzufügen (so nenne ich das; ein Analytiker hätte wohl seine Freude an diesem Ausdruck). Offensichtlich beutelte mich bereits das Heimweh, denn es handelte sich um eine populär-avantgardistische Wiener Meisterschrift, die ich zwischen zwei baden-württembergische Fotobände schmuggeln wollte. Als ich mich vorsichtig umschaute, bemerkte ich den anderen, genau in dem Moment, da er in aller Ruhe, jedoch mit der Rasanz und Fertigkeit des Taschendiebs, ein Buch aus der Sakkotasche zog und es auf einen Stapel legte – wie einer, der es sich gerade anders überlegt hat, so, als wolle er die Ware doch nicht erstehen. Dann schlenderte er aus dem Buchladen, wobei er noch einige Blicke auf die Regale warf. Ich konnte mir nicht sicher sein, zudem war der Gedanke neu, dass noch jemand dem Zwang des Zufügens unterstand. Also ließ ich die Wiener Meisterschrift in meiner Mappe und ging hinüber, um mir das Buch anzusehen, das der andere abgelegt hatte. Es handelte sich um Stendhals Le Rouge et le Noir, eine Ausgabe im Original aus dem Jahre 1967, also wohl kaum aus dem Bestand einer Bahnhofsbuchhandlung. Deponiert hatte er das gute Stück auf einem Werk der Trivialliteratur, das ebenfalls von erotischen Verwicklungen zur Zeit der französischen Restauration handelte. Weshalb ich zunächst annahm, es hier möglicherweise bloß mit einem Gegner seichter Unterhaltung zu tun zu haben, der solcherart seinem Protest Ausdruck verlieh. Doch als ich den Mann Wochen später wiedersah, ihm durch ein Kaufhaus folgte und dabei beobachtete, wie er mit der gleichen Raffinesse eine alte Aktentasche unter edle Lederstücke mischte (was übrigens Stunden später einen blinden Bombenalarm zur Folge hatte), war mir klar, dass es sich um einen Gleichgesinnten handelte. Und auch die Bücher betreffend ging es ihm nicht um Standesdünkel, sondern um Witz. Das erkannte ich, nachdem er in einem Antiquariat neben Musils Der Mann ohne Eigenschaften ein altes Wiener Telefonbuch abgelegt hatte. Was mir die vage Hoffnung gab, er sei ein Landsmann. Natürlich blieb ich auf Distanz. Auch unterließ ich es, meiner Leidenschaft in jener Bahnhofsbuchhandlung zu frönen, in der ich ihn des Öfteren sah. Das war sein Platz, auch wenn er zumeist bloß herumstand, den Körper gerade hielt und mit geneigtem Kopf das Angebot betrachtete – schließlich stiehlt man auch nicht jeden Tag. Wie ich selbst trug er stets eine Tasche, schien ebenfalls gerade von der Arbeit zu kommen oder auf einen Zug zu warten.
Eine solche Tasche hatte er auch jetzt bei sich, als er vorgab, einer recht fülligen Person Platz zu machen. Er tat es mit einer großzügigen Geste, während er gleichzeitig, sozusagen im Schutz der Geste, einen großformatigen Band aus seiner Aktentasche zog, nun darin blätterte, interessiert tat, schließlich enttäuscht schien und die Lektüre zwischen den Kochbüchern deponierte. Ich stellte mich neben einen Angebotstisch mit Kunstbüchern, keine zwei Schritt von ihm entfernt. Noch nie war ich so nahe an ihn herangekommen, vergaß mich und starrte unverwandt in seinen Rücken. Mit einer Bewegung, die gleichzeitig rasch, aber ohne jede Hektik war, drehte er sich zu mir. Erst jetzt erkannte ich, dass er einen leichten Silberblick hatte, das rechte Auge ein wenig nach außen abwich. Übrigens änderte das nichts daran, dass die Rechnung in seinem Gesicht aufging.
Einen Moment meinte ich, er blicke mich strafend an, als gehöre es sich nicht, dass ein Täter dem anderen bei der Arbeit über die Schulter schaut; dann aber deutete er ein Lächeln an, nickte mir zu wie jemandem, den er vom Sehen kannte, und widmete sich wieder der ausgestellten Ware.
Der Aufschrei einer Verkäuferin riss mich aus meinen Überlegungen. Im Eingangsbereich stand ein junger Kerl, keine achtzehn. Eine Menge solcher Typen lungerten auf dem Bahnhofsgelände herum, mit verkehrt herum aufgesetzten Baseballkappen, wuchtigen Basketballschuhen und schwarzen Lederjacken, die wie offene Zwangsjacken von den schmächtigen Körpern hingen. Die meisten Leute waren der Ansicht, dass die Seelen dieser Jugendlichen vermint waren und es besser sei, solche Problemfälle für allezeit aus dem Verkehr zu ziehen. Nun, der hier gab sich redlich Mühe, die pädagogischen Forderungen der Mehrheit zu begründen, nicht nur seines Aussehens wegen – etwa der schmucken Narbe, die quer über beide Wangen verlief, was seinem südländischen Gesicht einen schrumpfkopfartigen Charakter verlieh –, sondern vor allem, da er eine Pistole in der ausgestreckten rechten Hand hielt und damit durchaus die abendliche Geschäftstätigkeit störte, wie überhaupt den Frieden, der in den Herzen der Menschen brodelte. Noch immer brodelte, oder eigentlich schon wieder, nachdem dieser Friede kurz zuvor übergelaufen war, wie stets am Heiligen Abend.
Obwohl der Junge neben der Kasse stand, hielt er die Waffe nicht der Angestellten unter die Nase, sondern hatte sie in den Raum hinein gerichtet und zielte … nun, er zielte nicht in der Gegend herum, sondern drückte auch ab, denn wegen der Kasse oder eines Buches war er nicht gekommen.
Es war ein Reflex. Ich rede von mir. Der Reflex des guten Menschen? Der Reflex, der wie ein unverrückbarer Schrank auch in einem furchtsamen Gemüt steckt? Ich glaube nicht, dass ich für jeden x-beliebigen Passanten mein Leben riskiert hätte. Aber immerhin bewunderte ich diesen Mann, der mit solcher Bravour Waren in das Angebot hineinzuschmuggeln verstand. Sein Augenleiden, das ich soeben entdeckt hatte, rührte mich, während die Gestalt im Ganzen mir Respekt abverlangte. Ist das ein Grund? Ein Grund dafür, in dem Moment, da eine Kugel abgefeuert wird, sich nicht von jener Person abzuwenden, der diese Kugel gilt, sondern auf sie zuzustürzen, mit ausgebreiteten Armen, um sie aus der Schusslinie zu befördern? Genau das tat ich. Denn der, dem die Kugel galt, merkte es nicht, schaute weiter auf die Kochbücher, schien den Schrei nicht gehört zu haben. Alles ging sehr schnell. Aber ich erreichte ihn, und zwar rechtzeitig, sodass ich ihn gegen ebenjene Kochbücher schleuderte. Dort, wo die Kugel in den Mann hätte dringen sollen, befand ich mich nun selbst, glücklicherweise jedoch nicht mit lebenswichtigen Teilen meines Körpers, sondern bloß mit der linken Hand. Das Projektil trat zwischen den Ansätzen von Daumen und Zeigefinger ein und fuhr durch das Daumensattelgelenk – kein echtes Hindernis, weshalb die Kugel auf der anderen Seite wieder austrat und mit geminderter, aber noch beträchtlicher Geschwindigkeit in den Brustkorb eines Mannes eindrang, der möglicherweise erstarrt oder in die falsche Richtung geflüchtet war, auf jeden Fall so stand, dass die Kugel einen Schusskanal bilden konnte und erst stecken blieb, nachdem sie seine Lunge erreicht hatte. Der Mann hatte mit der Sache nicht das Geringste zu tun. Wonach keine Kugel fragt. Er starb. Woran ich schuld bin. Möglicherweise sogar in zweifacher Hinsicht. Einmal, da ich das eigentliche Opfer aus der Bahn gedrängt hatte. Durchaus löblich. Aber dann hätte ich wenigstens so gut sein können, selbst getroffen zu werden, und zwar entscheidend, nicht bloß mit der Lächerlichkeit der eigenen Hand. Später kam mir sogar der Gedanke, dass ich durch mein Eingreifen die Kugel auf eine Weise abgelenkt hatte, dass sie gerade dadurch an einer so ungünstigen Stelle oder, anders gesagt, in einem ungünstigen Winkel in den Unschuldigen gefahren war.
Ich presste den Körper auf den Boden – überzeugt, dass der Herr, der jetzt in den Kochbüchern lag, trotz meines Einsatzes getroffen worden war. Dass dies vielmehr für einen anderen Herrn hinter mir galt, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, auch befand ich mich in Unkenntnis der eigenen Verletzung, die ich noch nicht spürte (sie wird sich in dieser Geschichte noch deutlich bemerkbar machen – man soll nicht glauben, was so ein kleines, weggeschossenes Stück Fleisch wert ist).
Der Junge hatte einen einzigen Schuss abgegeben, fuchtelte mit der Waffe und schien zu überlegen, ob das auch genüge. Gut möglich, dass er in dem Durcheinander glaubte, den Richtigen getroffen zu haben. Auf jeden Fall war er kein eiskalter Profi. Er entschloss sich zum Rückzug und rannte durch die automatisch sich öffnende Tür. Deutlich drang der Lärm der Erregung in den Raum, die üblichen Haltet-das-Schwein!-Rufe von Leuten, die lieber stehen blieben und wohl auch kaum geschrien hätten, wäre ihnen die Waffe in der Hand des Davoneilenden aufgefallen. Auch von denen, die auf dem Boden der Buchhandlung lagen, rührte sich keiner. Der Schütze war draußen, das war gut so, das war die Hauptsache. Es herrschte eine merkwürdige Ruhe, als lauschten alle dem Quell austretenden Blutes. Man hätte meinen können, die Leute würden am liebsten ein wenig über die Sache schlafen. Wurden jedoch aufgeschreckt, als nun aus der Halle eine Reihe von Schüssen zu hören war. Die meisten sprangen auf, denn Neugier geht vor Angst. Sie drängten sich nahe dem Eingang und blickten hinüber zur Ostseite. Wie ferngesteuert war ich mit dem Pulk mitgezogen, vergaß, nach dem Herrn zu sehen, dem mein Rettungsversuch gegolten hatte, zwängte mich hinaus, streckte den Kopf, erblickte aber nicht viel mehr als einige Polizeibeamte, die auf der Höhe des Abgangs ein grünes Knäuel bildeten. Ein Bahnbediensteter drängte die Gaffer zurück, schrie über deren Köpfe einem Kollegen etwas zu. Was ich aus dem Gewinde aus Lauten heraushörte, das war: »…Sauhond erwischd…« Dies erinnerte mich daran, dass möglicherweise ebenjener Sauhund meinen unbekannten Freund verletzt oder getötet hatte. Ich trat zurück in den Laden, wo nur mehr wenige Leute standen. Einige hielten einander fest. Es war wie das Schluchzen aus einer verschlossenen Lade. – Da lag er. Jemand kniete neben ihm, schüttelte den Kopf. Dann schaute ich genauer hin. Er befand sich nicht bei den Kochbüchern, sondern ein Stück weiter hinten, auf der Höhe der Stadtpläne und Straßenkarten, neben seinem Kopf eine karierte Cordmütze. Er besaß ein feistes Gesicht, das nun wie eine umgekippte Torte schräg gestellt auf dem Boden klebte. Der Anblick der Blutlache ließ mich wanken. Ich weiß nicht, warum, aber wenn ich Blut sehe, habe ich diesen süßlichen Geschmack auf der Zunge. Der Geschmack ist nicht das Problem, sondern das Gefühl, Blut im Mund zu haben.
»Das ist er nicht«, sagte ich laut. Weshalb man zu mir herschaute.
»Großer Gott, Ihre Hand!«, rief jemand. Aber ich schaute mich nach dem Mann um, für den ich mein Leben riskiert hatte. Offensichtlich nicht umsonst, denn er war verschwunden.
In diesem Zustand der Ratlosigkeit kam ich so weit zur Ruhe, dass ich mich fragte, was der Hinweis auf meine Hand zu bedeuten habe. Und spürte auch schon den Schmerz, der sich beim Anblick der Wunde verdichtete wie auch der Geschmack von Blut in meinem Mund. Zum fremden nun auch das eigene, was meine Übelkeit nicht verringerte. Das Bild, das ich noch sah, gehörte schon nicht mehr zur realen Welt. Ich kannte dieses Bild aus meinen Träumen: Ein Ei öffnet sich, darin ein zerstückeltes… Dann kippte ich um. (Das Interessante an dem Ei war weniger der blutige, aber doch recht konventionell horrible Anblick als vielmehr der Umstand, dass dieses Ei in der Mitte und an den Polen aufgeschraubt werden konnte, obwohl es sich mit Sicherheit um ein natürliches Hühnerei handelte. Das war der eigentliche Schrecken. Eine Natur, die sich ohne jedes menschliche Zutun Marktgesetzen unterwarf.)
Als ich zu mir kam, lag ich bereits auf einer Trage, schaute hinauf zur Deckenkonstruktion der Bahnhofshalle, die ich jetzt noch monumentaler erlebte. Dann schob sich ein Kopf dazwischen. Ein Mensch mit Brille und weißem Kragen sah mir in die Augen, als suchte er darin eine Unregelmäßigkeit, die es zu beschreiben galt. Ich spürte die Hektik um mich herum, auch die eigene Bedeutung, die mir meine exklusive Lage verlieh; ich vermeinte sogar, einzelne Beifallsrufe zu vernehmen. Die dachten wohl, ich hätte die Kugel des Jungen absichtlich mit der Hand abgefangen.
Man hob mich in einen Rettungswagen, wo ich nie zuvor gelegen hatte. Drei Leute stiegen zu mir ein. Ich fand es eng. Und ich fand, dass es nach Zigaretten roch. Was ich nicht ansprechen wollte. Ohnehin wurde nichts geredet, eigentlich auch nichts getan. Na gut, es war ja bloß meine Hand verletzt, und der Einsatz der Sirene beim Losfahren galt vermutlich weniger mir als dem Vorfall an sich. Immerhin meinte ich trotz kurzer, ruhiger Fahrt mehrere Male das Bewusstsein zu verlieren. Vielleicht war da eine zweite Kugel, die ich nicht bemerkt hatte, die keiner bemerkt hatte.
Sie schoben mich durch lange Gänge. Alles wie im Fernsehen, wo man ja auch stets die Perspektive des Patienten zu sehen bekommt, halbe Gesichter, drittel Gesichter, hin und wieder einen Arm, beruhigende Worte, dahinschießende Neonröhren. Ganz so schnell ging es hier nicht. Die Neonröhren schossen nicht, sondern schwammen gemächlich vorbei. Auch sprach noch immer keiner. Und es schien sich nicht gerade um das neueste Spital zu handeln. Vergilbte Wände. Krankes Licht. Kaum Farbgestaltung. Sie ließen mich in einen Operationssaal gleiten. Saal ist übertrieben. Mehr ein Hobbyraum mit Tageslichtlampe. So hatte ich mir früher den Ostblock vorgestellt, Chirurgie als Höhepunkt improvisatorischer Kunst. Überall Mangel, überall Vorsintflut. Deshalb Mikroben, deshalb Amputationen et cetera. War es möglich? Lag ich im Hauptstätter Hospital? Einem Bau in bester Lage, dessen Architektur allerdings an jene Wohnanlagen erinnerte, die von den Rändern unserer Städte wie Nesseln abstehen, um wen auch immer abzuschrecken. Der Ruf dieses Krankenhauses war geprägt durch seine psychiatrische Abteilung. Doch auch als schlichter Unfallpatient eingeliefert zu werden, galt als Unglück, da einigen Ärzten der Ruf der Lässigkeit anhing, der operativen Lässigkeit. Klatsch machte die Runde von verschwundenen Organen, vergessenen Zangen, von Patienten, die wegen erkrankter Herzkranzgefäße gekommen und in der Psychiatrie gelandet waren, natürlich auch von Krankenschwestern, die kein Pardon kannten. Auch wenn einst ein berühmter und angefeindeter Regisseur sich hier hatte behandeln lassen (die Leute behaupteten, dass man es ihm auch ansehe), ein ehemaliger Stararchitekt von »grandioser Medizinmaschine« gesprochen hatte und der Haupttrakt unter Denkmalschutz stand, waren viele Stuttgarter nicht davon abzubringen, den ganzen Komplex als einen »irren Bau« anzusehen.
Ich lag da und blinzelte in die Leuchte. Wieder schob sich ein Kopf dazwischen. Das Gesicht des Chirurgen. Ich glaubte es jedenfalls an seinem zufriedenen Ausdruck zu erkennen. Einer von der spaßigen Sorte, der mit gespielter Hochachtung die Verletzung meiner Hand betrachtete, als hätte ich sie mir selbst zugefügt, und zwar mit Feingefühl und Kunstverstand. Und das nur, um ihm, dem Herrn Doktor, eine Freude zu bereiten.
»Also«, rief er jemandem zu, der hinter mir stand, »Vorhang runter.«
Der Angesprochene stülpte mir die Narkosemaske über und bat mich, rückwärts zu zählen. Warum rückwärts?, fragte ich mich. Gab es dafür einen stichhaltigen Grund, oder handelte es sich bloß um ein Zitat? Ein Anästhesist zitierte den anderen, eine reine Usance, so wie das umgehängte Stethoskop von Internisten, eine Kostümierung, mit der sie ihr Publikum unterhielten und …
Irgendwann in der Nacht schlug ich die Augen auf. Es war rein gar nichts zu sehen. Aber meine Hand spürte ich. Und wie. Als hätten sie mir alle Finger gebrochen und zu einem Zopf gebunden. Sie hatten mich verstümmelt und dann in den Keller geschoben. Niemand würde sich nach mir erkundigen. Ich war Österreicher, aber trotzdem unbeliebt. Auch bei meiner Frau. Sie würde nicht einmal …
»Guten Morgen, Herr … Szirba.«
Mein Name ging dem Mann nicht leicht von der Zunge. Das war ich gewohnt und ließ sämtliche Aussprachen zu. Es wäre unvernünftig gewesen, einen Einheimischen über die richtige Aussprache meines Namens unterrichten zu wollen. Der schwäbische Mensch liebt die Belehrung, die ausgeführte, nicht die angenommene. Sind die Schwaben untereinander, so belehren sie quasi in den leeren Raum hinein. Ihre verbalen Auseinandersetzungen vermitteln das Bild von Duellanten, die in entgegengesetzte Richtungen feuern, und zwar Rücken an Rücken, jedoch nichtsdestoweniger hasserfüllt, möglicherweise in der Hoffnung, das Geschoss würde nach einer Erdumdrehung den Kontrahenten treffen. Seitdem ich in dieser Stadt lebte, hielt ich mich zurück, blieb vermeintlich meinungslos, lachte, wo Lachen angebracht schien, bewegte mich nickend durch mein Arbeits- und Privatleben, lobte alles Inländische, leider jedoch unsicher, wo das Inland begann und wo es endete. Und legte auch eine gewisse Begriffsstutzigkeit an den Tag, wie man sie hier, wenn auch in Maßen, bei Ausländern gern antrifft. Es ist wie wahrscheinlich überall auf der Welt. Der Schwabe, ein wenig träge und langsam, hält sich gern für flink. Nur zu verständlich, dass er im eigenen Land darüber bestimmen möchte, wer hier langsam ist. Also: Ich bevorzugte es, Problemen aus dem Weg zu gehen. – Warum hatte ich dann in die Flugbahn dieser Kugel gegriffen?
Der Mann, der neben meinem Bett saß, war Hauptkommissar, eine nicht weiter auffällige Gestalt mit halbierter Haarfülle, aber gepflegten Zähnen, nicht eigentlich fett, jedoch mit einem direkten Übergang vom Kinn zum Halsansatz. Er schien mir einer dieser Leute zu sein, die nie in ihre Anzüge hineinpassen, sich aber daraus nichts machen, wie sie sich überhaupt aus nichts etwas machen, abgesehen von ihrem Beruf, der sie von zu Hause fernhält. Er sprach Hochdeutsch, wurde dennoch nicht ungemütlich. Sein Name war Remmelegg. Wie die bayerische Alp, erklärte er mir, von der er jedoch nicht stamme, sondern aus Heidelberg, und eigentlich müsste er Remmele heißen. Aber sein Großvater habe 1934 – nach nicht geringen Bemühungen – die deutsche Bürokratie überzeugen können, dass es auf zwei lächerliche g kaum ankomme und man nicht verlangen könne, dass er, Heinz-Eugen Remmele, weiterhin denselben Namen wie jener Hermann Remmele trage, der einst Vorsitzender der KPD und hoher Kominternler gewesen war. Zwar lebte der Kommunist seit 1932 in Moskau, war ein Jahr zuvor in die russische Mühle geraten und sämtlicher Funktionen enthoben worden, doch der Ärger des Heinz-Eugen war dennoch so beträchtlich, dass er lieber zum bayerischen Klang wechseln wollte, als weiterhin mit einem dunkelrot befleckten schwäbischen Namen leben zu müssen. Und dass Hermann Remmele nicht einmal mit den Bolschewisten auskam, wertete er als letzten Beweis für die Schlechtigkeit dieses Kommunisten. Obwohl dem Heinz-Eugen damals auch die Nazis zu sehr nach Gosse rochen (April 1934, noch marschierte Röhm), verdankte er ihnen die ersehnte Änderung seines Namens.
»So ist das Leben«, sagte Remmelegg, »der Mann ist erst vor zwei Jahren gestorben, vierundneunzigjährig. Nicht der Hermann, natürlich nicht, nicht unter Stalin, da war neununddreißig Schluss, sondern mein Großvater. Rüstig bis ins hohe Alter. Und stolz. Auf seinen Namen natürlich. Damit konnte er uns ganz schön auf die Nerven gehen. Ich weiß nicht, so alt möchte ich eigentlich nicht werden. Sie? – Entschuldigung, das ist eigentlich nicht die Frage, die ich Ihnen stellen wollte.«
Derartiges war ich gewohnt. Schwaben mussten sich erst einmal warmreden, am besten, indem sie von etwas ganz anderem als dem Eigentlichen sprachen. Immerhin, Remmelegg brauchte nicht allzu lange, um zur Sache zu kommen. Der Mann mit dem Lungenschuss war tot. Ebenso der Attentäter, übrigens ein Kind griechischer Einwanderer. Ein Polizist, der in der Bahnhofshalle gestanden war, hatte ihn verfolgt und nach zwei Warnschüssen niedergestreckt.
»Das ist natürlich bedauerlich«, meinte Remmelegg, »ich hätte schon ganz gern gewusst, was den Jungen zu seiner Tat bewogen hat. Was wollte er eigentlich? Bücher stehlen?«
»Die Zeit nach Weihnachten«, sagte ich.
»Wie?«
»Ist das nicht die Zeit, wo die Leute durchdrehen?«
»Dafür ist jede Zeit gut.«
Eine Weile schwiegen wir, als hätte der Niedergang der modernen Gesellschaft uns zu denken gegeben. Remmelegg erhob sich, machte einige Schritte durch den Raum, in dem ich als einziger Patient lag, und blieb vor einem Kunstdruck stehen.
»Die könnten sich wirklich mal überlegen, was sie aufhängen«, sagte Remmelegg. »Nichts gegen HAP Grieshaber, immerhin Oberschwabe, aber der Totentanz von Basel gehört nicht in ein Krankenhaus, nicht mal in dieses.«
Er kam zurück, schaute auf mich hinunter und erklärte: »Sie wollten ihn schützen.«
»Wen?«
»Ich denke, den Toten. Wen sonst? Kannten Sie den Mann?«
Ich traute Remmelegg nicht. Er war einer von diesen Leuten, die stets den Eindruck von Gleichgültigkeit vermitteln. Beamte ohne Ehrgeiz, die nur auf ihre Pensionierung schielen, so scheint es. Wenn dann alle schlafen, schlagen sie zu.
Ich wollte Remmelegg nicht sagen, was tatsächlich geschehen war. Wollte nicht von dem Mann sprechen, dem eigentlich die Kugel gegolten hatte. Wollte nicht erzählen, warum ich diesen Mann beobachtet hatte. Remmelegg hätte mich ausgehorcht, unangenehme Fragen gestellt. Ich wäre nicht umhingekommen, von meiner eigenen »Obsession des Zufügens« zu reden. Aber lieber wäre ich gestorben. Auch wollte ich nicht in irgendeine Kriminalgeschichte hineingezogen werden.
Ich sagte Remmelegg, dass ich den Toten nicht kannte. Diesbezüglich brauchte ich nicht einmal zu lügen. Was ich dann aber doch tat, indem ich erklärte, ich hätte niemals vorgehabt, jemanden zu retten. »Ich wollte flüchten«, schwor ich ihm, »offensichtlich in die falsche Richtung. Mir ist das eigentlich peinlich. Ich setze mich ungern in Szene. Ich bin der Typ, der sich aus allem raushält. Dieser Mann, der jetzt tot ist, er stand hinter mir, ich konnte ihn gar nicht sehen. Nein, glauben Sie mir, ich hänge an meiner Haut. Ich bin blöd, aber ich bin nicht dumm.«
»Sie meinen, Sie waren ungeschickt.«
»Ja«, sagte ich, erfreut, dass er es war, der mir erklärte, was ich meinte.
»Gut, Herr Szirba, ich will Sie nicht länger stören. Das war eine reine Formalität. Solche Dinge geschehen nun mal. Schießwütige Kinder, was kann man da machen? – Im Nebenzimmer wartet Ihre Frau. Sie hat mich um Rücksicht gebeten. Was ich durchaus verstehe. Ihre Frau weiß ja selbst am besten, wie die Medien arbeiten. Darum habe ich auch die Leute von der Presse nach Hause geschickt. Die müssen ja nicht alles erfahren. Ein Glück, dass Ihre Gattin einen anderen Namen trägt. Und Sie, Herr Szirba, wird man eben als todesmutigen Wiener bezeichnen. Lassen Sie uns Schwaben die kleine Freude. Das muss es auch geben dürfen: Ausländer mit Anstand. Und Ausländer, die nicht wie solche aussehen. Morgen ist der Vorfall ohnehin vergessen.«
Er schüttelte mir die Hand, was mich daran erinnerte, wie sehr die andere schmerzte, welche in dem Verband überraschend klein wirkte, als sei darunter lediglich der mumifizierte Rest der ehemaligen Pracht. Beim Hinausgehen ließ Remmelegg die Tür offen, durch die nun meine Frau trat, von der viele behaupteten, ich verdiente sie nicht. Sie arbeitete fürs Fernsehen, moderierte ein recht erfolgreiches Talk-Magazin, in dem bedeutende Menschen sich ständig ins Wort fielen, den Begriff der Moral strapazierten und gern die Köpfe schüttelten. Meine Frau saß in der Mitte und war hübsch anzusehen. Auch wirkte sie kompetent, indem sie ihre Fragen in einer Art stellte, als wüsste sie längst die Antworten. Was ja auch der Fall war. Jedoch keine Kunst. Und sie spielte die Schiedsrichterin. Hatte also darauf zu achten, dass die Lesung der Leviten im Rahmen zivilisierter Prügel blieb.
Marlinde trug eines von diesen hellen, steifen Kostümen, in denen die Damen aussehen, als kämen sie frisch aus dem Backofen.
»Idiot!«, sagte sie und blieb in der Mitte des Zimmers stehen, die Arme verschränkt, unter denen ein Kanister von Handtasche baumelte. »Ich glaub es einfach nicht. Was ist los mit dir? Wozu diese Übertreibungen? Musst du denn dämlicher sein als alle anderen? Spielst den Lebensretter, rettest aber niemanden.«
»Wär es dir lieber, ich wäre tot?«
»O Gott.«
Natürlich wäre es ihr lieber gewesen. Auch wenn wir uns kaum sahen, war ich der Klotz an ihrem Bein, talentlos, umfassend impotent, und zwar – wie sie mir vorhielt – mit Absicht und aus Überzeugung. Ein vierzigjähriger Architekt, der noch immer nicht baute, sondern auf Plänen Striche zog, die andere sich ausgedacht hatten. Man durfte sich also fragen, warum diese Frau mich genommen hatte. Sicher, damals war das beginnende Alter noch nicht wie ein Warnschild vor meinem Gesicht aufgeragt, und in meinen besten Momenten hatte mein Blick gewirkt, als wäre er auf das gerichtet, was die Leute eine Zukunft nennen.
Nach Stuttgart waren wir gezogen, da sie das Haus ihrer Eltern geerbt hatte, beste Lage, scheußlich eingerichtet, schreckliche Nachbarn. Es zu verkaufen, kam Marlinde nicht in den Sinn, nicht Papas Haus, nicht Mamas Vasen, die an jeder Ecke, jeder Kante wie aufgerichtete Zeigefinger standen. Ohnehin wollte sie, die Deutsche, weg von Wien und vom österreichischen Fernsehen, weg von Menschen, die ihr stets verbraucht erschienen und deren Lustigkeit sie für eine Art Kränkeln hielt.
Als Marlinde zum Star geworden war, hatte sie darauf geachtet, den Umstand ihres Verheiratetseins wie überhaupt ihr Privatleben (von dem auch ich recht wenig wusste) vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Gern ließ sie sich mit zwei Bernhardinern ablichten, zudem mit einem dreibeinigen Rehkitz und blinden Katzen. Weshalb ihr der Ruf anhing, nur für ihre Tiere zu leben. Was mich wunderte. Wir besaßen keine Bernhardiner. Auch keine blinden Katzen. Ich selbst hatte meine Frau nie mit irgendeinem Vieh gesehen. Und kannte ihre Abneigung gegen alles, was Haare verlor.
»Kannst du dir denken«, donnerte Marlinde (aber eben genau in jenem Tonfall, der eine Denkleistung meinerseits eigentlich ausschloss), »wie unangenehm es wäre, wenn die Presse herausbekommt, mit wem du verheiratet bist? Die reimen sich doch sofort eine unschöne Geschichte zusammen. Ein wahres Glück, dieser Kommissar. Ein diskreter Mensch.«
»Diskretion«, sagte ich und hob meine verletzte Hand, »das ist es, was mir fehlt. Ich bin doch wirklich so schamlos und lass mich in aller Öffentlichkeit von irgend so einem Lümmel anschießen.«
»Hör auf. Soweit ich weiß, hast du dich richtiggehend angeboten. Du hast ja diese Komödie auch nur deshalb überlebt, weil du wieder mal zu langsam warst. Schätzle, ich will ganz offen sein: Von mir aus bring dich ruhig um. Aber…nimm – bitte – Rücksicht.«
»Versprech ich dir, mein Lämmle.«
Immerhin, es gab noch so etwas wie einen dümmlichen Humor zwischen uns. Nicht, dass sie mich jetzt küsste. Sie hatte den ganzen Tag mit einer Unmenge Menschen zu tun. Und nicht wenige davon musste sie auch küssen, Kolleginnen und so. Da wollte sie zu Hause etwas kürzertreten.
Marlinde sah auf die Uhr, seufzte, lächelte, und zwar schief. Legte mir noch eine Schachtel Zigaretten hin und war auch schon verschwunden. Wenn ich mich recht entsann, hatte sie einen Termin in Magdeburg, wo es ja Gott sei Dank jetzt auch Fernsehen gab, ich meine, richtiges Fernsehen.
Eine Krankenschwester kam mit dem Frühstück. Sehr dünn, der Kaffee. Sehr freundlich, die Dame, die mir mein Kissen richtete und das Fenster öffnete. Das war ein nicht unwesentlicher Vorteil des Hauptstätter Hospitals: Hier konnte man noch Fenster öffnen. Was nützt Architektur auf der Höhe unserer Zeit, wenn man dabei erstickt? Die Schwester setzte sich zu mir, um mich zu füttern.
»Gute Frau, ich bitte Sie«, wehrte ich mich und demonstrierte ihr, wie gut mein unbeschadeter Arm funktionierte. Was sie anerkannte, jedoch sitzen blieb und mir von ihrer Heimat erzählte, Litauen, wo sie als Russin nicht hatte bleiben wollen.
»Wir sind dort jetzt der Abschaum.«
»Aha«, sagte ich. Was sollte ich auch sagen? Als durchschnittlicher Westeuropäer war ich veranlasst, Verständnis für das Schicksal von Muslimen zu entwickeln, vorausgesetzt, sie waren Bosnier, für Albaner, vorausgesetzt, sie lebten und starben im Kosovo, für den einen oder anderen Afrikaner, für Straßenkinder und Straßenhunde, was sich von selbst versteht – aber für Russen? Noch dazu für Russen in Litauen? Auch Verständnis hat seine Grenzen. Ich meine das nicht moralisch, sondern organisatorisch. Ich hatte sozusagen bereits für die Litauer unterschrieben, da die Zerschlagung des Sowjetimperiums auf meinem »Wunschzettel eines Demokraten« ganz oben gestanden war. Aber wie gesagt, die Dame war überaus liebenswürdig, zudem seit Kurzem mit einem Deutschen verheiratet, wozu ich herzlich gratulierte, erfreut über eine Ehe, die allen Ernstes einen Sinn ergab. Ich bot ihr meinen unangetasteten Kaffee an, als wäre er ein Strauß Blumen. Sie nahm ihn dankend an und schlürfte daran wie eine Zarentochter – wie ich mir eben vorstellte, dass Zarentöchter einst geschlürft hatten, verhalten, jedoch ohne den Unfug eines weggestreckten kleinen Fingers.
»Mein Heinz hat früher geboxt«, sagte sie mit Vorsicht. »Jetzt ist er Trainer.«
Wie nicht wenige Männer, die sich vom Intellektualismus zumindest gestreift glaubten, fand ich Boxen beeindruckend, quasi als einen Ersatz für jene großen Gemälde, die heutzutage nicht mehr gemalt wurden, nun, da die Kunst hinter der Unterwäsche von Theorie und Wissenschaft gänzlich verschwand oder sich im Missverständnis auflöste oder sich derart ausdehnte, dass man sich in ihr bewegen konnte, ohne sie zu bemerken. Der Boxring aber hatte die richtige Größe, besaß die Grenzen, die der Rahmen vorschrieb, in welchem drei Menschen eine variable, jedoch stets in sich stimmige Komposition bildeten. Boxen lieferte das letzte Bild, in welchem die Trinität tatsächlich funktionierte – in dem Sinne, dass die drei Personen nicht unabhängig voneinander wirkend gedacht werden konnten.
Ich gestand Frau Kasakow-Neuper, wie sehr ich für den Boxsport schwärmte. Woraufhin sie versprach, später nochmals mit einer Tasse Kaffee vorbeizuschauen, diesmal Privatkaffee. Was mich berührte, allerdings auch peinlich, da ich ihr zuvor die dünne Brühe aufgedrängt hatte.
Ende der Leseprobe