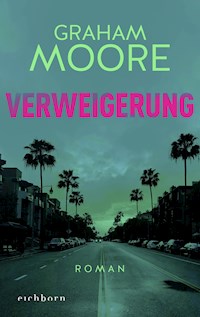9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Arthur Conan Doyle tritt in die Fußstapfen seiner berühmtesten Figur Sherlock Holmes: Weil Scotland Yard keinen Anlass sieht, den Mord an einem augenscheinlich leichten Mädchen aufzuklären, macht er sich selbst auf die Suche nach dem Mörder. Er schleicht durch die dunklen Straßen des viktorianischen London und landet an Orten, die kein Gentleman betreten sollte. Etwa hundert Jahre später ist ein junger Sherlock-Fan in einen Mordfall verstrickt, bei dem Doyles verschwundenes Tagebuch und einige Fälle seines berühmten Detektivs eine wichtige Rolle spielen. Zwei Morde, zwei Amateurdetektive, zwei Welten - und ein großer Lesespaß!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Karte: London im Jahr 1900
Karte: London im Jahr 2010
Hinweis
Widmung
Kapitel 1: Der Reichenbachfall
Kapitel 2: Die Baker Street Irregulars
Kapitel 3: Das letzte Problem
Kapitel 4: Das verschwundene Tagebuch
Kapitel 5: Trauerarbeit
Kapitel 6: Bis heute!
Kapitel 7: Der Blutsauger
Kapitel 8: Das abgedunkelte Zimmer
Kapitel 9: Sensationelle Entwicklungen
Kapitel 10: Die angewandte Wissenschaft der Deduktion
Kapitel 11: Scotland Yard
Kapitel 12: Ein Vorschlag
Kapitel 13: Das weiße Kleid
Kapitel 14: Jennifer Peters in Trauer
Kapitel 15: Liebesvorwürfe
Kapitel 16: Der Anrufbeantworter
Kapitel 17: Eine Liste an Grausamkeiten
Kapitel 18: Genusslektüre
Kapitel 19: Die zerbrochene Haarspange
Kapitel 20: Die Verfolgungsjagd
Kapitel 21: Vergil und Dante am Gestade des Acheron
Kapitel 22: Der Große Hiatus
Kapitel 23: Die Suffragetten
Kapitel 24: Die Blutflecke tragen Früchte
Kapitel 25: Observation
Kapitel 26: Ron Rosenbaum stellt Theorien auf
Kapitel 27: Die sonderbare Geschichte der Emily Davison
Kapitel 28: Nachdenken
Kapitel 29: Arthur kehrt zu Scotland Yard zurück
Kapitel 30: Britische Vogelarten, Catull und der Heilige Krieg
Kapitel 31: Auftritt Mr. Edward Henry
Kapitel 32: Die Bibliothek
Kapitel 33: Newgate
Kapitel 34: Nur die Dinge, die das Herz glaubt, sind wahr
Kapitel 35: Bitte um Hilfe
Kapitel 36: Ein Problem ohne Lösung
Kapitel 37: Ein Tod in der Familie
Kapitel 38: Zum Hecht
Kapitel 39: Der Drucker
Kapitel 40: Die vergangenen Jahrhunderte
Kapitel 41: Koste es, was es wolle
Kapitel 42: Das Sherlock-Holmes-Museum
Kapitel 43: Der Mörder
Kapitel 44: Bist du jetzt dran, mich umzubringen?
Kapitel 45: Das verschwundene Tagebuch des Arthur Conan Doyle
Kapitel 46: Der Reichenbachfall
Kapitel 47: Abschied
Nachbemerkung des Autors
Danksagung
Quellen der verwendeten Zitate
Über das Buch
Arthur Conan Doyle tritt in die Fußstapfen seiner berühmtesten Figur Sherlock Holmes: Weil Scotland Yard keinen Anlass sieht, den Mord an einem augenscheinlich leichten Mädchen aufzuklären, macht er sich selbst auf die Suche nach dem Mörder. Er schleicht durch die dunklen Straßen des viktorianischen London und landet an Orten, die kein Gentleman betreten sollte. Etwa hundert Jahre später ist ein junger Sherlock-Fan in einen Mordfall verstrickt, bei dem Doyles verschwundenes Tagebuch und einige Fälle seines berühmten Detektivs eine wichtige Rolle spielen. Zwei Morde, zwei Amateurdetektive, zwei Welten – und ein großer Lesespaß!
Über den Autor
Graham Moore, Jahrgang 1981, arbeitet als Drehbuchautor und Schriftsteller. In seinen Romanen fiktionalisiert er gerne historische Personen und Gegebenheiten. 2015 gewann er den Oscar für das beste Drehbuch; »The Imitation Game« wurde mit Benedict Cumberbatch und Keira Knightley verfilmt und von der internationalen Kritik gefeiert. Moore lebt in Los Angeles.
GRAHAM MOORE
Der Mann, der Sherlock Holmes tötete
ROMAN
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Kirsten Riesselmann
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe:»The Sherlockian«
Für die Originalausgabe:Copyright © 2010 by Graham MoorePublished by arrangement with Hachette Book Group, Inc.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2019/2021 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Friederike Achilles, KölnCovergestaltung: Semper smile, München unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock/Yevhen Tarnavskyi; Shutterstock/Nebojsa S; Shutterstock/Run_Vector_Run; Shutterstock/Ensuper; Shutterstock/AbstractorKartenillustrationen: © Markus Weber, Guter PunktE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-6043-1
luebbe.delesejury.de
Der Mann, der Sherlock Holmes tötete ist ein historischer Roman mit realen und fiktiven Elementen. Sämtliche in der Jetztzeit auftretenden Charaktere sind der Fantasie des Autors entsprungen.
Für meine Mutter, die mir, als ich sieben war, als Erste die Liebe zum Krimi vermittelte. Im Bett liegend ließen wir Agatha Christies Nikotinzwischen uns hin- und herwandern und lasen uns gegenseitig daraus vor. Sie hat all das hier möglich gemacht.
KAPITEL1Der Reichenbachfall
»Erfasse den Umstand mit geistigem Streiche:Puppe und Schöpfer sind niemals das gleiche.«
Sir Arthur Conan Doyle, An einen urteilslosen Kritiker,veröffentlicht in der Zeitschrift London Opinion, 12. Dezember 1912
9. August 1893
Arthur Conan Doyles Stirn lag in steilen Falten. Er konnte an nichts anderes denken als an Mord.
»Ich werde ihn umbringen«, sagte er schließlich und verschränkte die Arme vor der breiten Brust.
So hoch oben in den Schweizer Alpen kitzelte die Luft in seinem buschigen Schnauzbart, ja, sie schien ihm hier geradewegs durch die Ohren hindurchzublasen. Arthurs Ohren saßen sehr weit hinten an seinem Kopf, sodass es aussah, als wären sie ständig gespitzt, als horchten sie stets auf irgendetwas. Für einen so untersetzten Mann wie ihn war seine Nase auffällig scharf geschnitten. Seine Haare wurden erst seit Kurzem grau, ein Vorgang, den Arthur nur zu gern beschleunigt hätte. Denn obwohl erst dreiunddreißig Jahre alt, war er bereits ein berühmter Schriftsteller. Und für einen Literaten, der international gefeiert wurde, war das sichtbare Weisewerden deutlich standesgemäßer als diese ockergelbe Haarfarbe. Fand er zumindest.
Arthurs Reisebegleiter erreichten den Felsvorsprung, auf dem er bereits stand. Höher konnte man am Reichenbachfall nicht steigen. Silas Hocking war ein Mann der Kirche und ein wohlbekannter Romanschriftsteller in Arthurs London, das weit weg zu sein schien. Vor seinem jüngst auf dem Markt erschienenen religiösen Roman Her Benny hatte Arthur größte Hochachtung. Edward Benson, ein Bekannter von Hocking, war eine deutlich schweigsamere Natur als sein geselliger Freund. Auch wenn Arthur die beiden Männer erst an diesem Vormittag beim Frühstück im Hotel Riffelalp kennengelernt hatte, war er sicher, beiden vorbehaltlos vertrauen zu können. Er spürte, dass sie auf einer Wellenlänge lagen – und dass sie ähnlich dunkle Pläne hegten wie er.
»Er hängt an mir wie eine Klette«, fuhr Arthur fort, »und ich habe vor, ihm ein für alle Mal den Garaus zu machen.«
Hocking, der neben Arthur stand und auf die sich weit vor ihnen erstreckenden Alpen blickte, ließ ein Schnauben hören. Ein paar Meter unter ihnen im Fels schmolzen Schneekissen und verwandelten sich in einen reißenden Strom, der sich seit Jahrtausenden einen Weg durch den Berg suchte und sich dann rauschend in das schäumende Becken unten ergoss. Schweigend presste Benson einen Fäustling voll Schnee zu einem festen Ball zusammen und warf ihn leise lächelnd in den Abgrund. Noch während er fiel, riss der kräftige Wind kleine Stücke aus ihm heraus, bis schließlich der ganze Ball in mehreren weißen Böen zerstäubte.
»Wenn ich das nicht mache«, sagte Arthur, »treibt er mich in den Tod.«
»Finden Sie nicht, dass Sie da mit einem guten alten Freund doch recht harsch umspringen?«, fragte Hocking. »Immerhin haben Sie ihm Ihren ganzen Ruhm zu verdanken. Und Ihr Geld auch. Sie beide sind doch immer ein hübsches Paar gewesen.«
»Da ich seinen Namen auf jedes Groschenheftchen in ganz London gekleistert habe, ist er durch mich zu einer Prominenz gelangt, die die meinige weit übersteigt. Wissen Sie, ich bekomme Briefe wie: ›Meine geliebte Katze ist mir in South Hampstead entlaufen. Sie trägt den Namen Sherry-Ann. Können Sie sie finden?‹ Oder: ›Meiner Mutter ist die Handtasche gestohlen worden, als sie in Piccadilly aus einer Droschke stieg. Können Sie den Schuldigen überführen?‹ Allerdings sind diese Briefe nicht an mich adressiert. Sondern an ihn. Sie halten ihn für echt.«
»Ja eben! Ihre armen Leser, derart voll der Bewunderung!«, sagte Hocking flehentlich. »Haben Sie denn überhaupt schon an sie gedacht? Die Menschen halten offenbar schrecklich große Stücke auf diesen Burschen!«
»Größere als auf mich! Meine eigene Mutter hat mir einen Brief geschrieben, in dem sie mich – im vollsten Wissen, dass ich alles tue, was sie von mir verlangt – bat, ein Buch für ihre Nachbarin Beattie mit dem Namen ›Sherlock Holmes‹ zu signieren. Können Sie sich das vorstellen? Ich sollte mit seinem und nicht mit meinem Namen unterschreiben. Meine Mutter hört sich an, als sei sie Holmes’ Mutter und nicht die meinige. Pah!«
Arthur gab sich Mühe, seinen Wutausbruch im Zaum zu halten.
»Meine deutlich bedeutenderen Werke dagegen werden mit Missachtung gestraft«, fuhr er fort. »Micah Clarke? The White Company? Dieses bezaubernde kleine Schauspiel, das ich mir zusammen mit Mr. Barrie ausgedacht habe? Ignoriert wegen dieses düsteren Seemannsgarns. Noch schlimmer: Er raubt mir meine Zeit. Es wäre reine Qual, wenn ich mir nur noch eine dieser schauderhaften Geschichten aus den Fingern saugen muss: immerzu diese von innen abgeschlossenen Schlafzimmertüren, diese kaum zu entziffernde letzte Nachricht des Toten, und dann erzählerisch das Pferd immer schön von hinten aufgezäumt, damit niemand so schnell auf die eigentlich so naheliegende Lösung kommt …«
Arthur schaute auf seine Stiefel hinunter und ließ den tief hängenden Kopf die deutliche Sprache seines Überdrusses sprechen.
»Ich kann es offen sagen: Ich hasse ihn. Meiner eigenen geistigen Gesundheit zuliebe werde ich mich darum kümmern, dass er bald tot ist.«
»Wie wollen Sie das denn anstellen?«, versuchte Hocking, mehr aus ihm herauszulocken. »Wie fädelt man es ein, den großen Sherlock Holmes zu ermorden? Bohrt man ihm ein Messer ins Herz? Schlitzt man ihm die Kehle auf? Hängt man ihn an den Galgen?«
»Ihn erhängen! Ach, allein die Worte schon sind Balsam für meine Seele. Aber nein, nein, es muss etwas Spektakuläreres sein – schließlich ist er ein Held. Ich werde ihm einen letzten Fall kredenzen. Und einen Bösewicht dazu. Dieses Mal wird er einen wahrhaften Bösewicht nötig haben. Ein Kampf auf Leben und Tod, ausgetragen von zwei Gentlemen, und er opfert sich für die größere Sache, aber beide Kontrahenten kommen trotzdem um. Irgendetwas in diese Richtung.«
Benson klopfte sich einen weiteren Schneeball zurecht und warf ihn in sanftem, hohem Bogen in die Luft. Arthur und Hocking sahen zu, wie er im Himmel verschwand.
»Falls Sie bei den Begräbniskosten sparen wollen«, meinte Hocking und lachte in sich hinein, »könnten Sie ihn auch über eine Klippe werfen.«
Er sah zu Arthur, der aber hatte noch nicht einmal ein Lächeln im Gesicht. Stattdessen legte sich seine Stirn wieder in so steile Falten wie zuvor, als er noch in Gedanken versunken gewesen war.
Er schaute hinab in das klaffende Maul der Schlucht unter ihnen. Man hörte das Donnern der herabstürzenden Wassermassen und das gewaltige Krachen, mit dem sie in den felsgespickten Fluss mündeten. Plötzlich bekam Arthur es mit einer entsetzlichen Angst zu tun. Er stellte sich vor, wie er selbst dort unten auf den Felsbrocken starb. Als ein Mann der Medizin war er mehr als vertraut mit der Zerbrechlichkeit des menschlichen Körpers. Ein Sturz aus dieser Höhe … Auf dem gesamten Weg nach unten würde sein Körper immer wieder gegen die Felsen prallen … Ein angsterfüllter Schrei würde ihm in der Kehle stecken bleiben. In Stücke gerissen auf der Erdkruste liegend, die Grasbüschel fleckig von seinem Blut … In seiner Vorstellung verschwand sein eigener Körper plötzlich, an dessen Stelle trat eine schlankere Gestalt. Größer. Ein mageres, unterernährtes Fähnchen von einem Mann mit langem Mantel und Deerstalker-Mütze. Sein kantig geschnittenes Gesicht von einem stahlharten, felsigen Dorn ein für alle Mal unkenntlich gemacht.
Mord.
KAPITEL 2Die Baker Street Irregulars
»Mein Name ist Sherlock Holmes. Es ist mein Beruf, zu wissen, was andere Leute nicht wissen.«
Sir Arthur Conan Doyle, Der blaue Karfunkel
5. Januar 2010
Die Fünf-Penny-Münze fiel trudelnd in Harolds Hand. Bei ihrer Landung – mit dem Kopf nach oben – fühlte sie sich schwer an, Harold schloss die Finger um das angelaufene Silber und drückte einige Augenblicke fest zu. Dann merkte er, dass seine Hände zitterten. Im Saal brach Applaus los.
»Bravo!«
»Willkommen im Club!«
»Glückwunsch, Harold!«
Harold hörte, wie gelacht und weiter applaudiert wurde. Er bekam einen Klaps auf den Rücken und von jemand anderem einen herzlichen Schulterdruck. Aber er konnte an nichts weiter denken als an die Münze in seiner Rechten. Mit der Linken hielt er seine neue Urkunde umklammert. Die Münze war nur unzureichend auf der linken unteren Ecke festgeklebt worden und hatte sich gelöst, als Harold allzu begeistert nach dem Papier gegriffen hatte. Sie war richtiggehend abgefallen, und Harold hatte sie mitten im Flug aufgefangen. Jetzt sah er auf das winzige Silberstück hinunter. Es war ein Schilling aus dem viktorianischen Zeitalter, der damals schlicht fünf Pennys wert gewesen war. Heutzutage war er sicherlich sehr viel mehr wert – für Harold ein Vermögen. Seine Augenwinkel wurden feucht, und er blinzelte. Die Münze bedeutete, dass er angekommen war. Dass er etwas geschafft hatte. Dass er dazugehörte.
»Willkommen, Harold«, sagte eine Stimme hinter ihm.
Jemand fuhr ihm halb zärtlich, halb raufend mit der Hand über die Deerstalker-Jagdmütze auf seinem Kopf.
»Willkommen bei den Baker Street Irregulars.«
Als Harold diese Worte hörte, die zu hören er sich so lange gewünscht hatte, klangen sie seltsam und fremdartig. All diese Leute – zweihundert lachende, witzelnde und sich gegenseitig auf den Rücken klopfende Menschen – applaudierten ihm, Harold. Diesem Harold. Harold White, neunundzwanzig Jahre alt, mit dem leichten Bauchansatz, den buschigen Augenbrauen, der Hornhautverkrümmung und den schweißnassen, zitternden Händen.
Harold konnte nicht fassen, dass er all das tatsächlich verdient hatte. Hatte er aber. Hier gehörte er hin.
Die »Baker Street Irregulars« waren die weltweit führende der Vereinigungen, die sich den Sherlock-Holmes-Studien verschrieben hatten, und Harold war ihr jüngstes Mitglied. Zwei Jahre zuvor hatte Harold seinen ersten Artikel im Baker Street Journal veröffentlicht, der vierteljährlich erscheinenden Schriftenreihe der Irregulars. Zur Datierung von Blutflecken: Sherlock Holmes und die Begründung der modernen Forensik, so hatte Harold den Text übertitelt, in dem er den historischen Verbindungslinien zwischen Holmes’ ersten Experimenten in Eine Studie in Scharlachrot und dem Schaffen von Dr. Eduard Piotrowski nachgegangen war. (»Dr. Piotrowski, der in den 1890er-Jahren in Krakau praktizierte, schlug Kaninchenjungen den Schädel ein und zeichnete die Muster auf, die das herausspritzende Blut machte. Holmes’ Experimente waren ähnlich blutig, doch besaß er immerhin den Anstand, sich seines eigenen Blutes zu bedienen – genauso wie der Strapazen seines eigenen Schädels«, hatte Harold geschrieben, eine Passage, die er für die witzigste im gesamten Aufsatz hielt.) Hiernach hatte Harold noch zwei weitere Artikel in kleineren sherlockianischen Zeitschriften veröffentlicht. Heute war er zum ersten Mal beim jährlichen Dinner der Irregulars, zu dem man nur mit Einladung Zutritt hatte. Allein bei diesem Dinner ein geladener Gast zu sein, war schon eine gewaltige Ehre. Aber dann auch noch die Mitgliedschaft angeboten zu bekommen – in seinem jugendlichen Alter und mit einer derart kurzen wissenschaftlichen Laufbahn? Harold fiel niemand sonst bei den Irregulars ein, dem die Mitgliedschaft so schnell, nach nur einem einzigen Abendessen, angeboten worden war.
In seinem billigen schwarzen Anzug, der ihm an den Schultern zu weit war, und mit seiner mit Hühnchen besudelten Krawatte erlebte Harold gerade den stolzesten Moment seines Lebens. Er rückte die karierte Deerstalker-Mütze zurecht, die noch immer seinen Kopf zierte. Diese Mütze war mit weitem Abstand seine wertvollste Habe. Er besaß sie, seitdem er als Vierzehnjähriger zum Sherlock-Holmes-Aficionado geworden war und sich zu Halloween als der berühmte Detektiv verkleidet hatte. Als seine Liebe zu Holmes keine jugendliche Faszination mehr war, sondern sich zum Forschungsinteresse eines Erwachsenen mauserte, wurde aus dem, was einst Teil eines Kostüms gewesen war, nach und nach Alltagskleidung. Harold hatte diese Mütze sogar bei seiner Abschlussfeier an der Universität Princeton getragen und sich zu diesem Anlass zusätzlich noch eine Troddel angenäht. Als aus dem nervösen Teenager der Harold geworden war, der sich durch seine Jahre als Twenty-Something schleppte, leistete ihm die Mütze bei Cocktailpartys, Herbstpicknicks und den immer häufiger vorkommenden Hochzeiten im Freundeskreis gute Dienste. Er trug sie auch, als er seine erste Stelle als Assistent eines New Yorker Verlegers antrat. Und er trug sie, als er sich von Amanda trennte, mit der er seine bisher längste Beziehung gehabt hatte und über die er nie ein Wort verlor.
Das Dinner der Irregulars, abgehalten im Algonquin Hotel auf der 44. Straße, fiel wie jedes Jahr mitten hinein in die große Woche der Sherlockiana. Sämtliche Gesellschaften und Vereine, die sich weltweit der Feier von Sherlock Holmes verschrieben hatten, kamen für vier Tage in New York zusammen, üblicherweise rund um den 6. Januar, Holmes’ Geburtstag. Es gab Vorträge, Rundgänge, Signierstunden, Auktionen viktorianischer Antiquitäten und Erstausgaben: der reinste Himmel für einen Sherlock-Holmes-Jünger.
Von den Hunderten der hier vertretenen sherlockianischen Vereine waren die Baker Street Irregulars auf jeden Fall der älteste, geschichtsträchtigste und exklusivste. Sogar Truman und Roosevelt wollten hier Mitglied sein, genauso wie Isaac Asimov. Ausschließlich Irregulars sowie ihre wenigen Gäste wurden zum jährlichen Dinner zugelassen, und die selten an Außenstehende ergehenden Einladungen waren für Sherlockianer weltweit Objekte heißer Begierde.
Wie allgemein bekannt, zeichneten die Irregulars auch verantwortlich dafür, den 6. Januar als Holmes’ Geburtstag deduziert zu haben. Dieses Datum nämlich hatte Sir Arthur Conan Doyle im »Kanon« – also den vier Romanen und sechsundfünfzig kurzen Erzählungen, die zusammengenommen die wahren Sherlock-Holmes-Abenteuergeschichten sind – kein einziges Mal direkt genannt. Aber nach extensiver, allergründlichster Lektüre dieser kanonischen Geschichten stellte Christopher Morley, einer der Gründungsväter der Irregulars, die These auf, dass der 6. Januar der hochwahrscheinliche Kandidat für Holmes’ Geburtstag sei.
Alle anderen Vereine und Gesellschaften wurden als »Ableger« der Irregulars betrachtet und brauchten eine offizielle Gründungsbewilligung der Irregulars. Unmöglich, sich bei den Irregulars als Mitglied zu bewerben – wer sich im Feld sherlockianischer Forschung hervortat, der wurde von ihnen angefragt. Und wen der Vorsitzende der Irregulars für qualifiziert genug hielt, der bekam als Zeichen der Mitgliedschaft ein Schillingstück überreicht. Wie die Münze aus angelaufenem, antikem Silber, die Harold zwischen seinen weiß werdenden Knöcheln drückte.
Der Applaus verebbte zu verhaltenem Geplauder. Stühle wurden von den Esstischen weggeschoben, weiße Leinenservietten auf Teller voller halbverspeister Hühnchen und Gemüsereste gelegt. Scotch-Gläser wurden mit langen Schlucken ausgetrunken. Hände wurden geschüttelt. Man war dabei, sich zu verabschieden.
Plötzlich kam Harold sich wie ein Idiot vor, so mit seinem fest umklammerten Schilling in der Hand. Von diesem Moment hatte er geträumt, seitdem er wusste, dass es die Irregulars gab. Und jetzt war er vorüber. Er fragte sich, was er wohl als Nächstes unternehmen müsste, um dieses Gefühl erneut zu erleben. Er wollte sich so gern länger an seinen Erfolgen festhalten, sie im öden Alltagstrott nicht gleich wieder verblassen lassen. Harold sah den Kellnern dabei zu, wie sie das Besteck zusammenräumten, wie sie dreckige Gabeln und stumpfe Buttermesser in Plastikeimer kehrten.
Harold lebte in Los Angeles und arbeitete als freischaffender Literaturwissenschaftler. Die meisten Aufträge bekam er von Filmstudios, deren Rechtsabteilungen ihn anheuerten, sobald sie eine Klage wegen Urheberrechtsverletzung abzuweisen hatten. Wenn ein wütender Romanschriftsteller die Produzenten des größten Action-Blockbusters des Sommers verklagte, weil sie seiner Ansicht nach die Idee seines vor zwanzig Jahren erschienenen und kaum gelesenen Politthrillers geklaut hatten, war es Harolds Job, eine kurze Erörterung zu verfassen, in der stand, dass tatsächlich beide künstlerischen Werke ihre zentralen Handlungselemente einem wenig bekannten Theaterstück von Ben Jonson, einer der schwierigen Kurzgeschichten von Dostojewski oder irgendeinem anderen, ähnlich obskuren und ähnlich gemeinfreien Werk entlehnt hatten. Die Justiziare der Studios führten Harolds Namen oft und lobend im Munde – außer in den seltenen Fällen, wenn sie sich gegenseitig verklagten.
Harolds Hauptqualifikation für seine Tätigkeit war, dass er alles gelesen hatte. Er hatte schlicht mehr Bücher, mehr Romane gelesen als jeder andere, der ihm oder einem seiner Arbeitgeber je begegnet war. Dass er das trotz seines jungen Alters geschafft hatte, verdankte er seiner ausgeprägten Schnelllesefähigkeit. Während er sich als Kind mühsam Seite für Seite durch jeden Sherlock-Holmes-Fall gelesen hatte, war sein Wunsch – vielmehr sein animalisches Bedürfnis – zu wissen, was als Nächstes passierte, für ihn zum Problem geworden. Eine Geschichte durchzulesen dauerte länger, als er aushalten konnte. Also brachte er sich mithilfe eines im Versandhandel erstandenen Selbsthilfebuchs das Schnelllesen bei. Seine Mitschüler zogen ihn wegen dieser Fähigkeit auf. Für sie war es undenkbar, dass jemand einen Vierhundert-Seiten-Roman in zwei Stunden lesen und trotzdem eine bedeutende Menge an Informationen abgespeichert haben konnte. Was Harold konnte. Und auch unter Beweis stellte: Er las dieselben Bücher wie seine Freunde und ließ sich von ihnen über Handlungselemente und beschreibende Passagen ausfragen. Harold konnte sich auf jeden Fall mehr und schneller Dinge merken als alle anderen an seiner Grundschule in Chicago, auf dem College in Princeton und in seinem bisherigen Erwachsenenleben.
»Harold!«, ertönte eine tiefe, wohlklingende Stimme hinter ihm.
Hände legten sich auf seine Schultern. Als er sich umdrehte, blickte er ins Gesicht von Jeffrey Engels. Jeffrey, ein Kalifornier mit schlohweißem Haar und einem quasi dauerhaft ins Gesicht gemeißelten Lächeln, war mit Sicherheit der beliebteste und angesehenste Sherlockianer im Saal. Harold ging davon aus, dass es Jeffrey gewesen war, der sich für seine Aufnahme bei den Irregulars eingesetzt hatte, fragte aber auch nicht weiter nach. Er würde von Jeffrey so oder so keine Antwort darauf bekommen.
»Danke«, sagte er.
Jeffrey ging nicht darauf ein. Sein übliches Grinsen war verschwunden, stattdessen sah er ihn verdrießlich an und sagte dann leise: »Die Affäre hat eine ernste Wendung genommen.«
»Eine Wendung wohin?«
»Zu Mord!«
KAPITEL 3Das letzte Problem
»Sie wissen schon: Ein Zauberer bekommt keinen Applaus mehr, wenn er erst seinen Trick verraten hat.«
Sir Arthur Conan Doyle, Eine Studie in Scharlachrot
3. September 1893
Arthur ermordete Sherlock Holmes im Schein einer einsamen Schreibtischlampe.
Hinter den schweren Holztüren seines Arbeitszimmers, abgekapselt von der Welt, kam er mit dem Schreiben schnell voran. Die Ölleuchte auf seinem Tisch warf ein schwaches gelbliches Licht auf die mit Bücherregalen verkleideten Wände. Shakespeare, Catull, ja sogar – was Arthur ohne Umschweife zugeben würde – Poe: Er hatte all seine Lieblingsschriftsteller hier, holte sich allerdings nur selten Anregung bei ihnen. Er schrieb selbstsicher. Er war kein Schriftsteller, der seine Quellen vor sich ausbreitete wie ein Bettlaken, an das er sich klammerte, keiner, der sich ständig rückversichern oder da und dort etwas abschreiben musste. Der Hamlet stand auf seinem angestammten Regalbrett – das dritte von unten –, und falls Arthur für einen von Holmes’ markigen Aphorismen daraus zitierte und das ungenau tat: Nun, so war das eben in der Literatur.
Der Mord schmeckte süß. Er regte Arthurs Speichelfluss an. Sein Füller, der schwer zwischen seinen kurzen, dicken Fingern lag, kratzte nicht übers Papier, sondern streichelte die Seiten, während er eine nach der anderen von oben bis unten mit schwarzer Tinte vollschrieb. Den Verlauf der Handlung, ein vertracktes kleines Puzzle aus falschen Fährten und köstlichen Auflösungen, hatte er sich bereits im Vorfeld zurechtgelegt.
Zu diesem Zeitpunkt, nach der Hälfte seiner Karriere, war Arthur zweifelsohne Englands größter Verfasser von Kriminalgeschichten. Er selbst hielt sogar die Aussage, der erfolgreichste Kriminalautor der Welt zu sein, für durchaus vertretbar, schließlich hatten die Vereinigten Staaten keinen Schriftsteller von auch nur annähernd erwähnenswertem Format mehr hervorgebracht, seit Poe das Genre erfunden hatte. Natürlich gab es beim Verfassen von Kriminalgeschichten einen Trick, und Arthur schämte sich nicht zuzugeben, dass er ihn kannte. Es war derselbe Trick, den auch Tausende laienhafter Hinterstübchen-Taschenspieler und geschminkter Zauberkünstler im Zirkus anwandten: Irreführung.
Arthur breitete die Fakten des jeweiligen Verbrechens ruhig, klar und wirkungsvoll vor seinen Lesern aus. Kein wichtiges Detail wurde außen vor und – ja, das zeichnete den wahren Meister aus – nicht übermäßig viele unwichtige Details wurden drin gelassen. Schließlich war es kein Kunststück, den Leser mit einem Haufen überflüssiger Figuren und Ereignisse zu verwirren. Für Arthur bestand die Herausforderung darin, mit einer sauberen, schlichten Erzählung aufzuwarten, die nur einiger relevanter, konsequent durchgeführter Protagonisten bedurfte, doch dabei trotzdem mit der Lösung hinterm Berg zu halten. Der Schlüssel lag im Schreibstil, in der Art und Weise, wie die Informationen übermittelt wurden. Arthur fesselte die Aufmerksamkeit seiner Leser mit den aufregenden, außergewöhnlichen, aber eben trotzdem vollkommen belanglosen Fakten des jeweiligen Falls, während Holmes dann wie durch Zauberhand auf die eigentlich zentralen Punkte kommen konnte.
Diese Handlungsverläufe zu entwickeln war für Arthur wie ein Spiel. Er gegen sein Publikum, der im endlosen Kampf mit seinen Lesern verstrickte Schriftsteller, ein Kampf, aus dem nur eine Seite siegreich hervorgehen würde. Entweder würden die Leser die Lösung zu früh erraten, oder Arthur würde sie bis zur letzten Seite auf der falschen Fährte halten. Jede Geschichte war eine Prüfung in Sachen Schläue und Gewitztheit – ein Krieg, den Arthur nicht allzu häufig verlor.
Obwohl die Leser sich natürlich, wenn sie clever genug waren, schon nach den ersten paar Seiten alles zusammenreimen konnten. Doch Arthur wusste, dass seine Leser im Grunde gar nicht gewinnen wollten. Sie wollten ihre Klugheit auf die Probe gestellt sehen, und zwar auf Augenhöhe mit dem Autor, aber letztendlich wollten sie verlieren. Sie wollten überrascht werden. Weswegen Arthurs Kämpfe sich in die Länge zogen – und noch dazu verflucht anstrengend waren. Er wusste mittlerweile, was für eine höllisch qualvolle Angelegenheit es war, eine gute Kriminalgeschichte zu entwerfen. Und nachdem er nun seit einigen Jahren in dieser Mühle schuftete, war der Überdruss daran in einen Hass gegen Holmes umgeschlagen, den er nicht länger in Schach halten konnte. Inzwischen richtete sich dieser Hass allerdings nicht mehr nur auf Holmes, sondern auch auf die Leser, die diesen rattengesichtigen Detektiv derart verehrten. Gott sei Dank würde Arthur sich jetzt, mit dieser letzten Holmes-Geschichte, ihrer aller endlich ein für alle Mal entledigen.
Es war bereits spät, und Arthur hörte die Kinder oben heftig poltern. Schwach vernahm er, wie die Kinderfrau sie anwies, leiser zu sein, damit sie nicht noch ihre Mutter weckten. Touie würde jetzt tief und fest schlafen – wie sie es bereits während des Großteils des Tages getan hatte. Ihre Schwindsucht verschlimmerte sich zwar nicht weiter, aber der klare Schweizer Föhn hatte auch nicht sonderlich dazu beigetragen, dass es ihr gesundheitlich besserginge. Das Haus verließ sie kaum noch. Ausflüge in die Stadt kamen schlicht nicht mehr infrage. Ihrer Hinfälligkeit zum Trotz hatte Arthur die Entschlossenheit gepackt: Er würde sich um seine arme, liebe Touie kümmern, die mit neunzehn Jahren seine Braut geworden war. Auch wenn sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Lage weiterhin in getrennten Schlafzimmern nächtigen mussten, auch wenn Kindermädchen nötig waren, die sich um die Kleinen kümmerten, auch wenn Touie mittlerweile in den Winter ihrer Privatgemächer hinein verwelkt war … Nun, dann war es eben so.
Arthur würde schreiben. Er hatte immer gern tagsüber geregelte Zeiten für seine Arbeit gehabt. Nur am heutigen Abend sah es anders aus. Manche Dinge mussten in der Dunkelheit geschrieben werden.
Auch als er zur letzten Seite kam, stockte ihm die Hand, die den Füllfederhalter führte, nicht. Arthur schrieb in denselben weitausgreifenden Schwüngen wie immer. Die Wörter flogen ihm zu, reihten sich eins nach dem anderen in seinem Kopf auf – das ordnungsgemäße Nomen, das klärende Verb, gelegentlich ein willkommenes Adjektiv –, und gewissenhaft hielt er sie auf dem dunkler werdenden Blatt fest. Sobald die Sätze auf der Seite standen, ging er sie nicht noch einmal durch. Er strich keine Wörter durch, wie es seine guten Freunde Mr. Barrie und Mr. Oliver taten, die endlose Ersetzungen mit dem jüngsten mot juste durchführten. Nach Arthurs Dafürhalten war dieses Vorgehen Zeichen einer unentschlossenen Hand. Er musste seine vorigen Absätze nicht befragen, um zu wissen, wie es weitergehen sollte. Er wusste es einfach.
Die Finger zitterten ihm nicht, als er zu den letzten Sätzen seiner Geschichte kam. Ein Brief aus dem Jenseits des Grabes, der geöffnet werden sollte, nachdem sein Absender verstorben war. »… den besten und klügsten Menschen reinzuwaschen, den ich jemals gekannt habe«, schrieb Arthur. Eine angemessene Hommage, ein wohlfeiler Abschied. Er setzte einen leicht getupften Punkt ans Ende des Satzes und legte das Blatt auf die vorigen. Dann klopfte er den Stapel sorgfältig zu einem sauberen Rechteck und wendete ihn. Das letzte Problem stand als Titel oben auf Seite eins. In der Tat, dachte Arthur, wurde dann von einer plötzlichen Heiterkeit überfallen und musste lächeln. Da er ganz für sich war, erlaubte er sich sogar ein leises Glucksen. Arthur fühlte sich zum ersten Mal seit Jahren frei.
Er stand auf. Glücklich taumelte er zur Tür. Und dann – ach! Beinahe hätte er es vergessen.
Mit einem Satz war Arthur wieder zurück am Schreibtisch. Was war denn da über ihn gekommen? Man könnte ja geradezu denken, er sei ein frisch verliebter junger Mann, kurz davor, seine Geliebte zu besuchen!
Er schloss die Schublade links unten an seinem Schreibtisch auf und nahm von einem Stapel in dunkles Leder gebundener Bücher das oberste heraus. Er schlug es auf und blätterte bis zu einer Seite, die noch nicht gänzlich mit Tinte bedeckt war. Er zog die Kappe vom Füller und notierte das Datum. Und obwohl er an den meisten Abenden oft eine geschlagene Stunde damit beschäftigt war, die Ereignisse des Tages und sämtliche seiner intimsten Gedanken niederzuschreiben, vertraute er seinem Tagebuch heute nur zwei Worte an:
»Holmes umgebracht.«
Arthur war erleichtert. Seine Schultermuskeln lockerten sich. Er schloss die Augen und sog die dunkle Luft in die Lunge. Er war so glücklich.
Bevor er in den Flur hinaustrat, um sich einen Brandy zu genehmigen, schloss er sein kostbares Tagebuch wieder sorgfältig im Schreibtisch ein.
KAPITEL 4Das verschwundene Tagebuch
»Watson kann Ihnen bestätigen, dass ich manchmal einen Hang zum Dramatischen habe.«
Sir Arthur Conan Doyle, Das Flottenabkommen
5. Januar 2010
»Zu Mord!«, wiederholte Jeffrey Engels mit Nachdruck.
Harold schwieg. Hier stimmte doch irgendetwas ganz und gar nicht.
»Die Affäre hat eine ernste Wendung genommen? Zu Mord?«, sagte Jeffrey wieder, diesmal in einem fragenden Tonfall.
Da musste Harold lachen.
»Das ist ein Zitat aus Die sechs Napoleons. Jetzt sind Sie mir aber einen Drink schuldig.«
»Gut gemacht!«, strahlte Jeffrey. »Ich schulde Ihnen tatsächlich einen.«
»Wenn nicht sogar zwei. Das Zitat ist so nämlich nicht ganz korrekt. Es heißt, ›die Affäre hat eine wesentlich ernstere Wendung genommen‹, nicht nur ›eine ernste Wendung‹.«
Jeffrey dachte einen Augenblick nach.
»Du meine Güte, Sie haben Ihre Amtseinführung bei den Irregulars erst vor zwei Minuten hinter sich gebracht und fangen schon an, einem alten Mann gegenüber kleinkariert zu sein. Nun gut. Bei dieser Taktung werde ich Sie wohl bis zum Morgengrauen mit Scotch versorgen müssen.«
Dieses Zitierspiel war Harold gleich bei seinem ersten Sherlockianer-Treffen begegnet. Vor vier Jahren, noch bevor er überhaupt fürs Baker Street Journal geschrieben oder einen der Irregulars kennengelernt hatte, war er in Los Angeles zu einer Zusammenkunft der örtlichen Irregular-Aspiranten gegangen, den Curious Collectors of Baker Street, einer eher überschaubaren Gruppe mit deutlich weniger Renommee. Die Treffen waren sogar der Öffentlichkeit zugänglich. In einer eichenholzvertäfelten Bar hatten sie einander über Gläsern voller nach Torf riechendem Scotch – soweit Harold sagen konnte, schienen alle Sherlockianer davon auszugehen, dass Eiswürfel aus Gift waren, weswegen man ihnen nicht über den Weg traute – Zitate aus Sherlock-Holmes-Erzählungen zugerufen. Ein Mitglied der Gruppe brüllte ein Zitat, zum Beispiel: »Nein, nein, ich rate niemals. Das ist eine entsetzliche Angewohnheit – fatal für das logische Denkvermögen.« Daraufhin musste der rechte Sitznachbar den Namen der Erzählung nennen, aus der diese Stelle stammte, in diesem Fall Das Zeichen der Vier. War die Antwort korrekt, war es an dem- oder derjenigen, selbst ein Zitat in die Runde zu werfen, woraufhin dann der nächste Sherlockianer eine Antwort beizubringen hatte. Wer sich als Erstes irrte, musste die nächste Runde bezahlen. Da die meisten Sherlockianer einen guten Scotch durchaus zu schätzen wussten – auch in umfangreichen Mengen –, wurden die Kreditkarten von neuen, noch unerfahrenen Gruppenmitgliedern gern bis an die Grenzen ausgereizt.
»Es ist mein erster Abend als Irregular«, sagte Harold, »und ich habe so die Vermutung, dass Sie dafür mehr als nur ein bisschen verantwortlich sind. Ich glaube, ich bin hier derjenige, der Ihnen einen Drink ausgeben sollte.«
Jeffreys Grinsen kehrte zurück.
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie sprechen, mein Junge. Also, lassen Sie uns die Bar in Beschlag nehmen.«
Kurz darauf saß Harold neben Jeffrey auf einem Hocker und nippte an einem Bourbon. Eine Gruppe Feiernder hatte das Klavier der Hotelbar in einer nicht-feindlichen Übernahme gekapert und sang ein altes sherlockianisches Liedchen. Intonierte es, genauer gesagt, im Sprechchor. Der Barkeeper beobachtete sie in einer Mischung aus Missbilligung und Unverständnis.
Zur Melodie von Auld Lang Syne sang das betrunkene Grüppchen: »To all our friends canonical/On both sides of the crime/We’ll take the cup and lift it up/To Holmes and Watson’s time.« Es klang gleichermaßen schief wie aus dem Takt. Harold war sich allerdings nicht sicher, ob er je ein sherlockianisches Lied gehört hatte, bei dem viel Rücksicht auf die richtige Intonation genommen worden war.
Bald unterhielten sich Harold und Jeffrey über das Tagebuch, über das am heutigen Abend vermutlich alle sprachen. Man sang und trank nur, um sich abzulenken, denn eigentlich wurden sämtliche Hunderte von Sherlockianern im Algonquin Hotel nur von einem einzigen Gedanken umgetrieben: dem an das verloren geglaubte Tagebuch von Sir Arthur Conan Doyle. Das verloren geglaubte Tagebuch, das endlich gefunden worden war.
Nach dem Tod von Conan Doyle war ein Band seiner Tagebücher verschwunden. Der Schriftsteller hatte zeit seines Lebens akribisch Tagebuch geführt, aber als seine Frau und seine Kinder nach seinem Ableben seine Papiere durchgegangen waren, war eines der Bücher sonderbarerweise nicht aufzufinden. Für den Zeitraum vom 11. Oktober bis zum 23. Dezember des Jahres 1900 war kein abgegriffenes, in tintenfleckiges Leder gebundenes Tagebuch mehr vorhanden. Und in den hundert Jahren, die seither vergangen waren, hatte es auch keiner der vielen Forscher oder Familienangehörigen finden können. Das verschwundene Tagebuch war der Heilige Gral sherlockianischer Studien. Es war ein hypothetisches Vermögen wert – sollte es jemals bei Sotheby’s zum Verkauf stehen, würde es möglicherweise an die zehn Millionen Dollar erbringen. Aber, wichtiger noch, es würde vor allem ein Fenster öffnen in die Gedankenwelt des größten Kriminalautors der Welt, und zwar auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Wissenschaftler hatten hundert Jahre lang darüber spekuliert, was wohl in dem Tagebuch gestanden hatte. Das Manuskript einer ebenfalls in der Versenkung verschwundenen Erzählung? Ein geheimes Geständnis von Conan Doyle? Und wie um alles in der Welt konnte es bloß so spurlos verschwunden sein?
Drei Monate vor dem Dinner im Algonquin hatten alle Mitglieder der Irregulars eine quälend kurze E-Mail von ihrem Kollegen Alex Cale erhalten. »Das große Rätsel ist gelöst«, hatte da gestanden. »Ich habe das Tagebuch gefunden. Ich bitte um die Vorbereitungen für eine Präsentation des Buchs – und der darinstehenden Geheimnisse – bei der diesjährigen Konferenz.«
Es war ein köstliches Rätsel, sogar für Alex’ Verhältnisse, der diese Art von Dramatik ganz besonders schätzte. Eine ganze Flut von E-Mails ergoss sich schnell rund um den Globus: »Meint er das ernst?«, »Er kann nicht DAS Tagebuch meinen, oder?«, »Er sucht seit fünfundzwanzig Jahren nach dem verdammten Ding und hat es jetzt einfach so GEFUNDEN?« Die Baker Street Irregulars reagierten mit Unglauben, auch, um sich für den bevorstehenden Schock zu wappnen. Während der nächsten drei Monate ging man allenthalben durch sämtliche Stadien der begeisterten Aufregung, der Angst, der nervösen Vorahnung und, aus einigen dunklen Ecken kommend, auch der Eifersucht.
Alex Cale war bereits der versierteste aller Sherlockianer. Den Standpunkt zu vertreten, dass Cale nicht der weltweit größte Sherlock-Holmes-Experte war, war nicht einfach – obwohl es bei den Irregulars durchaus mehr als nur einen weiteren Experten gab, der da möglicherweise doch latent anderer Meinung war. Aber natürlich, so hatten es seine Rivalen formuliert, natürlich musste es ausgerechnet Alex Cale sein, der das verschwundene Tagebuch des Arthur Conan Doyle wieder auftrieb. Mit seinem ganzen Geld. Und seiner vielen freien Zeit. Und dem anscheinend niemals versiegenden Treuhandfonds seines lieben toten Papas in der Hinterhand.
Aber trotzdem war die Frage, die Harold, Jeffrey und Hunderte weiterer Sherlockianer, die im Algonquin Hotel zurzeit tranken, lachten, schliefen oder – weit weniger verbreitet – Sex hatten, vor allen Dingen umtrieb, eher diese: Wo hatte Alex das Tagebuch denn nun gefunden? Und wie?
Nachdem er seine Botschaft verschickt hatte, antwortete Alex auf keine E-Mails mehr. Er ging auch nicht mehr ans Telefon. Sogar Briefe wurden nicht mehr beantwortet, und das, obwohl er immer große Stücke auf die gute, alte Kulturtechnik des Briefeschreibens gehalten hatte. Nachdem Jeffrey Engels mehrfach versucht hatte, mit ihm in Kontakt zu treten, hatte Alex ihm endlich eine Nachricht zukommen lassen. Wenn man das überhaupt so nennen konnte.
»Werde verfolgt«, schrieb er an Jeffrey. »Melde mich demnächst.« Aus diesem Telegrammstil konnte Jeffrey nicht schließen, ob Alex scherzte oder ob er langsam verrückt wurde. Er leitete Alex’ Nachricht an die große Runde weiter, und es herrschte allgemein Übereinstimmung darin, dass Alex sich einen etwas zu deftigen Spaß erlaubte und es mit dem sagenhaften Rätsel ein wenig zu weit trieb. Sicher, das Tagebuch wäre durchaus etwas wert, aber wer beziehungsweise welche schattenhafte Gestalt sollte Alex schon rund um seine Londoner Wohnung verfolgen? Alle gingen davon aus, dass Cale künstlich die Spannung erhöhen wollte. Nur Harold mit seiner lebhaften Fantasie wurde von Ängsten umgetrieben. War es möglich, dass tatsächlich jemand versuchte, Alex Cale etwas anzutun?
»Darf ich raten?«, fragte Jeffrey jetzt. »Es ist eine Erzählung. Ein verschollenes Manuskript. Conan Doyle wird beschlossen haben, dass es nichts taugte, und hat es daraufhin weggeschlossen. Er wird sicher nicht gewollt haben, dass irgendjemand es findet und ein solches, seinen Ansprüchen nicht genügendes, Werk veröffentlicht.«
»Vielleicht«, erwiderte Harold. »Aber Conan Doyle hat im Laufe seines Lebens eine ganze Menge Texte veröffentlicht. Ich hoffe, dass ich mich der Blasphemie nicht verdächtig mache: Aber wir müssen doch zugeben, dass nicht alle davon Diamanten sind. Die Löwenmähne? The Mazarin Stone? Ich meine, ganz ehrlich …«
Jeffrey lachte.
»Ich war ja immer der Ansicht, dass Conan Doyle diese schrecklich schlechten späten Erzählungen gar nicht selbst geschrieben hat. Sie klingen gar nicht nach ihm. Das Tagebuch allerdings stammt aus dem Herbst 1900. Er steckte mitten in der Vorbereitung zum Hund der Baskervilles, seinem wahrscheinlich besten Text, wenn Sie mich fragen.«
»Schon«, sagte Harold. »Trotzdem, ich bin mir nicht sicher … Aus irgendeinem Grund glaube ich nicht, dass es eine Erzählung ist. Ich glaube, es ist …«
Harold ließ den Satz in der Luft hängen. Seine Vermutung laut auszusprechen, kam ihm albern vor.
»Es ist …?«, hakte Jeffrey nach.
»Ich denke, es ist … Ich glaube, das Tagebuch birgt ein Geheimnis. Etwas, das niemand wissen sollte. Etwas, das Conan Doyle nur für sich aufgeschrieben hat. Er war ein derart hingebungsvoller Tagebuchschreiber. Es hat ihm Freude bereitet, Dinge auf Papier zu bringen. Es hatte eine therapeutische Wirkung auf ihn. In diesem Fall wollte er aber nicht, dass die Welt erfährt, was in dem Ding steht.«
Jeffreys Handy klingelte. Mit einem Klingelton irgendwo zwischen einem Piepen und einem Quieken. Jeffrey sah auf das Display, machte eine entschuldigende Geste in Harolds Richtung und nahm den Anruf entgegen.
»Ja?«, war alles, was er sagte. Dann, nach einigen Sekunden: »Danke.«
Harold sah ihn fragend an.
»Sie glauben also, das Tagebuch birgt ein Geheimnis?«, fuhr Jeffrey fort. »Also dann, mein Junge, lassen Sie es uns doch herausfinden.«
Was Harolds Verwirrung nicht minderte.
»Das war die Rezeption«, erklärte Jeffrey. »Ich hatte darum gebeten, mich umgehend zu kontaktieren, wenn Alex Cale eincheckt.«
Er lächelte, augenscheinlich hochzufrieden mit sich.
»Cale ist in der Lobby. Haben Sie Lust, ein Rätsel lösen zu gehen?«
Harold schaffte es gerade so, sein Getränk nicht umzustoßen, als er von seinem Hocker sprang.
Wie Holmes auf den Fersen von Professor Moriarty stürzte er durch die doppelflügelige Tür hinaus in die hell erleuchtete Lobby. Der immer noch lächelnde Jeffrey folgte ihm.
Alex – Jeffrey hatte recht gehabt, es war tatsächlich Alex Cale, der da an der Rezeption stand und irgendetwas unterschrieb – trug einen dicken, bis zum Hals zugeknöpften Trenchcoat und in der rechten Hand einen schwer wirkenden Aktenkoffer. Während er die Formalia mit dem Hotel beendete, nahm er den Koffer von der rechten in die linke. Alex, effeminiert, aber freundlich, war ein Mann, der genauso viele Partys gab, wie er besuchte, und der ein Händchen dafür hatte, sogar auf den Partys, für die er nicht verantwortlich war, dafür zu sorgen, dass alle ein Getränk in der Hand hatten. Harold war Alex bereits bei früheren sherlockianischen Veranstaltungen begegnet, und natürlich kannte er Alex’ Namen schon fast so lange wie den von Sherlock Holmes selbst. Aber er konnte nicht behaupten, ihn wirklich gut zu kennen.
»Alex, mein alter Freund, da bist du ja!«, rief Jeffrey laut, woraufhin Alex sich umwandte.
Als er die beiden Männer auf sich zukommen sah, machte er keinen besonders glücklichen Eindruck.
»Gentlemen«, sagte er leise.
Sein englischer Akzent war im Kreise der Irregulars, die mehrheitlich US-Amerikaner waren, geradezu auffällig. Den Koffer stellte Alex nicht ab, und er machte auch sonst keinerlei Anstalten, die beiden Kollegen irgendwie zu begrüßen oder gar zu umarmen. Er stand nur da wie ein begossener Pudel, völlig durchnässt und erschöpft. Draußen musste ein Unwetter aufgezogen sein, was Harold noch gar nicht bemerkt hatte. Alex’ Pupillen waren geweitet, ganz so, als litte er unter Schlafmangel. Er schien direkt an ihnen vorbeizublicken.
»Wo bist du denn die ganze Woche über gewesen, altes Haus? Wir haben dich vermisst. Gestern hat Laurie King einen absolut wunderbaren Vortrag gehalten über die Frau und ihre Rolle in der Zeit des Großen Bruchs. All das. Faszinierend.«
»Wie schade, dass ich das verpasst habe«, sagte Alex, und seine Unehrlichkeit war offensichtlich.
Er muss wissen, dachte sich Harold, dass wir eigentlich gar nicht darüber mit ihm sprechen wollen, sondern über das, worüber alle mit ihm sprechen wollen: über das Tagebuch und seinen morgigen Vortrag. Über die Lösung eines hundertjährigen Rätsels.
»Und wer sind Sie?«, fragte Alex und machte sich noch nicht einmal die Mühe, Harold dabei in die Augen zu sehen.
»Harold. Ich bin Harold White. Ich bin heute Abend bei den Irregulars aufgenommen worden.«
Harold streckte die Hand aus, aber Alex machte keine Anstalten, sie zu ergreifen.
»Wir sind uns schon einmal begegnet. In Kalifornien. Sie haben damals einen Vortrag an der UCLA gehalten.«
»Ja, richtig«, sagte Alex, »ich erinnere mich. Freut mich, Sie wiederzusehen.«
Er erinnerte sich eindeutig nicht, und einen besonders erfreuten Eindruck machte er ebenfalls nicht.
»Unsere Neuen werden mit jedem Jahr jünger, oder?«, bemerkte Jeffrey jovial.
Harold gab sich Mühe, nicht gekränkt zu sein.
»So jung bin ich nun auch wieder nicht«, gab er zurück. »Ich habe schon …«
»Nicht umdrehen!«, rief Alex plötzlich.
Harold war irritiert. »Wie bitte?«
»Dreht euch nicht um!«, wiederholte Alex.
Beide, Harold und Jeffrey, standen mit dem Rücken zum Vordereingang des Hotels, und beide wandten nun instinktiv den Kopf leicht zur Seite.
»Da draußen steht jemand. Am Fenster. Nicht umdrehen, wie heißen Sie noch, Harry – was habe ich Ihnen gerade gesagt? Ich mache jetzt einen kleinen Schritt nach rechts. Ja. Und jetzt macht ihr beide es genauso. Ja. Noch einmal. Könnt ihr jemanden sehen? Dort am Fenster?«
Harold versuchte, die Augen zu verdrehen, ohne dabei den Kopf zu bewegen, was ihm leichte Kopfschmerzen verursachte. Er sah den Regen in dickem Schwall gegen die hohen Fenster schlagen. Er sah verwischte Streifen weißen Lichts auf den Scheiben, das von den Straßenlaternen auf der anderen Seite der 44. Straße kam. Ein unheimlich in die Lobby spähendes Gesicht konnte er nicht ausmachen.
Harold war ganz durcheinander – und auch zunehmend besorgt. Dabei war es weniger seine eigene Sicherheit, die ihm Sorgen bereitete, als vielmehr Alex’ Geisteszustand. Auch Jeffrey schien draußen vor dem Hotel nichts Befremdliches zu entdecken und wusste genauso wenig, wie er reagieren sollte.
»Komm schon«, sagte er, »hör doch auf, uns auf den Arm zu nehmen. Lasst uns etwas trinken gehen. Dann kannst du von deinen Abenteuern berichten.«
Alex achtete nicht auf ihn – oder hatte ihm gar nicht erst zugehört. Mit schnellen, hierhin und dorthin stechenden Blicken suchte er die Lobby ab.
»Erzähl uns doch, was in dem Tagebuch steht«, fuhr Jeffrey fort. »Bitte. Gewähre uns vor morgen schon mal einen kleinen Einblick.«
Einen schweigsamen Augenblick lang starrte Alex Jeffrey an. Er wirkte ernsthaft verstört.
»Ihr wollt wirklich wissen, was in diesem Tagebuch steht?«, fragte er dann.
Die Frage war derart einfach und die Antwort darauf derart naheliegend, dass sie beide einen Augenblick brauchten, um zu reagieren.
»Ja«, sagten sie dann annähernd gleichzeitig.
Alex nahm zum ersten Mal direkten Blickkontakt mit Harold auf. Was dazu führte, dass Harold sich so richtig unwohl fühlte.
»Ich frage mich, ob ihr das wirklich tut«, sagte Alex. »Wenn einem ein Problem vorgelegt wird, ist es nur natürlich, eine Antwort darauf finden zu wollen. Aber falls ihr glaubt, heute Nacht schlafen zu können, dann schlaft doch hiermit ein: Beschert einem das Rätsel nicht manchmal den größeren Genuss als die Lösung? Seid ihr sicher, dass es befriedigender sein wird zu wissen, was in diesem Tagebuch steht, als sich das bis in alle Ewigkeit zu fragen?« Er machte einen Schritt von ihnen weg und nahm den Aktenkoffer wieder in die andere Hand. Dann hielt er ihn sich vor die Brust und klopfte mit der freien Hand darauf. »Morgen werdet ihr es ja dann erfahren.«
Als Alex schnell übers Parkett davonging, fiel Harold auf, dass er eine Spur aus nassen Fußabdrücken hinterließ. Die schuhförmigen Pfützchen zerflossen schnell und bildeten unförmige Lachen, ihre ursprüngliche Form löste sich in einem hauchdünnen Wasserfilm auf.
In der ganzen Lobby erhob sich Gemurmel. Sherlockianer wandten die Köpfe. Moment mal, war das nicht Alex Cale, der dort eben gestanden hatte? Dieser Mann mit dem Aktenkoffer? Aber noch bevor sich irgendjemand nähern konnte, war Alex schon im Aufzug verschwunden.
»Du meine Güte«, sagte Harold. »Was wollte er uns denn jetzt damit sagen?«
»Dass wir morgen um diese Zeit das letzte große Geheimnis des Arthur Conan Doyle gelüftet haben werden.«
KAPITEL 5Trauerarbeit
»Kleine Diebstähle, mutwillige Anschläge, planlose Freveltaten – dem Manne, der den Schlüssel dazu besaß, fügte sich all dies zu einem geschlossenen Ganzen. Für den wissenschaftlichen Studenten der höheren Welt des Verbrechens bot keine andere Hauptstadt in Europa die Vorteile, die London seinerzeit besaß.«
Sir Arthur Conan Doyle, Der Baumeister aus Norwood
18. Dezember 1893
Aus dem orangerot erleuchteten Bahnhof Charing Cross trat Arthur in die trockene weihnachtliche Kälte hinaus. Obwohl der Winter schon fortgeschritten war, hatte es in London bislang nur wenig geschneit. Man rechnete täglich mit einem gewaltigen Schneeeinbruch. Die Kälte prallte gegen Arthurs Mantel, kroch ihm in die Ärmel, schlüpfte zwischen die Schnürsenkel seiner Lederschuhe, pikte ihm in die Ohrläppchen und ließ seine Ohrspitzen schon nach kürzester Zeit feuerrot werden.
In der zweiten Woche dieses schneelosen Dezembers war Arthurs Mord – und er hielt ihn unmissverständlich für genau das – an Sherlock Holmes an die Öffentlichkeit gelangt. Die Schlagzeile der Times posaunte: »BERÜHMTER DETEKTIV KOMMT UMS LEBEN!« Diese außerordentliche Dummheit war Arthur geradezu peinlich. Diese Tölpel druckten sogar einen Nachruf auf den Mann. Einen Nachruf auf eine Romanfigur. Der aber nichtsdestoweniger in einer Zeitung stand. Was, wie Arthur fand, zur Genüge unter Beweis stellte, dass die Dinge mit diesem Bürschchen aus dem Ruder gelaufen waren. Es war eindeutig richtig gewesen, einen Schlussstrich zu ziehen. Holmes war ein Quälgeist, und die braven Londoner Bürger wären mit etwas anspruchsvollerer Belletristik wahrlich besser bedient. Wenigstens würde sich dieser ganze Wahnsinn irgendwann legen. Auf den Seiten des Magazins The Strand würde eine neue Abenteurerfigur erscheinen und auf die nationale Bühne treten. Vielleicht dieser Raffles, über den Willie Hornung zurzeit schrieb. Binnen Jahresfrist würde Sherlock Holmes vergessen sein. Dessen war Arthur sich sicher.
Vor zweieinhalb Jahren war Arthur aus seinem beengten Quartier am Montague Place aus- und in ein hübsches dreistöckiges Haus im Umland gezogen, acht Meilen vor der Stadtgrenze in South Norwood. Was ihm sicher nicht fehlte, waren der Lärm und das Gewühl auf der Straße, denen man sich jedes Mal, wenn man aus dem Haus ging, entgegenwerfen musste. Aber er vermisste es, tagtäglich am British Museum vorbeizukommen und an der großartigen steinernen Mauer entlangzugehen, die das Museum wie ein großes, eckiges »U« umschloss. Gelegentlich hatte er einen kleinen Umweg gemacht und in die gähnende Weite aus grauem Stein geblickt, dort, wo die Eingangsöffnung in der Mauer einen ganzen Wald aus ionischen Säulen unter einem schlichten Architrav sehen ließ. Der Fries oben war so lang und schmal, dass Arthur, wenn er hinaufsah, immer den Eindruck hatte, als wären die Wolken die rechte Hand Gottes, die auf das Museum niederdrückte und es noch tiefer in den Boden Britanniens schob.
Trotz alledem: South Norwood war eine Verbesserung. Man musste sich nicht jeden Tag im Qualm der Stadt den Atem nehmen lassen – »In London kann man ein Vermögen sparen, weil man sich keinen Tabak kaufen muss«, sagte er als Witz zu Barrie, der so freundlich war zu lachen –, war aber trotzdem in ein paar Minuten mit dem Zug in Charing Cross. Er hatte für sich und Touie ein Tandem gekauft. Sie sprach sehr gut auf die sportliche Betätigung an. Wenn sie pünktlich nach dem Tee loskamen, schafften sie es, noch vor dem Abendessen fünfzehn Meilen zu radeln. Das Haus bot zudem Platz für Arthurs Schwester Connie, deren losem Herumziehen in Portugal Arthur und die Dame des Hauses ein Ende gemacht hatten. Connie gab ein formidables Kindermädchen für Arthurs Kinder Roger und Kingsley ab. Letzterer war mit seinem einen Jahr immer noch nicht größer als ein Sofakissen.
Arthur verließ die in der Mitte der Straße verlaufende Promenade und ging vom Charing Cross Hotel aus gen Süden. Er kam an einem einbeinigen Zeitungsverkäufer vorbei, der ihm mit den Blättern des Tages vor der Nase herumwedelte. Sie nahmen keinen Blickkontakt auf.
Eine ganze Reihe Taxen ächzte und ratterte die Strand entlang. Die Pferde gaben in dieser Kälte grummelnde Geräusche von sich, fast wie alte, müde, streitlustige Männer. Jungen flitzten hin und her und überbrachten Nachrichten in alle Richtungen gleichzeitig. Die weichen Linien der drei- bis vierstöckigen Gebäude, die die Straße säumten, wurden begrenzt von den knallroten »ZU VERMIETEN«-Schildern, die freie Zimmer über dem Telegrafenamt, über den Läden und über der langen Ladenzeile des Rechtsanwaltsbüros anpriesen. Arthur wandte dem Trafalgar Square den Rücken zu und bummelte weiter.
Natürlich war das Leben in der Vorstadt ein Genuss, aber die Stadt fehlte Arthur dennoch. Mit Vergnügen kam er her, um seine Besorgungen zu machen, die er ohne große Eile erledigte. Wie ein Schwamm nahm er die Energie der Stadt auf, ihr Quietschen und Kreischen, und kehrte dann mit vollem Bauch nach Norwood zurück. Zu Touie. Zu seinem Fahrrad.
Zufriedenheit erfüllte ihn in jenem Moment. Er ging weiter die Strand entlang und ließ den Gehstock schwingen. Wäre er ein Mensch gewesen, der gerne pfiff, dann hätte er jetzt gepfiffen. Was für ein schöner Vormittag.
»SIE UNMENSCH!«, kreischte da eine alte Dame und hieb Arthur mit ganzer Kraft die Handtasche ins Gesicht.
Die Tasche schrammte an seiner Nase entlang und ließ seinen Hut zu Boden gehen, Arthur selbst stolperte. Er war zwar weitestgehend unverletzt, aber der Schock saß. Die Frau musste mindestens sechzig sein. Sie ging gebeugt, fast küssten die Schultern die Zehenspitzen. Zerbrechlicher als sie konnte man kaum aussehen, und Arthur war schleierhaft, woher sie die Kraft für den Schlag gegen ihn genommen hatte. Über dem dunklen Mantel trug sie eine schmale schwarze Armbinde, als sei sie in Trauer.
Er stammelte: »Ich … Madam, ich – es tut mir leid, habe ich Sie … Bin ich Ihnen in irgendeiner Art und Weise zu nahegetreten?«
»SIE MONSTER!«, belferte sie und holte erneut mit der Handtasche aus.
Die Tasche war schwer und beschrieb langsam einen weiten Bogen durch den Himmel, wobei sich ihr Blau von der dichten Wolkendecke abhob. Immerhin war sich Arthur diesmal ihrer Anwesenheit bewusst, machte einen Schritt zurück und wich so dem Schlag aus. Er nahm sogar kurz eine Verteidigungshaltung ein, hob abwehrend den Spazierstock, schämte sich dann aber doch und setzte ihn zurück aufs Trottoir. Schließlich war er ein junger, athletischer Mann, dem es nicht gut zu Gesicht stand, den Stock gegen eine verwirrte ältere Dame zu erheben.
»Ma’am, ich weiß nicht, für wen Sie mich halten, aber seien Sie versichert, dass wir uns noch nie begegnet sind.«
Ein Zeitungsjunge blieb mitten im eiligen Lauf stehen, um sich die Szene anzusehen. Zu ihm gesellte sich eine großgewachsene vornehme Dame mit modischem Hut, die trotz des bedeckten, winterlichen Wetters ihren Sonnenschirm aufgespannt hatte. Jeder sich reckende Kopf zog weitere Schaulustige an. Allmählich bildete sich eine Menschenmenge.
»Ich weiß sehr gut, wer Sie sind, Dr. Doyle, und glauben Sie ja nicht, dass ich nicht wüsste, was Sie getan haben.«
Es war weniger die doppelte Verneinung, die ihn aus der Fassung brachte, als der selbstverständliche Gebrauch seines Familiennamens. Arthur war es nicht gewohnt, erkannt zu werden, auch wenn im letzten Jahr immer mal wieder eine Fotografie von ihm in der Zeitung abgedruckt worden war. David Thomson hatte für den Daily Chronicle ein sehr schönes Bild von ihm gemacht, wie er schreibend an seinem Schreibtisch saß.
Arthur konnte hören, wie sich aus der größer werdenden Menge ein Raunen erhob.
»Doyle … Doyle … Doyle …«
»Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen«, sagte er flehentlich.
Er blickte zu den Versammelten, suchte nach Unterstützung, nach einer Bestätigung für seine – verglichen mit dem Wahnsinn des alten Weibes – eigene geistige Gesundheit. Dann fiel ihm auf, dass viele in der Menge unter ihren aufgeregt schnatternden Mündern vergleichbare schwarze Armbinden trugen. Die ganze Stadt war in Trauer. Er hätte auf die Bibel schwören können, dass er am Morgen die Zeitungen durchgesehen hatte … Hatte er eine Todesmeldung schlicht übersehen? War ein großer Staatsmann verschieden? Sicher, Cecil Rhodes war schon alt, aber so alt, dass er …? Vielleicht die Königinmutter? Nein, nein, das hätte er doch ganz sicher mitbekommen!
»Sie haben ihn umgebracht! Sie haben ihn umgebracht, so wahr ich hier stehe«, zischte die Alte.
»Warum haben Sie das getan?«, rief jemand – es hätte jeder sein können – aus der Menge heraus.
»Ich habe jemanden umgebracht …?«, kam es stockend von Arthur, während hinter seiner Stirn ein entsetzlicher, undenkbarer Gedanke langsam Form annahm. »Sie wollen aber nicht sagen, dass Sie wütend sind, weil ich …«
»Doch, weil Sie Sherlock Holmes umgebracht haben!«
Zunächst war Arthur wie vor den Kopf geschlagen. Als die Alte ihm erneut einen Hieb versetzte, diesmal in die Bauchgegend, sagte er nichts und bewegte sich nicht. Aus der Menge heraus riefen einige – immerhin –, sie solle sich doch mäßigen, den meisten jedoch war an etwas ganz anderem gelegen. Sie wollten eine Antwort. Von Arthur. Es gab aber keine, die er hätte geben können.
Seine Wangen wurden heiß vor Zorn.
Vor zwei Monaten, im Oktober, war sein Vater in einer Nervenklinik in Crichton verstorben, ungefähr achtzig Meilen südlich von Arthurs Elternhaus in Edinburgh. Schon seit jeher hatte der Irrsinn von Charles Doyle, zusammengenommen mit seiner Trunksucht, die Nähe zu seinem einzigen Sohn verhindert. Über Jahre hinweg hatte Charles Arthur aus der Heilanstalt Briefe geschickt. Immer, wenn er die krakelig beschrifteten Umschläge mit der Briefmarke aus Dumfries auf seiner Türschwelle vorfand, verkrampfte Arthur inwendig. Richtige Briefe schrieb sein Vater ihm nie, es waren immer nur Zeichnungen: makabre Selbstporträts, Porträts von Arthur, von Tieren. Elfen im nahen Umgang mit monströsen Insekten. Grotesk riesenhafte Tausendfüßler, die auf grausamen, dunklen Blauhähern ritten. Zunächst war die Nachricht vom Tod seines Vaters mit einem gewissen Erleichterungsgefühl einhergegangen. Aber da Arthur selten hingefahren war, um seinen Vater zu besuchen, erfuhr er erst nach dessen Tod, dass er detailliert Protokoll geführt hatte über die Erfolge und Errungenschaften seines Sohnes. Charles hatte zu jedem von Arthurs Romanen Zeitungsartikel ausgeschnitten und in einem Sammelalbum verwahrt, in das er zusätzlich Szenen aus dem Familienleben gezeichnet hatte: die Familie am Tisch oder in der Küche ihres alten Hauses in Edinburgh. Die Mutter, die ihrem Ehemann trotz dessen Alkoholeskapaden und Tobsuchtsanfällen immer treu ergeben gewesen war, fand das Buch in Charles’ Habseligkeiten und schickte es ohne weiteren Kommentar an Arthur. Erst da hatte Arthur begriffen, was er verloren hatte. Hatte sein Vater, bevor er gestorben war, überhaupt gewusst, dass Arthur verheiratet war? Dass er zwei Kinder hatte? Dass sein zweiter Sohn als Frühchen zur Welt gekommen war und zwei Monate eng in Windeln gepackt im Krankenhaus verbracht hatte, bevor Arthur ihn mit nach Hause nehmen durfte?
Eine Woche nach Charles’ Tod war der Familienarzt einen langen Nachmittag auf Visite bei der geliebten Touie gewesen. Anschließend war er langsam die Treppe von ihrem Schlafzimmer im oberen Stockwerk heruntergestiegen und hatte Arthur mitgeteilt, dass der Husten in ihrer Lunge unheilbar sei. Tuberkulose. Sie würde mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten Monate sterben. Der Mann trat höflich und mit souveräner Professionalität auf, was Arthur nur noch mehr beschämte. Schließlich war er ebenfalls ein ausgebildeter Mediziner, und doch hatte seine Frau über Jahre hinweg mit Tuberkulose im Bett gelegen, während er das alles für eine nicht weiter bedenkliche Schwäche nach der Geburt ihres Sohnes gehalten hatte. An manchen Tagen drohte seine Scham die Trauer zu überwältigen. Es würde noch weitere Fahrten mit dem Tandem aufs Land geben. Er würde noch kräftiger in die Pedale treten. Jeder Ausflug zählte.
Charles Doyle war echt. Touie war echt. Ihr Tod und ihr Sterben waren Tragödien. Sherlock Holmes war nur ein Stück Fantasie. Sein Tod ein seichtes Freizeitvergnügen. Die alte keifende Frau und die immer noch anwachsende Menge in ihrem Rücken wussten nichts von Arthurs Vater – nicht einmal seinen Namen kannten sie. Der Tod von Charles Doyle war mit keinem einzigen Satz in der Times, dem Daily Telegraph oder wenigstens dem Manchester Guardian bedacht worden. Touies Krankheit würde über Jahre ein Geheimnis bleiben. Nein, diese Leute, diese elenden, verabscheuungswürdigen Leute, wussten nichts über Arthur. Sie kannten nur Holmes.
Arthur nahm die Attacken stumm hin, bis ein in der Nähe befindlicher Schutzmann herbeigeschlendert kam.
»Gehen Sie jetzt bitte weiter, nun gehen Sie schon«, wies er die Versammelten an, klang dabei aber eher verständnisvoll denn angriffslustig.
Die Leute fügten sich, die Alte allerdings verfluchte im Fortgehen Arthurs Namen mit jedem Atemzug. Der Schutzmann – klein, schmal, sehr geschäftsmäßig im Auftreten – hob Arthurs Hut auf.
»Danke, Sir«, sagte Arthur, der seine Umgebung erst langsam wieder bewusst wahrzunehmen begann.
»Lassen Sie sich von all dem nicht bekümmern, Mr. Doyle«, sagte der Schutzmann. »Ich finde, Sie haben dem alten Mr. Holmes einen recht hübschen Abgang beschert. Trotzdem natürlich überaus schade, ihn sterben zu sehen.«
Er tippte sich mit dem Finger an die Mütze und schritt von dannen.
KAPITEL 6Bis heute!
»Die Welt ist voller Mörder und deren Opfer; und mit welchem Hunger sie einander aufspüren!«
Ambrose Bierce zugeschrieben; eventuell apokryph
6. Januar 2010
Als Harold den großen Veranstaltungssaal im zweiten Stock des Algonquin Hotels betrat, wurde er von einer Geräuschkulisse in Empfang genommen, die sich mit Enten in der Paarungszeit messen konnte. Erwartungsvoll schnatterten die versammelten Sherlockianer durcheinander. »Versammelt« waren sie auch nur in dem Sinne, dass sich alle innerhalb derselben vier Wände befanden. Wie der gemeinste aller Pöbel lachten sie schallend, brüllten sich gegenseitig etwas zu oder riefen lautstark nach ihren Freunden. Das Ganze hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit einer gesitteten Zusammenkunft.
Hunderte sherlockianischer Koryphäen befanden sich irgendwie auf ihren Stühlen, auch wenn sie nicht richtig darauf saßen: Harold kam es so vor, als schwebten sie zitternd eine Handbreit über der Sitzfläche, während sie die Köpfe rasant von der einen zur anderen Seite fliegen ließen, um die Sitznachbarn nach den neuesten Gerüchten zu befragen. Harold schnappte einzelne Wörter aus einem halben Dutzend geschnatterter Unterhaltungen auf: »spät«, »Alex«, »verschwunden«.
Als er sich einen Weg zu einem freien Stuhl bahnte, tippte Harold einer etwas älteren Teilnehmerin aus England auf die Schulter, an deren Namen er sich nicht erinnerte. Die Frau mit dem streng zusammengebundenen grauen Haar wandte sich zu ihm um. Sie trug eine Brille, deren Gläser so dick waren, dass man meinen sollte, eine Frau würde sie nicht freiwillig tragen. Sie jedoch schien es nicht weiter zu stören.
»Ist irgendetwas passiert?«, fragte Harold und versuchte, gleichzeitig nonchalant und nicht hoffnungslos uninformiert zu wirken.
»Alex ist noch nicht da«, sagte sie schnell. »Man hat bereits versucht, ihn auf seinem Zimmer zu erreichen, aber das Telefon ist besetzt. Er ist offenbar verschwunden.«
»Mein Gott«, sagte Harold.
Er dachte an Alex’ Nervosität am vorigen Abend. Daran, wie sicher er sich gewesen war, verfolgt zu werden. Das konnte doch alles nicht wahr sein …
Eine kleine, eher junge Frau, die Harold unbekannt war, setzte sich auf den Platz links neben ihm. Als sie ihm den Kopf zuwandte, wogte ihr lockiges braunes Haar auf die eine Seite, und Harold sah ihre weit geöffneten Augen, die den Anschein machten, als sei Weltwahrnehmung eine ständige Neuentdeckung. Ihr hellblaues Kleid ließ sie jünger wirken, als sie wahrscheinlich war. Um den Hals trug sie ein hellgelbes Tuch, was kurz den Eindruck eines noch nicht ausgewickelten Bonbons entstehen ließ.
»Meine Güte, was für ein Aufruhr!«, sagte sie, den Kopf wieder nach vorn gewandt, den Raum mit den Augen absuchend.
Sprach sie mit Harold?
»Ja«, sagte Harold viel zu leise.
Sie wandte ihm das Gesicht wieder zu, und der abrupte Blickkontakt ließ ihn leicht zusammenfahren.
»Entschuldigung«, sagte sie freundlich. »Haben Sie etwas gesagt?«
»Ich, ähm, ja, habe ich. Ja.«
»Entschuldigung, es ist so laut hier, ich verstehe Sie nicht. Was haben Sie gesagt?«
»Ja.«