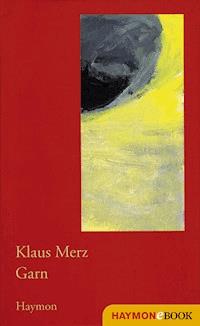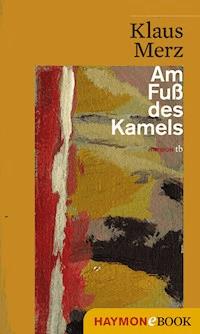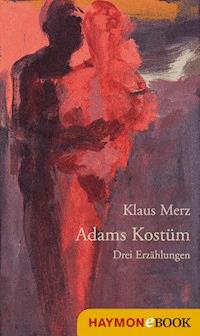Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der vierte Band der Werkausgabe von Klaus Merz versammelt eine repräsentative Auswahl seiner Feuilletons - Aufsätze, Kolumnen, Reden und Aperçus -, die seit den frühen 1970er Jahren für Zeitungen und Zeitschriften entstanden sind. Sieht man von den "Achtzehn Begegnungen" im Band Das Turnier der Bleistiftritter (2003) ab, liegen diese Texte erstmals in Buchform vor. Eine Vielzahl der Reden erscheint hier überhaupt zum ersten Mal in Buchform. Die vier Abteilungen bieten daher einen tiefen Einblick in das erweiterte Schaffen von Klaus Merz. Selbst da, wo der Schriftsteller scheinbar journalistische Gefäße bedient, bleibt er seiner literarischen Diktion treu. Gleichwohl zeigt sich Merz in den Feuilletons auch als ein Autor, der sich auf das aktuelle Zeitgeschehen einlässt und den Menschen und Ereignissen um sich herum nicht nur poetisch, sondern stets auch politisch und mit Witz begegnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HAYMONverlag
Klaus Merz
Der Mannmit der TüroderVom Nutzendes Unnützen
Feuilletons
WerkausgabeBand 4
Herausgegeben von Markus Bundi
© 2013
HAYMONverlag
Innsbruck-Wien
www.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
ISBN 978-3-7099-3722-8
Buchgestaltung und Satz:
hoeretzeder grafische gestaltung, Scheffau/Tirol
Umschlaggestaltung:
hoeretzeder grafische gestaltung, Scheffau/Tirol, nach einem Entwurf und unter Verwendung einer Zeichnung von Heinz Egger
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
Inhalt
Aufsätze
Fassade des eingeübten Anstandes
„Bereitschaftsdienst“
Jeder Mensch trägt einen Kopf auf seinen Schultern
Von dort nach hier
Das Ende der Bescheidenheit
Hut ab
Ein Himmel voller Geigen
Der Begleiter
Vom Auftrag der Farben
Man muss nicht immer alles zeigen
Kino auf dem Lande
Beinahe übersieht man ihn
So weit ich sehe
Addio, R.
„Wer unter Kronen geht, geht über Wurzeln“
Auf dem Weg nach Sardes
Zwischen Ochs und Öchsle
Ein Augenschein
Ich kann nicht schwören
Mein Aarau
Die Grüße stecken im Kopfsalat. Eine Nachbarschaft
Raum aus Wald
Stiller Has
Auf die Welt gekommen
Schlossnah
Zeigen und verweigern
Was den Menschen ausmache
Zwischen Schwarzenbach und Erlosen
O, die See!
Das Turnier der Bleistiftritter
Leises Trommeln auf dem Schirm
In Orika
Was zu leben wäre, wäre erlebt
Abend an der Reuss
Vom Hängen im Netz oder The Postman always rings twice
Fernes Wummern
Die Köpfe schiffbar machen
Kolumnen
Globi oder das Ende des Alphabets
Schwarze Magie?!
Zweite Lesung
Aufgelesen und notiert
Vom Salz im Meer
Notvorrat
In Frieden abschreiben dürfen
Nord-Süd-Dialog der Chaoten
Rumpelstilz & Co.
Am Anfang ist das Wort
Der Himmel ist grün
Souvenirs
Der Kandidat
Friede dem Gehörgang!
Indian Rubber
Der fiebernde Holländer
Der Nutznießer
Jenseits von Eden
Ich bin ein Hydrant, Madame
Im Vorübergehen 1–15
Das Gras wächst. Leise, hörbar.
Die Mäuse des Mittelstands. Ein Nachtrag
Von dort nach hier. Ein Brief
Kartenglück oder Wir nützlichen Idioten
Der Mann mit der Tür
Wut oder Die Sehnsucht nach Heimat und Glück
Vom Ende der gesprenkelten Schweiz
Bart ab oder Unsere Tour d’Horizon
Fieber herrscht! Eine Enttarnung
Von der Intelligenz der Stoffe
Die Arbeit am Kopf
Schlipsholdervalue: Die Dauerposse
Vorhang auf! Ein Nachtrag
Die Lastwagen & Unterhosen AG
Tag, Zeile! Ein Lob
Krieg & Frieden
In unser Hosensacklexikon
Lotto!
Daheim und daneben
Vorschuss am Äquator
Dunkel, heller, der 15. Mai
Don Quijote & die Windenergie
Heimatkunde. Zwei Empfehlungen
Kälte, Madonnen, Singen & Schnee
Die schwarzen Brüder 1–3
Das Glück beim WORTE machen
Vom Ab- und Zunehmen der Ohren
Reden
Wie erlebe ich Arbeit – warum arbeite ich?
Flugpost nach Leibstadt
Fährten legen
Nachruf auf meinen Vater
Zwischen Stühlen und Bänken
Ein schönes Erschrecken
Nah am Gebirg
Barfuß im Schnee
Schlussbild
Klima Kultur, gezappt
Der europäische Gedanke in der Literatur
Um die Ecken herum
Eulen fürs Rämibühl
Drei Wünsche
Näheres darüber will ich verschweigen
Ortstermin
Das Elementarwohl
Zwiesprache halten
Die sagbare Welt
65 Jahre Michael Forcher – 25 Jahre Haymon Verlag
Im Paralleltal
Kurze Vorrede zur Lesung vor den versammelten Gemeindeschreibern
Rothmans blau
Bleibe bei uns, denn es will Abend werden
Vom Nutzen des Unnützen
Ein Zwischenruf
Darmstädter Predigt
In Hölderlins Diensten
Aperçus
Der Kunde
Klaus Merz über sich selbst
Der Existenzialist auf dem Dorfe
Ronny Geisser ist tot
Countdown
Die Baumschule
Live aus Veltheim – eine Mitschrift on stage
In Christo Namen
VerSATZstücke
Ver(n)einte Nationen?
Wenig von allem – Kein Jurybericht
Die Zwietracht
Wieder die alten Feindbilder aus der Schublade
Fischbachs Weihnacht
Nachlass
Schneller kann man nicht reisen
Ohro-Pax
Die Schärfe der Unschärfe
Der Ruf der Wörter
Leonardo unter den Schnorrern
Hoher Mittag
Gruppe Olten 2002
Solothurn retour
Eine Seele, zwei Sprachen
Farbstifter Fedier
Adagio
Alphabet
Nebelhornisten
Der Blocher
En passant
Der lange Marsch
Kulturprovinz oder Provinzkultur?
Klingender Homberg
Zehn Grasnarben. Zur Wahl
Leises Beben
Die Kultur der Kritik – ein kurzes PoLem
Winterfahrplan
Editorische Notiz
Klaus Merz
Literaturnachweis
Aufsätze
Fassade des eingeübten Anstandes
Zum Film „L’Invitation“ von Claude Goretta
Im Vorspann dieses bedeutenden Schweizer Filmes sieht der Zuschauer in den engen grünblauen Glaskäfig eines Büroraumes hinein. Da sitzen die erste Sekretärin, die alles Klassische liebt, der rechtschaffene und altgediente Lamel, dem die Armee und ihre Werte heilig sind, neben Marmet, dem Vater und Ehemann, der nebst seiner Arbeit, die er gewissenhaft erledigt, in jeder freien Minute mit seiner Frau, der Mutter seiner Kinder, telefoniert. Da ist das liebenswürdig gealterte Fräulein Debonveau und die verliebte Hélène, die manchmal allzu eifersüchtig wird auf die kleine, noch mädchenhafte Lehrtochter Aline, wenn sich Maurice, der Spaßmacher im Büro, zu sehr mit ihr abgibt. Es bleibt noch Rémy Placet, der scheue Junggeselle, der von Michel Robin ergreifend dargestellt wird. Allein in seiner Vitrine sitzt der Chef und hält seine „Familie“ im Auge.
Um zwölf Uhr mittags verlassen Lamel, der Souschef, und sein Vorgesetzter als letzte ihr Schiff. Nur der Junggeselle bleibt. Er holt sich seinen Transistor hervor, wählt ein klassisches Programm, isst die mitgebrachten Salate und blättert daneben in einem großen alten Pflanzenbuch. Rémy liebt Blumen.
Abends empfängt ihn seine ergraute Mamma, eine feine, zerbrechliche Dame, die Rémy auf sein immerzu etwas verlegenes und unbeholfenes Gesicht küsst. Sie essen zusammen in ihrem Gärtchen, das rundherum von riesigen Wohnblöcken umstellt ist, und Rémy hilft beim Zusammenlegen der Leintücher. Er pflegt seine Blumen und zeigt sie Mamma.
Es zeugt von Gorettas Kunst, die nie im bloß Verstandesmäßigen steckenbleibt, wenn er diese Szenen, die allzu leicht ins Lächerliche abgleiten könnten, mit einer innerlichen Präzision auf die Leinwand bringt, die den beiden zurückgezogen lebenden Menschen einzig gerecht wird.
Als Rémys Mutter stirbt, bricht dieser zusammen und muss während zweier Monate seiner Arbeit im Büro fernbleiben. Zwischen Blumen, die er begießt, taucht er wieder auf: am Grab seiner Mutter, die nicht zu ersetzen ist.
Im Büro läuft das Leben auch ohne Rémy weiter, bis das Lehrmädchen die Einladungen verteilt: „Herr Rémy Placet lädt in sein neues Haus ein.“ Man freut sich darüber, obwohl es ungewohnt ist. Einzig der sture Lamel zerreißt sein Schreiben. „Aufschneider“, sagt er, findet sich aber dennoch ein, als seine Kollegen am Samstagnachmittag im Park vor Rémys Landhaus stehen und staunen. Man hat den Landsitz gegen das Häuschen in der Stadt abgetauscht und noch eine kleine Summe dazugegeben. Rémy kann eigentlich nichts dafür. „Er hat eine gewisse Klasse“, sagt Hélène zu Aline. Lamel beginnt nachzurechnen und ist verärgert über so viel Glück, das einem anderen in den Schoss fiel. Der Familienvater, der mit einem VW-Bus vorgefahren ist, beginnt rasch einmal mit Schritten auszumessen, wie viel Platz ihm hier für seine Kinder zur Verfügung stehen würde. Er erkundigt sich nach dem Standort des Telefons, um seiner Frau laufend Bericht erstatten zu können. Der Chef hält ungern, aber mit Bravour, eine kleine Rede, und Rémy dankt, ist gerührt und freut sich, dass alle zu ihm gekommen sind, die ganze „Gemeinschaft“, der er seit zwanzig Jahren auch angehört. Maurice, der Possenreißer, reißt seine Possen und jagt seine zwei Freundinnen, die große und die kleine, durch den Park und später sogar in die Büsche. Er versteht sich auch ausgezeichnet mit Emile, dem virtuosen Diener, dargestellt von François Simon. In der weißen, goldbeknöpften Jacke mit den passenden Handschuhen dazu mixt er souverän und nach einem eigenen Rezept, das er von weither mitgebracht hat, den starken Trunk für heiße Tage. Er steigt in die Spiele ein, zu denen der Spaßmacher aufruft, entzieht sich ihnen aber immer wieder, um weitere Getränke und Gebäck auszutragen, seines Amtes zu walten.
Rémys Glückseligkeit nimmt zu. Es wird sogar getanzt. Lamel dreht das ältere Fräulein, das zu viel von Emiles Trank zu sich genommen hat, beinahe bis zur Bewusstlosigkeit, so dass es sich zurückziehen muss und sich im Badezimmer einschließt, um wieder zu sich zu kommen. Der Chef gesteht in einer rührseligen Minute unter Männern und unter dem Einfluss des reichlich fließenden Alkohols, dass auch er sich seit Jahren sein kleines Leben eingerichtet hat, ebenfalls ein wenig Abwechslung braucht, eine Geliebte hat, die seine Gewohnheiten kennt.
Emile serviert den Champagner, den der Chef in der Hollywoodschaukel, die Hand auf dem Knie seiner ersten Sekretärin, zu sich nimmt. Er wird von Aline, seinem Lehrmädchen, aufgescheucht, während Maurice seiner großen Freundin hinter einem Baum die Perücke vom Kopf streift. Die Anzeichen mehren sich, dass es so nicht mehr lange weitergehen kann. Dennoch finden sich noch einmal alle zusammen, trinken, scherzen, verletzen einander. Das Stück Rasen, auf dem sie stehen, scheint sich immer schneller zu drehen, bis das Lehrmädchen als erstes aus den Fugen gerät, auf einen Stuhl steht und sich in einer gekonnten, tragikomischen Szene auszieht. Aber es ist nicht ihr Körper, den sie entblößt, sondern die gespielte, geheuchelte Würde dieser, unserer Gesellschaft. Die Fassade des eingeübten Anstandes bricht zusammen.
Vor so viel sichtbarer Unschamhaftigkeit geraten Lamel und sein Chef als Hüter der Ordnung vom Dienst außer sich. Das Mädchen flieht weinend in dieselbe Toilette, die vor ihm das ältere Fräulein schon aufgesucht hat. Im Garten spitzt sich der Disput zwischen Lamel und dem Spaßmacher zu. Lamel holt zu einem Faustschlag aus, Maurice duckt sich, gewandt wie immer, getroffen aber wird Rémy, der bewusstlos zu Boden fällt. Er liegt da wie zwei Monate zuvor, als ihm der Tod seiner Mutter mitgeteilt wurde. Lamel aber hat denjenigen getroffen, den er im Grunde meinte, diesen Toren, der keine Ahnung vom Geld hat, der sie mit seinem Reichtum beschämt, der eine solche Zusammenkunft außerhalb des gewohnten Rahmens einzuberufen wagte.
Als Rémy erwacht, fühlt er sich schuldig. Er erkennt, dass er nicht hätte einladen dürfen. Er möchte wieder allein sein, bittet seine Gäste zu gehen. Diese ziehen sich nacheinander zurück, verlassen dieses sinkende Schiff nun nicht mehr in hierarchischer Reihenfolge wie mittags und abends ihren Arbeitsplatz. Emile bleibt. Aber nicht für lange, denn er sei ein „Reisender“, erklärt er, als ihn Rémy Placet bittet, bei ihm zu bleiben.
Emile ist einer, der nur auftritt, um ab und zu die Getränke zu mischen, denen die Eingesessenen, die Sesshaften und „Rechtschaffenen“ nicht gewachsen sind. Einzig Rémy und das Lehrmädchen sowie das ältliche Fräulein Debonveau haben noch die Fähigkeit zusammenzubrechen: Zusammenbruch, der den Aufbruch und Ausbruch miteinschließen könnte. Alle andern ziehen sich in ihren schalldichten Glaskasten zurück: Am Montag ist die Welt wieder in Ordnung, ist Aline durch ein neues Lehrmädchen ersetzt.
Mit „L’Invitation“ ist es dem Westschweizer Claude Goretta gelungen, einen Film zu machen, der trifft, weil er zutiefst real ist. Es sind keine Stars, die auf der Leinwand agieren, es sind Leute einer „Bürogemeinschaft“, die der Regisseur hereinholt. Es ist keine Ideologie, auf die sich der Film abstützt, sondern zwingende Wirklichkeit, die von den Bildern her lebt und es nicht nötig hat, verbalisiert zu werden. Goretta leistet es sich sogar, einen Polizisten am Rande auftreten zu lassen, der nicht aussieht, wie Polizisten im Film auszusehen haben, der vielmehr einem Zahnarzt ähnlich sieht, wie einer der Gäste erstaunt feststellt. – Daneben darf viel gelacht werden in diesem Film, ausgelacht aber wird nie. – Ich wüsste nicht, was man von einem Film mehr verlangen könnte, der zudem mit einfachen Mitteln und in kurzer Zeit abgedreht werden musste.
„Bereitschaftsdienst“
Zu Hans Erich Nossack
„Diese Nicht-Erklärbarkeit, dies völlig Fehlen einer Begründung, ist das Erschreckendste an allem.“
„ …es kann ja irgendein Satz gefallen sein, ein ganz nebensächlicher Satz, der alles zum Einstürzen bringt.“
„ …ich meine damit, dass ich mich plötzlich ‚außerhalb‘ befand. Ich dachte zuerst, das geht vorüber, das ist nur eine Folge des Erlebnisses, du wirst schon darüber hinwegkommen.“
„Du musst so reden und musst dich so geben wie alle, dann fällst du nicht auf und gehörst zu ihnen, denn schließlich sind sie doch die Normalen, nach denen die Welt reguliert wird.“
Diese Sätze sagt der Chronist, Chemiker von Beruf, in Hans Erich Nossacks Bericht über eine Epidemie, der vor einiger Zeit unter dem Titel „Bereitschaftsdienst“ im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Es sind Kernsätze Nossackscher Prägung. Ähnliche Zeilen findet man auch in seinen früheren Werken, das stimmt, aber man kann solche Sätze nicht genug sagen und kauen:
„Nicht um das völlige Versagen aller Wissenschaftszweige geht es, von Politik, Gesellschaftsordnung und dem, was Ideologie genannt wird, gar nicht zu reden. Die Menschen nehmen das alles nicht so wichtig, wie die Funktionäre es sich einbilden, sie machen nur mit, um sich keinen Komplikationen auszusetzen. Nein, es geht darum zu verschweigen, dass einen Millimeter neben der Wirklichkeit das Nichts beginnt.“
Wie eine unaufhaltbare Seuche greift die Selbstmordwelle zu Beginn der siebziger Jahre in der westlichen Welt um sich, und es scheint, dass auch der durch Mauern und „todsichere“ Ideologien abgeschirmte Osten nicht davon verschont bleibt. Der Droge vergleichbar, fallen ihr vor allem junge Menschen zu Tausenden zum Opfer. Man spricht von einer Katastrophe aus heiterem Himmel. Ratlosigkeit herrscht überall dort, wo nicht schon Geschäfte gewittert werden: Die Chemie wirft massenhaft neue Mittelchen auf den Markt, die reißenden Absatz finden; biologisch gedüngtes Gemüse steht hoch im Kurs.
Nossack lässt den Chronisten zeitlichen Abstand nehmen; sein Bericht wird zu einem möglichst vollständigen und gelassenen Rückblick auf jene, unsere jetzige Zeit. Es wird alles angetippt, was uns bewegt, abstößt oder verwirrt: Mondflug und Jesus-Leute, Tiefkühlkost und Sexwelle, ‚Näher, mein Gott, zu dir‘ und die Internationale, Marxismus und das Leiden als absolute Privatsache. Es sind auf den ersten Blick flüchtige Bilanzen, die Nossack aus einer Anhäufung von Materialien unserer Zeit zieht, die aber gerade dadurch, dass er seine Einsichten als unverbindlich erklärt, für den Leser umso verbindlicher werden. Nossack will nie überzeugen, er ist einer von denen, die noch mit gekonntem Erzählen auskommen, um den Leser betroffen zu machen.
Hinter diesen „interessanten“, aktuellen Blitzlichtern steht aber die Geschichte des Chronisten, eines Heutigen. Er hat während der Epidemie als Freiwilliger dem Bereitschaftsdienst angehört. Auftrag dieser Equipen ist es gewesen, die Toten möglichst rasch wegzuschaffen und je nach gewählter Todesart die Umgebung wieder sauber zu machen. Er ist also „nahe daran“ gewesen, näher als die meisten andern, besonders dann, als seine Frau mit ihren beiden Kindern, nachdem sie den Tisch für das Frühstück schon gedeckt hat, den Gashahn aufdreht und jede Hilfe für sie zu spät kommt. Es lässt ihm deshalb keine Ruhe, wenigstens festzuhalten, was damals war, einige Versuche von Erklärungen anzustellen über die Zeit der großen Ratlosigkeit, die vielleicht noch gar nie aufgehört hat und gar nie aufhören wird, da der Kern der Verwirrung tiefer zu liegen scheint: in der Anlage des Menschen, in den menschlichen Bedingungen.
Nossack weiß das, wusste es schon früh, der Chronist aber verschweigt die klare Antwort, vielleicht, weil er die Hoffnung auf einen Ausweg nicht zerstören will, den Ausweg zum Beispiel, den Nossacks Figuren immer gehen: nach außerhalb. Dort ist auch in diesem Buch der Standort des Berichtenden, er ist einer der wenigen, ein Grenzgänger, „ein Remigrant“, wie es im vorletzten Buch „Die gestohlene Melodie“ hieß. Bei dieser Standortwahl fährt die Wirklichkeit zurück, ihr Gewicht wird relativ oder zumindest fragwürdig, aber immerhin ertragbar. Von da her stellt Nossack seine verhaltenen Fragen und gibt die für ihn gültigen Antworten zum möglichen Gebrauch frei.
Jeder Mensch trägt einen Kopf auf seinen Schultern*
Eine Mitschrift zum Burgdorfer
Bildhauer-Symposion 1986
Anreise. „Alarm! Schon 25 Prozent mehr Verkehrstote als im Vorjahr.“ Die Zeitung mit der roten Schlagzeile, die mein Gegenüber in den Händen hält, verspricht einen ausführlichen Hintergrundsbericht zum Thema. Vor den Zugsfenstern drehen Silberpappeln die metallene Unterseite ihrer Blätter in den Wind. Es steht ein Gewitter an. Herzogenbuchsee liegt schon hinter uns.
Zum Thema „Mensch“ soll in Burgdorf ab morgen gearbeitet werden. In Holz. In Stein. In Eisen ... Und morgen werden auch unsere Kinder auf ihren Fahrrädern wieder zur Schule fahren. Sie sind beide nicht aus Stahl.
Der Ort. Am ersten Abend stehen noch Zelt und Tross des Zirkus Knie auf der Schützenmatte. – Am liebsten rieche ich die Elefanten. Sie haben im Laufe meines Lebens nichts von ihrer Größe eingebüßt. Das Zirkuszelt hingegen ist in meiner Wahrnehmung schon wieder um ein Jahr kleiner geworden. – Dann werden im Bereich der alten Bäume die Arbeitsplätze für die Bildhauer gezeigt: Hier also, am FUSS der Flühe. Nach den Elefanten der „sekundäre Nesthocker Mensch“.
„Er ist in seinem Leben nie vollendet und heil, sondern auf dem Weg zu sich selbst. Und auf diesem Weg gefährdet und verführbar an Leib und Seele. Er ist auch nicht absolut frei, sondern bleibt hingewiesen auf die Natur und gebunden an seine eigenen natürlichen Voraussetzungen“ (Der Große Herder, 1956).
Knochen. Stirnbein Oberkiefer Unterkiefer Halswirbelsäule Schlüsselbein Oberarm Elle Speiche Handwurzelknochen Mittelhandknochen Fingerknochen Brustbein Lendenwirbelsäule Darmbein Kreuzbein Steißbein Schambein Sitzbein Oberschenkelknochen Schienbein Wadenbein Sprunggelenk Fußwurzelknochen Mittelfußknochen Zehen.
Traum. Schon am siebenten Abend sehe ich die hölzerne Frau mit dem Boot unter den Flühen landen. In hüfthohen Gummistiefeln steht ein Angler in der Mitte des Flusses und befischt das jenseitige Ufer. Er nimmt keine Notiz von der Frau.
„Cannabis legalis“ liest sie unweit der Anlegestelle auf einem hölzernen Rettungsring. Aber die Frau versteht kein Latein. Sie folgt dem Gesang eines steinernen Torsos, den Staccati-Schlägen des Fäustels, der ihn mit dem Zahneisen bearbeitet, tritt auf die Wiese hinaus.
Ein Saxophon fällt unverhofft ein. Die eingenickten Heeres-Polizisten mit den orangeroten Bruststreifen schrecken auf unter dem Spitzahorn, sie beginnen den Achtzehnuhrverkehr zu regeln, und der Bildhauer lässt seinen Fäustel sinken, während in der Oberstadt kurz vor Ladenschluss ein alter Bauer mit grünem Rucksack in die Eisenwarenhandlung tritt.
Ob er schon den Herbst von der „Lüdern“ herab mit sich bringe, fragt der Eisenhändler, der frostig hinter seiner Registrierkasse steht. Der Bauer bewegt seinen Kopf in eine unklare Zwischenrichtung und zieht ein Metzgermesser aus der Seitentasche. Er will nur den Griff ersetzen lassen, bevor es schneit.
Muskeln. Stirnmuskel Augenringmuskel Jochbeinmuskel Mundringmuskel Kopfnicker Kapuzenmuskel Deltamuskel Brustmuskel Sägemuskel Armmuskel (Bizeps) Bauchmuskel (Rektus) Schneidermuskel Schenkelmuskel Wadenmuskel Schienbeinmuskel.
Abwesenheit. Ein Madiswiler und ein Thöriger sollen laut Berner Zeitung vom 20. August 1986 endgültig als verschollen erklärt werden. In der Zeitung fällt die große Fotografie mit der weißen, ausgesparten Silhouette einer menschlichen Gestalt in die Augen, die auf einen Mischwald zuhält. Ein Mann mit Hut und Regenschirm geht seines Weges, direkt ins Büd hinein. – Ein Wandervogel. Ein Robert Walser-Gänger. Fitzcarraldo? – Nein, Gottfried Hermann Ledermann aus Madiswil und der Thöriger Hans Howald, geboren am 14. November 1887, beziehungsweise 18. Juli. 1893. Sie gehen Richtung Wald. Und verschellen.
Die Gestalt des Menschen. „Schlank werden, schlank bleiben. Bei drei reichhaltigen Mahlzeiten täglich. – Sie wissen ja, gemeinsam geht’s leichter! – In einer Weight-Watchers-Gruppe findet man die richtige Hilfe und Unterstützung. Mit jahrzehntelanger internationaler Erfahrung.“
„Das Gewicht der Welt“. – Jeden Mittwoch im Restaurant Schützenhaus, erster Stock.
Rondo. „Hier liegt das Vergängliche von Samuel Buri/Gebohren am 19. December 1784 / Gestorben am 15. August 1815 /Auf Wiedersehen Geliebter in der Ewigkeit“ (Grabplatte an der Südseite der Burgdorfer Stadtkirche).
Traum. Am zwölften Abend misst ein Einheimischer mit langen Schritten die Schützenmatte aus, er setzt Distanzmarken und schaut ab und zu zum Maulwurfshügel zurück, den sein Kamerad am unteren Ende des freien Feldes aufhäuft. Weitere Männer betreten jetzt die vermessene Ebene. Sie tragen überdimensionale Brotschieber auf den abendgrünen Platz und warten gefasst.
„Zieh mich heraus, zieh mich heraus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken“, meint die Frau mit dem Boot aus nördlicher Richtung rufen zu hören, da fliegt schon die erste schwarze Semmel durch die Luft. Die Männer schauen gebannt in den Himmel, bis der zuletzt Postierte seinen hölzernen Schieber nach dem Brötchen schießt, das wie ein toter Vogel auf die Erde stürzt.
„Hörnet. Hornissen“, erklärt der Saxophonist der Frau mit dem Boot. Er hält sie noch immer für eine Irländerin, die am Emmenstrand Schiffbruch erlitten hat, und er will ihr helfen. Da zitiert die Frau schnell einen gebürtigen Spanier**, der das Leben an sich als einen ständigen Schiffbruch bezeichnet habe. Schiffbrüchig sein, erklärt die Frau dem Musikanten, heiße aber noch lange nicht ertrinken. Das Gefühl des Schiffbruches, da es die Wahrheit des Lebens sei, bedeute im Gegenteil schon Rettung. Daher glaube sie, so gut wie der erwähnte Spanier, einzig an die Gedanken von Scheiternden.
„NussNussNuss“, beginnen die Männer auf der Wiese von neuem zu locken. Und der Saxophonist gibt sich der Frau seinerseits in einer langen, schwermütigen Kadenz zu erkennen. Er spielt, bis die Hornusser ihre Distanzmarken einsammeln und die Frau ihn einlädt, die zwölfte Nacht im Boot zu verbringen.
Das Pfand. Im Lauf der vergangenen Nacht ein schönes Gedicht geschrieben, das zwei sanfte Ausbuchtungen im weißlichen Wortkörper trägt. Wie Giacomettis frühe Plastiken oder neuere Arbeiten meines Freundes Ernst H. Man kann das Gedicht lesen und anfassen zugleich. Nur den Text habe ich ins Erwachen hinein zurücklassen müssen.
Eigenschaften. Arrogant Blind Cholerisch Depressiv Edel Fröhlich Gierig Hart Isoliert Kühn Lahm Munter Nobel Offen Perfide Quengelig Raffiniert Sündig Tot Ulkig Visionär Wund Xanthippisch Yeah-Yeah Zart
Holz anfassen. TA vom 21. 8. 86: „Dreifache Sprunggelenkfraktur am rechten FUSS, Brüche des linken Wadenbeines, beider Oberschenkel, des Beckens, des linken Schlüsselbeines und des rechten Schulterblattes. Verbrennungen am Hals, am linken Arm und an der linken Hand. Eine Nieren-Leber-Fehlfunktion und eine Schocklunge. Danach mehrere Operationen, Knochenverpflanzungen, Hauttransplantationen und dreimaliges Auswechseln des Eigenblutes. Dreieinhalb Wochen wurde der Patient in Deutschland im Koma gehalten, künstlich beatmet, künstlich ernährt. Erst nach einem Monat war der Transport ins Berner Inselspital möglich. Seit anderthalb Wochen ist Surer wieder zu Hause.“
Horrorbilder vom Unfall seien keine zurückgeblieben, sagt der Autorennfahrer, er müsse jetzt schauen, ob es ihn wieder jucke und ob er, falls er wieder Rennen fahre, keine Angst vor Bäumen habe.
Ora. Die Stunde der Geburt des Glücks der Bewährung der Gnade des Verrats des Widerstands der Erkenntnis des Wolfes der Liebe des Kampfes der Versuchung des Abschieds der Wiederkehr des Feuers der Häscher des Grauens der Götzen der Wahrheit der Freundschaft der Wandlung des Wildes des Weines der Lust und des Todes.
* Every Man Wears a Head on His Shoulder: Titel einer Bilderreihe von Ana Maria Pacheco
** Ortega y Gasset, 1934
Von dort nach hier
Lawrence Lee sitzt mit verschränkten Beinen auf dem Küchenstuhl. Er greift immer wieder nach seinen beiden großen Zehen, denkt nach, versucht seine Erinnerungen genau zu orten, bevor er zu erzählen beginnt.
Vor Jahren ist er aus Borneo nach Europa herübergekommen. Als Kind sind ihm auf der fernen Insel unter englischer Herrschaft die hiesigen Jahreszeiten gründlich beigebracht worden, obwohl es bei ihm zu Hause nie schneite: Kolonisierung bis in die kleinsten Köpfe hinein. Eines Tages wollte er, unter anderem, den Schnee sehen und verließ die Insel. In unregelmäßigen Abständen taucht er in unserer Gegend immer wieder auf, lächelnd, warmherzig, radebrechend auf eine eigenartig präzise Weise: Künstler und Lebenskünstler Lee, mehr Reisender als Emigrant, auch mit festem Wohnsitz immer noch unterwegs nach einem anderen, eigenen Innenland.
Er ist in den vergangenen Jahren kein Europäer geworden, und unser Schweizer Schnee hat ihn nicht kalt gemacht. Er pfeift seine Lieder weiterhin von einer unsichtbaren Kokospalme herab, lässt auf seinem Weg raus, was raus muss: kleinste Skizzen, Collagen, Riesenbilder, Wortgebilde, darauf steht er, denke ich, das ist sein eigentlicher Boden unter den Füßen. Der Ort heißt „Lee-Land“.
Seit einigen Jahren wohnt er mit seiner Lebensgefährtin Maria in einem angebauten Einfamilienhaus in der Nordschweiz. Beide haben sie aus ihren früheren Ehen zum Teil schon erwachsene Kinder, und sie erzählen gerne von ihnen, zeigen Bilder. Vom Vorgärtchen scheint grünes Licht in die Küche herein, Lee pflegt seine Heilkräuter und einen kleinen Urwald vor den Fenstern. Alles sprießt. Eine Zeitlang arbeitete er in einem Durchgangszentrum für Asylbewerber. Ich denke, dass er dort mehr als nur Übersetzerdienste leisten konnte. Daneben setzt er seine bildnerische Lebensart, Lebenskunst, kontinuierlich fort, zum Beispiel die Arbeit an einem großformatigen Bild, das die Wand eines ganzen Zimmers abdeckt. Ab und zu knurrt Duchamp, der (treue) Hund.
„Ich habe eine Kindheit in mir“, sagt Lee unvermittelt und beginnt jetzt von weit hinten her zu erzählen, begibt sich noch einmal auf seine Reise, die ihn schließlich hierher geführt hat:
„In Borneo lebten wir ganz anders – so viele Sprachen, verschiedene Rassen, Kulturen, Glaubensbekenntnisse –, man musste einander akzeptieren, sich integrieren, da war nicht alles so säuberlich voneinander getrennt, wie ich es hier oft erlebe.
Mein Vater arbeitete bei Shell. Wir sind oft dem Öl nachgereist, ähnlich wie hier die Fremdarbeiter. Zuerst ging der Vater, er holte uns dann nach. Ich besuchte englische Schulen, weil meine Eltern überzeugt waren, dass das für mein Fortkommen besser sein würde als eine chinesische Ausbildung. Europa, die roten Menschen, wie wir sagten, die mit den roten Haaren, weißt du, das war ein Begriff. Vor den Japanern hatten wir Angst, weil sie während des Zweiten Weltkrieges unser Land besetzt und sinnlos zerstört hatten. Überhaupt verschissen, der Krieg, er macht alles kaputt. Die Europäer akzeptierten wir, nur die rassistische Seite der Rothaarigen mit Villa und Dienerschaft, das machte uns Mühe, die Klassenstruktur.
Den ersten roten Mann lernte ich persönlich mit zwölf Jahren kennen. Er hatte an meiner Briefmarkensammlung Interesse und war der Chef meines Vaters, ein Holländer. Ich schenkte ihm meine Briefmarken, weil ich Freude daran hatte, dass er als Weißer in ein asiatisches Haus gekommen war, ein Ereignis! In der Schule lernten wir aus englischen Schulbüchern, aber erst viel später in Paris sah ich zum erstenmal Schnee, ich hatte wahnsinnig Freude daran, schaute fasziniert zu, wie er in meiner Hand schmolz, und ich fror.
Ich riss zu Hause aus, weil es so viele Spannungen gab innerhalb der Familie. Ich kam mir einfach so in die Welt gestellt vor, hoppla, fühlte mich auch für alle und alles zu sehr verantwortlich: Ich musste mich selber suchen gehen.
Mit achtzehn Jahren war ich dank meiner Sekundarschulbildung schon als Bauführer tätig – verrückt! Eine Schule und ein Spital wurden gebaut, auch da hatte ich mich übernommen. Eines Abends kam ich betrunken nach Hause, eine Zigarette im Mundwinkel. Vater schlug mich und stellte meine Sachen vors Haus. In seinem Haus werde nicht getrunken und nicht geraucht, basta. Es war mir damals nicht bewusst, dass ja Vaters Vater, ein guter Architekt, sein ganzes Geld versoffen und verspielt hatte, das ist mir erst später wieder in den Sinn gekommen. Man benötigt ja ein ganzes Leben, um das Leben zu begreifen.
Ich wollte heimlich weg, Christmas Island, die Weihnachtsinsel, der Name zog mich an, die Isolation, und weg von allem. Ich habe schon immer gesucht – in der Literatur, sogar in juristischen Büchern, und Tag für Tag. Schließlich landete ich auf einer anderen kleinen Insel im Norden Borneos und versuchte dort, die Matura zu machen und gleichzeitig zu arbeiten: Import-Export; ich wurde Angestellter der Borneo Company Limited. Ihr Hauptquartier lag in London. Ich stellte Zolldeklarationen aus für Waren aus Europa: Rolex- und Omega-Uhren, Dunkelbier, Motorräder usw. Alles kam über London, auch Nescafé und Milchpulver. Von der Schweiz hatte ich keine Vorstellung, und ob es Italien oder Deutschland tatsächlich gibt, das wusste ich eigentlich nicht, headquarter London, das war der Inbegriff von Europa.
Vieles kam auch direkt aus Amerika. Ich lernte in den Jahren amerikanischen Volkstanz. Die größere Furcht vor den Japanern machte die Präsenz des Euroamerikanischen, das langsam von uns verinnerlicht wurde, erträglicher, bis in die Religion hinein: Lawrence ist mein christlicher Name, Lee mein Familienname. Mit zehn Jahren ging ich zur heiligen Kommunion und besuchte lateinische Messen – Dominus vobiscum! Aber dieser Import-Export behagte mir auf die Länge nicht, deshalb entschied ich mich, selber in die Welt hinauszugehen, ohne genau zu wissen, wo diese eigentlich war.
Ich gab alles weg und reiste nach Singapur zu Verwandten. Meine Mutter weinte an der Straße, ich verweigerte Vater den Abschied. Ich war jung. Trotzdem unterstützten sie mich immer wieder auf der Reise. Zum Glück. 1966 war das. Ein Regenschutz, etwas Geld und ein Stock, wie wir ihn wegen der Schlangen mit uns trugen, das war meine Ausrüstung.
Ich stellte bald fest, dass ich gut unterwegs sein konnte. Thailand. Burma. Indien. In Delhi kam ich für ein Weilchen bei Studenten unter. Aber eigentlich schaute ich die Welt gar nicht an, es zog mich etwas fort, die Welt selber war so selbstverständlich. Ich war am ‚Gehen‘ interessiert, dazu kam das tägliche Leben.
Das schönste Gefühl hatte ich am Khaiberpass in Afghanistan. Ein spezielles, kühles Gefühl. Ich saß mit vielen anderen Menschen auf dem Dach eines vollgestopften Busses, manchmal war es, als säßen wir auf dem Dach der Welt. Ich war sehr überrascht, dass körperlich so große Menschen so fein sein konnten miteinander, auch zu mir. Große Menschen waren bis anhin immer Rothaarmenschen gewesen. Am Khaiberpass merkte ich, dass auch große, schwere Menschen nicht unbedingt herrisch und grob und aggressiv sein müssen. Wirklich, das waren schöne, feine Leute. – Hier begann ich zu malen. Ich weiß wenig von Kunstgeschichte, aber ich glaube, mein Gefühl stimmt.
In Kuwait stieß ich auf einen kleinen, geschäftigen Argentinier. In meinen schmutzigen Hosen stieg ich wieder für ein Weilchen in den Import-Export ein. Von Fleisch. Für große Hotels. Steaks aus Argentinien fürs Hilton. Aber viel wichtiger war, dass mir in Kuwait der erste Brite, ein junger Engländer, das Gefühl gab, die Weißen seien wie wir: Menschen.
Von der Türkei habe ich eine Art ‚Brotgefühl‘, die Leute sind sehr warm, wie das Geröstete am Brot, ja – aber in Istanbul schlug diese schöne Atmosphäre gnadenlos um, ich kam auf den Boden. Es waren so viele Drogenleute da, junge Schweizer, Engländer, Amerikaner, auch sie zum Teil weggerannt von zu Hause wie ich, aber in eine andere Richtung, die Flüchtlinge aus dem Hauptquartier prallten hier mit mir zusammen. Wir schliefen unter einem großen Zeltdach, das ein Hotelier aufgespannt hatte, über hundert junge Leute, die haschten und schachtelweise Romila, ein Hustenmittel, fraßen, um abzuheben. Einer starb vor meinen Augen. Ich wollte ihn noch massieren, zum Erbrechen bringen, aber einer, der für ein wenig Ordnung zu sorgen hatte, zerrte ihn mit sich, mit dem sei es fertig, sagte er. Unter diesem Zeltdach verzweifelte ich fast an diesen jungen weißen Menschen und an dem, was sie hierher getrieben hatte. Was war das? Ich trug auch zehn Ringe an den Fingern, schöne Ringe, aber das Kaputte macht dich selber auch kaputt. Dabei waren viele doch wie ich auf einer innerlichen Suche, nur scheiterten sie zum Teil – in Istanbul. Das ist der Punkt.
Für mich hat Europa erst mit Italien angefangen, mit Süditalien. Ich war erstaunt über die unerwartete Armut der Europäer, denn die Häuser standen so eng beisammen, gar nicht wie es in den englischen Schulbüchern gestanden hatte: große Häuser und Parks rundherum, Teestunden unter alten Bäumen.
In Rom auf dem Petersplatz habe ich in meiner Malerei zum erstenmal die Tropfenform verwendet, eine geschlossene, embryonale Form, sie war einfach plötzlich da und taucht seither immer wieder auf in meinen Bildern. Rom hat mich sehr fasziniert: die Renaissance. Aber ich empfand die Renaissance, im Gegensatz zu euch Europäern, nicht als vergangen. Für mich ist überhaupt immer alles Gegenwart. Ich kann nicht fünfhundert Jahre zurückschauen, wie ihr das könnt. Alles ist real. Alles existiert gleichzeitig, davon habe ich ein starkes Gefühl. Der Europäer geht immer vorwärts und lässt die verbrauchte Zeit hinter sich liegen. Für mich gehört alles zusammen.
Ich arbeitete in einem Durchgangszentrum für Asylbewerber, und da hat einer in einer Ecke den Hamlet gelesen. Mein ganzer Shakespeare von damals in Borneo war auf einen Schlag wieder da: To be or not to be. Ja … Schon in der sechsten Klasse lasen wir Golding, The Lord of the Flies. Ich war so überrascht, als ich vor ein paar Jahren hörte, dass Golding den Nobelpreis erhalten hatte – und wir in Borneo hatten ihn schon als Kinder gelesen: Das ist doch eine schöne Welt, wenn du denkst, dass jemand etwas schreibt, und es teilt sich so über Zeit- und Landesgrenzen hinaus jenen Menschen mit, die dafür Augen und Ohren haben, schwarze, weiße oder gelbe; das gehört auch alles zu meiner Realität. Trotzdem weiß ich, dass die Europäer das einem Farbigen nicht gern abnehmen und sagen: Du bist halt dennoch bloß eine farbige Kopie von uns, lieber Lee, du hast nichts Authentisches mehr an dir, bist europäisiert, aber kein Europäer, eine Ausgeburt von Eingeborenen, voilà! Leck mich, muss ich da oft denken, so ein shit, wohin soll ich denn gehen, wenn ich jetzt langsam älter werde und graue Haare bekomme? Dabei lebe ich doch nur einmal in dieser Welt, wer hat das Recht, mich zu disqualifizieren aufgrund meiner Herkunft, meiner Kindheit, meiner Vorstellung von der Welt als einer Menschenwelt? Ich bin immer wieder sehr durcheinander: Lee, bist du Asiate oder bist du hier? Wo ist deine Kindheit, der Ort, den du eigentlich gesucht hast? Das sind die Fragen.
In Paris lernte ich dann auf dem Seil gehen und jonglieren, Philippe Petit hat mir das beigebracht und mir Gedichte von Jacques Prévert vorgetragen mit Händen und Füßen. Von ihm habe ich viel gelernt, das musst du aufschreiben, ihn habe ich immer noch sehr gern, er ist ein berühmter Akrobat geworden, im Reader’s Digest las ich kürzlich über ihn. Er hatte eine spezielle Clownnase und war klein, ein bleiches Gesicht, eigentlich eine tragische Figur, er war nicht größer als ich. Aber sonst ist Frankreich für mich ein seltsames Land. Es geht nicht in mich hinein. In Paris begann ich mit der Bildhauerei, lebte eine Weile lang in einem maison des jeunes. Mit jungen Menschen bin ich immer und überall gut ausgekommen, sie haben weniger Vorurteile, was auch für jene ältere Dame zutrifft, die mir meine erste Holzplastik abkaufte.
Mon fils, sagte sie immer, und vor ein paar Tagen hat sie mir wieder geschrieben, mon fils, eine feine Frau. Ich verstand ihre Familienprobleme, weißt du, sie ist ja eine alte Französin mit château und Ferienhäusern hier und dort, aber sie ist trotzdem sehr lieb und einfach. Wirklich, mit ihr verstehe ich mich auch heute noch gut.
Hingegen hätte ich Van Goghs Bilder besser nicht kennengelernt damals. Das war so: Ich wollte über Belgien endlich einmal ins headquarter, nach London, aber die Belgier ließen mich nicht raus, da ich nicht so viel Geld auf mir trug, wie ich bei mir haben sollte. Klar, ich war ein Ausgeflippter, aber kein Hasch, nichts, ich wollte nur ins Mutterland einreisen, das war alles. Sie steckten mich ins Gefängnis, dort ritzte ich vor Wut Engel – in Tropfenform – in die Zellenwände. Es war das erstemal, dass ich von einem Rothaarmenschen geschlagen wurde. Zum Glück trug ich die Adresse eines Holländers bei mir. Die Polizei nahm mit ihm Kontakt auf, und er holte mich raus. Es war der ehemalige Chef meines Vaters bei Shell, dem ich als Zwölfjähriger meine Briefmarken geschenkt hatte. Crazy!
In Belgien stieß ich also auf Van Gogh, er ist ein kräftiger Teufel, zieht einen nicht durch die Oberfläche des Bildes an, nein, er zerrt einem das Innere heraus, das ist das Verrückte an ihm. Er hat mich magnetisiert. Ich reiste ihm nach in die Provence, half bei der Weinlese mit und malte wie besessen, auch als Straßenmaler. Eines Tages verbrannte ich alle meine Arbeiten. Ja, crazy, wenn dieser Dämon in dir hockt.“
Es läutet an der Haustür, Duchamp läuft bellend in den Flur. Maria redet mit einem Expressboten, kommt mit einem gelben Briefumschlag zurück.
„Das sind meine Pässe“, ruft Lee aus und holt zwei abgenützte, dunkelrote Büchlein heraus, keine Seite ohne Stempel, Daten, Unterschriften, Ortsbezeichnungen, er liest einzelne Namen von Ländern und Städten vor sich hin, als äße er Nüsse, kostet ihren Geschmack. Seine ehemalige Frau hat ihm die alten Pässe nachgeschickt, nachdem er kürzlich in Luxemburg seinen Geburtsschein verloren hatte. „Ohne Papiere bist du niemand, das weiß ich, glaub mir.“ Und jetzt treffen diese Unterlagen wie Belege zu Lees Erzählen ein. Er streckt mir seine abgegriffenen „Stationenbücher“ hin: Auf den ersten Seiten das Bild eines züchtigen jungen Mannes, ein dunkelblasser Gymnasiast mit Scheitel und schwarzer Hornbrille: Lawrence Lee aus Borneo, der Jahre später in Van Goghs Südfrankreich auf einen keine Angst mehr einflößenden Nachbarn aus Japan stößt. Dieser Freak mittleren Alters ist sozusagen mit einem Staatsauftrag in der Tasche durch die westliche Welt unterwegs: Er muss die Bilder Van Goghs kopieren und sie nach Hause zurückbringen. „Aber weißt du, der Japaner hatte in seinem eigenen Körper viel mehr Feuer, als nachher auf seinen Kopien zu sehen war. Gut für ihn: schade um Vincent.“
„Mit Mark Thomas aus Detroit ging ich später in Tanger an Land, die provenzalische Depression war zu Ende, Spanien lag dazwischen, die langen Gesichter El Grecos. Mein amerikanischer Freund sah aus wie Bob Dylan, sein Vater, ein Garagist, hatte ihm genug Geld gegeben, um einen Volkswagen aus Europa nach Hause zu bringen, ja. Aber Mark war ein Dichter, und er sah auch aus wie ein Gedicht, wirklich, er ging wie ein Gedicht. Ich weiß nicht, wie ein Gedicht ist, aber er war eins. Mit seinem VW fuhren wir nach Marokko. Ein Umschlagplatz von allem war dieses Tanger. Verrückt. Eigentlich fand mein Erwachen erst da richtig statt, auf dem Schwarzen Kontinent.
Ich porträtierte meinen Botschafter, um zu ein paar Pfund zu kommen, und war sehr verliebt. Aber ich hatte diese Liebe falsch verstanden. Ich feierte mit Lis meinen zwanzigsten Geburtstag, es gab für mich nichts anderes mehr als diese Liebe, total. Nur – da war noch ein ehemaliger katholischer Priester. Ich sah die beiden zusammen und verstand die Welt nicht mehr. Das Mädchen wurde schwanger, der Priester bezahlte die Abtreibung. Das war für mich nicht gut, hat mich kaputtgemacht, innerlich, meine Gefühle für diese Frau waren so stark gewesen, und auf einmal war alles so billig und leichtfertig geworden. Ein zweites Istanbul. Ich weiß, für dich hört sich das alles wie eine Legende an, die zunehmend schneller abläuft, ohne Dazwischenliegendes, dabei ist ja mein ganzes Leben genau dort angesiedelt: dazwischen.
Natürlich hätte ich nicht mehr, wie es in Asien der Brauch war, meine von den Eltern vorausbestimmte Verlobte zur Frau nehmen können, aber diese andere, schnelle Art und Weise der Liebe, wie sie an the road in Mode kam, ertrug ich auch nicht gut.
Ich kehrte nach Paris zurück und beschloss, stabiler zu werden. An der Alliance traf ich meine spätere Frau, ich reiste ihr in die Schweiz nach – oh, die deutsche Sprache!
Als ich vierzehn Tage lang hier in der Schweiz war, klopfte die Polizei an unsere Tür und wollte meine Papiere sehen, da jemand gemeldet habe, ich sei schwarz in die Schweiz gekommen. Das hat mich erschreckt, ich hatte doch einen legalen Pass. Diese Anzeige durch Unbekannt. Dabei war ich doch erst angekommen. – Die ‚grenzenlose‘ Liebe darf nirgends stattfinden! Das Gefühl, ständig misstrauisch beobachtet zu werden, hast du dir schnell eingehandelt – als Ausländer.
Zugegeben, ich bin schon ein etwas dramatischer Mensch. Deshalb fuhr ich einem älteren Schweizer, der mich beleidigte, wenig später wohl so entschlossen in die Knie. Er blieb lang hingestreckt liegen. Ich sah nur noch schwarz, das Ende der Welt – mit abgedecktem Alpenkranz. Dabei hatte mein Leben doch erst gerade angefangen, und jemand wollte es mit mir teilen! Es war so gut, dass der junge Polizist, der auf den Platz gerufen worden war, mich nicht wie einen Kriminellen behandelte, dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Im Lauf der Zeit habe ich dann gelernt, nicht mehr zurückzugeben, wenn man mich Schlitzauge nennt. Es ist der Name für einen Fremden, der ich in ihren Augen bin.
An meiner ersten Weihnacht hier in der Schweiz kaufte ich für uns ein Poulet und präparierte es indonesisch, aber beim Anschneiden kam ich nicht durch mit dem Messer. Unsere Freunde lachten: Ich hatte ein Suppenhuhn gekauft. Seither weiß ich, dass es in der Schweiz zweierlei Hühner gibt – voilà!“
Das Ende der Bescheidenheit
Zum Tod von Hermann Burger
Hermann Burger ist tot. Sein Herz habe versagt, meldet der Suhrkamp Verlag. „Freiwillig aus dem Leben geschieden“, berichtigt das Radio. Der Scheintod, über den keiner besser Bescheid gewusst hat als Hermann Burger, liegt jetzt jedenfalls hinter ihm. Ratlos und perplex steht man vor der lakonischen Todesmeldung und ringt, drei Wochen nach Thomas Bernhards Tod, erneut um Luft.
„Als ich die Eisenfaust zu spüren begann, welche mir durch den Rücken in den Brustkasten griff und das Herz zu erwürgen versuchte, saß ich, sozusagen zum Personal gehörend, also auf der Flaschenseite, an der Bartheke eines Wiener Kabaretts in der finsteren Zirkusgasse bei einer Flûte Veuve Clicquot: An der Bouteille beteiligten sich drei Damen, die Heidelore, die Milva und die unvermeidliche ‚Guggi‘, welche mir, da das Kunststück auf Anhieb gelungen war, neun Einschillingstücke als Brücke über ein Whiskyglas zu legen, teils verbal, teils labial bestätigten, dass an mir ein ganz großer Equilibrist verlorengegangen sei“, schrieb Hermann Burger 1982 in seiner „Glorietten-Vision“, dem Tagebuch eines Wiener Spitalaufenthaltes.
Hermann Burger, 1942 in Burg geboren, aufgewachsen in Menziken, studierte an der Universität Zürich Germanistik und Kunstgeschichte. Er lebte als freier Schriftsteller und Privatdozent für deutsche Literatur an der ETH Zürich im aargauischen Brunegg.
Wer Hermann Burger sagt, denkt an seine Bücher, denkt an „Schilten“, an „Diabelli“, an „Die künstliche Mutter“, denkt an den „Mann aus Wörtern“ und an den eben erschienenen Band „Brunsleben“ aus der geplanten Stumpenromantetralogie „Brenner“, um nur die wichtigsten und eindrücklichsten Titel zu nennen. – Aber daneben schießen noch unzählige weitere Geschichten und Schichten, Romanansätze ein, die Hermann Burger nicht geschrieben, sondern gelebt und dargestellt hat, wenn ihm seine Depressionen ein anderes Leben als das eines Gequälten zu leben erlaubten. Wir werden einander diese „Geschichten“ gerade in diesen Tagen eifrig – und vielleicht etwas verlegen – wiedererzählen. Verlegen deshalb, weil uns gegenüber Hermann Burger und seinen Kunst-Stücken nur selten etwas Besseres gelang als das bewundernde, angewiderte oder auch eigenartig ohnmächtige Zuschauen. Wahrscheinlich hätte er nur in unsere Arme geschlossen werden wollen – aber dafür waren unsere Extremitäten einfach zu kurz.
Es stehe jedem frei, aufs Matterhorn zu wollen. In gewissem Sinne wirke er als Führer, wolle er Hermann Burger zu ein paar Erfolgserlebnissen verhelfen, ließ sich der PR-Manager vernehmen, in dessen Fänge sich Hermann Burger vor einigen Monaten, dieserart schon zum Äußersten entschlossen, begeben hatte. Und als Urs Bugmann von der LNN daraufhin einwandte, ob sein Klient vielleicht nicht eher einen Therapeuten benötige, der ihn von seinen Depressionen befreie, anstelle eines Führers, der ihn zu Extremklettertouren verführe, zitierte der Öffentlichkeitsarbeiter Heinrich Böll, der schon vor Jahren „Das Ende der Bescheidenheit“ angemahnt habe.
Ich sehe Hermann Burger auf dem Rad balancieren, Schulhausplatz in Menziken, Mitte der fünfziger Jahre. Als drei Jahre Jüngerer stand ich ohne Velo im Tor und versuchte die scharfen Bälle von Hermanns Vorderrad zu parieren. Dass Gleichgewicht „Equilibre“ heißt, wusste ich damals noch nicht, und Hermann freute sich über jedes erzielte Tor.
An freien Mittwochnachmittagen stieg Hermann nur vom Rad, wenn die Gebrüder Engesser mit ihrem roten Tretauto – kein Ferrari, ein Austin – auf den Schulhausplatz einbogen. Wir umstanden das zweisitzige Cabriolet mit den Ledersitzen, den leuchtenden Front- und Hecklichtern und benieden die Besitzer des Wagens um ihr tröstendes Göttigeschenk, das ihnen der frühe Tod ihres Vaters eingebracht hatte.
Eigentlich waren Hermanns Beine schon etwas zu lang, um im roten Austin eine Ehrenrunde zu drehen, aber er achtete nicht auf das Gelächter seiner gleichaltrigen Klassenkameraden, die schon wieder auf ihren Drahteseln saßen und das unterbrochene Radballspiel fortsetzen wollten.
Für den Austin sind Hermanns beide Söhne jetzt auch schon ein wenig zu groß, aber dass sie in diesen Tagen einen gütigen und starken Götti nebst ihrer Mutter an ihrer Seite wissen, das wünsche ich ihnen sehr.
„Und mein Herz?“ – fragt der Wortmächtige in einem einzigen kurzen Satz am Schluss seiner Glorietten-Vision.
„Gehört Ihnen, tragen Sie Sorge dazu, es ist das einzige“, lässt Hermann Burger seine Entlassungsärztin antworten. Er hat es immer gewusst.
Hut ab
Ein Verwandtentreffen in Menziken
1
Nach dem Tod meines Vaters sind zwei Hüte auf mich gekommen, ein dunkelgrauer Allwetterhut und ein schwarzer, hochrandiger Nobelfilz. Für Hochzeiten, Staatsbankette, Beerdigungen.
Mein Vater trug den Eden-Hut nur einmal, zu meiner Konfirmation. Später setzte er ihn noch hie und da auf, wenn er guter Laune war, bevor er ihn schnell wieder in die steife, schützende Schachtel zurücklegte. Mein Sohn und ich setzen diesen Hausgebrauch noch sporadisch fort.
Vater hatte sich in der Mitte des Lebens endgültig für die Baskenmütze entschieden, denn ohne Kopfbedeckung ging er nie aus. Zu oft hatte er den gnadenlosen Türspruch seines Vetters und Fabrikanten zitiert, der bis zur Schließung der Hutmacherei über dem Fabrikeingang prangte:
„Hutlose Lieferanten werden nicht empfangen!“
Obwohl mein Vater kein Stroh- oder Filzlieferant war, er hätte seinem heftigen Verwandten auch auf offener Straße nicht ohne Kopfbedeckung unter die Augen kommen wollen.
2
Glätterei. Auszeichnerei. Garniererei. Näherei. Die Filzstumpen, vom Wollfilz bis zum Biberhaarfilz, sie wurden in der Glätterei unter Dampf und Hitze in Form gebracht. Aber erst in der Garniererei, im Atelier der Modistinnen, wurde dem anonymen Hut die Seele eingehaucht. Von den schönen, schnellen, den geschmackssicheren Artistinnen.
In Paris wurden die Ideen geholt und auf den helvetischen Kopf umgedacht. Ein Hut für die Stauffacherin und ein Hut für die verwegene Städterin. Die Putzmacherinnen stellten sich selber vor den großen Spiegel im Atelier, der sich sanft zu ihnen hinabneigte, so dass der Hut im Mittelpunkt ihres Spiegelbildes stand. Die Kreationen und Transformationen fanden zu einem großen Teil auf den Köpfen der huttragenden Modistinnen selber statt. Ihre Hüfte, Beine, Füße hatten bei der Arbeit ganz hinter den Kopfschmuck zurückzutreten. Reiherfedern und Schleier, Strohblumen und Bänder, sie veränderten den billigsten und den teuersten Filz. – Bis der ausländische Konkurrenzdruck, vorab aus Hongkong, und das hektische Auf und Ab der Hutmode selbst der behäbigen Infrastruktur der Firma zuviel wurden. – Nur für die paar letzten Bestellungen im alten Jahr blubbert der Dampfkopf noch.
3
Ein Enkel des verstorbenen Patrons, der einzige Hutmacherlehrling seit fünfzehn Jahren in der Schweiz, wird 1988 von seinem Vater, meinem Coucousin Hans, mit den letzten Aufträgen und dem Zusammenräumen der Fabrik betraut. Er angelt für mich eine goldgerahmte Fotografie von 1953 vom Nagel. Sie zeigt seinen schwergewichtigen Großvater als strahlenden Fabrikanten, den leiblichen Erben an seiner Seite, inmitten der fünfzigköpfigen Belegschaft. Alle Damen und Herren tragen ausnahmslos Hut. Der Geschäftsausflug führt sie nach Genf, um ein wenig welsche Luft zu atmen – als wäre es der Äther über Paris. Aber dorthin fuhr ihr Patron jeweils allein, um in Sachen Mode ständig à jour zu sein.
Fünfunddreißig Jahre später räumt sein Enkel die alteingesessene Firma auf dem Land endgültig zusammen. Der Großvater ist seit zwölf Jahren tot. Das „NOW“ auf der T-Shirt-Brust möchte der junge Berufsmann aber nicht als ein „Apocalypse Now“ für jegliche Kopfbedeckung verstanden wissen. Er denkt vielmehr an einen etwas schmaleren Neuanfang im Dienste des Hohspitzes aus Filz oder Stroh. Vielleicht in der Stadt, wo es mehr Köpfe hat.
4
Der Ehemann der letzten Näherin hat vor Jahren auch noch im Betrieb gearbeitet, in der Spedition. Dann kam die Kurzarbeit. Er wechselte die Stelle und trat vermehrt als Alleinunterhalter auf. Seine Frau blieb bei den Hüten.
Auf ihrem langen Arbeitstisch liegt der Brief eines zweiundneunzigjährigen Musiklehrers, der den Rand seines nicht mehr ganz salonfähigen Hutes gerne erneuert hätte.
Er bietet dafür eine Zierschrift von 1870 an, dreifarbig, die er vermutlich noch als letzter schreibe. Man solle ihm Namen und Geburtsjahr eines geliebten Menschen nennen, damit er mit seinem Werk beginnen könne. – Hans nimmt den renovierten Hut prüfend vom Tisch und ist zufrieden mit dem neuen Rand. Draußen beginnt es zu schneien.
5
Kurz vor Weihnachten vernehme ich, dass auch mein anderer Coucousin und Freund der frühen Jahre, seines Zeichens Bankdirektor und ehemaliger Hutmacher, für einen Tag an seinen ursprünglichen Wirkungsort zurückkehre, um für den Eigenbedarf noch ein paar Filze zu ziehen.
Hinter beschlagenen Scheiben, zwischen den rauchenden Dampfköpfen kommt es zu einem letzten Verwandtentreffen in den alten Sälen. Die Fabrik mit den beiden griechischen Gipsköpfen im Giebelfeld ist bereits eingerüstet. Der Käufer des sterbenden Betriebes, ein benachbarter Bar- und Nachtclubbesitzer, steht schon auf dem Baugerüst und schwingt selber den Pinsel. – Vom Hut zur Haut? Nein, er wird vermieten. Und später wohl abreißen, um neu zu überbauen.
6
„Man muss den Filz ziehen, solange er noch heiß ist.“ Der das sagt, ist vermutlich der einzige helvetische Bänkler, der sich am wirklichen Filz die Finger schon verbrannt hat. Unter seiner ein wenig aus der Übung geratenen Hand entsteht ein dunkelgrauer Borsalino. Mir verspricht er einen Panamahut, wie Fitzcarraldo ihn trug. Und hinter den Gesprächen über Hüte steht plötzlich auch unsere Kindheit wieder da, die wir zu einem großen Teil dem Jordan entlang verbracht haben, so nannten wir den Fabrikkanal.
Einige Jahre nach dieser Zeit nimmt dann der ausgelernte Hutmacher als erster den Hut und zieht in die Welt hinaus, schult um. Die Flüche seines polternden Onkels und Fabrikanten verhallen nur allmählich im Rücken des Abtrünnigen. Zurück bleibt Hans. Aber da ist das Glück schon aufgebraucht.
Ein Himmel voller Geigen
Die flache Messinggeige zittert im Wind. Sie hängt als Firmenemblem vor dem Haus. Ein Nussbaum überschattet den gekiesten Vorplatz, Großkinder gehen ein und aus.
Der Eintritt ins ehemalige Rucksack-Bauernhaus, Rolf W.s Elternhaus, erfolgt durch das Musik- und Musterzimmer. Ein gutes Dutzend Celli reihen sich der Wand entlang auf. In ihrer Mitte stehen wie bauchige Ratsherren die leeren Instrumentenkästen. In einer Vitrine an der Wand hängen zwei Violinchen. Man nennt sie Pochettes, Sackgeigen oder Tanzmeistergeigen. „Nit möööööglich!“ Die beiden Instrumente sollen Charles Adrien Wettach alias Grock gehört haben. Gekauft haben sie die W.s vor Jahren von einem Zigeuner-Händler aus Nizza, der die Geigen von einer Schwägerin des Clowns übernommen hat. Das Köfferchen dazu, in Grocks Biographie abgebildet, hat die Angaben des Zigeuners bestätigt, der die W.s auch sonst nie betrogen hat. Die eine der beiden Geigen muss im Auftrage Grocks von einem guten italienischen Geigenbauer dem älteren, französischen Violinchen nachgebaut worden sein: damit der Clown immer ein spielbares Instrument zur Hand hatte.
Hand aufs Herz, wann haben wir beim Wort „Boutique“ zum letztenmal an eine „Werkstatt“ gedacht? Die „Budig“ der Geigenbauer misst keine zwanzig Quadratmeter. Das breite Fenster an der Längsseite geht auf den Gemüsegarten hinaus. Claudia, Mark, Brigitte W., die Tochter, der Sohn, die Mutter belegen die Fensterplätze. In ihrem Rücken steht eine Hobelbank, Vaters Arbeitsplatz. Rolf W. hat sich vom Fenster zurückgezogen, seit er die gesundheitlichen Probleme hat, arbeitet jetzt näher bei der Tür. Kommt er jeweils vom kurzen Ausspannen zurück, zugegeben, hat er mit einem Blick auch die Übersicht wieder in seinem Betrieb, der langsam an seinen Sohn, den ausgebildeten Primarlehrer und gelernten Geigenbauer übergeht: „I ha lieber wölle schaffe als Schuel gäh.“
Mark wohnt mit seiner Frau, die er während seiner Berliner „Wanderjahre“ kennengelernt hat, und mit den drei Kindern im oberen Stockwerk des Hauses. Zusammen mit den Eltern im Erdgeschoss proben sie zeitweise das Leben in der Großfamilie.
Claudia, auch sie gelernte Geigenbauerin, arbeitet teilzeitig mit. Als junge Witwe mit zwei kleinen Kindern geht es nicht anders.
Bei Brigitte W. gehörte es im Basler Elternhaus noch zum guten Ton, ein klassisches Instrument zu spielen. Eines Tages stürzte sie mit ihrem Cello die Treppe runter und lernte dank der notwendig gewordenen Reparatur den Geigenbau kennen, der sie faszinierte. Sie begann zu Hause darum zu kämpfen, dass sie nicht nur Celli spielen, sondern auch welche bauen durfte. Und wurde Geigenbauerin. Sie überlässt mir ihren Platz am Fenster, hat noch Buchhaltungsarbeiten im hinteren Zimmer zu erledigen, ohne Computer, den Sohn und Tochter allerdings für unabdingbar halten. In Zukunft.
Auf der Hobelbank liegt ein Cello ohne Saiten. Rolf W. befeuchtet mit der Zunge den neuen Ahorn-Steg, damit er sich mit dem Schnitzmesser leichter bearbeiten lässt. Mark hält ebenfalls einen Steg in der Hand, überprüft dazwischen die Flucht des Griffbrettes, stellt seinen Steg versuchsweise auf den Resonanzdeckel seiner Geige. Die Auflage ist noch nicht perfekt. Er schleift sein Messer auf dem nassen Stein. „Wenn eines der beiden Instrumente später wieder einmal in unsere Werkstatt zurückkommen wird, werden wir erkennen können, ob der Alte oder der Junge den Steg geschnitten hat“, sagt Rolf W.
Geigenbau sei eine Suche nach der eigenen Identität, meint Mark. Er zum Beispiel wolle nicht Herrn Stradivari oder Guarneri nachahmen, er habe innerhalb des strengen Rahmens klassischer Streichinstrumente ein eigenes Modell, seine Bratsche, entwickelt und bald einmal genug Liebhaber, die damit „etwas anfangen“ könnten. – Erst jetzt fällt neben dem Wort „Handwerk“ zum erstenmal auch das Wort „Kunst“.
Wie es die Liebhaber der Werke von bildenden Künstlern, Komponisten, von Schriftstellerinnen und Schriftstellern gibt, gibt es auch die Passionierten für ein bestimmtes Instrument: Nebst dem Dienst am Kunden haben die W.s immer auch „den Dienst an der Musik“ im Auge. „Eigentlich sind unsere ‚Neubauten‘ Autographen, die man anschauen, anfassen und spielen kann.“
Plötzlich erklingt ein heller Saitenklang im Atelier. Aha, denke ich, die Musik! Aber Claudia hat nur das Blättchen an ihrer Laubsäge geprüft. Sie repariert einen defekten Geigenbogen, wärmt das zähe Fernambukholz über der kleinen Flamme eines Bunsenbrenners auf. Hinter ihrem Arbeitsplatz fällt ein weißer Pferdeschweif bis auf den Werkstattboden hinab. Die Ersatzhaare für den gepflegten Bogenstrich.
„Der Geigenbau fordert die Sinne heraus. Das Zusammenspiel aller Faktoren will berücksichtigt sein, soll es zum ‚Wohlklang‘ kommen: die Stärke des Holzes, die Eigenschaften der verschiedenen Bäume, die Härte des Lackkleides, die Balance der Kräfte. Ein steiler Hals gibt viel Druck auf den Körper des Instrumentes ab, es klingt hart und laut, der flache Hals macht es modulierfähiger und weicher im Klang.“
„Über den Geigenbau gibt es Bücher“, sagt Mark und schweigt, ist wieder ganz bei seiner Arbeit. Er fährt mit einer schlanken Stablampe in den Geigenbauch hinein, spiegelt den Hohlraum mit einem Zahnarztspiegel aus, den er durchs linke F-Loch geschoben hat. Sein Patient kennt keine Angst.
Dass es hier so still und unspektakulär zugeht und ohne Betulichkeit Hand angelegt wird an alte, neue, mindere und wertvollere Instrumente, macht mich fast ein wenig nervös, neidisch und verlegen. Hier muss die Langsamkeit nicht erst noch entdeckt werden, sie findet statt. Und dass alles seine Zeit braucht, dieses Wissen gehört bei den Geigenbauern zur Profession, sonst entsteht Pfusch.
Eine alte Violine liegt an meinem Fensterplatz. Vom Schrank einer Großmutter herab. Ob sich die Restaurierung lohne, wollte der Kunde wissen, der die wertvolle neapolitanische Arbeit aus dem späten 18. Jahrhundert auf den Werkstatttisch gelegt hatte. „Sie ist nicht so schön gearbeitet, aber klanglich trotzdem sehr stimmig. Zu jener Zeit herrschte in Neapel musikalische Hochkonjunktur, die Geigenbauer mussten schnell arbeiten. Trotzdem hat die Violine eine Ausstrahlung. Wie ein guter Mensch“, sagt Mark. Die Etikette Carlo Tononi Bolognese Fece in Venezia l’Anno 1742 ist allerdings mit Bestimmtheit falsch, Tononis Instrumente sind um einige Klassen besser, der Bleistiftvermerk Repariert von Ludwig Bausch junior, Leipzig 1869 hingegen ist sicher richtig und nicht „frisiert“.
Im letzten und in diesem Jahrhundert hat es in ganz Europa viele gute Geigenbauer gegeben, denen aber zu oft italienische Zettel „unterlegt“ worden sind, um sie im Zuge der qualitativen und preislichen Vorreiterschaft von Stradivari und Guarneri wertvoller erscheinen zu lassen. Drittklassige italienische Produkte haben z. B. immer wieder bessere Bewertungen erfahren als erstklassige deutsche Meisterarbeiten, deren Namen im Lauf der Zeit in vielen Instrumenten zum Verschwinden gebracht worden sind. Heute forscht man vermehrt nach ihnen. Die Fixiertheit auf italienische Namen hat unter Sachverständigen Vernunft angenommen. Vielleicht könnte man sogar von einem neuen Selbstbewusstsein der Geigenbauer reden.
„Noch in den fünfziger Jahren“, ergänzt Rolf W., „stellten einander Händler von hier nach dort Atteste aus, ohne das fragliche Instrument je gesehen zu haben. Diese Praktiken schadeten natürlich dem Geigenbau und seiner Glaubwürdigkeit. Heute laufen die Geschäfte wieder seriöser. Über Empfehlung und Vertrauen. 1962 haben wir unser erstes Inserat aufgegeben. Es ist bis heute das einzige geblieben.“
Ein Himmel voller Geigen. Das Restaurierungsgut, vielleicht zwei Dutzend Geigen, hängt an einer Wäscheleine an der Decke der Werkstatt. Es sind die geheimen Reserven des Betriebs. Weitere Instrumente sind noch in einem alten Schrank verwahrt. Sie werden sorgfältig restauriert. Neben der Kundenarbeit, die immer Vorrang hat, da die Leute ihre defekten Instrumente möglichst bald wieder spielen sollen und wollen, nimmt das Restaurieren einen großen Teil der Zeit in Anspruch. „Schön, wenn in Zukunft noch etwas mehr Raum für den Neubau bliebe“, sagt Mark und denkt dabei auch an seine Schwester, die im Lauf der Zeit vielleicht wieder regelmäßiger mitarbeiten wird.
Achtzehn Uhr. Draußen ist es noch hell, Sommerzeit seit kurzem. Claudia geht nach Hause. Mark hängt seine Arbeitsschürze ein wenig später an den Nagel. Die abgelegten Instrumente bleiben auf dem Tisch in ihren „Arbeitsschüsseln“ liegen. Ich sitze mit Rolf W. allein in der Werkstatt.
„Vielleicht war ich immer zu sehr auf Mitsprache aus. Zu wenig ‚autoritär‘. Mark schaut jetzt genauer, schaut auch mir ab und zu auf die Finger, um alles rauszuholen – qualitativ. Er dokumentiert sich, forscht“, sagt Rolf W. „Als wir damals anfingen, zwischen Portsmouth und London an einem kleinen Ort, die beiden Älteren kamen dort zur Welt, war alles noch ein wenig schwieriger. Ich hatte Brigitte in der Fachschule in Brienz kennengelernt. Mein erster Beruf war übrigens Möbelschreiner, daher wohl die Hobelbank hier. In England baute ich Gamben und Lauten, historische Instrumente, Brigitte schnitzte Lautenrosetten in Heimarbeit. Beides für wenig Geld. Wir wohnten in einem Jägerhaus im Wald. Der Besitzer des Häuschens besaß Ölfelder und Gummiplantagen in ‚Commonwealth-Kolonien‘. Er überließ uns das Häuschen gratis. Wasser und Elektrizität gab es dort nicht. Nur der Postbote kam regelmäßig und einmal im Jahr ein Polizist, um nachzuschauen, ob es noch gehe im Wald. Einmal benötigten wir einen Arzt. Ich streute Zeitungsschnitzel, um den Weg zu markieren. Ohne Einmischung von anderen wuchs da wohl die Basis für unser Zusammenhalten. Vielleicht haben wir uns später deshalb gegen die Großtechnologie zur Wehr zu setzen begonnen, weil wir etwas anderes erlebt hatten. Vor dem AKW in Gösgen wurde ich zum erstenmal abgespritzt. – Mark wird weiter kommen als wir, mit seinen Bratschen hat er schon einen schönen Erfolg, er muss sich das Vertrauen nicht mehr mit kleinen ‚Ärbetli‘ verdienen. Das ist schön, auch wenn es mich manchmal schmerzt, wenn er mich kritisiert und überflügelt. Mir hockt auch die Sparsamkeit enorm in den Knochen. Aber wenn jeder versucht, glaubwürdig zu leben, dann geht es gut.“
Dass sich die Aussagen von Rolf und Mark, den ich zwischen Tür und Angel auch nach seinem Verhältnis zu seinem Vater und „Meister“ frage, unabhängig voneinander so genau decken, hat mich nach meinem Augenschein bei der Geigenbauerfamilie nicht erstaunt.
„Ich habe ihn schon sehr gern, den Vater“, sagt Mark, bevor er die latenten und ausgetragenen Konflikte zwischen jung und alt, die Schwierigkeiten mit der Distanz und bei der Übernahme von Verantwortung offen anspricht. „Aber wie gut Vater und Mutter ‚im Nehmen‘ sind, hoffentlich kann ich das auch, wenn bei mir diese Zeit kommt.“
Vielleicht sind die Mitglieder der Geigenbauerfamilie W. in S. nicht die letzten, die die Welt begreifen. Aber ich denke, sie gehören zu denjenigen, die begriffen haben, was uns ohne diese „Letzten“ fehlen wird.
Der Begleiter
In Erinnerung an Hermann Burger
„Der Schönheit dienen, die Gestalt suchen, ein Ästhet werden – in welcher Disziplin auch immer – bedeutet, einen Pakt mit dem Tod zu schließen. Zeitlichkeit durch Kunst aufzuheben war nur möglich um den Preis einer höheren und verfrühten Einsicht in die nichteuklidische Geometrie des Todes.“ – Hermann Burger, „Die Glorietten-Vision“
Im November 1989 betreten wir von der Schlossallee her die Symmetrie Schönbrunns. Die braunen Narben des ausgeräumten Blumenparterres zwischen Schloss und Neptunbrunnen drücken durch die dünne Schneedecke, Eiswind weht. Die russischen Rabenkrähen mit den großen Schnäbeln mischen sich unters einheimische Taubenvolk. Grau hängt der Himmel in den Bogenarkaden der Gloriette. Die Hände tief in den Manteltaschen vergraben, halten wir auf den mächtigen Kulissenbau am Horizont zu, der uns neue Fernsicht verspricht. Eine Fernsicht, von der ich allerdings weiß, dass die eigentliche Sensation des stets wieder erwarteten, überraschenden Ausblicks das Zurückschauen sein wird.
1961 bin ich schon einmal, in milderem Lichte, durch diesen Park gegangen, als jüngstes Mitglied einer Gruppe reisender Seminaristen und Gymnasiasten aus der Schweiz. Hermann Burger, drei Jahre älter, aber im selben Dorf aufgewachsen wie ich, war auch dabei. Im spärlichen Reisegepäck führten wir als Hauptlast unsere dunklen Konfirmandenanzüge, die silbernen Krawatten mit, damit uns auch in der Staatsoper und im Burgtheater Einlass gewährt würde, unbedingt. 28 Jahre später wird Hermann Burger auf Schloss Brunegg, wo er, von seiner Familie getrennt, bei J. R. von Salis in Untermiete lebt, in seinem Schreibzimmer aufgefunden. Der inzwischen berühmt, auch „berüchtigt“ gewordene Schriftsteller ist, nur drei Wochen nach dem Tode seines „Prosalehrers“ Thomas Bernhard, freiwillig aus dem Leben geschieden.
„Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, / ist dem Tode schon anheim gegeben, / wird für keinen Dienst auf Erden taugen, / und doch wird er vor dem Tode beben, / wer die Schönheit angeschaut mit Augen!“