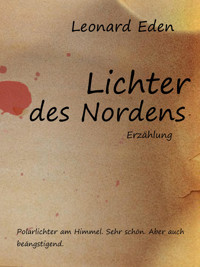0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Brüder Stephen und Marvin Hutter suchen seit zwei Jahren erfolglos nach Gold. Als sie einen schwer verwundeten Mann finden, der eine Satteltasche voll Gold bei sich hat, nehmen sie das Gold an sich und verweigern dem Fremden die nötige Hilfe. Wieder Zuhause in San Francisco wollen die beiden ihren Wohlstand genießen sowie ihr neues Ansehen in der High Society. Doch dann geschehen mit einem Mal merkwürdige Dinge. Stephens Frau Leo benimmt sich plötzlich eigenartig, und auch Marvin verändert sich ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Leonard Eden
Der Mann vom Klondike
Aus der Reihe: 'Nordlandgold'Band 6 Weitere Titel der Reihe:IcebeardDas Gold des MexikanersHungerWolfsweihnachtDie Fee von NomeLichter des NordensInhaltsverzeichnis
Der Mann vom Klondike
Historische Personen
Impressum
Der Mann vom Klondike
And some will return to a maid. Hamlin Garland, Die Goldsucher
1897 Das Feuer war niedergebrannt. Die schwarzen Holzstücke glühten nur noch schwach und standen kurz davor, sich der Kälte des Nordens zu ergeben. Der Mann lag in der Nähe seines Lagerfeuers, neben einem Schlitten, den er wohl selbst durch die eisige Wildnis des Yukon Territoriums gezogen hatte. Hunde jedenfalls waren nirgends zu sehen. Auch keine Spuren von ihnen. Mein Bruder sah das glühende Holz und die Umrisse des Mannes als erster. Sie schälten sich wie geheimnisvolle Zeichen aus der Dämmerung. Marvin, der auf dem Schlitten stand, mit dem wir gerade unsere Jagdbeute zur Hütte am Klondike bringen wollten, hielt die Hunde an und blieb vor dem niedergebrannten Lagerfeuer stehen. Ich war kurze Zeit später bei ihm. Während Marvin das Gewehr unter den Decken hervorholte, suchten meine Augen die Umgebung ab. Doch es war nichts zu sehen, als die dunklen Wälder und die weißen Schneeflächen, die wir nun seit fast zwei Stunden durchquerten.
Wir näherten uns dem reglosen Körper in unseren Schneeschuhen. Ich bückte mich zu dem Mann hinab und drehte ihn auf den Rücken. Um die Augen, die halb geschlossen waren, lagen dunkle Ränder, die Wangen waren eingefallen, wodurch die hohe Stirn deutlich zur Geltung kam. Seine Jacke war an der linken Seite dunkel gefärbt. Blut. Daran bestand kein Zweifel. Der Mann war noch am Leben. Er atmete verhalten, aber sein Atem war deutlich zu hören.
„Verdammt“, murmelte Marvin.
Wir holten ein Fell von unserem Schlitten, legten den Mann darauf und wickelten ihn in eine Decke.
Ich sah mich nach Fußspuren um, nach Schlittenspuren. Da war nichts. Dabei hatte es den ganzen Tag über nicht geschneit. Irgendwie musste der Mann doch an diesen Platz, an dem er sein Lager aufgeschlagen hatte, gekommen sein und irgendwie musste sich sein Mörder entfernt haben. Es gab keine Hinweise darauf. Die einzigen Spuren führten zu einem nahe gelegenen Waldstück, aus dem der Mann allem Anschein nach Feuerholz geholt hatte.
„Wir müssen ihn nach Dawson bringen“, brummte ich.
Marvin war dabei, den Schlitten des Mannes zu durchsuchen.
„Wir sollten keine Zeit verlieren“, antwortete er wie nebenbei. „Seine Sachen nehmen wir mit.“
Unsere Hunde winselten. Sie waren unruhig. Die Kälte der hereinbrechenden Nacht biss sich mehr und mehr fest. Ich bereitete unseren Schlitten soweit vor, dass wir den Fremden seinen Verletzung entsprechend lagern konnten.
„Sieh dir das an.“
Etwas in Marvins Stimme ließ mich aufhorchen. Ich spürte, dass da etwas Außergewöhnliches war. Marvin hielt eine Satteltasche in die Höhe, deren Verschluss er geöffnet hatte. Das Leder der Tasche war abgegriffen. Während ich näher kam, fuhr Marvin mit einer Hand in die Öffnung. Als er sie wieder hervorholte war sie voller Nuggets. Ich konnte nicht anders. Ich wollte fühlen, was Marvin fühlte, in meinen Fingern, auf meiner Haut, in meinem Herzen. Ich zog einen meiner Handschuhe aus und fasste ebenfalls in die Öffnung. Gold. In den beiden Seitentaschen befanden sich jeweils zwei Wildlederbeutel voller Gold. Marvin hatte einen davon geöffnet. Insgesamt waren es mehrere Pfund Klondike-Gold. Viele der Nuggets waren so groß wie ein Daumennagel.
Was dann geschah, war nicht abgesprochen. Vielleicht streiften sich unsere Blicke kurz, um unsere Absichten auszutauschen. Vielleicht dachten wir aber auch nur dasselbe, weil wir Brüder waren, aufgezogen von denselben Eltern, am selben Küstenstreifen Kaliforniens. Hier oben im Norden hatten wir zwei Jahre lang dieselbe Schinderei erlebt. Erst am Stuart River, dann am Klondike. Wir hatten fast achttausend Dollar investiert, die wir uns geborgt hatten. Unsere Eltern waren kurz hintereinander gestorben und wir waren in ihrer Todesstunde nicht bei ihnen gewesen, weil wir damit beschäftigt gewesen waren, hier oben in dieser Wildnis und Einsamkeit nach Gold zu suchen. Wir hatten alles riskiert und waren kurz davor gewesen, alles zu verlieren. Nun stand nur noch das Leben dieses Fremden zwischen dem Gold und uns. Es war plötzlich möglich, die scheinbar unabwendbare Niederlage in einen unverhofften Sieg zu verwandeln. Ich würde nicht als Verlierer nach San Francisco zurückkehren. Ich würde keine Schulden mit nach Hause bringen. Ich würde Leo in die Augen sehen, und sie würde stolz auf mich sein. Marvin un dich, wir hatten das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
Mit einer Axt, die wir auf dem Schlitten des Mannes fanden, schlugen wir Holz. Genug für ein Feuer, das, wenn es sein musste, die ganze Nacht durch brannte. Da ich der Ältere von uns beiden war, blieb ich bei dem Fremden, während Marvin zu unserer Hütte fuhr, kaum eine halbe Stunde entfernt, um dort die Hunde zu versorgen und die Jagdbeute zu zerlegen.
Der Mann atmete ruckartig, während ich neben ihm saß. Manchmal hustete er, dann lief Blut über seine Mundwinkel und in dünnen Streifen seinen Hals hinab. Ich würde die Nacht über dafür sorgen, dass er nicht erfror und dass die Wölfe nicht über ihn herfielen. Das war alles. Ich würde ihn nicht töten. Die Kugel würde ihr Werk vollenden, ohne mein Zutun, oder das Zutun Marvins. Die Absicht des unbekannten Mörders würde aufgehen. Mein Beitrag bestand darin, nichts zu tun. Nichts. Ich musste nur den Dingen ihren Lauf lassen.
Die Sterne flammten auf und stachen durch die Dunkelheit des Himmels wie durch ein schwarzes, seidenes Tuch. Das Feuer wärmte mich und hielt wilde Tiere fern. Bald gab es nur noch die Sterne und den weißen Schnee, und den Mann neben mir, dessen Atem stoßweise kam, rasselnd und schwer. Ich starrte in die Flammen und versuchte nicht an den Verwundeten zu denken. Er brauchte Hilfe, die ich ihm nicht gab. Hätten Marvin und ich nicht den Weg am Fluss entlang genommen, um zur Hütte zurückzukehren, wären wir nie auf diesen Mann gestoßen. Unsere Verantwortung für ihn war ein hauchdünner Faden, der in all den Fäden, die das Schicksal um uns Menschen herum spann, verloren ging. Mit ihm verlor sich unser Gefühl der Verantwortung. So sehe ich das heute. Damals dachte ich an das Gold. Immer wieder. An das Gold.
Das glühende Holz knackte und Funken sprangen.
Gehörte das Gold ihm alleine? Hatte er noch Teilhaber? Freunde, die ihn nun suchten?
Der Mann murmelte etwas.
Ich warf einen Blick über die weißen Hügel und Ebenen, als wäre dort jemand, der mich beobachtete. Einen Zeugen, der mein Richter werden konnte. Ich beugte mich zu ihm herab. Er sah mich aus tief liegenden Augen heraus an. Zunächst verstand ich nicht, was er sagte. Dann schälte sich ein Namens heraus, den er mehrmals wiederholte, er hauchte ihn mehr, als dass er ihn aussprach.
'Joseph.'
Mir graute bei dem Gedanken, irgendetwas bei dem Mann zu finden. Die Besitzurkunde eines Claims, oder gar Fotos. Eine Frau. Geschwister. Eine Familie. Ich zog die Decke etwas enger um ihn, dann legte ich Holz nach. Die Wärme hüllte mich ein. Sie lockte die bereits verloren geglaubten Träume wieder hervor, die wir hatten, als wir in den Norden aufbrachen. Diese Träume waren wieder zum Greifen nahe, während der dunkle, weite Himmel über mir nichts als Leere verbreitete.
Nach einer scheinbar unendlich langen Zeit kam Marvin wieder. Ich hörte das Jaulen der Hunde noch ehe das Gespann um einen sanften Hügel bog.
„Er ist noch am Leben“, sagte ich, als Marvin vom Schlitten stieg.
Er bot an, die nächste Wache zu übernehmen, aber ich lehnte ab, also fuhr er zurück zu unserer Hütte. So blieb ich auch die restlichen Stunden dieser langen Nacht an der Seite des Fremden, lauschte dem Heulen eines Wolfsrudels und beobachtete die grünen Polarlichter, die über dem Klondike tanzten, dessen Eis langsam aufzubrechen begann. Der Winter ging zu Ende. Der Widerschein des grünen Lichts glitt über das bereits brüchige Eis des Flusses und verwandelte die Eisschicht in etwas, das einer anderen Welt angehörte. Der grüne Schimmer lag auch auf dem Gesicht des Mannes. Einen Abglanz davon glaubte ich in seinen Augen zu sehen.
Es war die Kälte, die mich Stunden später langsam aus dem Schlaf holte. Das Feuer war niedergebrannt, bis auf ein paar Glutnester. Es roch scharf nach verkohltem Holz. Ich richtete mich auf. Ein Blick genügte, um zu sehen, dass es vorbei war. Mein erster Gedanke war, dass dieser Fremde lange durchgehalten hatte. Wir hätten die Blutung stoppen können. Die Wunde verbinden. Dann beruhigte ich mich: Wir hätten ihn niemals lebend bis Dawson gebracht. Fast aussichtslos. Fast. Fast.
Einige Sekunden zögerte ich, dann schlug ich die Decke zurück und öffnete seine Jacke. Ich fand einen Brief und eine Uhr, die nicht besonders wertvoll war. Sie war aus vergoldetem Blech gefertigt, doch das Motiv, das den aufklappbaren Deckel zierte, gefiel mir. Es war eine Szene der Bostoner Tea Party, als im Hafen von Boston aus Teekisten ins Wasser geworfen wurden. Ich öffnete den Deckel. Auf der Innenseite waren die Initialen BG eingraviert.
Ein Hinweis auf seinen Namen?
Ich klappte den Deckel wieder zu. Den Brief verbrannte ich in der noch verbliebenen Glut, ohne ihn zu öffnen. An wen er gerichtet war wollte nicht wissen. Hatte er jemandem von seinem Goldfund berichtet? Das alles ging mich nichts an. Mein und sein Leben sollten nichts mehr miteinander zu tun haben. Ich steckte die Uhr ein, dann wartete ich auf Marvin.
*
Gold ist mehr als ein glänzendes Metall, das die Menschen verzaubert. Mehr als Reichtum. Gold bedeutet Leben. Das wahre, schöne Leben. Bunt. Luxuriös. Aufregend. Gold verschafft einem Aufmerksamkeit und Einfluss. Plötzlich legen dir Menschen die Hand auf die Schulter, die dich ohne dein Gold keines Blickes gewürdigt hätten. Als wir im Hafen von San Francisco an Land gingen, stand Leopoldine schon seit einer Stunde auf dem Pier. Ihre Freude war kaum zu bremsen. Bei ihr war es nicht das Gold, das sie so glücklich machte, es war einfach nur die Tatsache, dass sie ihren Mann und ihren Schwager nach so langer Zeit wieder in die Arme schließen konnte.
Das Schicksal hatte es gut mit mir gemeint, als sich der Lebensweg der damals halbwüchsigen Leopoldine Baumgarten mit meinem kreuzte. Leo hatte mich von Anfang an auf eine Art und Weise geliebt, die ich kaum aufwiegen konnte. So viel Liebe ich auch aufbrachte, sie war mir immer ein Stück voraus. Hinzu kam ihre verblüffende Offenheit. Von den ersten Tagen unserer Beziehung an hatte sie keine Geheimnisse vor mir. So erzählte sie mir zum Beispiel, dass ihr Vater Ernie während der ersten Jahre seiner Ehe ein Schürzenjäger gewesen sei. Erst nach einer Fehlgeburt, die Leos Mutter wochenlang ans Bett gefesselt hatte, sei er zu dem aufmerksamen Ehemann geworden, der er heute war. Leo offenbarte mir auch das Geheimnis ihrer ersten großen Liebe. Ein Junge namens Millon. Das Ganze lag etwa acht Jahre zurück. Millon kam oft in den Laden und kaufte Süßigkeiten. Dann stand er an der Tür und sah Leo mit einem aufmerksamen Lächeln an, dabei kaute er seine Karamellbrocken oder seinen Kaugummi. Er sprach nie ein Wort. Millon sprach überhaupt nie, dennoch verliebte Leo sich derart heftig in den Jungen, dass sie ganz krank war, wenn er an einem Tag nicht auftauchte. Irgendwann war Millon schließlich fortgeblieben. Er war mit seiner Mutter nach New Mexiko gegangen, wo ein Onkel von ihm eine Ranch besaß.
„Wenn ich jemanden liebe, Stephen“, hat Leo einmal zu mir gesagt, „dann verliere ich die Kontrolle.“
Damals konnte ich nicht ahnen, wie bitter dieser Satz einmal für mich klingen würde.
*
Marvin und ich gehörten nie zu der Sorte Mensch, die einen plötzlich erworbenen Reichtum sofort in Luxus und Vergnügen auflösten. Wir investierten. Ehe wir investierten, erkundigten wir uns jedoch bei Menschen, die wussten, wo es sich lohnte zu investieren. Zunächst erwarben wir eine der kleineren Villen auf dem Nob Hill, die Leo mit viel Geschmack einrichtete. Die Villa war einerseits unser Begrüßungsgeschenk an sie, andererseits war es unsere erste Investition.
Ende 1897 gaben wir einen Empfang, gewissermaßen als Einweihungsfeier. Wir luden alle ein, die in der Stadt Rang und Namen hatten. Der Erste, der zusagte, war William Randolph Hearst, einer der einflussreichsten Verleger der Stadt. Ich glaube, er hatte an Leo einen Narren gefressen, an ihrem Charme und ihrer Lebensfreude. Es war natürlich kein Zufall gewesen, dass Leo mich begleitete, als ich Hearst die Einladung persönlich überbrachte. Ich wusste natürlich, wie Männer auf sie reagierten. Gerade für ältere Herren war ihre ungezwungene Art ein Jungbrunnen. Als sich herumsprach, dass Hearst an diesem Abend zu uns kommen würde, lagen fast täglich weitere Zusagen im Briefkasten. Unter anderem von Stephen Mallory White, der für Kalifornien im US-Senat saß, und von Ambrose Bierce. Bierce war ein mäßig bekannter Schriftsteller, der für Hearsts 'Examiner' und seine 'Cosmopolitan' schrieb. Außerdem hatte er gute Verbindungen in den Bohème-Club, dessen Mitglied er war.
Der Abend wurde ein voller Erfolg, nicht zuletzt dank der Vorbereitungen, die unter Leos Aufsicht vonstatten gegangen waren. Es war ihre Idee gewesen, mitten im Salon einen größeren Stein zu platzieren. Das Objekt wurde Anlass für viele Gespräche rund um die Goldsuche und die Wildnis des Nordens. An der Wand hing eine Karte von der Gegend am Klondike, in der sich unser Claim befunden hatte. Mir war nicht ganz wohl beim Anblick des roten Kreuzes, das unseren Claim markierte, einem in Wirklichkeit unergiebigen Stück Land, das für Marvin und mich eine einzige Enttäuschung gewesen war. Marvin lächelte, als er die Karte das erste Mal sah, und zwinkerte mir zu. Er schien den Mann vergessen zu haben, der über Stunden sterbend neben mir gelegen hatte.
Wir hatten sogar drei Musiker im Salon, die zum Tanz aufspielten, und die mit Gassenhauern wie 'Upidee', dessen Melodie unüberhörbar von einem Deutschen nach Amerika gebracht worden war, Stimmung machten. Leo tanzte für ihr Leben gern. Sie konnte einfach nicht stillhalten. Kaum wurden die ersten Takte gespielt, war sie auf der Tanzfläche und brachte ihren Tanzpartner ins Schwitzen, leicht wie eine Feder, mit unerschöpflicher Energie. Während die anderen Frauen der höheren Gesellschaft herausgeputzt waren und aufwändige Ballkleider trugen, hatte sich Leopoldine als Hausherrin für ein schlichtes Kleid aus weißer Baumwolle entschieden, dessen einziger Schmuck ein roter Gürtel war, der ihre schlanke Taille betonte.
Jedenfalls führte dieser Empfang später zu einem Briefwechsel zwischen Jane Stanford, der Witwe des Unternehmers Leland Stanford, und mir. Jane Stanford, eine Frau mit markanten, etwas müden Gesichtstzügen, war an jenem Abend bei uns und hatte sich ausgiebig mit Leo unterhalten. Sie besaß umfangreiche Weingüter in Tehema County und half uns bei unseren ersten Investitionen dort. So kam es, dass wir ein knappes Jahr nach unserer Rückkehr aus Kanada Anteile an mehreren Weingütern erwarben. Hinzu kam der vollständige Besitz eines Weingutes in der Nähe von Fairfield, in Solano County. Zu dem Gut gehörte, außer dem Haus der Weingutverwaltung, ein etwas vernachlässigtes Herrenhaus, aus Ziegelstein. Außerdem gab es einen Pferdestall sowie ein paar Hühner und zwei Schafe. Leo schlug vor, das Weingut 'River-Lodge' zu nennen, in Erinnerung an das Blockhaus, in dem Marvin und ich am Klondike gelebt hatten. Sie entwarf auch ein Etikett für unsere Weinflaschen. Es bestand aus einer blauen Linie, die den Klondike darstellen sollte, dahinter erhob sich skizzenhaft ein Gebirgszug. Marvin war sofort einverstanden. Ich zögerte, der Gold-Claim war schließlich eine Lüge, stimmte dann aber doch zu. Leos Begeisterung für das Weingut hatte etwas ungemein Ansteckendes. Dasselbe galt für die Renovierung des Herrenhauses, die wir bald in Angriff nahmen. Wir scheuten keine Kosten, um das Haus innerhalb weniger Wochen nach Leos Vorstellungen zu erneuern. Zeitweilig hatten wir bis zu zwanzig Handwerker vor Ort, die sich nicht selten gegenseitig im Weg standen, bis Leo Ordnung in die Angelegenheit brachte.
Zu den regelmäßigen Gästen in unserer Villa in San Francisco gehörte bald auch ein stadtbekannter Fotograf namens James Adams. Leo war begeistert von seinen Porträts und den Aufnahmen der Stadt, die Adams seit vielen Jahren anfertigte. Also schlug sie nach Abschluss der Arbeiten vor, ein Farbporträt von ihr, Marvin und mir vor dem Herrenhaus von 'River-Lodge' anfertigen zu lassen. Marvin und ich hatten nichts dagegen, und so reiste Adams eines Tages, als wir uns ebenfalls dort aufhielten, mit seiner Ausrüstung ins Solano County. Ich verstand nicht viel von Fotografie. Adams erläuterte die Funktion von Eosinsilberplatten, während er alles vorbereitete, und Leo erzählte mir begeistert, dass James Adams den berühmten Kriegsfotografen Matthew B. Brady noch persönlich kennengelernt habe. Adams lächelte bescheiden und meinte, dass Brady zwar beruflich sein Vorbild sei, aber wahrlich nicht, was das Geschäftliche betraf. Schließlich war der berühmte Brady völlig verarmt in New York gestorben.
Wir drei lächelten in Richtung des Kastens, hinter dem Adams stand. Vornübergebeugt. In einem dunklen Zweireiher. Natürlich konnte Marvin es nicht lassen, Leo am Nacken zu kitzeln, genau in dem Moment, in dem Adams 'Bitte lächeln' sagte. Wir machten also noch zwei weitere Aufnahmen vor der in einem pastellfarbenen Grünton gestrichenen Gebäudefront. Dabei standen wir erneut demonstrativ unter dem neuen Holzschild mit der Aufschrift 'River-Lodge'. Marvin und ich trugen einen Frack und Krawatte, während Leo ein hellblaues Kleid mit weißen Spitzen angelegt hatte. Dazu trug sie einen Strohhut mit einem blauen Band. Wir haben es geschafft, dachte ich damals. Leo, Marvin und ich. Wir hatten es endlich geschafft. Ich konnte nicht ahnen, dass ein Schatten über uns lag. Ein langer, kalter Schatten, der vom Klondike bis in unser neues Leben reichte.
Schließlich reiste Adams wieder ab, ohne dass wir ein Ergebnis seiner Arbeit zu sehen bekamen. Die Abzüge auf Papier würden wir uns in drei Tagen abholen, wenn wir wieder in San Francisco waren. Diese drei Tage auf 'River-Lodge' wurden zu einer Perle in meinem Leben. Drei Tage im Licht einer goldenen Zukunft. So schien es. Leo und ich, wir genossen die langen Spaziergänge durch das Weingut. Marvin kaufte sich einen Schimmel, den er 'Snowboy' nannte. Ein schnelles, intelligentes Pferd, das auf Anhieb Zutrauen zu Marvin fasste und sich von ihm alles fast gefallen ließ. Für 'Snowboy' wurde sogar ein eigener Stall in der Nähe des Herrenhauses errichtet. Marvins Lieblingspferd musste somit seinen Alltag nicht mit den gewöhnlichen Arbeitstieren verbringen. Manchmal kam es mir vor, als würde der Hengst dadurch von Tag zu Tag arroganter. Doch das bildete ich mir natürlich nur ein.
Leo kümmerte sich in Stiefeln und Arbeitshose um die Hühner und die beiden Schafe, während ich Stunden mit unserem Verwalter und dessen Ehefrau verbrachte, um mich über den Weinanbau zu informieren. Ralf Mayer bewohnte mit seiner Frau Alberta ein zweistöckiges Holzhaus auf unserem Grundstück, etwa dreihundert Meter vom Herrenhaus entfernt. Die Stallungen für die Nutztiere und andere Wirtschaftsgebäude befanden sich ebenfalls in der Nähe dieses Hauses der Verwaltung. Hier, wo er auch sein Büro hatte, teilte Mayer die Tagelöhner, die täglich aus Fairfield kamen, zur Arbeit ein.
Marvin, Leo und ich saßen jeden Abend auf der Terrasse des Herrenhauses, im roten Licht der Abenddämmerung und ließen uns Rotwein, Apfelkuchen und deutsches Brot von Mrs. Mayer schmecken, einer drallen Frau mit üppigen Haaren, die sie immer hochgesteckt trug. Anders als ihr Mann hatte sie noch einen harten deutschen Akzent. Alberta Mayer war nicht mehr die Jüngste, das war an den Fältchen in ihrem Gesicht zu erkennen, aber sie war noch immer eine gut aussehende Frau. Am Abend vor unserer Rückkehr nach San Francisco tauchte der Schatten zum ersten Mal auf. Er legte sich über die weiße Tischdecke und über das rubinrote Glühen in unseren Weingläsern, das die untergehende Sonne verursachte. An diesem Abend war ich der einzige, der die Anwesenheit des Schattens spürte.
„Ich hatte gestern einen fürchterlichen Traum“, sagte Leopoldine nach einer längeren Pause, in der jeder seinen Gedanken nachhing. „Ich habe den Deckel einer Taschenuhr geöffnet und plötzlich lief Blut auf meine Hand. Die Rüschen meiner Ärmel färbten sich rot. Ich stellte fest, dass die Uhr stehengeblieben war. Darüber erschrak ich mehr, als über das Blut. Ich weiß nicht warum. Glaubt ihr, dass Träume etwas zu bedeuten haben?“
Ich spürte, wie sämtliche Farbe aus meinem Gesicht wich. Mein Mund stand halb geöffnet, so erschrocken war ich, über das, was ich hörte. Marvin schien Leos Traum nichts anzuhaben. Er lächelte und meinte, sie habe doch gar keine Taschenuhr. Also bräuchte sie sich um den Traum keine Gedanken zu machen. Der Traum habe sich sicherlich nur verlaufen.
„Eigentlich gehört er zu jemandem anderen.“
Leo lachte.
„Der wird ihn wohl nicht vermissen.
Als sie mein Gesicht sah, wurde sie wieder ernst.
„Ich wusste gar nicht, dass du so ein zartes Gemüt hast.“
Ich griff nach dem Weinglas und versuchte zu lächeln.
„Müde“, erwiderte ich. „War ein langer Tag.“
Der Traum ließ mich nicht mehr los. Die ganze Fahrt über, zurück nach San Francisco, dachte ich an die vergoldete Uhr des Mannes vom Klondike. Leopoldine genoss die vorüberziehende Landschaft mit den ausgedehnten Weiden und Weinbergen, während Marvin aufmerksam Hearsts 'San Francisco Examiner' las. Er schien nicht mehr an die Uhr zu denken. Ich bewahrte sie seit meiner Rückkehr in meinem Schreibtisch auf. Im Arbeitszimmer unseres Hauses in San Francisco.
„Hast du die Uhr genauer gesehen?“, hörte ich mich fragen. Meine Stimme klang harmlos, so als wüsste ich im Augenblick nichts, worüber ich sonst mit meiner Frau sprechen sollte.
„Die Uhr?“
„Die Uhr in deinem Traum“, sagte ich. „Hast du auch den Deckel gesehen, oder die Kette?“
Leo sah mich verdutzt an.
„Nein“, sagte sie schließlich. Dann sah sie wieder hinaus auf die Landschaft, die im Licht der Sonne lag wie ein Gemälde von Monet. Die Federn der Kutsche knarrten und die Räder knirschten im Dreck. „Ein wunderbarer Landstrich“, sagte Leo nach einer Weile. „Irgendwann möchte ich weg aus der Großstadt und nur noch hier leben.“
In der Ferne arbeitete sich eine der modernen landwirtschaftlichen Maschinen durch ein Feld und verbreitete schwarze Rauchschwaden, die ein langes Rohr ausstieß. Das Knattern und Dröhnen war von weither zu hören. Eine verrückte Idee. Mit dieser Art von Technik einen Acker umzugraben. Das konnte man mit einem Pferd besser. Ich wollte mich mit diesem Allerweltsthema ablenken, versuchte in Gedanken technische Einzelheiten über diese Maschine zusammenzutragen. Doch der Versuch, mich zu zerstreuen war halbherzig und sinnlos. Der Traum ging mir nicht aus dem Kopf.
Kaum waren wir zurück in unserer Villa auf dem Nob Hill, ging ich in mein Arbeitszimmer. Ich holte die Uhr aus der Schublade, in der ich sie seit unserer Rückkehr vom Klondike aufbewahrte, und öffnete sie. Da ich sie immer aufzog zeigte sie die genaue Uhrzeit an. Ich fuhr mit dem Daumen über die Gravur. BG. Nach einer Weile klappte ich den Deckel wieder zu und legte die Uhr auf den Schreibtisch. Jeder sollte sie sehen. Es gab keine geheimnisvollen finsteren Mächte. Zufall. Leos Traum war purer Zufall gewesen. Ich zwang mich, daran zu glauben. Die Welt war voller Zufälle. Diese simple Erkenntnis beruhigte mich jedoch nicht lange. Genauer gesagt, bis zum nächsten Vormittag, als Marvin und ich zum Laden von James Adams gingen, um die Fotos abzuholen. Adams Gesicht verriet mir sofort, dass etwas nicht stimmte.
„Es tut mir leid, wirklich“, druckste der Fotograf herum. „Das ist mir noch nie passiert. Und ehrlich gesagt, ist es mir unerklärlich. Wirklich. Unerklärlich. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht haben sollte. Ich habe schließlich schon Tausende von Fotos gemacht - “
„Worum geht es, Mr. Adams“, unterbrach ich ihn schroff. Meine Nerven waren überreizt. Ich hatte Angst, Angst vor etwas, von dem ich nicht wusste, was es sein konnte. Doch in dem Augenblick, als James Adams uns den Papierabzug überreichte, wusste ich es. Ich wusste mit einem Mal, worin meine Angst bestanden hatte. Keiner von uns Dreien war zu sehen. Wir waren alle in einem Lichtblitz verschwunden. Auch die Front des Herrenhauses wurde zur Hälfte von dem hellen Licht verschluckt.