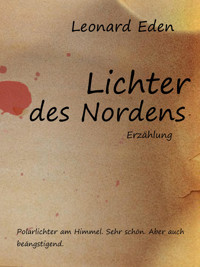
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Philadelphia 1924. Die junge Amy Korczak verliebt sich während ihrer Arbeit für die Heilsarmee Hals über Kopf in den vermeintlich armen Frank Shuman, der mehr als zwanzig Jahre älter ist als sie. Frank hat ein verletztes Bein und braucht Hilfe. Amy kümmert sich um ihn und pflegt ihn. Schließlich geht sie sogar eine sexuelle Beziehung mit ihm ein, die sie vor ihren Eltern geheimhalten muss. Die Gedanken an Frank nehmen bald jeden ihrer Sinne und jede Faser ihres Körpers in Anspruch. Doch dann wird sie mit Franks erschütternder Vergangenheit konfrontiert ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Leonard Eden
Lichter des Nordens
Aus der Reihe: 'Nordlandgold'Band 7 Weitere Titel der Reihe:IcebeardDas Gold des MexikanersHungerWolfsweihnachtDie Fee von NomeDer Mann vom KlondikeInhaltsverzeichnis
Lichter des Nordens
Impressum
Lichter des Nordens
Each passed with a light on his face.Hamlin Garland, Die Goldsucher
Er fiel mir sofort auf. Ich war gerade damit beschäftigt Geschirr abzuräumen, um Platz für die nächsten Bedürftigen zu schaffen, als mein Blick an seiner großen, schlanken Gestalt hängen blieb. Trotz der abgetragenen Kleidung machte er einen außerordentlichen Eindruck auf mich. Vielleicht war es seine Größe, die ihn über die Hüte im Gedränge hinwegsehen ließ, oder die umsichtige Art, wie er an den anderen Stadtstreichern vorbei seinen Weg zu einem freien Platz an einem der langen Tische suchte. Vorsichtig, fast schüchtern, aber zielbewusst steuerte er einen der wenigen leeren Stühle an, seinen Teller in der einen, ein Stück Brot in der anderen Hand. Er hob den Blick nur, wenn es nötig war. Auf seiner alten, an manchen Stellen ausgebesserten Jacke hing noch Schnee, der in der Wärme des weihnachtlich dekorierten Saales bereits zu schmelzen begann.
„Glotz nicht so.“
Ich erschrak bis ins Mark, als mich Miss Travor zurechtwies. Sie nahm mir das Geschirr aus der Hand und brachte es in die Küche. Miss Travor war eine warmherzige, verständnisvolle Person. Eigenschaften die sie gut zu verbergen wusste. Vor allem Menschen gegenüber, die wenig mit ihr zu tun hatten. Sally Travor war eine langjährige Freundin meiner Mutter. Sie beanspruchte an den Wochenenden, an denen sie bei uns war, nicht selten den ganzen Nachmittag über das Teezimmer. Dort, an dem runden mit einer Spitzendecke gedeckten Tisch, wurde vor wenigen Wochen auch die Idee geboren, dass ich während der traditionellen Armenspeisung zu Weihnachten, aushelfen würde. Diese Wohltätigkeitsveranstaltung fand seit Jahren in einem Saal der City Hall statt. Früher hatte ich mir den Umgang mit Männern von der Straße – und es waren überwiegend Männer - nicht zugetraut. Sie waren schmutzig und rochen ziemlich unangenehm. Viele litten an Krankheiten, der Umgangston war rau. Diese Menschen lebten auf den Straßen Philadelphias, unter Brücken, in Armenhäusern und billigen Unterkünften. Viele davon hatten auch schon im Gefängnis gesessen. In aller Regel waren sie in einem erbarmungswürdigen Zustand und hatten dringend Wärme und etwas zu essen nötig. In den letzten Jahren kamen auch immer mehr Schwarze nach Philadelphia, die ihre Wohnorte im Süden verlassen hatten und auf der Suche nach einem besseren Leben in den Norden der Vereinigten Staaten gezogen waren.
Der Mann, der meine Aufmerksamkeit erregt hatte, war frisch rasiert und wirkte trotz der abgetragenen Kleidung einigermaßen gepflegt. Ich schätzte ihn auf Mitte vierzig. Mir war aufgefallen, dass er mit dem rechten Fuß nur vorsichtig auftrat. Er schien Schmerzen zu haben, die er so gut es ging zu verbergen versuchte. Er war sicherlich nicht der einzige, der an diesem Abend medizinische Hilfe nötig hatte, ohne uns darauf anzusprechen. Doch er war der einzige mit dem ich unbedingt sprechen wollte. Der einzige, dessen Nähe ich spüren wollte. Der Zufall gab mir einen kleinen Schubs.
Da eine zierliche Frau mit weißen dünnen Haaren am Kinn gerade aufgestanden war um zu gehen, wurde der Stuhl neben dem Fremden frei. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und steuerte den Tisch an, an dem er saß. Wenn so etwas wie Bestimmung unser Leben leitet, dann war die Tatsache, dass die Frau genau in diesem Moment ihren Platz verließ, ein Zeichen dafür, dass es kein Entkommen gab für uns beide. Für ihn nicht und nicht für mich. Die Frau, die sich eben erhoben hatte, drückte ihren Teller an sich, als hätte sie vor, ihn mitzunehmen. Ich befürchtete, sie würde sich strafbar machen, da sie gerade dabei war, Eigentum der Stadt Philadelphia zu entwenden. Also nahm ich ihr den Teller vorsichtig aus der Hand und wünschte ihr eine gesegnete Weihnachten.
„Ihnen auch, M'am“, sagte sie und offenbarte dabei eine Reihe gelber Zähne und mehrere Zahnlücken. „Ich danke Ihnen für das Essen. Und dass ich mich aufwärmen konnte. Vielen Dank. Der Herr segne Sie und alle anderen.“
Die Frau zog löchrige Handschuhe an und ging Richtung Ausgang. Ich setzte mich an den Tisch. Der Mann löffelte seine Kohlsuppe mit ein wenig Fleisch als Einlage, ohne mich zu beachten.
„Entschuldigen Sie“, sagte ich. „Mir ist aufgefallen, dass Sie hinken.“
Der Mann hielt den Löffel dicht vor seinen Mund und wartete einige Sekunden lang bewegungslos. Dann aß er weiter und nickte. Die anderen Männer am Tisch musterten mich verstohlen. Einige lächelten mich an, als wären wir alte Bekannte.
Ich dachte unwillkürlich daran, dass der Fremde einmal ein stattlicher Kerl gewesen sein musste. Gutaussehend. Seine dunkelblonden Haare waren fettig und von grauen Strähnen durchsetzt. Um die Nase herum hatte er tiefe Kerben. Seine Haut war trocken und schuppig. Die feinen Linien seines Gesichts und das ausgeprägte Kinn ließen allerdings noch etwas von seinem früheren beeindruckenden Aussehen erahnen. Ich muss zugeben, dass ich auf Anhieb mehr als nur Sympathie für ihn empfand. Es war eine Vertrautheit, der ich mich von der ersten Sekunde an nicht entziehen konnte.
„Wie heißen Sie“, fragte ich so unbefangen wie möglich.
Der Mann zögerte, dann sagte er mit etwas heißerer Stimme:
„Frank. Frank Shuman.“
In diesem Moment hörte ich zum ersten Mal Franks Stimme. Ich glaube, mich daran zu erinnern, den Namen wiederholt zu haben.
„Kommen Sie mit, Frank“, sagte ich so bestimmt wie möglich, um meine Gefühle, die gerade damit begonnen hatten Karussell zu fahren, zu überspielen. Außerdem hatte mir Miss Travor eingebläut, mit klarer, fester Stimme zu sprechen, wenn ich mit 'diesen Kerlen', reden würde. Sonst, davon war sie überzeugt, würden die Männer mich unterbuttern und sich auf meine Kosten amüsieren.
Frank nickte. Er wirkte noch immer etwas verschüchtert. Wir standen auf und schoben uns zwischen den Tischen hindurch in die Richtung eines Zimmers, das die Heilsarmee an diesem Abend für dringend notwendige medizinischen Versorgungen eingerichtet hatte. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie der Mann, der uns am Tisch gegenüber gesessen hatte, Franks Teller zu sich heranzog und ihn hastig auszulöffeln begann, so als wäre er sicher, dass die Frauen der Heilsarmee, die an den großen, kochenden Töpfen standen, ihm einen Nachschlag an Kohlsuppe verwehren würden.
Da Dr. Swayer gerade damit beschäftigt war einem dunkelhäutigen Mann mit glasigen Augen eine Wunde am Arm zu verbinden, warteten Frank und ich. Wir saßen nebeneinander auf abgeschabten Holzstühlen, ohne ein Wort miteinander zu wechseln. Ich bemerkte allerdings, dass Frank mich manchmal von der Seite her ansah. So, als wäre er verwundert, dass ich überhaupt mit ihm sprach. Nach etwa fünf Minuten, in denen Dr. Swayer seinem farbigen Patienten noch einige Hinweise für die Versorgung seiner Wunde gegeben hatte, kam zu uns.
„Und was haben wir hier für ein Problem?“, fragte er aufgeräumt. Elenower Swayer war ein Mensch, der sich in fast allen Situationen seine gute Laune zu bewahren wusste. Er war während des Weltkrieges Arzt in Frankreich gewesen, zumindest während der beiden ersten Jahre. In den Schützengräben an der Somme hatte er schreckliche Dinge erlebt, ehe er aus Altersgründen seinen Dienst bei der Army quittieren musste. Nun, im Ruhestand, setzte er seine freie Zeit für die Armen und Ärmsten der Stadt ein.
„Frank hat ein verletztes Bein“, erläuterte ich.
„Ein verletztes Bein“, wiederholte Dr. Swayer, als müsste er den Fall für sich aktenkundig machen.
Er wies Frank an, sich auf die Liege zu legen, die an einer Wand des Raumes stand, neben einem Regal, auf dem Verbandszeug und einige grüne Flaschen mit Lysoform aufbewahrt wurden. Das Desinfektionsmittel stammte aus deutscher Produktion und Dr. Swayer bezog es über persönliche Verbindungen in Frankreich. Meine Aufgabe war nun, da ich Frank in Dr. Swayers Obhut übergeben hatte, erledigt und normalerweise hätte ich den Raum verlassen. Doch ich zögerte.
„Ist noch etwas, Amy?“
Frank war gerade dabei seine Hose und eine dicke Unterhose auszuziehen. Ich schüttelte den Kopf.
„Ich hätte ja nichts dagegen, wenn Sie mir assistieren würden“, ergänzte Dr. Swayer seine Frage und begutachtete dabei Franks Bein, während dieser sich auf der Liege ausstreckte. „Aber ich denke, da draußen wartet jede Menge Arbeit auf Sie.“
„Ich denke auch“, stimmte ich zu.
Dann verließ ich das Krankenzimmer.
Ich nahm die Geräusche im Saal nur noch gedämpft wahr. Das Klappern des Geschirrs, das Gemurmel, das Hüsteln und Schlürfen. Ich dachte an Frank Shuman. Ich fragte mich, wie ich ihn wiederfinden sollte, wenn wir uns heute Abend aus den Augen verloren. Ich musste verrückt sein. Völlig übergeschnappt. Den Rest des Abends rettete ich mich in Arbeit. Ich lachte mit den anderen Frauen, scherzte, schleppte Teller und Besteck, wusch in der Küche ab, wechselte verschmutzte Tischdecken. Ich wollte nicht mehr an Frank Shuman denken und dachte doch den ganzen Abend an ihn.
Als Sally Travor mich Stunden später in ihrem Ford nach Hause brachte, sprach ich kaum ein Wort. Während sie Anekdoten über die eine oder andere Begegnung mit den Armen Philadelphias erzählte, starrte ich durch die Frontscheibe nach draußen, wo die von wenigen Lichtern erhellte winterliche Market Street an uns vorüberzog. Meine Familie wohnte damals in Spruce Hill, in einer Villa mit großem Garten und weißen Erkern. Mein Vater war als einziger noch wach, als ich nach Hause kam. Er saß in seinem Arbeitszimmer, eine Zigarre im Mund, und blätterte in einer Akte. Als ich an diesem Abend ins Bett ging, glaubte ich, Frank Shuman nie wieder zu sehen.
Doch es kam anders.
Am nächsten Tag, wir waren gerade dabei den Saal aufzuräumen und die Dekoration abzunehmen, kam zu meiner Überraschung Frank auf mich zu. Er hinkte noch immer, während er den Saal durchquerte. Ich stieg von der Leiter und legte die Papiersterne, die ich eben abgenommen hatte, auf einen Tisch.
„Guten Tag“, sagte ich. „Ich hoffe, Dr. Swayer konnte ihnen gestern helfen.“
Er fuhr sich mit einer Hand unsicher durch das feste Haar, das aussah, als hätte er es frisch gewaschen.
„Ich wollte mich bedanken.“
„Das sollten Sie bei Dr. Swayer tun“, erwiderte ich. „Falls Sie das nicht schon gestern getan haben. Er ist heute leider nicht da.“
Frank druckste herum, dann rückte er mit der Sprache heraus. Er hatte ein offenes Bein mit eitrigen Wunden. In ein Krankenhaus wollte er auf keinen Fall, das sei ihm zu teuer und Dr. Swayer meinte, dass er ja auch mich fragen könne, ob ich ihm nicht behilflich sein könne. Ich wäre schließlich Krankenschwester und hätte vor Medizin zu studieren. Ich würde mich sicherlich bereit erklären, hin und wieder nach ihm zu sehen. Elenower Swayer hatte ihm meinen Namen genannt, nur den Vornamen natürlich, und ihm mitgeteilt, dass ich heute Nachmittag wieder in der City-Hall wäre um zusammen mit den Frauen von der Heilsarmee den Saal aufzuräumen.
Es war, als hätte jemand ein Eisenband geöffnet, das meine Brust seit dem vergangenen Abend zusammengepresst hatte. Ich stand kurz vor einem befreiten Lachen. Doch über Franks Schulter hinweg sah ich, dass Miss Travor auf uns zukam. Ihr Gesichtsausdruck und ihre Körperhaltung versprachen nichts Gutes.
„Gibt es Probleme, Amy?“, fragte sie streng.
„Alles in Ordnung, Miss Travor“, sagte ich gelöst.
Miss Travor warf Frank einen skeptischen Blick zu und ging dann zu einer Gruppe von Mädchen, die zusammenstanden und schnatterten, um diese wieder an die Arbeit zu scheuchen.
Frank richtete seine grau-blauen Augen wieder auf mich. Sie hatten etwas Klares, Lebendiges, wie frisches Quellwasser in der kargen Landschaft seines Gesichts.
„Er hat mir eine Rolle Verbandsmaterial gegeben und eine Salbe“, sagte er, als wüsste er nichts mit diesen Dingen anzufangen.
Ich stellte klar, dass das mit dem Medizinstudium noch nicht ganz sicher sei. Dann fragte ich Frank, ob er denn eine Unterkunft habe oder obdachlos sei. Zu meiner Erleichterung sagte er mir, dass er in einem Haus in Port Richmond lebe, direkt am Hafen. Mit Blick auf den Delaware River. Das Haus wäre schon ziemlich marode, aber für ihn würde es reichen. Er hatte es vor vielen Jahren erworben.
Ich notierte mir die Adresse und versprach, mit meinen Eltern darüber zu sprechen, ob ich seine medizinische Versorgung übernehmen dürfe. Einen Augenblick lang zögerte Frank und ich hatte den Eindruck, dass er es sich anders überlegt habe. Dann bewegten sich seine Lippen, als würde er etwas sagen, aber es kam kein Ton hervor.
„Ist noch irgendetwas“, fragte ich.
„Danke“, murmelte er.
Er drehte sich um, ohne mich noch einmal anzusehen.
Meine überschäumenden Gefühle wurden langsam von der Realität gebremst. Ein ungutes Gefühl schlich sich in meine Freude. Ich fragte mich, ob ich wirklich zu dem alten Haus am Hafen fahren solle, falls ich die Erlaubnis dafür bekäme. So sehr es mich drängte Frank Shuman wiederzusehen, so deutlich sah ich aber plötzlich auch den Leichtsinn, der damit verbunden war. Doch letztlich überwand ich meine Angst. Denn soviel hatte ich von Sally Travor und ihren Soldatinnen der Heilsarmee gelernt: Wenn du anderen Menschen hilfst, dann ist Gott immer bei dir.
*
Das Weihnachtsfest wurde in meiner Familie damals noch sehr traditionell gefeiert. Meine Mutter schmückte alle Räume mit Kiefern- und Fichtenzweigen und wir zogen unsere schönsten Kleider an. Den ganzen Tag über wurde gefastet, abgesehen von einem kleinen Frühstück, so dass unsere Mutter am Abend um so üppiger auftischen konnte. Hilfreich war dabei, dass wir uns den Nachmittag mit Musizieren vertrieben. Meine jüngere Schwester Dorthy war eine begnadete Klavierspielerin und spielte Stücke von Tschaikowski und Chopin. Zur Belohnung durfte sie dann 'Running Wild' zum Besten geben, einen der größten Hits des vergangenen Jahres. Dorthy hatte eine eigene Klavierversion dazu erfunden, die zwar etwas holprig war, dafür aber ziemlich ausgelassen.
Abends gab es Karpfen und anschließend Piroggen, gefüllt mit Marmelade. Im Wohnzimmer stand ein großer, leuchtender Weihnachtsbaum, unter dem Geschenke lagen. Ein Muss war allerdings auch der Gottesdienst in der berühmten St. Augustin Kirche, zu dem wir im Ford T meiner Eltern fuhren. Danach besuchten wir die Gräber unserer Geschwister. Die Zwillinge Daniel und Josh waren nur wenige Monate nach der Geburt gestorben, während der Älteste von uns, Macin, bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Eine Kutsche hatte ihn überfahren. Macin stand zur Zeit des Unfalls kurz vor seinem zwanzigsten Geburtstag. Er war die Lichtgestalt der Familie Korczak gewesen. Blond, mit geradezu leuchtend blauen Augen. Macin ging auf jeden Menschen zu, als würde er ihn schon seit Jahren kennen. Er konnte nicht nur gut Geschichten erzählen, er konnte auch zuhören und gab jedem Menschen das Gefühl ganz bei ihm zu sein. Macin war der Held meiner Kindheit.
Um so unerwarteter war für uns alle die Art, wie er ums Leben kam. Der Unfall geschah, als Macin betrunken die Straße überquerte. Es war frühmorgens gewesen, im Winter. Der Kutscher des Kohlewagens war zu spät zur Arbeit gekommen und trieb die Pferde nun schneller an, als es erlaubt war. Macin ist ihm direkt in das Gespann gestolpert, als er um eine Ecke bog. Es stellte sich heraus, dass mein Bruder irgendwann damit begonnen hatte ein Doppelleben zu führen. Er trank, nahm Kokain und trieb sich in Kneipen herum, an die ein anständiger Mensch nicht einmal zu denken wagte. Kneipen, in denen Männer gezielt nach Männern suchten. Macin, der immer weiße Anzüge trug, verwandelte sich in manchen Nächten, wie wir später erfuhren, in einen Straßenjungen mit Baumwolljacke und Schlägermütze. Diese Verwandlung geschah in der Wohnung eines Freundes, der allerdings nicht viel davon erzählte. Wir wollten auch nicht mehr darüber wissen. Zu unserer Erleichterung fragte auch kaum jemand nach. Offensichtlich hatte niemand Interesse daran, den Ruf unserer Familie zu zerstören.
Jedenfalls sprach ich mit meinen Eltern über Frank Shuman und mein Vater meinte, dass er damit einverstanden wäre, wenn ich mich um den Mann kümmern würde. Ich spürte, dass mein Vater stolz auf mich war, auf mein soziales Engagement und auf die Tatsache, dass ich keine Berührungsängste mit Menschen aus der untersten sozialen Schicht hatte. Aussprechen musste er diese Empfindungen nicht. Ich spürte sie. Mein Vater sprach nur selten über Gefühle. Meine Mutter stimmte ihm zu, hatte aber mehr Bedenken.
„Wir kennen diesen Frank Shuman doch überhaupt nicht“, meinte sie, als wir, eingewickelt in unsere Mäntel, auf dem Rückweg vom Friedhof durch einen dichten Vorhang aus Schneeflocken zu unserem Automobil gingen. Der Pelzkragen des Mantels meiner Mutter war mit Schneeflocken bedeckt und auch der dunkle Wollmantel meines Vaters hatte weiße Flecken, genauso wie sein schwarzer Hut. Dorthy ging dicht hinter uns und ich spürte förmlich, wie sie mit großen Ohren der Unterhaltung lauschte.
„Ich habe Sally gebeten, einige Erkundigungen einzuholen“, warf mein Vater ein. „Ich denke, morgen erfahren wir mehr.“
„Kommt morgen Miss Travor?“, fragte Dorthy genervt.
„Ja, Dorthy. Und ihr sitzt alle mit am Teetisch.“
Ich konnte es zwar nicht sehen, aber ich wusste, dass Dorthy die Augen verdrehte.
„Weihnachten könnte so schön sein“, hörte ich ihre Stimme. Aber da war ich in Gedanken schon wieder bei Frank Shuman. Ich fragte mich, was für ein Mensch er wohl sein mochte. Was für ein Leben es war, das die tiefen Falten in sein Gesicht gegraben hatte. Weshalb war er so einsam? Seine Einsamkeit schien mir offensichtlich zu sein, und sie machte ihn um so hilfsbedürftiger.
*
Es stellte sich am nächsten Tag heraus, dass es nicht sonderlich viel war, was Sally Travor über Frank Shuman herausgefunden hatte. Sie wusste nur, dass er ein altes Haus am Hafen besaß und dort seit fast zwanzig Jahren alleine lebte. Es gab ein Gerücht, das besagte, dass er einige Jahre in Kanada gelebt und um die Jahrhundertwende herum sein Glück als Goldsucher in Alaska versucht habe. Allem Anschein nach gab es in ganz Philadelphia niemanden, der Genaueres über Frank wusste.
„Letztlich fragt der Herr nicht nach unserem Namen und er sucht auch nicht in unserer Vergangenheit herum“, sagte Miss Travor und biss ein Stück von einem der selbstgebackenen Plätzchen ab, die sie mitgebracht hatte. Sie trug noch immer die altmodischen Humpelröcke, die wie Bandagen am Körper anlagen und die die Beinfreiheit unangenehm einschränkten. Meine Eltern waren in Kleidungsfragen Gott sei Dank immer aufgeschlossen gewesen. Dorthy und ich duften schon sehr früh moderne Röcke und Kleider tragen, manchmal auch Hosen. Seit einem Jahr ließ ich mir sogar die Haare kurz schneiden und wagte mich mit einem Bobschnitt auf die Straße. Dorthy war damals neidisch. Ihr erlaubte unsere Mutter nur den 'falschen Bob' mit hochgesteckten Haaren.
„Hältst du es unter diesen Bedingungen für richtig, wenn Amy ihn besucht?“, fragte meine Mutter und stellte ihre Teetasse ab.
„Da ist guter Rat teuer, Alinka“, seufzte Miss Travor. „Ich weiß nur, dass unser Herr Jesus Christus keinen Winkel dieser Welt scheuen würde, um zu helfen. Keinen Schmutz und keine Gefahr.“
„Amy ist nicht Jesus“, piepste Dorthy die bisher ausschließlich mit den Plätzchen beschäftigt gewesen war.
„Dorthy“, sagte meine Mutter scharf.
Dorthy zog den Kopf ein und holte sich ein neues Plätzchen vom Weihnachtsteller.
„Ich werde euch jedes Mal Bescheid geben, wenn ich zu ihm fahre“, sagte ich.
Miss Travor nickte.
„Und du sagst ihm, dass deine Eltern jederzeit wissen, wo du bist.“
Meine Mutter wirkte etwas bedrückt.
„Vielleicht sollte jemand mit ihr gehen?“, sagte sie.
„Ich komm mit“, rief Dorthy mit großen Augen. „Dann sind wir schon zu zweit. Was will er da noch ausrichten?“
„Ich kann auf mich alleine aufpassen“, stieß ich hervor und entschuldigte mich gleich darauf für den Tonfall.
Meine Mutter ging auf Dorthys Angebot nicht ein, so abwegig war es.
„Dr. Swayers Neffe hat versprochen, ein Auge auf Shuman zu werfen“, versuchte Miss Travor meine Mutter zu beruhigen. „Dann ist er jedenfalls vorgewarnt.“
Colby Swayer war gerade dabei, Karriere bei der Polizei in Philadelphia zu machen. Sein Onkel war mächtig stolz auf ihn und scherzte nicht selten mit seinen Verbindungen zur Stadtpolizei.
'Wenn ich mal mit ein paar Flaschen Hochprozentigem erwischt werde, dann kostet mich das keinen Cent', gab er manchmal zum Besten. „Vorausgesetzt, Colby hat zur richtigen Zeit am richtigen Ort Dienst. Und vorausgesetzt, er hat gute Laune.'
Der Hinweis auf die Polizei beruhigte meine Mutter ein wenig. Meine Bedenken waren ohnehin schwächer, als die überraschend starken Gefühle, die ich von Anfang an für Frank Shuman empfunden hatte. Außerdem sah ich, dass Dorthy mich um mein kleines Abenteuer beneidete, was das Kribbeln in meinem Bauch nur noch verstärkte.
Als der entsprechende Tag kam, fuhr ich mit der Market-Frankford-Linie, der Untergrund- und Straßenbahn von Philadelphia in Richtung Hafen und legte den restlichen Weg zu Fuß zurück. Mein Vater hatte mir bisher ein eigenes Automobil verwehrt. In dieser Hinsicht war er etwas altmodisch. Er war der Meinung, dass es uns Korczaks gut anstand, die öffentlichen Transportmittel zu benutzen oder zu Fuß zu gehen. Er selbst nahm ebenfalls häufig die öffentlichen Verkehrsmittel, um ins Büro zu kommen.
Meine Erwartungen bezüglich des Hauses von Frank Shuman waren nicht besonders groß. Als ich jedoch davor stand, glaubte ich in einen Abgrund von Armut zu blicken. Das Holzhaus mit dem Giebel und der Veranda stand etwas abseits der anderen Wohnhäuser in der Nähe einiger langgezogener Lagerschuppen, die in den Delaware hinausreichten. Ich wusste, dass mehrere dieser Schuppen entlang des Hafenbeckens den Lencias gehörten, einer befreundeten Familie. Und ich spürte plötzlich, wie groß die Barriere war zwischen der Gesellschaftsschicht, der ich angehörte und der Welt Frank Shumans.
Shumans Haus hatte einen kleinen Vorgarten. An einer Seite stand ein morscher Apfelbaum im Schnee, der aussah, als wäre er nur vorhanden, um das Haus in der Zeit des Verfalls und des Niedergangs zu begleiten. Mittlerweile lag der Jahreswechsel einige Tage zurück und ich hatte mich bei Frank Shuman schriftlich über einen Botenjungen angemeldet. Ein Telefon besaß er nicht.
Das hüfthohe Gartentor quietschte in den Angeln, als ich es mit einem Gefühl der Beklommenheit im Herzen aufschob. Die Platten des Gehweges waren zerbrochen und mit Matsch bedeckt. Ich stieg die Treppe zur Veranda hoch und klopfte an die Tür. Es dauerte eine Weile, ehe Shuman öffnete. Er sah mich stumm an. Er trug dieselbe ausgebeulte Hose und dieselbe abgetragene Jacke wie an dem Tag, als ich ihn das erste Mal sah, und er roch nach einer Mischung aus Schweiß und Alkohol. Der Alkoholgeruch überraschte mich damals nicht. Die seit gut drei Jahren geltende Prohibition hatte für viele dem Alkohol verfallene Männer kaum etwas geändert.
„Ich habe etwas aufgeräumt“, sagte Frank, ohne mich in irgendeiner Weise begrüßt zu haben.
„Schön“, meinte ich so unbefangen wie möglich. „Darf ich reinkommen?“
Shuman machte mir etwas linkisch Platz und ich trat in eine schlichte Diele, in der neben zwei altern Schränken, ein Tisch mit drei Stühlen sowie ein eiserner Ofen zu sehen waren. Der Ofen verbreitete eine angenehme Wärme, unterlegt vom gelegentlichen Knacken der brennenden Holzscheite. Die Bodenbretter waren fleckig, wirkten aber robust. Auf dem Tisch stand eine Petroleumlampe, daneben eine Blechkanne mit einem dünnen Hals, in der sich vermutlich das Petroleum befand. Shuman schloss die Tür hinter mir und ich muss zugeben, dass das einschnappende Türschloss eine gewisse Panik in mir auslöste. Ich drehte mich schnell um. Da die Fenster ziemlich schmal waren und die nahen Hafengebäude einen Teil des ohnehin spärlichen Sonnenlichts schluckten, war es unerwartet düster in dem Raum.
„Wollen Sie etwas trinken?“
„Ich habe leider nicht viel Zeit.“
Shuman entzündete die Lampe und setzte sich. Dabei fiel mir auf, dass er noch immer Schwierigkeiten hatte, das Bein zu belasten.
„Die Polizei war hier“, sagte er und seine Stimme hatte plötzlich einen Anflug von Härte.
Ich dachte an Miss Travors Ratschlag und antwortete mit fester Stimme.
„Vielleicht verstehen Sie ja, dass meine Eltern sich Sorgen machen, wenn ich alleine hierherkomme.“
„Der Verband und die Salbe sind oben, im Schlafzimmer“, erwiderte Shuman ohne auf meine Bemerkung einzugehen.
Er ging die Treppe vor mir nach oben, wobei er nur mühsam auftrat, und führte mich in ein Zimmer, in dem ein Bett und ein Schrank standen. Das Zimmer war etwas kleiner, als die Diele im Erdgeschoss. Die Wände waren mit alten Streifentapeten tapeziert. Gelbe, rote und grüne Streifen, abgeschabt und blass.
„Wollen Sie das Schlafzimmer verlassen, wenn ich die Hose ablege?“, fragte Shuman und seiner Stimme war anzuhören, dass er mit der Situation nicht richtig umzugehen wusste.
„Ich bin Krankenschwester“, sagte ich. „Zumindest habe ich Erfahrung darin. Und Sie sind mein Patient.“
Nachdem Shuman sich seiner Hose entledigt hatte, nahm ich den alten Verband ab und besah mir die Wunden. Sein ganzes Bein war befallen. Insgesamt waren es fünf offene Stellen.
„Den Verband habe ich schon einmal erneuert“, sagte Shuman. „Ich hätte ihn eigentlich auskochen müssen. Das hat der Doktor gesagt. Aber das habe ich noch nicht gemacht.“
Ich hatte einen neuen Verband und eine Flasche Lysoform bei mir. Außerdem eine Heilkräuter-Tinktur aus der Apotheke, eine Mischung, auf die unsere Großmutter geschworen hat. Frank Shuman ließ die Prozedur klaglos über sich ergehen. Er fragte mich ein paar Mal, ob die offenen Wunden gefährlich für ihn werden könnten und ich antwortete etwas flapsig, dass Vieles im Leben gefährlich werden könne.
„Wenn die Wunden in den nächsten Wochen regelmäßig versorgt werden, dann bekommen wir das Ganze schon in den Griff“, versuchte ich ihm schließlich Mut zu machen.
„Ihr Doktor in der City Hall wusste nicht so recht, woher diese Löcher stammen“, beschwerte sich Shuman über Dr. Swayer. „Wofür ist er eigentlich Arzt geworden?“
Als wir wieder unten in der Diele waren, setzte ich heißes Wasser auf, um den verschmutzten Verband auszukochen. Es stellte sich heraus, dass dieses in der Hafengegend vergessene Haus zwar keinen Stromanschluss, aber immerhin fließendes Wasser hatte, was Shumans Lebensumstände in ein erträglicheres Licht rückte. Jegliches Gefühl in Franks Nähe nicht sicher zu sein, war inzwischen verschwunden. Frank Shuman war ein kranker Mann, der niemanden hatte, der sich um ihn kümmerte. Und ich war nur zu gerne bereit, diese Aufgabe zu übernehmen.
„Warum sind Sie eigentlich nicht verheiratet?“, fragte ich.
„Sie könnten mich fragen, warum ich trinke. Stattdessen fragen Sie mich, warum ich nicht verheiratet bin“, sagte er ruhig.
Ohne genau zu wissen weshalb, fühlte ich mich ertappt. Ertappt bei allem, was ich nicht denken, nicht fühlen, nicht fragen durfte.
„Also gut“, sagte ich so gelassen wie möglich. „Warum trinken Sie?“
Er lachte heiser.
„Sind Sie wirklich Krankenschwester?“, fragt er.
Ich stand noch immer neben dem eisernen Holzofen, als wäre meine Anwesenheit dort nötig, um das Wasser, in dem der mit Eiter und Salbe verschmierte Verband schwamm, zum Kochen zu bringen. Mir wurde klar, dass Frank Shuman nur etwas über sich preisgeben würde, wenn ich auch etwas von mir preisgab. Also erzählte ich ihm, dass ich als Krankenschwester gearbeitet hätte, weil ich der Überzeugung wäre, dass der Dienst an kranken Menschen etwas sehr Wichtiges sei. Und dass ich tatsächlich mit dem Gedanken spielte, Medizin an der Universität von Philadelphia zu studieren.
„Auf der anderen Seite“, fuhr ich fort. „hat mein Vater mehrere Kurzwarengeschäfte. Auch hier, im Stadtteil Port Richmond existiert eins. Sie haben es vielleicht schon gesehen. 'Kurzwaren Korczak'.“
„Korczak. Das ist Ihr Vater?“, fragte Shuman überrascht. „Er hat überall Läden.“
„Es sind nur drei. Hier in Philadelphia.“
Ich begann mit einem Kochlöffel den Verband im heißen Wasser zu drehen.
„Letztes Jahr haben wir zwei neue Geschäfte in New York eröffnet“, erzählte ich und hatte das eigenartige Gefühl, mich bei ihm interessant machen zu müssen. „Insgesamt sind es somit fünf Geschäfte, die sehr gut gehen. Da es in unserer Familie aber keinen Stammhalter mehr gibt, stellt sich die Frage, ob meine Schwester Dorthy und ich in das Geschäft mit einsteigen. Vielleicht auch nur eine von uns beiden.“
„Gab es denn einen Stammhalter?“
„Meine Eltern hatten außer meiner Schwester und mir noch drei Söhne. Zwei starben kurz nach der Geburt. Macin, mein älterer Bruder, starb bei einem Unfall.“
Der Verband drehte sich in dem heißen Wasser und ich sah Macin vor mir, so wie er sich in meine Erinnerung eingegraben hat. Immer lachend, zuvorkommend und gutaussehend. Ich dachte zu dieser Zeit häufig an ihn, daran, was aus ihm hätte werden können, wenn er ein normaler Junge gewesen wäre.
„Mein Bruder trank zu viel“, sagte ich. „Der Alkohol hat ihn das Leben gekostet.“
„Der Alkohol ist nur ein Mittel zum Zweck“, meinte Shuman.
Damit hatte er recht. Die düsteren Dämonen, die Macins Leben zerstört hatten, waren j nicht so konkret wie Kokain und Alkohol. Doch sie waren womöglich mächtiger. Es war einfacher, die Sucht dafür verantwortlich zu machen. Tante Wlada war Zeit ihres Lebens der Meinung, dass der Teufel Macin verführt habe. Es war das erste Mal, dass ich einem Fremden gegenüber so offen über Macin sprach und es zeigt mir bis heute, was für eine Nähe ich von Anfang an Frank gegenüber empfand - und was für ein Vertrauen ich in ihn hatte.
„Sind Sie Katholikin?“, fragte Shuman. „Hier wimmelt es von Polen. Allesamt Juden oder Katholiken.“
Port Richmond war ein überwiegend von Polen bewohntes Viertel, was Shuman offensichtlich nicht gefiel.
„Meine Familie kommt aus diesem Viertel“, gestand ich. „Ich hoffe, Sie werfen mich nicht raus, nur weil ich Katholikin bin. Meine Eltern halten sich noch an manche Traditionen, aber wir gehören nicht zu den engstirnigen Katholiken.“
„Mein Vater war Calvinist“, sagte Shuman. „Streng und ungerecht.“
Wir schwiegen eine Weile. Shuman schien über irgendetwas nachzudenken. Ich spürte eine gewisse Spannung, die von ihm ausging.
„Wie lange wohnen Sie schon hier?“, fragte ich schließlich.
Shuman stöhnte, während er das kranke Bein auf einen Stuhl hob.
„Sehr lange“, sagte er und fragte dann unumwunden: „Wann kommen Sie wieder?“
„In den nächsten zwei Wochen ist es wichtig, den Verband häufig zu wechseln“, sagte ich. „Wie wärs mit Montag, Mittwoch und Freitag. Jeweils nachmittags. So wie heute. Um 14.00 Uhr. Falls Sie an diesen Tagen Zeit haben.“
Er bejahte die Frage, kaum, dass ich sie ausgesprochen hatte.
Ich wollte Frank schon fragen, wie er seinen Lebensunterhalt bestritt und ob er Bekannte oder Verwandte in der Stadt habe, konnte meine Neugierde im letzten Augenblick aber noch zügeln. Ich war hier, um ihm zu helfen, nicht um in seinem Leben herumzuschnüffeln. Wenn es wirklich einen Gott gibt, der uns beobachtet, und daran habe ich nie gezweifelt, dann war er in diesem Moment sicherlich entsetzt von seiner Dienerin Amy Korczak. Unter dem Vorwand der Fürsorge für einen Kranken suchte ich die Nähe eines Mannes. Mir war damals sehr wohl bewusst, auch wenn ich es mir noch nicht vollständig eingestand, wie sehr ich Frank Shuman begehrte. Meine Seele begehrte ihn, aber auch mein Körper. Es war, als hätte sich etwas Fremdes in mir breit gemacht, das meine Gedanken und Wünsche bestimmte.
Als wir uns bereits verabschiedet hatten und ich dabei war, den Vorgarten zu durchqueren, rief Frank mir etwas hinterher, einen Satz, der sich wie ein spitzes Messer durch meinen Mantel hindurch direkt in meine Brust bohrte.
„Ich trinke, weil ich nie jemanden gekannt habe wie Sie, Amy.“
Ich blieb für einige Sekunden stehen und wir sahen uns an. Ich glaube, wir spürten in diesem Moment beide, dass etwas begonnen hatte. Damals konnte ich allerdings noch nicht wissen, wie weit ich gehen und worauf ich mich bald einlassen würde.
*
David Darius Lencia, von allen nur DD genannt, kannte ich, seit wir Kinder waren. Mein Vater war mit DD's Vater zur Schule gegangen. Beide stammen wie ihre Frauen aus polnischen Einwandererfamilien und hatten sich aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet. Während mein Vater mit Kurzwaren Erfolg hatte, hatte sich DD's Vater mit einem Speditionsunternehmen etabliert. Anfang der Zwanziger Jahre gehörten der Familie Lencia mehrere Lagerhallen am Hafen. Außerdem belieferte ihre Spedition von Philadelphia aus Teile von Pennsylvania und New Jersey mit Lebensmitteln und allerhand anderen Gütern. Dafür waren einige Dutzend Lastwagen, Drei- und Fünftonner, im Einsatz.
DD und ich teilten eine Leidenschaft: Das Reiten. Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter - wir liebten es beide über Wiesen und durch Wälder zu galoppieren und die Freiheit zu genießen, die einem nur der Rücken eines Pferdes bieten konnte. Dafür holte mich DD hin und wieder mit seinem zweisitzigen Abbott F ab, der aussah wie ein Spielzeugrennwagen. Wir fuhren dann zum Landhaus der Lencias, das in der Nähe von Rockledge lag, einem eintausend Seelen Dorf, nicht weit von Philadelphia entfernt. Antek und Julka, DD's Eltern, lebten fast nur noch dort und hielten sich ein halbes Dutzend Reitpferde. Ihr Stadthaus in der Lombard Street in Society Hill diente DD als Studentenwohnung und war so etwas wie ein Gästehaus für Freunde und Geschäftspartner aus dem ganzen Land geworden. In Rockledge hatten wir vor gut einer Woche auch an dem großen Neujahrsball teilgenommen, zu dem Antek und Julka jedes Jahr einluden. Das Buffet war wie immer exquisit gewesen und im großen Salon hingen zwei Kronleuchter mit elektrischem Licht. Auf der Terrasse hatte Julka Papierlampen mit Kerzen aufgehängt
Am Tag nach meinem ersten Besuch bei Frank Shuman waren DD und ich wieder einmal nach Rockledge gefahren, doch diesmal spürte ich, dass etwas anders war als sonst. DD war befangen und wirkte sehr bemüht. Er war aus unerfindlichen Gründen nervös. DD hatte sich gut mit meinem Bruder Macin verstanden. Die beiden steckten früher oft zusammen. Und obwohl DD nicht gerne über Macin sprach und ich ihm jedes Wort über meinen Bruder aus der Nase ziehen musste, färbte Macins Glanz lange auf DD ab. Dabei waren die beiden sehr unterschiedlich. Nicht nur äußerlich. Macin war gutaussehend gewesen, DD hatte ein langes, blasses Gesicht.





























