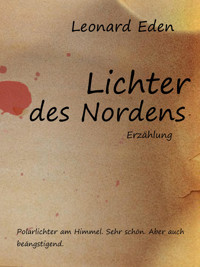0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sommer 1903. Zusammen mit seinem Freund Peter hat Roul Haskins in Nome, Alaska, Gold gefunden. Doch Peter betrügt ihn und macht sich mit dem gesamten Ertrag aus dem Staub. Da lernt Roul, kurz vor seiner Abreise, die zwölfjährige Polly kennen. Das Mädchen verspricht ihm seinen Partner und das Gold ausfindig zu machen. Doch bald muss Roul feststellen, dass Polly McIntry selbst in großen Schwierigkeiten steckt. Und noch etwas: Das Mädchen entwickelt romantische Gefühle für ihn, was den jungen Mann in eine schwierige Lage bringt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Leonard Eden
Die Fee von Nome
Aus der Reihe: 'Nordlandgold'Band 5 Weitere Titel der Reihe:IcebeardDas Gold des MexikanersHungerWolfsweihnachtDer Mann vom KlondikeLichter des NordensInhaltsverzeichnis
Impressum
No longer of fortune the fool .. Hamlin Garland, Die Goldsucher
Eigentlich war Polly McIntry wie jedes zwölfjährige Mädchen. Aufmüpfig, ein wenig altklug und voller Träume. Mit ihren kurzen rotblonden Haaren, dem schmalen Körper und den frechen Augen konnte man sie für einen Jungen halten, und so benahm sie sich auch. In einer Stadt wie Nome war das ein Vorteil, vor allem an den Abenden, an denen sie in Dusty's Saloon arbeitete, unter Abenteurern und Kriminellen aus aller Welt. Eine Kundschaft, die in aller Regel wenig Taktgefühl hat.
Ich würde gerne wissen, was aus Polly geworden ist, ob sie in Nome geblieben ist oder die Goldgräberstadt verlassen hat. Vielleicht hat sie das Sägewerk ihres Vaters übernommen, oder sie hat mit irgendeinem der jungen Glücksritter ein Geschäft eröffnet. Polly und ich, wir waren wie zwei Schiffe, deren Wege sich auf dem Meer kreuzen. Für einen kurzen Augenblick hatten wir jeweils Teil am Leben des anderen, ehe wir uns wieder auf den Weg machten. Jeder auf seinem Kurs, das eigene Schicksal als Gepäck und die eigenen Sehnsüchte als Kompass.
Natürlich war Polly in einer Situation, in der man sich Sorgen um sie machen musste, und das habe ich auch reichlich getan. Aber irgendetwas in mir sagt mir, dass sie es geschafft hat, denn sie war nicht nur eine Fee, die den Anspruch hatte, anderen Menschen, wo immer sie konnte, zu helfen. In ihrem irischen Körper steckte auch ein kleine Raubkatze. Schlau und stark, wenn es darauf ankam. Ich habe sie manchmal in ihren Augen aufblitzen sehen, dieses Raubkatze. Dann wusste ich: Polly McIntry wird so schnell nicht untergehen. Sie hatte gelernt zu kämpfen. Aber vielleicht habe ich sie damals auch überschätzt. Vielleicht war sie wirklich nur ein zwölfjähriges Mädchen, das ihre Ängste und Unsicherheiten mit der magischen Kraft ihrer Wunschstäbe zu beherrschen versuchte.
Angefangen hat alles mit einem Betrug. Der Betrüger war mein bester Freund Peter und der Betrogene war ich. Das alles spielte sich vor vielen Jahren im Sommer des Jahres 1903 ab. In Alaska, wohin Peter und ich aufgebrochen waren, um, wie Zehntausende anderer Glücksritter, nach Gold zu suchen. Wir hatten in diesem Jahr beide unser Studium in San Francisco beendet. Peter stammte aus einer wohlhabenden Familie von Anwälten, folglich ist auch er Anwalt geworden. Er sah seinem Vater bereits erstaunlich ähnlich, trotz des Altersunterschiedes von mehr als dreißig Jahren. Wie die Haare seines Vaters befanden sich auch Peters Haare bereits auf dem Rückzug, dazu kam eine eher stämmige Figur.
Für mich war die Welt des gehobenen Bürgertums, die ich durch Peter kennengelernt hatte, eine neue Erfahrung. Ich bin in Seattle geboren und aufgewachsen, einer eher armen Stadt. Mein Traum war es immer gewesen, Medizin zu studieren. Bereits als Kind hatte ich viel Elend gesehen. Armut. Krankheiten, die nicht behandelt wurden. Meine kleine Schwester Pia war mit fünf Jahren an Typhus gestorben. Meine Eltern hatten einfach nicht die Mittel, sie medizinisch ausreichend zu versorgen. Pias Tod war ein Einschnitt in unser Leben, der sich der ganzen Familie tief eingeprägt hat.
Zurück zu den Ereignissen des Jahres 1903. Einige Wochen nachdem wir die Universität erfolgreich beendet hatten, schlossen Peter und ich uns den Goldsuchern an, die damals bereits seit Jahren in den Norden strömten. Nach Alaska und Kanada. Wir hatten uns in den Kopf gesetzt, uns das Startkapital für unser künftiges Berufsleben auf den dortigen Goldfeldern zu besorgen. Ein ordentlicher Goldfund würde die ersten Jahre unserer Selbständigkeit deutlich erleichtern. Das Leben hält schließlich alle möglichen Unwägbarkeiten bereit. Eine Portion Abenteuerlust allerdings war auch mit im Spiel.
Im Juni erreichten wir auf einem Segelschiff Nome. Hier auf der Seward Halbinsel hatten im September 1898 zwei Schweden und ein Norweger am Anvil Creek einen sagenhaften Goldfund gemacht. Die Gerüchteküche besagte damals, dass das Gold in Cape Nome am Strand herumliegen würde und dass man sich nur zu bücken bräuchte, um es aufzusammeln. Später stellte sich heraus, dass das Gerede etwas übertrieben war. Die meisten Goldsucher konnten das begehrte Metall dem Boden Alaskas nur mit viel Aufwand und Schinderei entreißen. Viele der Glücksritter gingen sogar vollkommen leer aus.
Als Peter und ich dort eintrafen, war die Stadt ein unübersichtliches Gebilde aus Zelten, Hütten sowie ein- bis zweistöckigen Holzhäusern. Auch der Strand Richtung Cape Rodney war mit Zelten bedeckt, die zwei bis drei Meilen in das hügelige Land um Nome hineinreichten. Es waren die Unterkünfte von Goldsuchern, Prostituierten und Geschäftemachern. An den Ufern standen bereits die berüchtigten Eisenmonster, die Sand aus dem Meer baggerten, um der Natur noch den letzten Rest des begehrten Edelmetalls abzutrotzen. Wir übernahmen einen Claim westlich von Nome am Penny River, den drei junge Männern aus Australien zum Verkauf anboten. Sie wollten zurück in ihre Heimat. Ein Jahr waren sie in Alaska gewesen und hatten nichts gefunden. Nun hielten sie das unwirtliche Klima nicht mehr aus. Unser Plan war es, die Abstützung der Seitenwände, die die Australier ziemlich schlampig angebracht hatten, stabiler zu machen und dann noch einige Meter tiefer zu gehen, auch wenn das hieß, bis zu den Knien im Grundwasser zu stehen, das man nie vollständig abpumpen konnte. Für diese Vertiefung des Schachtes mussten wir uns hohe Stiefel und wärmende Unterwäsche besorgen. Zuvor aber wollten wir die Grube zu erweitern. Ein Problem dabei war der Permafrostboden. Zunächst musste ein Feuer gemacht werden, um die Erde aufzutauen.
Es mag unglaublich klingen, aber das Wunder geschah. Binnen weniger Monate wurden Peter und ich zu wohlhabenden Männern. Der Claim war nach seiner Vergrößerung überraschend ergiebig. Wir gehörten somit zu den Auserwählten, und das in einer Zeit, in der die Anfänge des Goldrausches am Cape Nome schon mehrere Jahre zurücklagen. Bereits im August hatten wir genug Gold gefunden, um in Zukunft ein materiell sorgenfreies Leben führen zu können. Nach kurzer Zeit war das Goldvorkommen allerdings wieder versiegt und wir buddelten uns die Finger wund für zehn Cent am Tag. Also beschlossen wir Nome wieder zu verlassen und in die Zivilisation zurückzukehren. Peter Freyman und Roul Haskins. Zwei erfolgreiche Glücksritter.
Wir mieteten eine Bretterbude am westlichen Stadtrand von Nome, nicht weit vom Snake-River entfernt, und verkauften unsere Ausrüstung, um den Eindruck zu erwecken, dass wir Geld benötigten für die Schiffsfahrkarte nach Seattle. Schließlich sollte sich unser Goldfund nicht herumsprechen. Aus Angst, dass man uns hier in Nome – wo Korruption in den letzten Jahren an der Tagesordnung gewesen war – übers Ohr hauen würde, wollten wir das Gold nicht auf eine Bank bringen, sondern mit nach Kalifornien nehmen. Es war der 29. August, ein mit über 50 Grad Fahrenheit für die dortigen Verhältnisse warmer Tag. Die Sonne schien aus einem fast wolkenlosen Himmel, obwohl der August auf der Halbinsel eigentlich ziemlich verregnet ist. An solchen Tagen wurde deutlich, weshalb man Nome auch die 'weiße Stadt' nannte. Die Zelte, von denen die Siedlung durchsetzt war, und die sich in ihrem Umland ausgebreitet hatten, schimmerten hell im Licht der Sonne und erinnerten Veteranen des Bürgerkrieges nicht selten an ein Militärlager.
Peter wollte zum Büro der Schifffahrtsgesellschaft, um die Schiffskarten für die 'C. D. Lane' zu besorgen. Sie sollte uns wieder nach Kalifornien bringen. In der Zwischenzeit brachte ich unser einziges Pferd, Wilhelm, einen Grauschimmel, zu seinem neuen Besitzer, einem Schmied, der erst vor wenigen Wochen nach Nome gekommen war. Peter hatte Wilhelm aus San Francisco mitgebracht, da Pferde in Nome deutlich teurer waren als in Kalifornien. Als ich jedoch zurück zur Hütte kam, war der Bretterboden aufgebrochen. Die Pokes, die handlichen Wildlederbeutel, in denen sich unser Gold befand, waren verschwunden. Geblieben war mir nur die Goldwaage, mit der wir unseren Fund erst vor wenigen Tagen redlich in zwei Teile geteilt hatten. Peter hatte auch seine privaten Habseligkeiten mitgenommen, was darauf hindeutete, dass er nicht vorhatte, wieder in unserer Hütte aufzutauchen. Der Kerl hatte mich hereingelegt. Ihn durch die zuständigen Behörden suchen zu lassen war aussichtslos. In Nome herrschte damals ein endloses Kommen und Gehen von allen möglichen Leuten. Die Bevölkerung war auf deutlich mehr als zehntausend Menschen angestiegen. Die Durchsetzung von Recht und Gesetz in dieser Region hatte sich in den zurückliegenden Jahren als enorm schwierig erwiesen. Doch auch wenn der Arm des Gesetztes hier in der Wildnis Alaskas stärker gewesen wäre: Ich hätte beweisen müssen, dass mein Geschäftspartner mir meinen Anteil gestohlen hatte. Eine äußerst schwierige Angelegenheit, denn niemand außer Peter und ich wusste schließlich, wie viel Gold wir besaßen. Peter hätte sich zudem als Anwalt selbst verteidigen können, während ich tief in die Tasche hätte greifen müssen für einen Rechtsbeistand. Angesichts der vielen Unwägbarkeiten, die noch herrschten, trotz der neuen Gesetze, die von der Regierung in Washington für dieses Territorium erlassen worden waren, wäre ein juristisches Vorgehen damals eine riskante Sache gewesen.
Mir war elend zumute. Ich konnte es nicht fassen. Zwei Tage lang verließ ich die Hütte kaum und hoffte, entgegen jeder Vernunft, darauf, dass mein Freund und Partner zurückkam. Dass er mich um Verzeihung bat. Dass er einfach durchgedreht und nun wieder zur Vernunft gekommen war. Dieser Diebstahl passte nicht zu Peter, den ich immer für einen aufrechten, gesetzestreuen Menschen gehalten hatte. Doch ich musste mich damit abfinden: Mein vermeintlich bester Freund hatte mich bestohlen.
Durch den Verkauf von Wilhelm hatte ich Gott sei Dank etwas Bargeld in der Tasche. Der Grauschimmel war zwar nicht mehr der jüngste gewesen, so dass der Preis, den ich erzielt hatte, nicht besonders hoch ausgefallen war, aber mit dem Geld konnte ich mich für einige Zeit über Wasser halten. Für die nächste Monatsmiete reichte es und für etwas zu essen. Die Fahrkarte für die Schiffspassage zurück nach Seattle musste ich mir allerdings erst verdienen.
Zunächst überlegte ich, eine Arztpraxis in Nome zu eröffnen. Mir fehlte allerdings jegliche Ausrüstung dafür. Und selbst wenn ich diese irgendwie auftreiben würde, hätte ich zunächst eher unregelmäßige Einnahmen. Einen weiteren Winter wollte ich aber auf keinen Fall in Nome verbringen. Ich wollte weg. Nur noch weg.
Am zweiten Tag nach Peters Verschwinden ging ich in Dusty's Saloon. Der Saloon war eine Börse für alles. Hier hörte man die neuesten Gerüchte über vermeintliche Goldfunde oder erfuhr von Claims und vielen anderen Dingen, die zum Verkauf angeboten wurden. Natürlich konnte man hier auch etwas über Jobs erfahren. Ich stellte mich also an die Theke, bestellte ein Bier und hörte mich nach Arbeit um. Es war noch nicht viel los. Das Klavier war verwaist. Einige Leute spielten Karten. An der Theke standen vier Männer und starrten auf ihre Gläser. Trotzdem hatte ich Glück. Es war Dusty Monroe, der Wirt persönlich, der mir einen Tipp geben konnte.
„Ich denke, Polly hat da was für dich“, grunzte er, während er einige Flaschen in die Regale räumte.
Er verschwand im hinteren Bereich des Saloons und rief nach Polly. Sein Tonfall war dabei wenig freundlich. Kurz darauf kam er mit einem etwa zwölfjährigen Mädchen zurück in den Schankraum. Sie war angezogen wie ein Junge. Die Hose war allerdings etwas zu groß und die hellgrüne Jacke war an manchen Stellen geflickt. Das weiße Leinenhemd hatte auch schon bessere Tage gesehen. Und die klobigen Schuhe sahen aus, als hätte das Mädchen sie einem Goldsucher abgeknöpft.
„Mr. Haskins sucht Arbeit“, grunzte der Wirt. „Dein Vater braucht doch Leute.“ Dusty sah mich an, ohne eine Antwort des Mädchens abzuwarten. „Ihr Vater ist John McIntry. Das Sägewerk draußen vor der Stadt gehört ihm. McIntry. Du hast bestimmt schon davon gehört.“
Hatte ich tatsächlich. Also wandte ich mich an die Kleine.
„Meinst du, ich könnte bei euch arbeiten?“
Polly verzog den Mund. Wie sich später herausstellte, tat sie das immer, wenn sie sich unsicher fühlte.
„Wenn du arbeiten kannst, dann hat er bestimmt was für dich“, sagte sie etwas naseweis. „Gestern haben sich zwei Männer aus dem Staub gemacht. Wenn ich sage arbeiten, dann meine ich aber auch arbeiten. Baumstämme schleppen und auseinander sägen.“
Dusty empfahl mir, bei McIntry nachzufragen und widmete sich dann wieder seinen Gästen. Polly gab mir ein Zeichen, als hätte sie das Sagen in diesem Saloon. Sie ging zu einem abseits in einer Ecke stehenden Tisch und setzte sich. Ich folgte ihr und setzte mich ihr gegenüber.
„Weißt du, wo unser Sägewerk ist?“, fragte sie.
Selbstverständlich wusste ich es. Jeder in Nome kannte das Werk. In aller Regel hatte es aber wenig Sinn, dort nach Arbeit zu fragen. McIntry war bekannt dafür, immer genug Männer an der Hand zu haben.
„Dann werde ich morgen mal bei deinem Vater anfragen.“
Polly nickte.
„Tu das. Ich lege ein gutes Wort für dich ein.“
Ich ließ meinen Blick durch den etwas heruntergekommenen Schankraum gleiten.
„Was macht ein Mädchen in deinem Alter in einem Saloon?“, fragte ich.
„Arbeiten.“ Polly kratzte sich unter dem Kinn. „Wenn ich zu Hause fertig bin, dann kann ich mir hier was verdienen. Die Hälfte bekommt mein Vater.“
„Und was arbeitest du hier?“
Polly zog die Augenbrauen nach oben und sah für einen Moment tatsächlich aus wie ein Kind.
„Den Spucknapf auswischen, die Tische saubermachen, Waren einräumen. Die Flaschen und so. Gläser spülen. Hin und wieder mache ich auch Besorgungen für irgendjemanden.“ Sie runzelte die Stirn und funkelte mich an. „Glaub ja nicht, dass du auf mich aufpassen musst.“
„Wie kommst du denn darauf?“
Sie sah auf den Boden und schlug mit dem Absatz gegen die Stuhllehne.
„Hast du irgendetwas Nützliches gelernt?“, fragte sie und es klang, als hätte sie diese Frage irgendwo aufgeschnappt.
„Ich habe Medizin studiert“, erwiderte ich. „In San Francisco. An der UCSF, der Universität von Kalifornien.“
Polly verzog für einen Moment anerkennend das Gesicht. Dann nickte sie.
„In Nome gibt es keine Universität“, sagte sie und es klang, als würde sie das ziemlich bedauern.
„Polly.“
Dustys Stimme schlug in unserer Ecke auf wie ein zu hart geschlagener Baseball.
„Wir sehen uns ja noch“, meinte Polly und trollte sich hinter den Tresen, wo der Wirt auf sie wartete.
Das war meine erste Begegnung mit Polly McIntry. Mir fiel auf, dass sie sich auf dem Weg zu Dusty einmal kurz umdrehte. Sie sah mich mit einem kleinen Lächeln an, von dem ich erst viel später erfuhr, was es bedeutete.
Am selben Tag noch machte ich mich auf den Weg zum Sägewerk. Die Straße dorthin war gut befestigt, wenn sie auch von Fuhrwerken und Pferdehufen gezeichnet war. Das Sägewerk lag ein Stück weit den Snake-River hinauf, ein Fluss, der seinen Namen den vielen Windungen verdankte, die an eine Schlange erinnerten. Das Gebäude bestand aus einem langgezogenen, breiten Holzbau, in dem eine Gattersäge sowie eine Bandsäge untergebracht waren. Beide Sägen waren hochmoderne mit Dampf angetriebene Maschinen. Nicht weit davon entfernt befand sich ein großer Holzlagerplatz, auf dem mehrere Dutzend Baumstämme ordentlich gestapelt auf ihre Weiterverarbeitung warteten. Dazu kam ein ziemlich heruntergekommenes Wohnhaus mit einer angegliederten Scheune, in der sich auch ein Pferdestall befand.
Eine Handvoll Arbeiter, die sich um ein leeres Fuhrwerk herum versammelt hatten, um Brot zu Essen und Bier zu trinken, schickten mich auf die andere Seite des Gebäudes. Dort traf ich John McIntry, der sich gerade mit einem Kunden unterhielt. Der Mann hatte eine Ladung Baumstämme vom Hafen zum Sägewerk gebracht. McIntry war ein großer, stämmiger Kerl, dessen Unterkiefer so ausgeprägt war, dass man ihm zutraute, damit Paranüsse zu knacken. Es ging ein eigenartiges Gefühl des Misstrauens und der Gewaltbereitschaft von ihm aus, das mich von Anfang an einschüchterte. McIntry sah mich an und zuckte unwirsch mit dem Kopf, was ich als Aufforderung verstand, ihm zu sagen, weshalb ich das Gespräch mit seinem Kunden zu stören wagte.
„Mr. McIntry?“, fragte ich so selbstbewusst wie möglich, obwohl kaum ein Zweifel daran bestand, dass der ungeduldige kräftige Mann der Besitzer des Sägewerks war.
„Was gibts?“
„Ich habe gehört, dass Sie Arbeiter suchen.“
„Stimmt“, sagte er. „Gestern sind zwei verschwunden. Sind Sie der Kerl aus Dusty's Saloon?“ McIntry spuckte auf den Boden, die groben Hände fest in die Hüften gestützt. „Polly sagt, sie wären harte Arbeit gewohnt.“
Polly hatte also tatsächlich ein Wort für mich eingelegt.
„Ich habe monatelang auf einem Claim geschuftet“, erwiderte ich. „Außerdem habe ich schon häufiger in einem Sägewerk gearbeitet.“
Er lachte spöttisch.
„So sehen Sie nicht aus.“
Ich war kurz davor auf dem Absatz kehrt zu machen und keinen Gedanken mehr an McIntry zu verschwenden. Doch mein Stolz hielt mich davon ab: Ich wollte nicht kleinbeigeben. Und ich brauchte das Geld.
„Das war während meines Studiums“, erwiderte ich, ohne den kräftigen Mann aus den Augen zu lassen. „Das Werk war deutlich größer als dieses hier.“
Der Kunde, der bisher schweigend zugehört hatte, kratzte sich am Kopf und sah betreten zu Boden.
„Was sind Sie von Beruf?“, fragte McIntry und es klang, als hätte er mich aufgrund meiner unverschämten Bemerkung schon abgeschrieben.
„Arzt“, sagte ich prompt. „Ich habe mein Studium letztes Jahr abgeschlossen.“
In McIntrys Augen leuchtete etwas auf. Seine trockenen Lippen, die dick waren wie Weinbergschnecken, verzogen sich zur Andeutung eines Lächelns.
„Wenn Sie dazu bereit sind, sich neben der Arbeit um die medizinische Versorgung meiner Leute zu kümmern“, meinte McIntry etwas gönnerhaft. „Dann werde ich es mit Ihnen versuchen. Über die Höhe des Lohns reden wir, wenn Sie ein paar Tage für mich gearbeitet haben.“
Ich nickte.
„Abgemacht. Aber Sie bezahlen mich rückwirkend.“
Noch immer wich ich seinem Blick nicht aus.
„Werden Sie nicht unverschämt“, raunzte McIntry. „Dann sagte er etwas leiser. „Abgemacht.“
Er wandte sich ohne ein weiteres Wort um und sprach wieder mit seinem Kunden.
„Einigen wir uns auf fünfhundert. Mein letztes Wort.“
Der Mann warf mir einen verstohlenen Blick zu, dann hielt er McIntry die Hand hin.
„Fünfhundert.“
Ich fasste den Verlauf des Gespräches so auf, dass ich gleich mit der Arbeit beginnen konnte. Also ging ich zurück zu den Männern, die ich angetroffen hatte. Sie waren gerade dabei, einen drei Inch dicken Stamm auf dem Vorschub der Gattersäge auszurichten.
„Wer ist hier der Vorarbeiter?“, fragte ich.
Einer der Männer wandte sich mir zu. Er hatte schwarze, mit grauen Strähnen durchsetzte Haare und ein Gesicht, das Falten warf wie eine Gebirgslandschaft. Seine Haut war auffallend dunkel. Er stellte sich als Beto Pelosi vor.
„Du jetzt arbeiten hier?“
Pelosi grinste. Dem Dialekt nach war er Italiener.
„Ich wurde soeben eingestellt.“
„Dann stehen nicht rum“, erwiderte Pelosi und grinste noch ein wenig breiter.
Sein Brot in einem Sägewerk zu verdienen ist kein Vergnügen. Die körperliche Arbeit, der Lärm, die herumfliegenden Sägespäne. McIntry hatte nicht ganz unrecht gehabt, als er die Frage aufgeworfen hatte, ob ich für diese Art von Arbeit überhaupt geschaffen war. Doch meine Erfahrung half mir. Während des Studiums hatte ich häufiger in einem Sägewerk nahe San Franciscos ausgeholfen und konnte dabei vor allem den Umgang mit Gattersägen lernen. Die Abläufe in einem Sägewerk waren mir also vertraut, und so konnte ich von Anfang an ordentlich mit anpacken. Am Abend machte ich mich dann müde auf den Weg zurück zu meiner Bretterbude.
Nicht weit entfernt von den ersten Häusern Nomes traf ich auf Polly. Sie saß am Ufer des Snake Rivers, vor sich eine selbstgebastelte Angel. Neben ihr lag ein zu klein geratener Collie. Die beiden sahen mir aufmerksam entgegen.
„Hallo“, sagte ich.
Polly grinste.
„Ist die Dampfmaschine ausgefallen?“
„Wie kommst du darauf?“
„Du siehst aus, als hättest du die Gattersäge mit deinen Händen angetrieben. Völlig fertig.“
„So fühle ich mich auch“, lächelte ich.
„Wie heißt du eigentlich?“, fragte Polly.
„Haskins. Roul Haskins.“
Sie knabberte auf ihrer Unterlippe herum und betrachtete ihre Angel, als hätte sie einen Fehler entdeckt.
„Abends, nach der Arbeit im Saloon, darf ich immer fischen gehen“, sagte sie schließlich. „Manchmal fange ich auch etwas.“
Sie zeigte mit der Angel auf den Hund. „Das hier ist übrigens Spänchen. Er ist aus unerfindlichen Gründen zu klein geraten. Aber er ist ein richtiger Kumpel. Mein Vater wollte ihn schon erschießen, weil er angeblich kein normaler Hund ist. Aber ich habe mich vor ihn gestellt. Dann hätte er mich gleich mit erschießen können.“
„Dein Vater ist ein ziemlich ruppiger Kerl“, sagte ich.
Ich weiß nicht warum, aber ich hatte das Gefühl, dass ich ihr das sagen konnte. Doch Polly ging nicht auf diese Bemerkung ein.
„Wenn ich einen Fisch fange“, erzählte sie stattdessen, „dann nehme ich ihn gleich an Ort und Stelle aus. Ich hole die Innereien heraus und schneide ihm den Kopf ab. Dann kratze ich die Schuppen herunter.“ Sie sah mich schief an. „Ich würde auch Schlangen fangen, wenn es sein müsste.“
„Das glaube ich dir“, erwiderte ich. „Du wirkst ziemlich tough.“
Sie grinste erneut.
„Das muss ich sein“, sagte sie im Brustton der Überzeugung.
Ich setzte mich zu ihr. Polly drehte sich sofort dem vorüberziehenden Fluss zu, so als würde sie meine Nähe verunsichern.
„Hast du Geschwister?“, fragte ich.
Polly schüttelte den Kopf.
„Und du?“
Ich erzählte ihr von meiner Schwester Mary, die sich vor wenigen Monaten verlobt hatte, und von meinen Brüdern Glenn und Scott. Glenn war reisender Händler. Scott arbeitete bei der Fischereipolizei.
„Wenn ich alt genug dafür bin“, meinte Polly gedankenverloren, „dann kaufe ich mir vielleicht einen Fischtrawler. Dann verdiene ich mein Geld mit Fischen. Ich bin den ganzen Tag auf dem Meer und niemand sagt mir, was ich zu tun habe.“
„Willst du nicht eines Tages das Sägewerk übernehmen?“
„Das verkaufe ich“, sagte sie. „Das Wohnhaus lasse ich abreißen und baue an der Stelle ein Waisenhaus. Es gibt so viele Kinder ohne Eltern. Die sind verdammt arm dran.“
„Wo ist eigentlich deine Mutter?“
Polly zögerte ein wenig mit der Antwort.
„Dad sagt, dass sie uns sitzen gelassen hat. Er sagt, dass wir ihr gleichgültig sind. Aber das glaube ich nicht. Sie hatte bestimmt etwas zu erledigen. Etwas, das für die ganze Welt wichtig ist. Ich kann mich jedenfalls kaum an sie erinnern. Nur an ihre Stimme und daran, dass sie herrliche Plätzchen backen konnte. Für Dad ist das anders. Ich glaube, er trinkt so viel, weil er sich so verletzt fühlt. Aber sie musste eben gehen. Sie konnte es sich nicht aussuchen. Wenn man eine große Aufgabe hat, dann ist das so.“
„Was, glaubst du, hatte sie denn zu erledigen?“
Polly zuckte mit den Schultern.
„Das ist ein Geheimnis. Ich werde wohl nie dahinter kommen. Aber ich hab so meine Vermutungen.“
Polly inspizierte ihren Fischhaken. Die Angel war durchaus geschickt angefertigt worden und man konnte damit sicherlich etwas anfangen.
„Wie lange seid ihr schon hier, in Nome?“, fragte ich.
„Als wir hierher kamen hat es kaum ein Dutzend Häuser gegeben. Da war ich aber noch ziemlich klein. Wir haben vorher in Sitka gelebt. Aber daran erinnere ich mich kaum noch. Dad hatte da auch ein Sägewerk. Deshalb kann er auch ein wenig russisch.“
„Lebst du mit deinem Vater alleine?“, fragte ich.
Sie nickte.
„Bist du aus San Francisco?“, fragte Polly, während sie weiter den Fischhaken untersuchte, der aus einem gebogenen Nagel bestand.
„Aus Seattle“, sagte ich.
Sie wandte mir überrascht den Kopf zu.
„Seattle?“
„Sagt dir das etwas?“
Sie erzählte mir, dass ein gewisser Reverend Brower, der letztes Jahr für ein paar Monate hier in Nome gewesen war, ihr von Seattle erzählt habe. Der Name Brower sagte mir tatsächlich etwas. Es gab eine Familie Brower in Seattle, die einen Priester in der Familie hatte. Ich kannte die Browers aber nicht näher.
„Reverend Brower hat gesagt, dass die Stadt schon mehrmals abgebrannt ist“, meinte Polly etwas abschätzig. „Ich würde niemals in einer Stadt bleiben, in der es dauernd brennt. Da kann man doch keine Nacht ruhig schlafen.“
„Es gab Brände“, versuchte ich die Sache richtigzustellen. „Aber Seattle ist nie ganz abgebrannt.“
„Außerdem gab es da mal ein Stadtviertel, in dem es vor Typhus- und Cholerakranken nur so wimmelte“, ergänzte Polly ihre Vorbehalte gegen meine Heimatstadt.
Ich erzählte ihr, dass meine Schwester Pia mit fünf Jahren an Typhus gestorben sei. Polly verzog das Gesicht.
„Siehst du“, meinte sie, als müsste sie mich warnen.
„Für mich ist Seattle trotzdem die schönste Stadt der Welt“, sagte ich. „Meine Heimat. Ich werde auch dorthin zurückgehen.“
„Was machst du dann hier in Nome?“, fragte Polly und sah mich mit ihren wasserblauen Augen an, als gäbe es ein großes Geheimnis, das ich ihr anvertrauen könnte. In gewisser Weise gab es auch ein Geheimnis. Eine Weile überlegte ich, ob ich ihr die Wahrheit sagen sollte. Dann entschied ich mich, es zu tun. Peter hatte jedes Recht auf Verschwiegenheit verspielt.
„Ich hatte mit einem Freund zusammen einen Claim“, sagte ich. „Am Penny River. Stell dir vor, wir haben tatsächlich Gold gefunden.“
Pollys Gesicht hatte inzwischen nicht mehr diesen skeptischen Ausdruck, der ein Teil ihres Wesens zu sein schien. Ihre Gesichtszüge waren während unserer Unterhaltung weich geworden und in ihren Augen stand eine Neugierde, wie sie nur Kinder an den Tag legen können. Bei der Erwähnung meines Goldfundes wurden ihre Augen schmal.
Sogar Spänchen hob den Kopf.
„Viel Gold?“, fragte sie.
„Sehr viel Gold“, erwiderte ich.
Polly spitzte den Mund.
„Dann bist du also stinkreich.“
„Sagen wir: Wohlhabend. Aber das ist vorbei.“
„Warum?“
„Mein Partner hat mich betrogen. Genauer gesagt: Er hat mich beklaut. Bist du schon einmal von deiner besten Freundin beklaut worden?“
„Ich habe nur wenige echte Freunde“, sagte Polly kühl. „Aber denen vertraue ich. Sie wickelte die Schnur um die Angel. „Wie heißt er denn, der Schuft?“
„Peter Freyman. Er ist Anwalt. Wir sind beide kurz nach Abschluss unseres Studiums hierher gekommen.“
„Wie ist es denn an der Universität?“, fragte sie unwillkürlich.
„Man muss viel lernen.“
„Ich könnte mir vorstellen, Geologin zu werden“, meinte Polly aufgeräumt.
„Weißt du überhaupt, was das ist“, fragte ich. „Ein Geologe?“
„Ich habe mal einen kennen gelernt. So ein Geologe kennt sich mit Steinen aus. Man ist den ganzen Tag in der Natur, untersucht den Boden und die Steine. Ein Geologe weiß genau, wie alt ein Stein ist und wo welche Bodenschätze zu finden sind. Aber man muss dafür leider studieren.“
„Ich dachte, du wolltest mit einem Trawler aufs Meer hinausfahren?“
„Das kann ich ja trotzdem.“
„Um zu studieren müsstest du eines Tages von hier weg.“
Polly verzog den Mund und nickte stumm.
„Ich werde ihn für dich suchen“, sagte sie plötzlich.
„Wen?“
„Deinen Partner. Den Betrüger. Und ich finde ihn. Ganz bestimmt. Ich kenne eine Menge Leute hier. Und die kennen wieder eine Menge Leute. Wenn ich den Schuft aufgetrieben habe, dann holst du dir dein Gold wieder.“
„Wie soll das gehen?“, fragte ich. „Soll ich mich mit ihm prügeln? Vielleicht sollte ich die ganze Sache einfach vergessen.“
„Nein“, rief Polly. „Auf keinen Fall. Das ist dein Leben, Roul Haskins. Sein Leben darf man sich von niemandem zerstören lassen.“
Es lagen so viele ehrliche Gefühle in ihrem plötzlich Ausbruch, dass ich gar nicht anders konnte, als ihr Angebot anzunehmen.
„Das würdest du für mich tun?“, fragte ich mit einem Lächeln im Gesicht.
Polly senkte den Blick. Sie zog die Augenbrauen nach oben und versuchte so gleichgültig wie möglich zu wirken.
„Für meine Freunde tue ich alles“, sagte sie leise, in einem Tonfall, als wären wir die besten Kumpels. „Das kann Spänchen bestätigen. Nicht wahr, Spänchen?“
Der Hund wackelte mit dem Schwanz und jaulte.
Polly schlang die Arme um die Beine und sah auf den Snake River hinaus. An ihrem Hals waren rote Flecken zu sehen.
„Du hast recht“, sagte ich so aufgeräumt wie möglich.