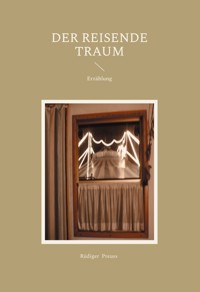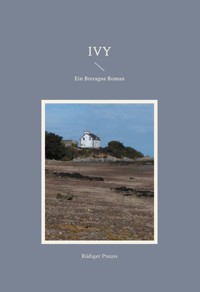Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Daniel, der fast 14 Jahre alt ist, lebt im Löwengruben-Mief der 1960er Jahre auf dem Land, wo bei so manchem die Ahnengalerie lehmverschmierter Gummistiefel mindestens bis ins Mittelalter reicht. Wenn der Vater vom Krieg spricht, dann sind es keine Geschichten. Er spricht von seinem Kameraden Max Lenard, der immer irgendetwas zum Essen organisieren konnte und nach dem Krieg nach Amerika ausgewandert ist. Kurz vor der ersten Mondlandung kommt Max tatsächlich zu Besuch, " direkt aus Amerika in die Gartenzwergwelt unseres Vorgartens". Endlich findet Daniel in Max einen väterlichen Freund, dessen Leben nicht Alltagstrott und Biederkeit ist, sondern tiefsinnige Gespräche, in denen Freiheit denkbar ist. Max erzählt vom Märchenfischer, dem Schöpfer, der in jedem Wasser wohnt, und wird selbst zu einem solchen. Er fischt Daniel aus der Grube der Langeweile und gibt ihm den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
1
Ich hörte von dem Märchenfischer, lange bevor er in unser Dorf kam. Damals war er natürlich nicht der Märchenfischer, sondern nur ein Mann, den mein Vater aus dem Krieg kannte und der eine Art Freund oder gar ein Lebensretter für meinen Vater bedeutete, ein Mann, der aus dem Osten stammte und über unzählige Fähigkeiten verfügen sollte.
Er hieß Max Lenard und es gab ein Foto, das zeigte ihn und meinen Vater, wie sie dicht nebeneinander auf einem grauen Kasernenhof standen und schüchtern in die Kamera lächelten.
Die Art, wie sie dastanden, offenbarte eine Nähe zueinander, die mich überraschte. Auch das Aussehen meines Vaters ließ mich erstaunt auf die vergilbte Aufnahme starren. Er war ein schlanker, gutaussehender Kerl mit scharfen Gesichtszügen und fast athletischem Körperbau.
Später sah mein Vater ganz anders aus, so wie ich ihn bis zu seinem Tod in Erinnerung behalten sollte, mit Halbglatze und breitem Gesicht und mit der Halbkugel des sogenannten Wohlstandbauches. Es hatte nur weniger Jahre bedurft, um aus dem jungen, hübschen Mann, der noch etwas Offenes und Abenteuerlustiges im Blick hatte, den aufgeschwemmten, selbstzufriedenen Bürger zu machen, als den ich ihn kannte.
Mein Vater schaute sich das alte Foto gern an, weniger jedoch, um sich selbst zu betrachten, sondern eher seinen Kriegskameraden. Tief gebeugt konnte er es minutenlang ansehen, völlig abwesend, während meine Mutter, die neben ihm auf dem Sofa saß, verlegen zur Seite schaute oder in Illustrierten blätterte, ganz so, als sei ihr die Vergangenheit peinlich. Bevor er das Fotoalbum zuklappte und in einer Schublade der Kommode verstaute, sang mein Vater stets das Loblied auf seinen ehemaligen Gefährten.
„Er konnte jeden Weg finden, sogar in der Nacht. Er sah alles, wie eine Eule.“
Meine Mutter schlug gelangweilt die Seiten um.
„Er konnte Fische fangen, mit der bloßen Hand. Er konnte immer etwas zu essen auftreiben.“
Meine Mutter versank im Gesicht eines Filmschauspielers, der ganzseitig abgebildet war, und seufzte.
„Und wenn es nichts gab, absolut nichts, dann konnte er aus Schnee einen Kuchen backen.“
Mein Vater lachte leise auf.
„Und nach dem zweiten Stück glaubte man wirklich, Schokolade und Sahne zu schmecken.“
Er warf meiner Mutter einen schnellen Seitenblick zu, aber seine Frau blieb unbeeindruckt von der Schneetorte, legte die Zeitung auf den Tisch und ging in die Küche.
Ich fragte natürlich, was aus diesem seltsamen Menschen, aus diesem Alleskönner, denn geworden sei. Warum kam er nie zu Besuch? Warum kam er nie in unser Dorf, nach Dagehusen?
War er vielleicht tot, im Krieg gefallen oder an einer schrecklichen Krankheit gestorben? Mein Vater sah durch mich hindurch und schüttelte den Kopf. Er schien sich anzustrengen.
„Nein, nein. Er lebt nicht hier, er ist weggegangen, weit weg.“
„Wohin denn?“
„Nach Amerika“, antwortete mein Vater.
Daraufhin zeigte er mir eine andere Aufnahme von Max Lenard und die war jünger. Sie zeigte ihn vor einem stattlichen Haus mit Treppenaufgang und Säulen, die mit Efeu berankt waren. Er stand davor wie ein stolzer Besitzer, kaum verändert, nur etwas grauhaarig. Mein Vater erklärte, dass müsse wohl das Haus seines Freundes sein, in Amerika hätten sie ja alle solche großen Häuser, so wie sie auch größere Autos fahren und breitere Straßen haben. Dieses Bild schaute er nie lange an, sondern legte es schnell ins Album mit den anderen Fotos zurück. Mehr erfuhr ich nicht.
„Du bist zu jung für solche Dinge“, sagte mein Vater.
Eine Zeitlang träumte ich von Amerika. Nicht von den Städten, obwohl viele immer an die Städte dachten, an New York mit seiner Musik, die hinauf zu den Wolkenkratzern klang, an das goldene San Francisco mit der roten Hängebrücke über dem blauen Wasser, an New Orleans mit seinen französischen Vierteln und den Jazzkapellen in schwüler Nacht.
Auch ich war gefangen vom Glanz der Millionen Lichter, vom Lärm der wimmelnden Straßen, in denen jeder eine glorreiche Zukunft hatte, aber nach dem Gespräch mit meinem Vater hatte ich andere Träume, die weiß Gott woher kamen, aus einem unbekannten Land. Wale mit buckligen, bewachsenen Rücken tauchten am frühen Morgen dicht neben meinem Bett auf. Meine Fußspuren waren vom Schnee verweht. Ich schlief unter Fellen im Kiefernwald und eine hochgereckte Wolfsschnauze heulte in die Nacht hinein. Ich wachte auf und wusch mein Gesicht im eisigen Wasser eines glasklaren Sees.
Manchmal tauchte ein fremder Mann in meinen Träumen auf, unwirklich und fern wie das Land. Mal hatte er das Gesicht des fremden Soldaten, dann sah er wieder meinem Vater ähnlich.
Am Morgen war alles wie immer. Ich schaute durch das Dachfenster meines Zimmers hinaus. Da waren die roten Dächer der Höfe. Auf den Feldern humpelten Saatkrähen. An der Dorfstraße standen die Linden und Eichen. Ein Traktor rumpelte vorbei. Der Fluß strömte durch die Wiesen, auf denen Kühe weideten.
In der Küche klapperte Geschirr. Meine Mutter war wie immer beschäftigt mit Aufräumen und Putzen. Mein Vater würde gerade das Haus verlassen und mit zwei anderen Männern zusammen zur Arbeit fahren.
Der Himmel über der Dachluke war hell und sommerlich. Ich hatte Ferien. Amerika war weit weg.
Ich vergaß es. Ich vergaß auch Max Lenard. Bis zu dem Tag, an dem er zu Besuch kam, ohne Ankündigung. Er kam einfach zu uns, so selbstverständlich, als käme er mal eben aus dem Nachbardorf auf einen Kaffee vorbei.
2
Meinem Vater gehörte ein beträchtliches Stück Land am Fluss und ein Teil des Waldes. Am Seeufer lag auch eine Hütte, in der früher Waldarbeiter und Knechte während der Sommerarbeit lebten. Es war nicht mehr als ein Holzhaus, ein Unterstand für Arbeitsgerät, zerrissene Netze, Aalreusen und Holzvorräte. Es gab zwei oder drei Pritschen mit übel riechenden Decken, einen wackligen Schrank mit ein wenig Essgeschirr, und einen bauchigen Ofen mit Eisentürchen. Etwas abseits befand sich die Außentoilette. Ich hatte dort Zeitungen gefunden, die viele Jahre alt waren.
Die Hütte gehörte mir. Ich hatte mich selbst zum Besitzer gemacht. Wenn ich auf dem wackligen Stuhl am Tisch saß und durch die halbblinden Scheiben auf den See blickte, bildete ich mir ein, dass ich ein Waldläufer war, der nach Hause gekommen war.
Ich fühlte mich stark und furchtlos in dieser Vorstellung. Außerdem hatten meine Eltern mir verboten, am See zu spielen. Es gab einige gefährliche Stellen. Der Zulauf zum See war versumpft, ein toter Flussarm war entstanden und hatte eine kleine Insel gebildet. Das Gras wuchs dort hoch und immer lag ein Geruch von Fäulnis und Moor in der Luft.
Man erzählte sich, dass dort vor Urzeiten einmal ein Kloster oder eine Kapelle gestanden hatte. Wenn ich die Augen schloß, standen da Klostermauern, eine Glocke tönte im grauen Abendhimmel, und Mönche in langen Kutten, die Gesichter verhüllt, strichen durch das Gras und sandten endlose Gebete gen Himmel.
Mein Vater kümmerte sich nicht um das Grundstück. Es war da wie der Fluß. Es war da wie unser Garten, in dem meine Mutter sich zwischen die Beete bückte und fluchte, weil sie Gartenarbeit hasste. Einmal hatte mein Vater einen Teil der Flußwiese an einen Bauern verpachtet, der dort sein Vieh weidete. Dann aber war eine Kuh im Morast ertrunken oder erstickt und es gab Streit um den Wert des Tieres. Die Bauern zogen die tote Kuh mit Seilen aus dem Sumpf. Ich war dabei und schaute zu. Die Kuh hatte Augen und Maul noch aufgerissen, als wollte sie schreien. Ich malte mir aus, wie sie tiefer und tiefer gesunken war, ohne Halt unter den Klauen. Jedenfalls musste mein Vater die Kuh oder einen Teil von ihr bezahlen. Daraufhin zäunte er den sumpfigen Teil ein und stellte ein Warnschild auf.
Auch wenn es mir erlaubt gewesen wäre, hätte ich mich nicht auf die Insel getraut. In manchen Träumen versank ich selbst im Moor, ich sah mir dabei zu, und konnte mich nur durchs Aufwachen retten. Aber am Flussufer spielten wir auch, warfen Steine ins Wasser und ließen Stöcke treiben. Wir versuchten ein Floß zu bauen und träumten davon, auf diesem Floß bis zum Meer zu fahren. Ich war immer mit Christian dort, meinem besten Freund, und mit Katharina, die zwei Jahre älter war und sich uns aus irgendeinem Grund anschloss. Christian und ich, wir waren beide in Katharina verliebt. Sie saß gern im Badeanzug auf der Wiese, oft mit Kofferradio und einem Buch, sonnte sich und spornte uns an, im Fluss zu tauchen und die Luft in der Tiefe so lange anzuhalten, wie wir konnten. Christian gewann immer, denn er war größer und kräftiger als ich. In diesem Sommer, als Max Lenard zu uns kam, veränderte sich auch Christian. Wir alle veränderten uns, aber bei Christian fiel es besonders auf.
Er wurde manchmal furchtbar ernst, wie ein Erwachsener, und er sprach abfällig von Kindereien, wenn ich von unserem Floß und der Reise ans Meer anfing. Er zog seine nasse Badehose nur noch unter einem schützenden Handtuch aus. Er hatte einige Pickel auf der Stirn und manchmal sah er durch mich hindurch. Er lungerte nun oft an Sommerabenden an der Bushaltestelle herum, im Schutz der Kastanie, und rauchte mit großer Geste eine Zigarette. Er knatterte mit einem Moped durch das Dorf und gab mit Filmen an, die für Erwachsene waren und die er sich angeschaut hatte. Zu der Zeit musste ich ihn Chris nennen. Noch blöder ging es nicht, fand ich. Aber er bestand darauf. Statt Michael hieß man Mick, Tom anstelle von Thomas, und eben Chris statt Christian. Überall würde so geredet, sagte er und strich sich die Haare hinter die Ohren. Er hatte sie sich ein bisschen wachsen lassen, über die Ohren und in die Stirn. Ich trug die Haare immer noch kurz. Mein Vater wollte es so. Mein Vater fuhr immer mit mir zum Friseur und es wurde mir weit über die Ohren wegrasiert. Ich sah aus wie ein kleiner Soldat mit Segelohren. Sogar meine ältere Schwester, die im nächsten Jahr eine Lehre in der Stadt machen sollte, durfte das Haar nur bis zum Nacken tragen, schwarz, glatt, wie einen Helm. War ich ein Soldat, so war meine Schwester eine Nonne. Die Haare von Chris allerdings wehten wild im Fahrtwind, wenn er an unserem Haus vorbeibrauste, am Waldrand wendete und dann mit verzerrtem Gesicht an unserem Gartenzaun bremste.
Er wollte mich ebenfalls Danny nennen statt Daniel, aber ich wehrte mich. Ich fand, dass Daniel viel schöner und viel erwachsener klang. Chris besah sich meine Frisur und meine geröteten Ohren und meinte verächtlich, ich sei ein tödlicher Langweiler.
3
Es war an einem Sonntag, als mein Vater Besuch aus dem Dorf bekam. Es war eine ungewohnte Zeit, ein Sonntagmorgen, der heilige Sonntag, meine Mutter blickte beim Ertönen der Hausklingel überrascht auf. Sie hielt in der linken Hand eine Kartoffel und schaute mich an. Mein Vater, der am Küchentisch gesessen hatte, schien den Besuch erwartet zu haben, er machte eine gleichmütige Bewegung und ging zur Haustür. Meine Mutter ließ die fertig geschälte Kartoffel ins Wasser plumpsen, stand auf, nahm die Schürze ab und fuhr sich durchs Haar.
Sie kamen zu viert.
Da war der alte Hofer, der reichste Bauer im Dorf. Seine Ahnengalerie lehmverschmierter Gummistiefel reichte mindestens bis ins Mittelalter zurück. Er kaufte ständig Land anderer Bauern auf. Hofer gehörte zum alten Eisen der Pferdehändler. Er war gerissen, ihn konnte man nicht so leicht übertölpeln. Er war weißhaarig und ein wenig zittrig, aber immer noch herrisch. Er machte meinem Vater immer wieder Angebote für ein Stück Wiese hinter unserem Garten, die er für seine Zwecke nutzen wollte. Niemand wusste, wie diese Zwecke aussahen. Meine Mutter unterstützte den alten Hofer in seinen Bemühungen, aber mein Vater zögerte noch mit dem Verkauf. Manchmal hatte er seinen eigenen Kopf.
An diesem Morgen stützte sich Hofer auf einen schweren Spazierstock und war mürrischer denn je. Bei der Fütterung des Viehs hatte ihn ein Zuchtbulle übel getreten. Wäre das Tier nicht so kostbar gewesen, er hätte seinen Sohn Georg aufgefordert, es sofort zu erschießen. Noch lieber hätte er es selbst gemacht. Das Tier sei allgemeingefährlich, erzählte er und rieb sich die Hüfte. Jeden dritten Tag musste er nun in die Kreisstadt fahren und sich bei seinem Hausarzt eine Spritze geben lassen. Sievers war dabei, ein Kerl mit Habichtsgesicht. Er war jünger und hatte eine Menge mit der örtlichen Feuerwehr zu tun. Er wollte immer neue Leute für die Löschmannschaft rekrutieren, auch mich. Er war Beamter in der Stadt, im Rathaus, ein Typ wie ein gespitzter Bleistift. Er redete ständig von Finanzen, Geldanlagen, Investitionen. Er wollte Dagehusen modernisieren, unter Wahrung des Dorfcharakters, wie er betonte.
Hinter ihm kam Hugo Rettlich, ein Mann mit den Eigenschaften einer landwirtschaftlichen Maschine, zuverlässig, fleißig, ehrgeizig. Er besuchte an der Volkshochschule einen Kurs für Betriebswirtschaft und hatte sich auf Schweinezucht spezialisiert. Rettlich sah chronisch schwarz und eine Überlebenschance für die gesamte Landwirtschaft nur in der Spezialisierung. Als letzter betrat Konerding unser Haus, und der war mir der liebste, weil er mich in Ruhe ließ. Alle anderen wollten immer etwas von mir und redeten auf mich ein. Konerding schlug mir nur manchmal auf die Schulter, was ziemlich wehtat, denn er war ebenso kräftig wie wortkarg. Er hatte die Nase in der Ackerfurche, hockte Tag und Nacht auf einem Traktor. Aus diesem Grund war er auch der einzige an diesem Sonntag, der unter der dunklen Hose lehmverschmierte Gummistiefel trug. Die anderen hatten alle Sonntagsstaat an, mit Krawatte und so. Konerding hingegen war am Morgen noch rasch auf der Weide bei einer kranken Kuh gewesen. Er trug auch eine Flasche versteckt am Körper, eine Flasche Doppelkorn.
Mein Vater bat sie herein, machte eine kurze Bewegung zum Wohnzimmer hin, während meine Mutter stillschweigend in der Küche weiter arbeitete. Ich schlich hinterdrein wie ein Kobold, der sich hinter dem Sofa versteckt, im Ofenrohr, in der Wanduhr. So setzte ich mich auf den niedrigen Schemel, der meinem Vater beim Fernsehgucken und Lesen der Zeitung als Fußstütze diente. Es nahm mich auch niemand wahr, es funktionierte, ich war unsichtbar. Mein Vater ging an mir vorbei, er holte Bier aus dem Kühlschrank, die anderen hatten Platz genommen. Sie tranken alle schweigend ein Glas Korn, kippten es schwungvoll herunter, öffneten den Mund und zogen hastig, mit leicht brennenden Augen, die Luft ein. Dann spülten sie mit dem eiskalten Bier nach. Eine Zeitlang hockten sie da, hingen Gedanken nach, man spürte eine Spannung in der Luft, die nur durch eine weitere Ladung Schnaps gemildert werden konnte.
Sievers, der passionierte Feuerwehrmann, begann daraufhin, aus heiterem Himmel, aber wohl aus dem Grund, endlich einen Anfang zu finden, eine lange Schwärmerei über das neue Modell eines Feuerwehrwagens anzustimmen, eines Autos, dessen lackglänzender Anblick ihn beinahe umgehauen hatte, und er verglich in einem ermüdenden Monolog die Qualitäten und die Nachteile verschiedener Fabrikate. Seine Ausführungen über Wasserspritzen, Schlauchlängen und Druckstärken schienen ihn mehr zu berauschen als der Schnaps. Konerding schwieg verbissen und hörte Sievers zu. Zwischendurch starrte er mit großen Augen auf den Teppichboden zu seinen Füßen, und als ich seinem Blick folgte, wusste ich auch, warum Konerding so verdattert guckte. Aus den tiefen Ritzen und Furchen der Sohlen seiner Stiefel waren alle verkrusteten Lehmbrocken und angetrockneten Erdkrumen auf unseren Teppich gerieselt.
Der junge Rettlich hingegen grinste töricht, weil er insgeheim stolz war, zu diesem Kreis der bedeutenden alten Kämpen zu gehören, ein ebenbürtiger Kamerad, er, der früher nur eine Art Vasall gewesen war, von fragwürdiger Herkunft, denn sein Vater war im Krieg geblieben, der kleine Rettlich aber später gezeugt worden. Hinzu kam, dass seine Mutter eine zeitlang die Kneipe am Fluss geführt hatte, mit großem Erfolg, das muss man sagen, was man jedoch mehr ihrer üppigen, für sinnliches Vergnügen stets bereiten Leiblichkeit zuschrieb als ihren Kochkünsten und gastronomischen Erfahrungen. Um anzugeben oder aus purem Glücksgefühl heraus kippte Rettlich sein Bier herunter und zwei Schnaps hinterher, wurde daraufhin rot wie eine Rübe und sein Grinsen blöder als zuvor. Nur der alte Hofer veränderte sich nicht, steif und erhaben thronte er auf dem äußersten Rand des Sessels, beide Arme schwer auf seinen Spazierstock gestützt wie auf ein riesiges Zepter, das er jederzeit über den Häuptern dieser Idioten erheben konnte und hörte mit gesenktem Blick zu.
Sievers hatte sich plötzlich leer gequatscht und sank ermattet in die Sofakissen, ganz wie ein Feuerwehrschlauch, dem der Wasserdruck genommen worden war. Nun blickte Rettlich nervös in die Runde, suchte offensichtlich nach der Zustimmung, endlich das Wort erheben zu können, schien diese auch in den Gesichtern gefunden zu haben, und begann. Bevor er zum Thema kam, zum Problem und dessen Lösung, machte er einige rhetorische Umwege, und nach wenigen Worten war jedem klar, warum Rettlich zu einer der neuen jungen Stimmen gehörte, bereits in einprägsamen Abständen plakatiert an Landstraßen, ein offenes, ein ehrliches Gesicht, jungenhaft mit Seitenscheitel, bereits redegeübt auf Bürgerwahlen und Ratssitzungen.
Er faselte nicht herum, er war konzentriert und konnte, trotz der benebelnden Schnäpse, klar und verständlich formulieren. Sein irres Grinsen zu Beginn musste als Bluff gewertet werden.
Rettlich sprach also, sprach von der Geschichte Dagehusens, seiner verbürgten Historie, es würden bald siebenhundert Jahre, was einem unverhohlen Respekt abverlangen sollte, allein diese immense Zeitspanne dörflichen Lebens bewies die Lebensqualität der Gegend, so fand er, angefangen bei Strohdächern und Lehmhäusern, bei Ackerbau mit Ochse und Pflug, bei Fischfang mit der Reuse und dem Netz in der Ahle und harter Waldarbeit im nahen Forst. Aber bei aller Nostalgie und Geschichtsfreude sollte man stets nach vorn blicken, ein Motto, dem sein ganzes Arbeitsleben unterstand. Das war, nebenbei bemerkt, auch sein Wahlspruch, der über seinem akkuraten Scheitel auf den Plakaten gedruckt stand: Nur nach Vorn. Er, Rettlich, wisse genau, dass er mit diesem Motto offene Türen einrennen würde. Der Fortschritt sei niemals aufzuhalten gewesen. Wie viele waren gegen die Schließung der Dorfschulen im letzten Jahr gewesen? Nicht wenige, aber es habe sich ja wohl herausgestellt, dass diese Idylle eine Scheinwelt gewesen sei. Die gute alte Dorfschule mit den Kastanien auf dem Schulhof, das sei ja wohl überholt gewesen. Nun müssten die Kinder mit den Bussen in die Stadt fahren und dort würden sie für die Welt da draußen geformt werden. So sagte Rettlich, mit genauer Wortwahl und richtiger Betonung. Formen, sich dem Leben stellen, für das Leben, nicht für die Schule lernen. Ich hörte von meinem niedrigen Schemel diese Worte und sie fielen durch mich hindurch. Ich schwieg. Natürlich schwieg ich, ich machte mir eigene Gedanken. Was nützte es, die glorreiche Zukunft im Blick zu haben, wenn die Angst, mit den anderen Jungen in den Bus zu steigen, einen lähmt?
Wenn man lieber allein stehen blieb und sich an der klebrigen Gummischlaufe im schwankenden Bus festhielt als sich mit anderen auf die Sitzbänke zu quetschen, all das Drücken und Fassen und Krallen zu ertragen?
Was nützte es, in zehn oder fünfzehn Jahren ein Doktor zu werden, wenn man sich nicht traute, das Mädchen mit den hübschen Locken auf dem Schulhof anzusprechen? Und vielleicht ging es immer so weiter. Immer nur nach vorn, ohne Gegenwart. Statt des Mädchens würde es eine Frau sein, immer würde der Schulhof sich mit dem letzten Klingelzeichen leeren, immer würde das Mädchen für einen Moment dastehen, die Frau einen Augenblick auf dich warten, das Leben kurz den Atem für dich anhalten, dann jedoch, dann würde es für immer vorbei sein.
Ich war so tief versunken in meinen Betrachtungen des Lebens, dass mir ganze Teile des Gesprächs am Tisch entgangen waren. Jetzt hörte ich wieder zu. Offensichtlich ging es um Bauland, um Wiesen und Felder. Konerding wollte schon verkaufen, ein Stück Brachland am Fluss, ein großer Investor sei bereits gefunden, auch die Ratsherren hätten schon zugestimmt, und mit einigen Protestlern und Abweichlern würde man sicher einig werden. Am Tisch kehrte Ruhe ein. Gab es Widerspruch? Ich hörte, wie frisches Bier in die Gläser schäumte. Gegenargumente? Man war sich nie uneins gewesen. Das Schlusswort hatte natürlich der alte Hofer.
„Überleg dir, ob du nicht verkaufen willst. Jetzt, da alles anders wird. Was willst du mit dem Land? Überleg nicht so lange.“
Mein Vater rieb sich das Gesicht. Er nickte bedächtig. War das schon seine Zustimmung? Oder war es nur ein müdes, wie beiläufiges Nicken, gepaart mit einem Bitten um Bedenkzeit? Ich wusste es nicht. Ich fand, dass er plötzlich krank aussah.
Es war so, dass mein Vater in letzter Zeit häufiger von einer Müdigkeit erfasst wurde, die ihn überfiel wie ein Anfall, ähnlich wie das bohrende Kopfweh, das meine Mutter lahm legte, eine Erschöpfung, die ihn außer Gefecht setzte und für Stunden aufs Sofa oder sogar ins Bett zwang, wo er untätig vor sich hin brütete. Es war beängstigend zu sehen, wie kraftlos er dann dort lag, lang ausgestreckt mit schlaffen Gliedern, und mit einer unheilvollen Blässe, die unter seinem gebräunten Gesicht zu wachsen schien. Meine Mutter wusste mir auf besorgte Fragen nicht viel zu antworten. Es ist wohl das Blut, die Organe, da ist was krank, sagte sie ausweichend, dein Vater hat viel mitgemacht.
Das war alles, was ich erfuhr, und ich machte mir keine Gedanken darüber. Die meiste Zeit war mein Vater voller Tatkraft und vermied es, sich eine Blöße zu geben oder eine Schwäche zu zeigen. Auch an diesem Sonntag nicht. Sein Oberkörper straffte sich wie unter einem Befehl, den nur mein Vater gehört hatte. Seine Augen bekamen wieder Glanz und sein Gesicht wurde ernst und entscheidungsfreudig.
„Ich bin nicht dagegen“, sagte er. „Keinesfalls. Ich hatte eigentlich schon selbst dran gedacht, ja, schon häufig.“
Die sonntägliche Gesellschaft löste sich erleichtert auf.
„Ach, übrigens, Harald“, sagte der alte Hofer im Flur, bevor er auf den Hof hinaustrat.
„Weißt du eigentlich, dass letzte Nacht ein Fuchs bei uns war? Er hat ein Huhn mitgenommen und eines so böse zugerichtet, dass ich es schlachten musste.“
Mein Vater fragte, ob Hofer etwa Tollwut vermuten würde. Es gab Zeiten, da hingen an vielen Baumstämmen die Warnschilder vor der Krankheit und man durfte seinen Hund nicht herumstreunen lassen. Ich fand diese Schildchen und Warnzettel interessant, weil sie Gefahr bedeuteten.
Hofer schüttelte verneinend den Kopf. Er vermutete, dass der Fuchs ein Einzelgänger war, der Gefallen am Hühnermorden gefunden hatte. Solche Exemplare mussten einfach abgeschossen werden. Sein Sohn sei beinahe jeden Morgen auf dem Hochsitz, aber der Fuchs hatte sich nicht blicken lassen.
4
Ich kniete in den Blumenbeeten und rupfte Unkraut, als Max Lenard aus Amerika kam, direkt aus Amerika in die Gartenzwergwelt unseres Vorgartens kam. Tatsächlich war unser Vorgarten ein Musterbeispiel ernst genommener Gartenpflege, denn meine Eltern liebten einen gepflegten Vorgarten über alles. Unser Vorgarten war hübsch und ordentlich wie ein Blumenkasten im Fenster eines Försterhauses. Alles hatte seinen Platz, jede Pflanze, jedes Blatt, jede Wurzel, die sich unter der geharkten Erde verbarg. Nur war in letzter Zeit viel Unkraut gesprossen. Ich kniete auf den Steinplatten und zog Giersch und Löwenzahn aus der trockenen Erde. Ich dachte an meine Klassenkameraden, die jetzt mit dem Rad unterwegs waren, zum Baggersee, um zu schwimmen oder die auf dem Sportplatz Fußball spielten. Einige waren sogar verreist, ans Mittelmeer, und ich sah Fischerboote, das blaue Meer und Mädchen in Badeanzügen, während ich kniete und mir der Rücken wehtat. Meine Eltern verreisten nie. Mein Vater arbeitete am Haus oder an seinen Modellflugzeugen, wenn er Urlaub hatte. Er schaute immer, dass auch ich genug zu tun hatte. Kein Tag durfte für ihn ohne irgendwelche Pflichten vergehen, Vorbereitung aufs Leben, so nannte er es. Und er fand immer etwas.
Einmal musste ich den gesamten Gartenzaun streichen, ganz wie mein berühmter Vorgänger vom Mississippi, aber es kam niemand vorbei, den ich mit List an den Farbtopf gekriegt hätte. Dann wiederum musste ich den Schuppen neben der Garage aufräumen, Werkzeug und Nägel sortieren, und hustend und spuckend den Boden fegen. Die widerlichste Arbeit war jedoch das Säubern des Hühnerstalls. Die Hühner waren das Erbe meines Großvaters, der im letzten Jahr gestorben war. Ich glaube, mein Vater hatte einfach Angst, sie zu schlachten, und das mit dem Erbe war nur eine Ausrede. Jedenfalls wurde mir regelmäßig schlecht, wenn ich gebückt durch die niedrige Tür in den Stall kroch. Der warme Federngeruch hüllte mich ein. Es stank furchtbar nach Hühnerkot, der alles weiß und krustig überzog, nach verfaulten Kohlstrünken und aufgeweichtem Hühnerfutter. Draußen, auf einem zerscharrten Wiesenstück, kratzten die Hühner im Dreck, mit hornigen Krallen und nickenden Köpfen. Ich wünschte mir einen Marder herbei oder den Fuchs, der beim alten Hofer gewildert hatte, einen lautlosen Dieb und Mörder, schon in der nächsten Nacht sollte er kommen und sie alle holen. Ich genoss die Vorstellung, wie mein Vater die Stalltür öffnete, und sich ihm ein Bild des Grauens auftat. Dort ein abgerissener Flügel, da ein aufgesperrter Schnabel, blutbefleckte Federn, die langsam zu Boden sanken.
Ich schämte mich für meine Phantasie, aber ich wurde sie nicht los. Es war wie mit dem Bild, das im Schlafzimmer meiner Eltern hing. Es zeigte eine schöne weiße Frau, eine Göttin, die, von halbnackten Engelsjungen umgeben, in einem langen Seidenkleid auf einer prächtigen Schlafstatt lag. Goldene Locken fielen ihr auf die runden nackten Schultern und den vollen Busen herab. Sie wirkte fraulich und körperlos zugleich.
Ich schaute von der Arbeit hoch durch die Toreinfahrt, die Dorfstrasse war leer, die Sonne glänzte auf dem Asphalt. Einige Dunghaufen, von einem Anhänger gefallen, rochen vor sich hin, Fliegen schwirrten umher.
Ein Mann kam die Strasse herauf, und schon an der Art seines Gehens wurde mir klar, dass es ein Fremder war. In unserem Dorf bewegte man sich anders, es gab keine langen Fußwege, höchstens an den Sonntagen ging man gemächlich spazieren, vor der Kirche oder nach dem Mittagessen, und werktags fuhr man entweder mit dem Auto, dem Traktor oder auf dem Rad vorbei.
Dieser Mann wirkte jedoch wie ein Wanderer, wie ein Heimkehrer, der einen Marsch hinter sich hatte, und er trug einen Rucksack, der so schwer zu sein schien, dass er ihn nach hinten zog und seinen Gang etwas schwerfällig machte. Als er näher kam, erkannte ich ihn. Es war eindeutig der Mann von dem Foto. Es war Max Lenard. Damals verglich ich Menschen gerne mit Tieren. Mein Vater war für mich ein Elephant oder ein Nashorn, stark, gepanzert. Man suchte in bestimmten Situationen seine Nähe, seinen Schutz. Meine Mutter war tatsächlich eine Antilope, mit flinken braunen Augen und einer seltsamen Grazie, die mir besonders auf Gemeindefesten auffiel, wenn sie tanzte. Max Lenard hingegen hatte etwas von einem Fuchs. Das Gesicht war gebräunt, aber eingefallen und spitznasig. Als er auf mich zukam und an den Zaun trat, fiel mir auf, dass er sehr mager war. Seine Bewegungen waren geschmeidig und irgendwie vorsichtig. Der Gang eines Indianers, dachte ich. Sein Lachen allerdings war offen und herzlich. Alles an ihm schien dann zu lachen, die hellgrauen Augen, die vollen Lippen, und er sah jung aus.