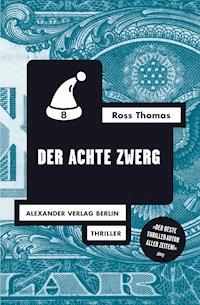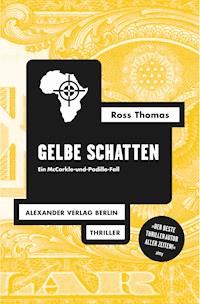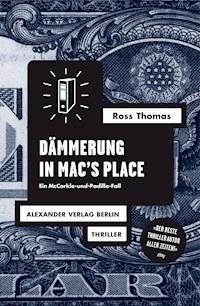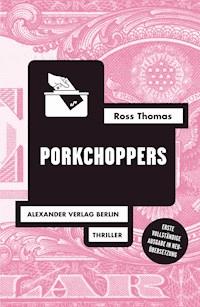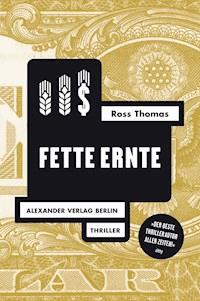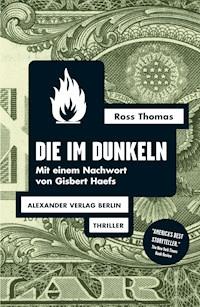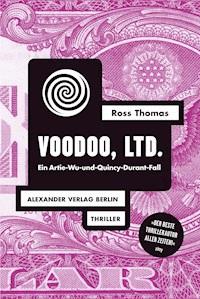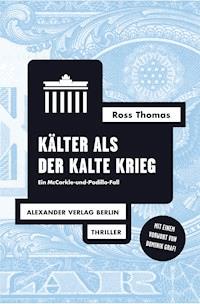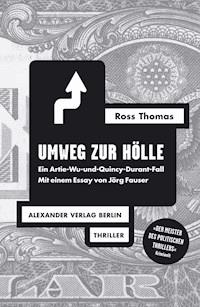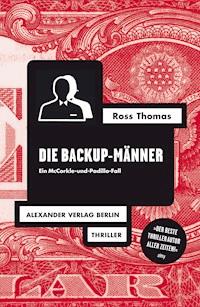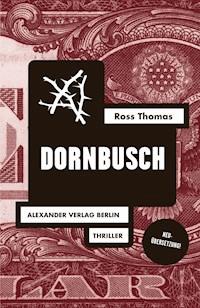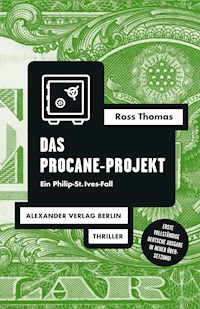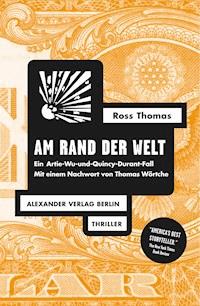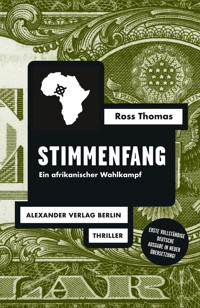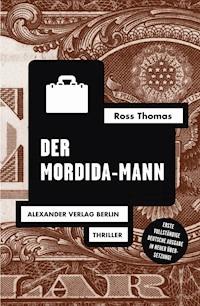
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alexander Verlag Berlin
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ross-Thomas-Edition
- Sprache: Deutsch
1981: Ein international gesuchter Terrorist wird von amerikanischen Agenten entführt. Kurz darauf lässt der Nachfolger Gaddafis den Bruder des amerikanischen Präsidenten kidnappen, um mit ihm den Freiheitskämpfer freizupressen, nicht ahnend, dass dieser schon tot ist. Der Einzige, der die Kohlen jetzt noch aus dem Feuer holen kann, ist Chubb Dunjee. Der ehemalige amerikanische Kongressabgeordnete war lange Mittelsmann in den unruhigen Gegenden dieser Welt; seine besondere Spezialität: Bestechung – "mordida".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ross Thomas, geboren 1926 in Oklahoma, verarbeitete seine vielfältigen beruflichen Erfahrungen in seinen Politthrillern, in denen er vor allem die Hintergründe des (amerikanischen) Politikbetriebs entlarvt und bloßstellt. Ihm wurde zweimal der Edgar Allan Poe Award und mehrmals der Deutsche Krimi Preis verliehen. Bis zu seinem Tod 1995 entstanden 25 Romane.
Ross Thomas
Der Mordida-Mann
Aus dem Amerikanischenvon Jochen Stremmel
Die Ross-Thomas-Edition im Alexander Verlag Berlin
Herausgegeben von Alexander Wewerka
Der Messingdeal. Ein Philip-St. Ives-Fall
Protokoll für eine Entführung. Ein Philip-St. Ives-Fall
Umweg zur Hölle. Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Am Rand der Welt. Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Voodoo, Ltd. Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Kälter als der Kalte Krieg. Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Gelbe Schatten. Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Die Backup-Männer. Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Dämmerung in Mac’s Place. Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Gottes vergessene Stadt · Teufels Küche · Die im Dunkeln ·
Fette Ernte · Der Yellow-Dog-Kontrakt · Der achte Zwerg ·
Dornbusch · Porkchoppers Alle auch als eBook!
Erste vollständige deutsche Ausgabe in neuer Übersetzung.
Die gekürzte deutsche Erstausgabe erschien 1982 unter dem Titel
Der Bakschischmann im Ullstein Verlag, Frankfurt a. M./Berlin.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1981 unter dem Titel
The Mordida Man.
© 1981 by Ross Thomas
© für diese Ausgabe by Alexander Verlag Berlin 2017
Alexander Wewerka, Fredericiastr. 8, D-14050 Berlin
[email protected] · www.alexander-verlag.com
Umschlaggestaltung: Antje Wewerka
Alle Rechte vorbehalten.
eISBN 978-3-89581-464-8
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Anmerkungen
1
Es war eine fast perfekte Verkleidung. Zunächst mal hatte er all das Gewicht verloren, mindestens zwölf Kilo, und die geschickt in den Absätzen seiner plumpen, glatten schwarzen Schuhe verborgenen Einlagen hatten ihn fast fünf Zentimeter größer gemacht und seinen Gang leicht verändert. Der Bart half natürlich auch; wahrscheinlich, weil er so säuberlich gestutzt war.
Vor noch nicht mal drei Monaten war er mehr oder weniger glatt rasiert gewesen und mittelgroß und eher pummelig, wenn nicht etwas fett. Jetzt war er knapp eins achtzig und schlank, fast schmal. Er war auch anders angezogen. Verschwunden waren die Jeans und die Army Jacke und der schwarze Rollkragenpulli – eine Kombination, die früher praktisch sein Markenzeichen gewesen war. Jetzt trug er einen blauen Nadelstreifenanzug – nicht zu alt, aber auch nicht zu neu – und ein gestärktes weißes Hemd und sogar eine hübsche Fliege, die zu binden er sich beigebracht hatte. In der linken Hand hielt er eine abgewetzte lederne Aktentasche, die wie ein alter, heruntergekommener Freund wirkte – noch ein hübsch kalkulierter Anflug von Seriosität, der ebenfalls hilfreich war.
Das Einzige, was den Gedanken an eine Verkleidung hätte aufkommen lassen können, war die Brille. Ihre einfachen, bernsteinbraun getönten Gläser machten es schwierig, seine Augen mit ihrer verräterischen seltsam regengrauen Farbe zu erkennen. Aber das sorgfältig ausgesuchte Gestell war aus einem klaren, schmucklosen Kunststoff, der eher auf Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit als auf eine Verkleidung schließen ließ.
Man hatte sich auch viele Gedanken über sein Haar gemacht, das mal eine wirre, fettige Mähne gewesen war. Jetzt war es kurz und ordentlich geschnitten, sowohl hinten als auch an den Seiten. Wie sein Bart war es grau gesprenkelt. Das Grau war natürlich. Außerdem war es neu und hatte sich innerhalb der vergangenen drei Monate in Haar und Bart eingeschlichen.
Als er aus der U-Bahn-Station Maida Vale herauskam und auf der Elgin Avenue nach rechts ging, klammerte die Frau in dem Taxi auf der anderen Straßenseite die große Handtasche fest an ihre Brust, holte etwas Luft, hustete einmal und sagte: »Das ist er. Das ist Felix.«
Der Mann neben ihr sagte: »Sind Sie sicher?«
»Das ist er«, beharrte die Frau und schlang die dünnen Arme noch fester um ihre Handtasche aus schwarzem Leder, die einen silbernen Verschluß hatte.
»Er sieht todsicher nicht nach ihm aus«, sagte der Mann. Er hatte irgendeinen amerikanischen Akzent.
»Er ist es, Sie Narr.«
Der Amerikaner nickte skeptisch, drehte das Taxifenster hinunter und warf eine zerknüllte rote Packung Pall-Mall-Zigaretten auf den Bürgersteig. Auf der anderen Straßenseite bemerkte ein kleinerer Mann mittleren Alters, der einen dreiteiligen braunen Anzug und das spitzbübische Gesicht eines alten Kindes trug, die fallende Packung, wandte sich schnell von dem Zeitungsstand ab und ging dem als Felix identifizierten Mann hinterher. Der kleinere Mann marschierte mit kurzen affektierten Schritten und hatte einen eng zusammengerollten schwarzen Schirm in der Hand, den er nach oben schwang und sanft auf seiner rechten Schulter ablegte.
In dem Taxi beugte sich der Amerikaner vor, öffnete die Tür zum Bordstein und sagte: »Raus.«
Die Frau mußte zuerst husten. Ein tiefes, trockenes Bellen, vier- oder fünfmal, das ihren Körper durchschüttelte und ihr Gesicht rötete. Der Amerikaner ignorierte es so, wie er sie ignorierte, als sie über seine langen Beine stolperte, während sie sich, immer noch hustend, mühsam aus dem Taxi quälte. Sobald sie draußen war, preßte sie sich die Handtasche nur noch fester an die Brust. Sie schien das Husten zu lindern – vielleicht, weil sie einen tröstlichen Balsam in Form von zwanzigtausend Dollar in Zwanzig- und Fünfzig-Dollar-Scheinen enthielt, die der Amerikaner ihr dafür bezahlt hatte, daß sie ihn zu Felix führte. Die Frau, deren Lippen jetzt fest zusammengepreßt waren, als wäre sie entschlossen, nie mehr zu husten, eilte fort von dem Taxi, ohne sich umzudrehen.
Der kleinere Mann mit dem Schirm war inzwischen nur fünf oder sechs Schritte hinter Felix. Mit einem eleganten kleinen Sprung wurde er schneller und verringerte die Distanz zwischen ihnen auf weniger als einen Meter. Er schwang den Schirm in einem Bogen nach unten, bis die Spitze nur noch knapp zwei Zentimeter von Felix’ Rücken entfernt war –, genau mitten zwischen den Schulterblättern.
Der kleinere Mann drückte auf den Knopf im Griff des Schirms. Der Knopf gab die Stahlfeder frei, die den Plastikpfeil mit der Chromspitze, in dem sich hundert Milligramm eines konzentrierten und schnellwirkenden Beruhigungsmittels namens Doxxeram befanden, durch Felix’ Jackett und Hemd tief in seinen Rücken schoß. Doxxeram war bisher nur einmal bei einem überwachten Versuch in einer Klinik für geisteskranke Straftäter im nördlichen Michigan an Menschen ausprobiert worden. Obwohl es für eine intramuskuläre Injektion außerordentlich schnell wirkte, wurden seine Nebenwirkungen als »unerwünscht« bezeichnet, der Versuch als »ergebnislos« abgestempelt und das Mittel aus dem Verkehr gezogen.
Als das Doxxeram in Felix eindrang, blieb er unvermittelt stehen. Er faßte mit der linken Hand hinter sich und nach oben, tastete nach dem Pfeil. Seine Hand fand einen Teil, den Plastikteil – jetzt leer –, der die Droge enthalten hatte. Er riß ihn los, starrte ihn kurz an, ließ ihn fallen und zertrat ihn mit dem Absatz seines Schuhs. Die mit einem kleinen Widerhaken versehene Chromspitze blieb an Ort und Stelle. Felix nahm die alte Aktentasche rasch in die linke Hand, fuhr mit der rechten nach oben und versuchte, über die linke Schulter an die Spitze heranzukommen. Aber dafür war sein Arm nicht lang genug. Ist er bei fast niemandem.
Dann drehte sich Felix um, regelrecht wirbelnd, und nestelte an dem Verschluß seiner alten Aktentasche herum. Inzwischen war der kleinere Mann, den Schirm wieder auf der Schulter, schon ein gutes Stück an ihm vorbei und mit seinem schnellen Tuntengang zur Ecke unterwegs. Eine Frau mittleren Alters starrte Felix einen kurzen Augenblick neugierig an, aber schaute dann weg und eilte weiter.
Felix tastete in der Aktentasche herum, bis seine Hand sich um den Griff des kurzläufigen .38er Smith & Wesson schloß. Während er nach dem Revolver tastete, versuchte er, seinen Angreifer zu identifizieren – denjenigen, den er erschießen müßte. Er kam zu dem Schluß, daß es vier mögliche, alle aber äußerst unwahrscheinliche Kandidaten gab.
Zwei von ihnen waren Frauen um die Vierzig mit Einkaufsnetzen – vermutlich Schwestern. Der dritte war der jockeygroße Zeitungsverkäufer, der gerade ins Zählen seines Kleingelds vertieft war, und der vierte ein älterer Mann von mehr als siebzig, der auf seinen Stock gestützt dastand und nachdenklich auf eine Reihe fetter Kapaune im Schaufenster eines Metzgers starrte. Der alte Mann schien zu überlegen, ob er sich wirklich einen leisten konnte.
Felix spürte die erste leichte Wirkung der Droge, unmittelbar nachdem der kleinere Mann mit dem Schirm um die Ecke gebogen und verschwunden war. Felix’ Schultern sackten unwillkürlich herab, und seine Knie begannen zu zittern – auch wenn beides von der Erleichterung verursacht sein mochte, die ihn durchströmte, als er begriff, daß man ihn nicht vergiftet hatte.
Beruhigungsmittel, dachte er. Irgendjemand hat dich mit einem Beruhigungsmittel vollgepumpt. Aber die Droge schien nicht sehr stark zu sein, und er fragte sich, ob sie genug genommen hatten. Vielleicht hatten sie einen Fehler gemacht, und er würde den Revolver gar nicht brauchen. Er nahm die Hand aus der Aktentasche und ging, nicht gerade verträumt, hinüber zur Tür des Gemüseladens, wo er sich umdrehte, gähnte und anfing, die Stelle zwischen seinen Schulterblättern an dem Türrahmen zu reiben. Damit gelang es ihm nur, die Chromspitze mit dem Widerhaken noch tiefer hineinzutreiben, während er gemächlich, fast wohlig, weiter rieb, als wollte er sich von einem alten, vertrauten Juckreiz befreien.
Trotzdem würde es noch Minuten dauern, bis die Droge wirkte, und auf der anderen Straßenseite wartete der Amerikaner geduldig in dem Taxi, während seine Augen von seiner Armbanduhr zu Felix und wieder zurück schnellten. Felix rieb sich weiter an der Tür zum Gemüseladen und versuchte zu entscheiden, ob er wieder zur U-Bahn-Station gehen sollte. Aber vielleicht war das der Ort, wo sie ihn haben wollten. Ein schneller Zug. Ein rascher Stoß. Felix beschloß, noch ein bißchen darüber nachzudenken.
Endlich schaute der Amerikaner von seiner Uhr hoch, beugte sich vor und sagte zu dem Fahrer: »Bringen wir’s hinter uns.«
Das Taxi wendete und hielt weniger als drei Meter von der Stelle entfernt, wo Felix gähnend stand und sich die Pfeilspitze in den Rücken rieb. Als er das Taxi vorfahren sah, wußte er, warum es dort war und daß er etwas dagegen unternehmen mußte – vorausgesetzt, es erforderte nicht zu große Mühe. Er dachte wieder fast ein wenig gleichgültig an den Revolver, bemerkte aber dann, daß ihm alles vor den Augen verschwamm. Die Realität schien sich langsam davonzumachen. Es war es vermutlich besser, wenn er einfach loszugehen begann. Nicht zu schnell natürlich. Unnötig, Aufmerksamkeit zu erregen. Nur bis zur Ecke, langsam, ganz langsam, denn er war müde, und dann nach rechts.
Er machte einen Schritt weg vom Eingang des Gemüseladens und dann noch einen. Aber er hatte keine Kontrolle mehr über seine Beine. Sie begannen zu zittern, und seine Füße verweigerten sich allmählich jedem Befehl. Trotzdem schaffte er noch einen Schritt, dann noch einen, aber nach diesem sank er langsam auf die Knie.
Der Amerikaner stieg aus dem Taxi und näherte sich ihm vorsichtig. Ein paar Leute drehten sich um und glotzten. Felix richtete seinen Blick auf den Amerikaner und begann wieder in seiner Aktentasche herumzutasten. Der Amerikaner griff nach unten und nahm sie ihm ab. Felix beobachtete gleichgültig, wie sich der Amerikaner die Aktentasche unter den Arm klemmte.
Sie starrten sich einige Augenblicke an, und Felix ertappte sich dabei, wie er sich über die zunehmend schwankenden Konturen des Amerikaners wunderte. Vielleicht war es das Licht – die Dämmerung. Aber mittags konnte es keine Dämmerung geben. Die Realität machte noch ein paar schnelle Schritte weg von Felix. Dann hörte er den Amerikaner, wie es schien aus weiter Ferne, in einem furchtbaren Grenzspanisch sagen: »Vamos, amigo.«
Felix schloß die Augen, leckte sich die Lippen und dachte daran zu fragen, wohin; aber es war einfach zu anstrengend. Zumindest wäre es nicht Israel. Zumindest wären es nicht die Juden. Er fragte sich flüchtig, wie die Amerikaner an die Informantin herangekommen waren – und wieviel Geld sie bekommen hatte. Aber das konnte alles später geklärt werden, nachdem er sich ausgeruht hatte. Vielleicht sogar ein Schläfchen. Es wäre so angenehm, sich gleich hier auf dem Bürgersteig zusammenzurollen. Er hatte sich fast schon entschlossen, genau das zu tun, als der kleinere Mann in dem dreiteiligen braunen Anzug wieder erschien. Der kleinere Mann hatte den Schirm nicht mehr bei sich.
»Dürfte ich Ihnen bei Ihrem Freund zur Hand gehen?« sagte der kleinere Mann in einem affektierten britischen Tonfall, der gut zu seinem tuntigen Gang paßte.
Der Amerikaner nickte. »Ich wäre Ihnen sehr verbunden.«
Zusammen legten sie jeder einen Arm um Felix und hoben ihn auf die Füße.
»Nimmt gern ab und zu ein Schlückchen, nicht wahr, der Gute?« sagte der kleinere Mann.
»Ab und zu.«
Der kleinere Mann öffnete die hintere Tür, und sie kippten Felix auf den Rücksitz.
»Tausend Dank«, sagte der Amerikaner, als er in das Taxi stieg.
»Nicht der Rede wert«, sagte der kleinere Mann. Er sah zu, wie das Taxi losfuhr, und als es nicht mehr zu sehen war, drehte er sich zu dem Metzgerladen um. Er hatte sich fast für einen dicken Kapaun entschieden, aber wenn die Lammkoteletts besonders gut aussähen, würde er sich vielleicht sogar ein Paar von denen gönnen.
2
Sie waren zu viert in dem feuchtkalten Keller des alten verbarrikadierten Hauses in der kurzen Straße in Hammersmith. Zwei Männer und zwei Frauen. Die anderen Häuser auf beiden Straßenseiten waren auch verbarrikadiert und standen leer, auf die Abrißbirne wartend, die mittlerweile drei Wochen überfällig war. Der Keller roch nach toter Katze.
Eine der Frauen war fast nackt ausgezogen und mit gelbem Isolierdraht an einen schweren Eßzimmerstuhl gefesselt worden. Sie hieß Maria Luisa de la Cova, und sie war eine vierunddreißig Jahre alte Venezolanerin. Sie war außerdem die hustende Frau, die den Mann namens Felix für zwanzigtausend Dollar in Zwanzig- und Fünfzig-Dollar-Scheinen an die Amerikaner verkauft hatte.
Das Geld lag jetzt säuberlich gestapelt auf einem zum Stuhl passenden Eßzimmertisch aus Eichenholz mit ringförmigen Wasserflecken. Der Tisch hatte nur drei Beine. Ein viertes Bein wurde von zwei Whisky-Kisten der Marke Cutty Sark ersetzt. Neben dem gestapelten Geld lag die große schwarze Lederhandtasche mit dem silbernen Verschluß. Die Handtasche war umgestülpt und ihr Futter war herausgerissen worden. Es gab keinen Strom. Licht kam von sechs rosafarbenen Kerzen, die in Bierflaschen steckten.
Einer der Männer, ein blasser Blonder fast ohne Wimpern mit rechteckigem Körper und einem flachen, ernsten Gesicht, zündete sich mit einem Wegwerffeuerzeug eine Zigarette an. Er wurde von den anderen Frank genannt, obwohl er eigentlich Bernt Diringshoffen hieß und vor zweiunddreißig Jahren in Hamburg geboren war. Nach dem Anzünden der Zigarette paffte er ungeschickt daran, ohne zu inhalieren, offenbar ein Nichtraucher.
Die de la Cova beobachtete ihn. Ihre Augen waren gerötet, und ihr Gesicht war tränenüberströmt, aber sie weinte nicht mehr. Auf der linken Seite ihres Halses und auf ihren kleinen Brüsten waren hochrote Brandwunden. Insgesamt vier.
»Erzähl mal«, sagte Diringshoffen und blies auf die Glut der Zigarette.
»Ich hab’s euch schon erzählt«, sagte die de la Cova und begann heftig zu husten. Diringshoffen wartete geduldig, bis das Husten schließlich aufhörte. »Erzähl es uns noch mal«, sagte er freundlich.
Sie begann mit einer schnellen eintönigen Stimme zu sprechen, die so leise und undeutlich war, daß die anderen sich vorbeugen mußten, um sie zu verstehen.
»Er sagte, sein Name wäre Arnold. Ich weiß nicht, ob es sein richtiger Name war. Ich weiß nicht mal, ob es sein Nachname oder sein Vorname war. Es ist mir egal. Ich nannte ihn nur Arnold, wenn ich ihn überhaupt irgendwie nannte. Wir haben uns mehrmals getroffen, vielleicht vier- oder fünfmal. Zweimal in Soho, mindestens zweimal da, und dann in einem Café in Islington, das er kannte. Vielleicht dreimal da. In Islington. Vielleicht nur zweimal. Ich kann mich nicht erinnern.«
»Sagte er, er wäre von der CIA?« fragte die andere Frau. Die andere Frau sprach auch Englisch, aber mit einem fast lähmenden französischen Akzent. Sie hieß Françoise Leget und war vor neunundzwanzig Jahren in Algier geboren. Sie hatte große schwarze Augen, mit denen sie viel blinzelte, und einen schlanken eleganten Körper, und viele hielten sie für ziemlich hübsch.
De la Cova schien Françoise Legets Frage dumm zu finden. Sie seufzte müde und sagte: »Das hab ich schon erklärt.«
Der zweite der beiden Männer war älter als der Rest, fast achtunddreißig. Er war außerdem Japaner. Die anderen nannten ihn Nelson, obwohl er eigentlich Ko Yoshikawa hieß. Sein Englisch hatte eine starke amerikanische Färbung.
»Bitte, erklär es uns noch mal«, sagte er. »Wir würden es sehr begrüßen.«
Die de la Cova seufzte. »Er hat nichts davon gesagt – daß er CIA wäre. Brauchte er nicht. Er setzte sich an jenem Tag in Soho nur zu mir an den Tisch und sagte, er wüßte alles über mich – daß ich zweiunddreißig und krank sei und Geld für das Baby brauchte und daß Felix mich sowieso sitzenlassen würde.« Sie schaute den Japaner an. »Der Teil stimmte, oder – mit Felix?«
Ko runzelte die Stirn und sagte: »Was hast du ihm über uns erzählt?«
»Nichts. Er war an keinem von euch interessiert. Er schien alles über euch zu wissen – über uns alle. Aber der einzige, den er wollte, war Felix.«
»Und du hast ihm Felix gegeben«, sagte Françoise Leget.
»Ich hab ihm Felix gegeben. Das Baby war krank. Ich war krank. Ich bin immer noch krank.« Als wollte sie es beweisen, begann sie wieder zu husten.
Als das Husten endlich aufhörte, sagte Diringshoffen: »Wann ist es passiert – wann genau?«
»Um zwölf Uhr«, sagte sie. »Heute genau um zwölf. Ich rief Felix heute morgen an und sagte ihm, ich hätte etwas Schlimmes gehört – ihr wißt schon, etwas, das ich nicht am Telefon sagen konnte. Wir verabredeten uns für zwölf Uhr im Lord Elgin Pub in Maida Vale. Ich saß mit dem Amerikaner in einem Taxi – mit Arnold. Ich glaube nicht, daß es ein echtes Taxi war. Als Felix aus der U-Bahn-Station herauskam, habe ich ihn Arnold gezeigt. Er wollte wissen, ob ich mir sicher sei. Ich sagte ja, ich sei mir sicher. Das Geld hatte er mir schon gegeben. Er warf mich aus dem Taxi. Ich weiß nicht, was mit Felix passiert ist.«
Sie schaute zu dem Japaner hoch und sagte mit leiser, klagender Stimme: »Bringt ihr mich jetzt bitte um?«
Zunächst antwortete Ko nicht. Es war fast, als hätte er ihre Bitte nicht gehört, weil seine Gedanken an irgendeinem fernen, interessanteren Ort waren. Aber nach einem Moment nickte er dem Deutschen geistesabwesend zu, der die Zigarette fallen ließ, sie austrat, ein Stück gelben Isolierdraht in die Hände nahm und hinter die gefesselte Frau trat.
Dann schaute der Japaner Maria de la Cova an. »Nun ja, natürlich«, sagte er fast entschuldigend. »Wir kümmern uns sofort darum.«
Es war Ko selbst, der bei der Botschaft der Libysch-Arabischen Volksrepublik anrief. Er machte den Anruf von einem Münztelefon im Foyer des Hotels Cunard. Er wurde von Faraj Abedsaid entgegengenommen, der auf der Botschaftsliste als Attaché (Kulturbereich) geführt wurde, eine Position, die ihm beträchtliche Freizeit ließ.
Nachdem Ko sich als Mr. Leafgreen vorgestellt hatte, sagte er: »Rufen Sie mich unter dieser Nummer an«, und las die Nummer des Münztelefons vor, wobei er als übliche Vorsichtsmaßnahme die letzten beiden Ziffern miteinander vertauschte.
Zwölf Minuten später klingelte das Telefon im Foyer des Cunard. Als Ko sich mit einem ausdruckslosen »Ja« meldete, sagte Abedsaid: »Und?« woraufhin Ko sagte: »Die Amerikaner haben Felix.«
Nach einem kurzen Schweigen flüsterte Abedsaid: »Schöne Scheiße.« Abedsaid war achtunddreißig und einer der ersten Libyer, die einen Abschluß in Erdöltechnik an der University of Oklahoma erworben hatten. Oder überhaupt an einer Universität, was das betraf.
Ko sprach schnell und skizzierte, was seiner Ansicht nach der Sachverhalt war. Als er damit fertig war, entstand ein weiteres Schweigen, bis Abedsaid seufzte und sagte: »Der Oberst wird wütender sein als ein angeschossener Rotluchs mit Zahnschmerzen.« Während seines vierjährigen Aufenthalts in Oklahoma hatte sich Abedsaid sorgfältig eine große Sammlung von Aphorismen, Metaphern und Vergleichen angeeignet, die für den Südwesten der USA besonders typisch waren. Er fand ein Vergnügen daran, seine Wortbeiträge damit zu würzen, vornehmlich in London, wo fast jeder daran Anstoß zu nehmen schien.
»Wie schnell können Sie ihn davon unterrichten?« fragte Ko.
»Innerhalb einer Stunde.«
»Wir haben beschlossen, es wäre am besten, wenn wir zurück nach Rom gingen.«
»Sie alle?«
»Ja, wir alle drei.«
»Brauchen Sie irgendwas – Geld?«
»Nein, Geld gibt es genug«, sagte Ko, der an die zwanzigtausend Dollar in Zwanzig- und Fünfzig-Dollar-Scheinen dachte.
»Ich kann denen in Rom Bescheid sagen, daß Sie kommen.«
»Ja, das wäre hilfreich.«
»Der Oberst wird … na ja, das hier wird ihm überhaupt nicht gefallen.«
»Nein«, sagte Ko. »Das wird es wohl nicht.«
»Er und Felix standen sich nahe. Äußerst nahe.«
»Ich weiß. Haben Sie eine Ahnung, was er tun wird?«
»Der Oberst?« Abedsaid legte eine Pause ein, als dächte er über die Frage nach. »Vermutlich irgendwas Bizarres«, sagte er und legte auf.
Die Boeing 727 hatte eine helle Cremefarbe und trug keine anderen Kennzeichen als das Minimum der von der internationalen Luftfahrtbehörde vorgeschriebenen. Sie befand sich in fünf Meilen Höhe und 213 Meilen westlich von Irland, als der neunundfünfzigjährige Arzt in den nach Kundenwünschen eingerichteten Salonbereich schlurfte und in den Sessel gegenüber des Mannes sackte, der sich manchmal Arnold nannte.
»Nun ja, Sir, er ist von uns gegangen«, sagte der Arzt mit einem schweren Seufzer, der dem andern Mann eine Whiskyfahne ins Gesicht wehen ließ.
»Was meinen Sie damit, von uns gegangen?«
»Wie ich sagte, von uns gegangen. Tot. Er ist gestorben. Wollen Sie’s auf fachchinesisch oder wollen Sie’s in Laiensprech?«
Arnold sprang aus seinem Sessel hoch und beugte sich tief über den Arzt, der vor den großen Händen zurückwich, die ziellos herumfuchtelten, als suchten sie etwas, das sie packen – oder würgen – konnten. Arnolds Augen traten aus ihren Höhlen hervor, und sein merkwürdig gummiartiges Gesicht nahm ein dunkles, gefährliches Rot an, während sich sein Mund in seltsame Formen verzog. Der Irre wird gleich schreien, dachte der Arzt.
»Er ist nicht tot«, sagte Arnold, als sein Mund sich schließlich zu einem aufgesetzten Lächeln verzerrt hatte, das der Arzt für mehr als nur ein bißchen wahnsinnig hielt.
Der Arzt schüttelte weise das Haupt. »Wieviel von dem Dreck habt ihr in ihn reingepumpt?«
Arnold wischte sich heftig über die untere Hälfte seines Gesichts, als wolle er alle Spuren von Schock und Überraschung beseitigen. »Wieviel? Genau wie Sie uns gesagt haben, Dr. Lush. So viel. Einhundert Milligramm.«
Der Arzt runzelte die Stirn, bemühte sich, nachdenklich, sogar besonnen auszusehen. »Na ja, so viel hätte er eigentlich verkraften können sollen – vorausgesetzt, ihr habt keinen verdammt blöden Fehler gemacht – oder er hatte irgendein Problem mit der Atmung. Oder ein Herzleiden. Oder irgendwas.« Seine Miene hellte sich auf. »Jedenfalls wird es sich bei der Autopsie rausstellen.«
»Nein«, sagte Arnold und lächelte wieder, wenn auch nicht ganz so wahnsinnig.
»Was heißt nein?«
»Er ist nicht tot.«
»Oh doch, er ist vollkommen tot«, sagte der Arzt ruhig, überzeugt von seiner Diagnose. »Er ist tot wegen all der Drogen, die ihr in ihn reingepumpt habt. Wahrscheinlich hat ihn das so glücklich gemacht und entspannt, daß er ganz vergessen hat zu atmen. Aber wie ich sagte, bei der Autopsie wird sich’s rausstellen.«
»Nein«, sagte Arnold.
»Was heißt diesmal nein?«
»Keine Autopsie.«
Der Arzt runzelte die Stirn, als versuche er sich an irgendwelche halb vergessenen Anweisungen zu erinnern. Endlich schien er sich zu entsinnen. »Also wenn’s keine Autopsie gibt, dann muß ich die andere Sache machen.«
»Wie lange wird das dauern?«
Der Arzt runzelte wieder die Stirn. »Zwei Minuten. Vielleicht drei.«
»Dann machen Sie’s«, sagte Arnold.
Als der Arzt fertig war, brauchte die 727 nur vier Minuten für den Sinkflug auf sechstausend Fuß. Ihre Hintertür, eine von fallschirmspringenden Luftpiraten einmal sehr geschätzte Vorrichtung, wurde abgesenkt. Einen Moment später fiel der Körper des Mannes namens Felix etwas mehr als eine Meile bis ins Meer.
3
Die Immobilienmaklerin in Lissabon hatte Chubb Dunjee, dem Ex-Kongreßmann, nichts von den Stufen gesagt. Aber selbst wenn sie es getan hätte, hätte er das Haus in Sintra wohl trotzdem gemietet, weil es relativ billig war und die achtundsechzig Stufen, die hinunter zur Straße führten, für ein bißchen Bewegung sorgten und seinen Besuchern überhaupt nichts ausmachten, weil es keine gab. Oder fast keine.
Die Maklerin hatte das Haus ziemlich großspurig als Villa bezeichnet, aber in Dunjees Augen war es ein Fünf-Zimmer-Bungalow, der auf verblüffende, irgendwie deprimierende Weise der Variante mit dem roten Ziegeldach ähnlich sah, die man überall in seiner südkalifornischen Heimat fand. Das Haus gehörte einer älteren englischen Witwe, die mit zweiundsiebzig plötzlich beschlossen hatte, Brasilien einen Besuch abzustatten, dem Geburtsland ihres verstorbenen Mannes. Es hieß, die Witwe sei besonders neugierig, wie es am Oberlauf des Orinoko wirklich aussah.
Das Haus mit den achtundsechzig Stufen war Dunjee unter der Bedingung billig vermietet worden, daß er die auch als Köchin fungierende Haushälterin und den Gärtner übernahm, der sich vorzüglich um den fast einen Morgen großen, mit Immergrün, Rosen, Geranien, Kamelien, wildem Lavendel und zwei anderen Arten bewachsenen Garten kümmerte – die eine rosa, die andere gelb –, die Dunjee (kein Blumenliebhaber) nicht bestimmen konnte, aber immer Stiefmütterchen nannte.
Während seines siebzehnmonatigen Aufenthalts in Sintra, den er schließlich als eine Art Exil oder vielleicht sogar Verbannung betrachtete, hatte Dunjee sich rund vierhundert Wörter Portugiesisch beigebracht. Das war genug, um die Hausmannskost der Köchin zu loben, mit dem Gärtner über das Wetter zu plaudern und dem Postboten für das Ersteigen der achtundsechzig Stufen zu danken, um die zwei bis drei Tage alte Ausgabe der International Herald Tribune abzuliefern – praktisch die einzige Post, die Dunjee erhielt.
Wenn das Wetter schön war, saßen er und der Postbote gelegentlich draußen unter den Zitronenbäumen neben dem Eisentor zur Treppe und tranken in angenehmem Schweigen ein oder zwei Glas Wein. Zu einem der beiden Weihnachten, die Dunjee in Sintra verbrachte, hatte er dem Postboten einen guten Schinken aus Chaves geschenkt.
Vier Tage, nachdem der Mann namens Felix etwas mehr als eine Meile bis ins Meer gefallen war, hatte Dunjee seinen ersten richtigen Besucher seit fast elf Monaten. Er kam unangekündigt um die Mittagszeit mit einem Taxi. Mittags war die Zeit, da Dunjee gern draußen unter den Zitronenbäumen saß und das Kreuzworträtsel in der Herald Tribune zu lösen versuchte. Vor Portugal hatte Dunjee Kreuzworträtseln keine Beachtung geschenkt. Inzwischen betrachtete er sie als albernes Laster, das für ihn eine gewisse Suchtgefahr enthielt.
Der Besucher unten auf der Straße war Paul Grimes. Er stieg aus dem Taxi, bezahlte den Fahrer und wandte sich den achtundsechzig Stufen zu, um sie einer freudlosen Einschätzung zu unterziehen. Als er die Treppe hochzugehen begann, erhob sich Dunjee, versuchte sich an das portugiesische Wort für Gast zu erinnern, und begab sich zur Küche, um der Haushälterin zu sagen, daß er gleich einen hätte.
Als Grimes oben an der Treppe ankam, atmete er schwer, fast keuchend. Er machte eine Pause, um sich gegen die mit Prunkwinden berankte Stützmauer aus Backsteinen zu lehnen. Die rundliche Haushälterin stand neugierig und ein bißchen aufgeregt neben den Gartenstühlen aus Holz und hielt ein Tablett mit Gläsern und zwei kalten Bierflaschen in der Hand.
Grimes, der jetzt schwitzte, aber nicht mehr so sehr keuchte, starrte Dunjee mehrere Augenblicke an, lächelte dann und sagte: »Warum Portugal?«
»Das Etikett auf einer Sardinendose«, sagte Dunjee. »Ich habe es mir manchmal genauer angesehen, als ich arm war. Du weißt, wie arm ich war.«
Grimes nickte nachdenklich, immer noch lächelnd.
»Willst du ein Bier?« sagte Dunjee.
»Gott, ja.«
Sie schafften es, sich nicht die Hände zu schütteln – Dunjee, indem er auf die Gartenstühle zeigte, Grimes, indem er sich mit einem Taschentuch die Stirn abwischte, während er hinüberging und sich mit einem Seufzen hinsetzte. Als die Haushälterin ihm sein Bier servierte, dankte er ihr förmlich, sogar liebenswürdig auf spanisch, weil er nicht Portugiesisch sprach, aber den Eindruck zu haben schien, daß Spanisch zumindest näher dran wäre als Englisch. Die Haushälterin lächelte feierlich und ging den Gärtner suchen, um mit ihm über den Besucher plaudern zu können.
Nachdem Grimes eine Zigarette hervorgeholt hatte, zündete er sie sich an, trank die Hälfte des Biers in seinem Glas, füllte es wieder nach, schaute sich sorgfältig um, als wäre er wirklich daran interessiert, was er sah, und sagte: »Hübsches Haus.«
»Ruhig.«
»Was machst du den ganzen Tag?«
Dunjee dachte zuerst nach. »Ich lese viel, laufe ein paar Meilen, gehe einkaufen, besuche ein paar Kneipen, grübele ein wenig.«
Wieder nickte Grimes. Diesmal war es ein anerkennendes Nicken, das Dunjee zu einem strengen, aber produktiven Terminplan zu beglückwünschen schien. Nach einem weiteren Schluck Bier kam er zur Sache. »Wie sieht es mit dem Geld aus?«
»Es ist genug da.«
»Nun.«
»Nun, was?«
Grimes zuckte leicht, fast gleichgültig mit seinen schweren Schultern. »Na ja, ich dachte nur, du hättest vielleicht Lust, welches zu verdienen.«
Dunjee lächelte. Er hatte ein merkwürdig träges, merkwürdig herzliches Lächeln, mit vielen weißen Zähnen, das normalerweise ausreichte, die meisten Leute zu bezaubern. Er hatte es immer für eine praktische, fast schmerzlose Methode gehalten, nein zu sagen. Ein Großteil des Lächelns war noch da, als er sagte: »Ich tue das nicht mehr.«
»Was?«
»Das, was du von mir getan haben willst.«
Dunjee stellte fest, daß es ein Vergnügen war, Grimes dabei zuzusehen, wie er das Thema wechselte. Er tat es reibungslos, mühelos – auf eine Weise, die in Dunjees Kopf alte Markennamen wachrief: Fluid Drive, Hydramatic, Powerglide.
»Weißt du, woran ich mich zu erinnern versucht habe?« sagte Grimes. »Ich hab versucht, mich daran zu erinnern, wie lange es her ist, daß wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Zwölf Jahre?«
»Dreizehn«, sagte Dunjee. »Fast vierzehn. Chicago, achtundsechzig.«
Grimes nickte, als ob er sich plötzlich erinnerte. »Diese Schweinerei. Hast du je von ihr gehört?«
»Von Nan?«
»Unsere Nan.« Grimes sprach den Namen fast ehrfürchtig aus. Nan war Dunjees Exfrau.
»Man hört, sie hätte einen Getreidemakler geheiratet und lebte in St. Paul«, sagte Dunjee. »Sie soll auch sehr aktiv im Little League Baseball sein. Als Coach. Hört man.«
»Herrgott. Unsere Nan.«
Die Haushälterin erschien aufs neue mit noch zwei Bierflaschen, und Grimes dankte ihr wieder auf spanisch. Als sie verschwunden war, lächelte er schief. »Wie hat sie dich dauernd im Hilton genannt, direkt nachdem du ihr gesagt hattest, du würdest auf keinen Fall raus auf die Straße gehen und dir für die Bewegung den Kopf einschlagen lassen. Eine Art Kosename.«
»Kryptofaschist«, sagte Dunjee.
»Unsere Nan«, sagte Grimes, inzwischen nickend und lächelnd, wie bei einer liebevollen Erinnerung. »Direkt danach hat sie sich mit den Weathermen davongemacht, oder?«
Dunjee schüttelte den Kopf. »Das war im nächsten Jahr – neunundsechzig.«
»Wie lange hat das gedauert?«
»Sechs Monate. Bis sie dreißig wurde – und kein Geld mehr hatte.«
»Und damit warst du erledigt, oder? Selbst in deinem Wahlkreis. Teufel noch mal, du mußt mehr Kiffer und Geisteskranke und alte, pensionierte jüdische Sozialisten und Ex-Trotzkisten gehabt haben als jeder andere Bezirk im Staat, abgesehen von Berkeley vielleicht.«
Dunjee zuckte mit den Achseln. »Selbst die konnten das mit den Weathermen nicht schlucken. Daraus hat man mir einen Strick gedreht.«
»Aber du hattest die eine Legislaturperiode.«
»Das stimmt. Ich hatte die eine Legislaturperiode.«
Grimes schüttelte traurig den Kopf. »Unsere Nan«, sagte er, diesmal mit einem gewissen Tadel in der Stimme. »Wenn sie nicht gewesen wäre, wärst du vermutlich noch immer drin. Es sprach alles für dich – ehemaliger Captain der Special Forces, die ganze Brust voll Orden, eindeutig gegen den Krieg und fast das jüngste Kongreßmitglied mit einem Bezirk voll roter Brüder und Schwestern. Mensch, Chubb, du hättest da Wurzeln geschlagen, wenn sie nicht gewesen wär. Unsere Nan.«
»Ich war das jüngste Kongreßmitglied«, sagte Dunjee, und es mißfiel ihm, das zu erwähnen. »Zumindest war ich es, als ich gewählt wurde.«
»Yeah, ich glaube schon.« Es entstand ein Schweigen, bis Grimes sagte: »Weißt du, was ich jetzt mache?«
Dunjee schaute ihn mehrere Augenblicke prüfend an. »Vermutlich das, was du immer gemacht hast – die Schweinerei wegmachen, die andere angerichtet haben.«
Grimes lachte leise in sich hinein. Es war das leise, sprudelnde Lachen eines dicken Mannes mit einem leichten Keuchen. Als Dunjee ihm an der Uni begegnete, mehr als zwanzig Jahre zuvor an der UCLA, hatte Grimes eine fast unheimliche Ähnlichkeit mit Victor Mature gehabt, einem bekannten Schauspieler. Grimes hatte diese Ähnlichkeit immer dafür verantwortlich gemacht, daß er nicht in die Politik gegangen sei, weil er völlig davon überzeugt war, daß niemand im Traum darauf käme, Victor Mature für irgendwas seine Stimme zu geben.
Mit inzwischen dreiundvierzig, möglicherweise vierundvierzig Jahren hatte Grimes nicht mehr die geringste Ähnlichkeit mit Victor Mature – von der Adlernase vielleicht abgesehen. Im Lauf der Jahre war Grimes’ Gesicht rund und voll und rosig und sanft geworden, sein Kieferknochen umkränzt von zwei dicken weichen Fettwülsten. Was von seinem Haar übrig war, hatte er sehr tief auf der linken Seite gescheitelt, fast am Ohr, und hoch und auf die andere Seite gekämmt. Aber das brachte wirklich nicht viel. Er wirkte trotzdem kahlköpfig. So ziemlich alles, was Grimes davor bewahrte, wie ein fröhlicher fetter Mann auszusehen, waren diese Hakennase und diese kalten, feuchten, silbrigen Augen. Die Augen glitzerten irgendwie, fand Dunjee, möglicherweise amüsiert, aber bestimmt nicht fröhlich.
Grimes lachte immer noch sein routiniertes Dickmännerlachen, als er sagte: »Würde es dir gefallen, einen Haufen Geld zu verdienen?«
»Ich brauche kein Geld.«
Wieder tauchte Tadel in Grimes’ Lächeln und in seinem Tonfall auf; sanfter Tadel. »Du hast 4.136 Dollar und ein paar zerquetschte auf dieser Lissabonner Bank. Damit kommst du noch zwei Monate aus – drei, wenn du knauserst.«
Es dauerte mindestens dreißig Sekunden, bevor Dunjee antwortete. »Wieviel ist heutzutage ein Haufen Geld?«
»Sagen wir hunderttausend – plus Spesen.«
Dunjee nickte. Es war ein Nicken, das leichtes Interesse andeutete, nicht mehr. Es war alles, was Grimes brauchte.
»Wir haben uns nach der Wahl aus den Augen verloren. Der 1970er Wahl. Aber ich –«
Dunjee unterbrach ihn. »Eine Menge Leute haben mich aus den Augen verloren. Ex-Frischlinge im Kongreß tragen offenbar eine Art Paria-Aura mit sich herum. Vielleicht auch einen Geruch. Den Geruch von Niederlage und Schock. Jemand sollte eine Seife entwickeln.«
»Wie gesagt, wir haben uns aus den Augen verloren, aber ich habe deine Spur verfolgt. Du hast dich nicht unterkriegen lassen. Du bist ins Ölgeschäft gegangen.«
»Ein Sahnestück«, sagte Dunjee. »Man mußte nur einen Strohhalm reinstecken, und es kam rausgesprudelt. Ich hab das Geld besorgt, alles Steuerfluchtmodelle. Fünftausend hier, zehn da. Und wir steckten den Strohhalm rein, und raus kam’s gesprudelt. Salzwasser. Eine Million Barrel am Tag – oder so was in der Art. Zum Teufel, ich erinnere mich nicht.«
Grimes machte ein mitfühlendes Schnalzgeräusch und begann sich noch eine Zigarette anzuzünden. Während er in die Streichholzflamme starrte, bevor er sie ans Ende der Zigarette hielt, sagte er: »Dann gab es diesen Abstecher zur UN.«
»Abstecher«, sagte Dunjee ein wenig spöttisch. »Ja, mein Abstecher bei der UN. Zweiundvierzigtausend im Jahr, steuerfrei, eine Menge Reisen und nützliche und produktive Gespräche mit den Führern der weniger entwickelten Länder der Welt. Es war so, als würde man mit Nan reden.«
»Unsere Nan. Nun, als du bei der UN aufgehört hast, hab ich ein paar Jahre deine Spur verloren.«
Dunjee starrte Grimes wieder an, bevor er lächelte und sagte: »Du hast meine Spur nicht verloren. Ich war zwei Jahre lang Taxifahrer. Ich bin in Miami und Houston und Denver und Seattle und San Francisco und Great Falls und New Orleans Taxi gefahren. In einer guten Woche hab ich hundertfünfzig Dollar verdient. Dann beschloß ich eines Tages, daß ich keine ›Geschichte, die das Leben schrieb‹ werden wollte. Man sieht sie die ganze Zeit. Ich glaube, neulich war eine in der Herald Trib. Irgendwas mit dem Titel ›Jüngster Ex-Gouverneur Taxifahrer in Chicago‹ oder so ein Mist. Und es geht darum, daß dieser Typ, der mit siebenundzwanzig oder so Gouverneur von Michigan oder West Virginia war, bis er Schnaps und Bräute entdeckte, inzwischen mit fast fünfzig Taxi fährt und nie im Leben glücklicher war wegen der tiefen Einblicke, die er nicht nur in sich selbst, sondern in die Menschheit allgemein gewonnen hat.«
Grimes nickte mehrfach, als hätte er die gleichen Geschichten gelesen. »Also bist du nach Mexiko gegangen.«
»Ich bin nach Mexiko gegangen.«
»Der Mordida-Mann. Du hast deinen Namen doch noch in die Zeitungen bekommen.«
Dunjee zuckte mit den Achseln. »Und sie sind aus dem Gefängnis gekommen.«
»Wie viele hast du« – Grimes machte eine Pause zur Wortwahl – »rausverhandelt?«
»Zweiundsechzig.«
»Bestechung und Erpressung.«
»Sie sind aus dem Gefängnis gekommen. Ich war gut darin. Meine Vorgeschichte war hilfreich – der Kongreß, die UN. Und daß ich Taxifahrer war. Du bekommst eine Menge wundervoller Einblicke in die menschliche Natur, wenn du Taxifahrer bist.«
»Man sagt, du hättest eine Menge Geld in Mexiko verdient.«
»Wer ist man?«
»Der IRS.«
Dunjee lächelte. »Mit dem hab ich ein leichtes Problem.«
»Nicht so leicht. Man spricht von Auslieferung.«
»Ich hab einen Anwalt drauf angesetzt.«
»Ich habe mit ihm gesprochen. Er macht sich Sorgen. Du hast 251.817 Dollar als Abzüge für Geschäftskosten geltend gemacht. Der IRS hat entschieden, daß es Schmiergelder waren. Schmiergelder sind keine rechtmäßigen Geschäftskosten.« Grimes gähnte. »Natürlich könnte ich das alles in Ordnung bringen.«
Noch einmal entstand ein langes Schweigen, bis Dunjee sagte: »Bleibst du zum Mittagessen?«
»Was gibt es denn?«
»Ich weiß nicht, was es gibt. Ich gehe mal nachsehen.« Er stand auf und ging zum Haus – ein hochgewachsener Mann, fast ein Meter neunzig groß, vielleicht mehr. Grimes bemerkte, daß Dunjees Fersen immer noch diesen schnellen, federnden Auftrieb hatten, wenn sie vom Gras hochkamen. Er dachte, daß Dunjee mit einundvierzig (oder waren es zweiundvierzig?) immer noch so durchtrainiert wirkte, daß er als Profisportler durchgehen konnte, der mindestens noch eine Saison spielen konnte. Oder vielleicht nur noch den Teil einer Saison.
Nach der revidierten Einschätzung fühlte sich Grimes etwas besser. Das Grau in Dunjees mittellangem, dunkelbraunem Haar trug auch dazu bei. Das war neu. Aber das Grau und diese neuen tiefen Falten waren ungefähr die einzigen körperlichen Veränderungen, die Grimes entdecken konnte. Dunjees braungrüne Augen waren immer noch eher schlau als weise, und sein Gesicht blieb immer noch durch diesen Wangenknochen davor bewahrt, zu regelmäßig, fast hübsch zu sein, den linken, der fast zwei Zentimeter höher hinausragte als der rechte. Aus einem bestimmten Blickwinkel ließ der schräge Wangenknochen Dunjee so aussehen, als schiele er ein bißchen.
Grimes trank gerade sein Bier aus, als Dunjee zurückkam. »Fisch«, sagte er. »Es gibt Fisch.«
»Gut«, sagte Grimes. »Fisch kann ich essen.«
Dunjee sank zurück in den niedrigen Gartenstuhl. »Du sagst, du kannst die Sache mit dem IRS in Ordnung bringen.«
»Ich kann das in Ordnung bringen.«
»Wer ist dein Auftraggeber?«
Grimes schüttelte den Kopf.
Dunjee starrte ihn einen Moment an und nickte dann ungeduldig. »Okay. Wenn du es mir sagst, bin ich dabei. Verbindlich. Wer ist dein Auftraggeber?«
»Das Weiße Haus«, sagte Grimes, der es gegen seinen Willen genoß, den Namen auszusprechen.
Dunjee kratzte sich den linken Handrücken, bemerkte einen Niednagel und beschloß, daran herumzukauen. »Das Weiße Haus, hmm?« sagte er zwischen zwei Bissen. »Das könnte bedeuten, der Chefgärtner oder der Pool-Mann oder ein achtundzwanzigjähriger Yale-Gelehrter im Untergeschoß vom West Wing oder –«
Grimes fiel ihm ins Wort. »Der Präsident.«
Dunjee seufzte. »Okay, Teufel auch, Paul. Dann erzähl mal, was los ist.«
4
Paul Grimes zufolge gab es verschiedene Gründe, warum Bristol »Bingo« McKay nicht mit den anderen nach Disneyland gegangen war, der erste davon war, daß er den Park für ein kleines bißchen blöd hielt. Außerdem hatte er ihn schon mal vor fast fünfzehn Jahren unter Protest besucht. Aber der wahre Grund, warum er diesmal nicht mitgegangen war, war einfach der, daß man keinen Schnaps mehr bekam, sobald man durch das Tor gegangen war, und die schreckliche Aussicht, Mickey Mouse ein weiteres Mal stocknüchtern gegenüberzutreten, war etwas, zu dessen Vermeidung Bingo McKay mit Vergnügen einen Meineid geschworen hätte.
Also hatte er sich herausgelogen und den frühen Nachmittag mit sechsundzwanzig Ferngesprächen, drei Drinks, einem leichten Mittagessen und fünf Bahnen im Swimmingpool des Marriott Hotels verbracht. Um sechzehn Uhr, was neunzehn Uhr an der Ostküste entsprach, hatte er seinen üblichen Fünf-Minuten-Anruf mit seinem kleinen Bruder in Washington geführt. Bingo McKays kleiner Bruder war Präsident der Vereinigten Staaten.
Wie immer sprachen sie über Politik, hauptsächlich über Innenpolitik, was Bingo McKays Spezialgebiet war; und wie immer hörte der Präsident aufmerksam dem treffenden, völlig unverblümten Bericht seines Bruders zu, dessen unangenehmere Tiefpunkte sich zehn Tage später in den landesweiten Meinungsumfragen spiegeln würden.
Aber zu diesem Zeitpunkt hätte der Präsident unter der umsichtigen Anleitung seines Bruders die notwendigen Kunstgriffe entwickelt, um eventuelle politische Schieflagen zu korrigieren. Das war einer der Gründe, warum Jerome McKay mit neununddreißig häufig als das vollkommenste politische Wesen im Weißen Haus seit Franklin Delano Roosevelt bezeichnet wurde, an den sich der Präsident, sosehr er sich auch bemühte, nicht erinnern konnte.
Inzwischen kaum neun Monate im Amt, war die neue McKay-Regierung absolut außerstande gewesen, irgendeins der ökonomischen Wunder zu vollbringen, die sie mehr oder weniger versprochen hatte. Die Inflation bewegte sich um geschätzte neunzehn Prozent; das monatliche Zahlungsbilanzdefizit lag dauerhaft bei etwa 2,6 Milliarden Dollar; die Arbeitslosigkeit war auf fast zehn Prozent gestiegen; die Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts war irgendwie bei Null steckengeblieben, und Benzin kostete, obwohl es rationiert war, 2 Dollar 26 die Gallone an der Ostküste und 2 Dollar 31 im Westen. Die durchschnittliche Wartezeit an einer Tankstelle war von den NBC News bei siebenundzwanzig Minuten und achtundzwanzig Sekunden gestoppt worden, obwohl eine Stunde keineswegs ungewöhnlich war.
All das war für die McKay-Regierung besonders peinlich, weil sie ihren Wahlkampf mit Öl – oder besser gesagt: dagegen – betrieben hatte. Die Strategie der Brüder McKay war eigentlich ziemlich simpel gewesen – sträflich simpel, meinten später viele. Jerome McKay hatte seine politischen Gegner ignoriert und war stattdessen gegen die OPEC und die großen Erdölfirmen angetreten – und gegen die Russen.
Der zukünftige Präsident hatte ein ungewöhnliches Verständnis der Öl- und Erdgasindustrie, weil Bingo McKay ihn mit zweiundzwanzig in das Geschäft eingeführt hatte, wodurch er mit achtundzwanzig zum Multimillionär geworden war. Mit dreißig war Jerome McKay vom Fünften Bundeswahlkreis Oklahomas in das US-Repräsentantenhaus gewählt worden und hatte mit einiger Auszeichnung oder zumindest unter beträchtlichem bundesweiten Aufsehen zwei Sitzungsperioden durchlaufen, bis er auf seinen Sitz verzichtet hatte, um sich mit Erfolg um das Amt des Gouverneurs in seinem Heimatstaat zu bewerben.
Bingo McKay war einundfünfzig, als er die große Landkarte der Vereinigten Staaten in das Büro seines kleinen Bruders im Gouverneurspalast an der Northeast 23rd Street in Oklahoma City geschleppt und auf eine Staffelei gestellt hatte. »Wofür zum Teufel ist das denn?« hatte der Gouverneur, damals erst siebenunddreißig, gefragt.
»Grundlagen der politischen Geographie, Lektion Nummer eins. Wie würde es dir gefallen, zum Präsidenten gewählt zu werden?«
»Sehr.«
»Dann erzähl ich dir, wie wir’s machen.«
Sie machten es, indem sie höchst aufmerksam elementare politische Grundregeln beachteten und indem sie unbeirrt gegen die OPEC und das wetterten, was Jerome McKay als das Öligopol beschimpfte – und gegen die Russen. McKay verfluchte die Gier und die Habsucht der Ölfirmen energisch mit unanfechtbaren Fakten und Zahlen, wodurch er den dunkelsten Verdacht von 69,2 Prozent der amerikanischen Wähler bestätigte, die sich schon lange nach einem so leicht identifizierbaren Sündenbock gesehnt hatten.
McKay bot anscheinend praktische, äußerst vernünftige Lösungen und präsentierte sich als Experte für das Ölgeschäft, der er mit Sicherheit war, und zugleich als reumütigen Sünder, der sein Vermögen damit gemacht hatte, daß er denselben niederträchtigen Methoden folgte, die er mittlerweile verurteilte. Der autobiographische Bericht über seinen Wahlkampf, den er selbst in drei Wochen schrieb, trug den Titel Plündere! und stand siebenunddreißig Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times, und das Taschenbuch verkaufte sich noch besser.
Die Strategie der Brüder McKay war sowohl ausgezeichnetes Theater als auch solide Politik. Jerome McKay schlug seine Rivalen in fast einem Drittel der Vorwahlen vernichtend, sicherte sich die Nominierung seiner Partei im vierzehnten Wahlgang um drei Uhr früh und gewann dann die Präsidentschaftswahl mit 48,3 Prozent der abgegebenen Stimmen und einem Vorsprung von zwei im Wahlmännergremium. Nicht ganz ein Jahr später fand er sich in ein heikles, sogar verzweifeltes Hasardspiel um Öl verwickelt.
Es hatte mit einem Flüstern in der Lounge der Delegierten bei den Vereinten Nationen begonnen. Dann wurde dem amerikanischen Botschafter in Rom gegenüber eine Andeutung fallengelassen. Es sei natürlich nichts verbindlich, sagte der Andeuter, aber es sei durchaus möglich, daß die Libysch-Arabische Volksrepublik, ein sowohl an Erdöl als auch an Streitsucht reiches Land, durchaus bereit sein könnte (könnte, wohlgemerkt), ihre Förderung von Erdöl zu erhöhen und es für die Vereinigten Staaten vorzumerken – eine feste Garantie natürlich –, im Austausch für das Recht, einige der neuesten technischen Spielereien der Amerikaner zu erwerben, zu denen auch ein paar Sachen gehörten, die man als äußerst hochentwickelte Waffen bezeichnen könnte.
Jerome McKay beschloß, an dem verführerischen Köder ein wenig zu knabbern, und schickte seinerseits ein bißchen Gemurmel und Geflüster über Lagos, Nigeria, nach Tripolis. Das amerikanische Signal erreichte zu gegebener Zeit die Ohren des Führers des neuen Militärregimes in Libyen, Oberst Youssef Mourabet, ein auf die Schnelle beförderter Major der Armee, der nach dem unerwarteten Tod des noch jungen, oft cholerischen Oberst Muammar Gaddafi vor sechs Monaten an die Macht gekommen war. Der Herzinfarkt, den Gaddafi nicht überlebt hatte, war Gerüchten zufolge durch einen ungeheuren Wutanfall ausgelöst worden.
Also war eine inoffizielle Zwölf-Mann-Delegation unter der Leitung des neuen Verteidigungsministers von Libyen, Major Ali Arifi, auf einen informellen Schaufensterbummel in die Vereinigten Staaten geschickt worden. Und da alles absolut und eindeutig inoffiziell war, hatte der Präsident seinen Bruder als Fremdenführer eingeschleust, wodurch er die Regierung hübsch von einer offiziellen Anerkennung des Ausflugs trennte, aber die Libyer zugleich enorm zufriedenstellte, weil Bingo McKay, wenn auch mit keinem Regierungsposten belastet, normalerweise als dritt- oder viertmächtigster Mann in Washington betrachtet wurde. Viele sagten sogar, er sei der zweitmächtigste.