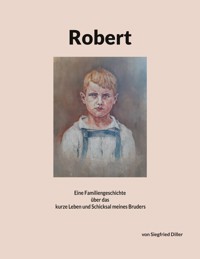Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Roman zeichnet den Werdegang des jungen Franz Diller aus Merkendorf bei Bamberg zum späteren Nagelschmied, dem Nagler Franz, in Taufkirchen bei Eggenfelden auf. Auf dem Weg dorthin, angefangen von der Lehrzeit über die Walz bis zur eigenen Selbstständigkeit, erlebt Franz Abenteuer, Enttäuschungen, Widrigkeiten des Lebens und sogar historische Zäsuren, aber auch die große Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Auf dem Feldweg von Merkendorf nach Laubend
Gespräch im Elternhaus mit der Mutter
In der Nagelschmiede zu Merkendorf
Abschied von den Toten auf dem Friedhof
Abschiedsbesuch bei den Großeltern in Laubend
Eine ereignisreiche Abschiedswoche
Abschiedsfeier mit den Freunden im Dorfwirtshaus
Reisevorbereitung und Abschied vom Meister
Kirchgang und Abschied von den Eltern und Geschwistern
Erste Walzetappe von Bamberg nach Strullendorf
Glück- oder Unglückstag?
Erlebnisse auf einem Bauernhof
Sonntäglicher Kirchgang
Sündhaftes Begehren und ein Zeichen vom Himmel
Abschied vom Bauernhof in Eggolsheim
Gesellenplatz in Erlangen
Verzinnte Nägel
Betrug beim Würfelspiel
Der gelöste Betrugsfall
Abschied von Erlangen und Fahrt nach Fürth
Ein neues Zeitalter beginnt
Vorweihnachtliche (Miss-)Stimmung
Erstes Weihnachten in der Fremde
Brandgefährlich
Osterbräuche
Emmausgang
Abschied von Fürth
Unterkunft in Feucht und Mitarbeit am Kanal
Längerer Aufenthalt in Berg und Neumarkt in der Oberpfalz
Weitere Stationen von Berching bis nach Kelheim
Ankunft in Kelheim und Einkehr in Weltenburg
Schifffahrt auf der Donau nach Regensburg
Donauabwärts ins Niederbayerische nach Straubing
Mit Hindernissen gepflasterte Wegstrecke
Kirchweih in Taufkirchen
Eine hübsche Erscheinung
Erste Arbeitswoche in Taufkirchen
Überraschendes Zusammentreffen
Begegnung auf dem Rossmarkt und in Wickering
Gegenbesuch in Taufkirchen und Aufdeckung der Liebschaft
Zeit der Prüfung für die Liebe zwischen Franz und Therese
Versteckspiel und Entdeckung der körperlichen Liebe
Wichtige Weichenstellungen zum Glück
Antrittsbesuch und Verlobung in Wickering
Inbesitznahme der Nagelschmiede und Bestellung des Aufgebots
Ein glückliches Brautpaar
Geburt und Tod des ersten Kindes
Geburt und Ableben des Stammhalters
Maria – die Wohlgenährte
Anhang
Vorwort
So könnte es gewesen sein … oder so ähnlich oder auch ganz anders. Dieser Familienroman ist eine fiktive, also erdachte und angenommene, Geschichte über meinen Urgroßvater väterlicherseits, mit historischen Daten und geschichtlichem Hintergrund. Im Laufe meiner hobbyhaften Ahnenforschung traten immer neue Fakten zu Tage über den Nagelschmied Franz Diller. Der „Nagler Franz“, wie der Titel dieses Buches lautet, lebte im 19. Jahrhundert, im Übergang zur Neuzeit, die geprägt war von der beginnenden Industriealisierung. Er erlebte den schleichenden Niedergang seines Handwerks, die Landflucht und das Aufblühen neuer Berufe. Er verspürte noch das harte, entbehrungsreiche Landleben der einfachen Bevölkerung und musste mit ansehen, wie Krankheiten und hohe Kindersterblichkeit die Menschen oft schon in jungen Jahren hinwegrafften. Seine Lebensstationen waren in Bayern die Regierungsbezirke Oberfranken, Niederbayern und Oberpfalz. So musste er mit den Eigenheiten und Gepflogenheiten der jeweils dort lebenden Menschen und mit den verschiedenen Dialekten zurecht kommen. Sein Leben und Wirken war geprägt von den gesellschaftlichen und religiösen Konventionen des 19. Jahrhunderts. Seine Katholizität half ihm in vielen Lebensbereichen, der christliche Glaube gab ihm Halt und Zuversicht, auch wenn ihm verschiedene Frömmigkeitsformen der damaligen Zeit übertrieben vorkamen und er mit manchen Aussagen der Geistlichkeit haderte. Letztere Aussage ist aber eine angenommene Behauptung meinerseits im Roman.
Am Romanende ist der Stammbaum meiner Vorfahren angefügt – so wie ich ihn in den Archiven der Diözesen Regensburg und Bamberg sowie in Falkenberg/Taufkirchen erforschen konnte. Die Geburts-, Hochzeits- und Sterbedaten sind dabei allerdings auf meinen Urgroßvater, dessen erste Ehefrau, seine Kinder aus erster Ehe, seine Eltern und Brüder begrenzt. Weitere Angaben über die Nachkommen bis in unsere Zeit sind – auch aus datenschutzrechtlichen Gründen – nicht aufgeführt. Im Anhang ist auch Wissenswertes zu Personen, Orten, geschichtlichen Vorkommnissen und Gegebenheiten zu finden.
Leider haben meine Vorfahren über ihr Leben, Wirken und ihre Erfahrungen keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen. Ich habe, mit den wenigen Daten, die mir zur Verfügung standen, versucht, ein wenig die Vergangenheit meines Urgroßvaters zu erhellen und nachzuzeichnen. Wenn sein Lebensweg, seine Einstellungen und seine Erlebnisse anderer Art gewesen sein sollten, so möge er mir meine literarische Abhandlung über ihn verzeihen.
Auf dem Feldweg von Merkendorf nach Laubend
Für die herrlichen Feldblumen am Wegesrand hatte Franz heute wirklich keinen Blick übrig, denn zu sehr plagten ihn die quälenden Gedanken, bald auf die nicht ganz ungefährliche Walz gehen zu müssen. Der Abschied von seiner geliebten Heimat Merkendorf bei Bamberg fiel ihm wahrlich nicht leicht. Den Weg zu den Großeltern ins nahe gelegene Bauerndorf Laubend war er in seiner Kinder- und Jugendzeit schon öfter gegangen, um bei der Stall- und Feldarbeit immer wieder Neues zu entdecken. Er war gerne als Kind den gackernden Hühnern hinterhergelaufen, hatte gerne die Hasen oder die Katze gestreichelt und die Tauben verjagt; nur zu den stinkenden Schweinen hatte er nicht gehen wollen und sich vor dem Füttern gedrückt. Hin und wieder hatte er später auch dem Großvater geholfen, die vier Kühe zu melken und den angrenzenden Stall hinter dem Wohnhaus auszumisten, denn die Gicht hatte dem Bauern in den letzten Jahren immer wieder schwer zu schaffen gemacht. Auch wegen der Kochkunst der Oma war er öfter auf den kleinen, bescheidenen Hof gekommen, vor allem wenn es freitags Rohrnudeln mit Rosinen gab. Das war sein Leibgericht, auch wenn seine beiden Brüder Petrus, einfach Peter gerufen, und Josef die Weinbeerl’n immer herauspulten und den Hühnern verfütterten. Doch heute suchte er den Trost und die guten Ratschläge beim Opa und bei der fürsorglichen Oma. Denn lange Zeit würde er sie wohl nicht mehr sehen oder aufgrund ihres hohen Alters – vielleicht gar nicht mehr sehen können. Auf der Walz war eine Verbindung nach Hause bekanntlich kaum möglich – auch wenn er sich mehrere Wochen oder Monate am gleichen Ort aufhalten würde und einen Brief schreiben und so vielleicht Antwort erhalten könnte. Die Großeltern konnten einigermaßen gut lesen, auch wenn sie als Kinder bei ihren Eltern bei der Feldarbeit hatten mithelfen müssen und so, außer in den Wintermonaten, den Unterricht in der Schule versäumt hatten. Würde der Brief per Post bei ihnen überhaupt ankommen? Oder wenn er einem anderen Fremden auf der Walz eine Nachricht übergeben würde in der Hoffnung, dass dieser irgendwann bei Merkendorf vorbeikäme, weil dieser in Richtung Norden mit Ziel Bamberg unterwegs wäre – würde dieser sie dann wohl gewissenhaft überbringen? Eigentlich verstand Franz nicht, warum er die Heimat verlassen musste. Er würde viel lieber in seinem Heimatdorf bleiben – auch deshalb, weil er hier seine Freunde hatte, mit denen er des Öfteren im gemütlichen Dorfwirtshaus gerne eine Maß Bier trank und die tristen Abende mit derben Späßen und Sprüchen verbrachte. Das kleine, urige Dorfwirtshaus lag nicht weit weg von seinem Vaterhaus des Johannes Diller in Merkendorf, Haus Nr. 32, und deshalb konnte er meist länger sitzen bleiben, da er im Gegensatz zu seinen Freunden keinen langen Heimweg hatte. Ja, und da war auch noch die hübsche Brauerstochter Lisa, die ihm in letzter Zeit verstohlen schöne Augen machte. Und bei einem Spassetl, einer Faschingsgaudi, hatte er sie sogar in den Arm genommen und ihr einen flüchtigen Kuss auf die Lippen gedrückt. Ihr Vater, der Gastwirt, zischte jedoch sofort scharfzüngig: „Da wird nichts d‘raus. Lass‘ die Finger von meinem Madel!“ Aber was nicht ist, könnte ja noch werden, dachte sich Franz insgeheim.
Sollte er das jetzt wirklich alles aufgeben? Sein Lehrherr in der Nagelschmiede hatte zu ihm nach Beendigung der dreijährigen Lehrzeit gesagt: „Franz, es hilft nichts: Du musst, wie jeder andere Handwerker auch, nach der Ausbildungszeit auf die Walz gehen und bei anderen Nagelschmieden dazulernen. Und das kannst Du nicht im Nachbarort tun, denn Du weißt ja, dass Du während der mehrjährigen Walz nicht Deine Heimat im Umkreis von 50 Kilometern betreten darfst.“ Das hatte Franz zu Beginn seiner Lehrzeit nicht gewusst und bedacht. Er meinte immer, dass dies nur die Zimmererleute betreffe, die er hin und wieder in ihrer schwarzen Kluft, mit dem breitkrempigen Hut und dem Wanderstock durch das Dorf marschieren sah. Aber die Zunftordnung war ein festgeschriebenes Gesetz, das jedermann einhalten musste. Und wenn er Nagelschmiedmeister werden und nicht ein Leben lang Hilfsarbeiter bleiben wollte, dann musste er die zwei- bis vierjährige Gesellenzeit auf der Wanderwalz als Fremdgeschriebener auf sich nehmen. Immerhin gehörten die Nagelschmiedemeister zu den angesehenen Handwerksberufen und man verdiente dabei nicht unerheblich. Allerdings hatte Franz auch schon gehört, und das beunruhigte ihn ein wenig, dass die zunehmende Industriealisierung – in seinem Fall die Herstellung von maschinell gefertigten Nägeln aus Draht – seinem Handwerk zusetzte. Aber dass das Handwerk des Nagelschmieds aussterben könnte, war für ihn noch unvorstellbar. Es wurden doch nach wie vor so viele, unterschiedliche Nägel benötigt. Allein der örtliche Dorfschuster benötigte für die Anfertigung und Reparatur der Arbeitsschuhe täglich Hunderte von Nägeln – und er, der Geselle Franz, schaffte als Tagespensum schon fast 2.000 Schuhnägel. Denn was gab es nicht alles für verschiedene Berufe, die die unterschiedlichsten Nägel benötigten: Es gab kantige und runde Nägel, Nägel mit kleineren und größeren, ganzen und halben Köpfen, viereckige Hufnägel, ferner Brettnägel, Lattennägel, Schindelnägel, Schiefernägel, Kutsch-, Reif und Bandnägel, Schlossernägel, Mauerernägel, Bootsnägel und Tornägel. Ja sogar für Fischerboote oder Holzkähne sowie für Zillen und Fähren waren Schiffsnägel mit 20 bis 25 Zentimetern Länge nötig. Und sogar für große Schleusennägel, die bis zu 45 Zentimeter lang waren, war Bedarf vorhanden; und daneben gab es noch die kleinen Zwecken, die von Sattlern gebraucht wurden und die so winzig waren, dass 1.000 Stück nur lediglich 125 Gramm wogen.
Es war keine leichte Arbeit in der Schmiede. Der heiße Schmelzofen, der ständig Hitze abgab und einem die Schweißperlen auf die Stirn trieb, und der schwere Schmiedehammer, mit dem man das glühende Eisenstück auf dem Amboss formte, setzten einem gewaltig zu und erforderten viel Kraft und Ausdauer. Hin und wieder musste ihn der Meister auch schimpfen, wenn er tags zuvor, besser gesagt nachts, dem dunklen Bier allzu süffig zusprach und ihm dann am nächsten Tag die Konzentration fehlte. Franz entschuldigte sich dann beim Meister meist mit dem Hinweis, dass er doch noch jung sei und das Leben ein wenig genießen müsse.
Angelangt beim großelterlichen Bauernhof musste Franz feststellen, dass nur die Magd das Anwesen hütete, weil die Großeltern mit den Nachbarn in deren Kutsche in die nahe gelegene Erzbistumsstadt Bamberg gefahren waren, um auf dem Josefimarkt Einkäufe zu erledigen. Schweren Herzens trat Franz deshalb grübelnd wieder den Heimweg an. Er würde es dann am nächsten Sonntag – dem einzigen freien Tag in der Woche – noch einmal probieren, und vielleicht kamen die Großeltern ja auch zur Messe nach Merkendorf in die Kirche. Und wenn nicht, dann würde er eben am Sonntagnachmittag den Weg zum Hof gehen.
Gespräch im Elternhaus mit der Mutter
Zuhause wieder angekommen begrüßte ihn die Mutter bereits mit den vorwurfsvollen Worten: „Wo hast Du Dich wieder rumgetrieben? Oder hast Du gar den ganzen Sonntagnachmittag im Wirtshaus verbracht? Du weißt doch, dass Du noch das Walzgesellenbuch mit Deinen persönlichen Angaben ausfüllen und Deinem Meister zur Bestätigung am Montag vorlegen musst!“ Mürrisch setzte sich Franz folgsam an den Küchentisch, holte Tintenfass und Federhalter aus der Tischschublade hervor und begann mühsam, das Formular zu lesen und auszufüllen. „Mutter“, seufzte Franz, „die wollen jetzt wissen, wie mein Taufname ist. Was soll ich jetzt eintragen: Johannes oder Franz?“ „Natürlich musst Du beide Taufnamen eintragen: Johannes Franz“, antwortete die Mutter. „Aber, warum werde ich dann nur Franz gerufen, wenn ich eigentlich Johannes Franz heiße? Kannst Du mir das erklären?“ „Das ist ganz einfach zu erklären: Dein Vater heißt ja mit Vornamen Johannes, und nach alter Sitte ist es Brauch, die Söhne nach dem Vater zu benennen. Damit man aber unterscheiden kann, wer der Senior und wer die Juniorbuben sind, bekommen die Söhne einen zweiten Namen, den Rufnamen. So heißen Deine Brüder ja auch Johannes Petrus und Johannes Josef. Im Taufbuch von Merkendorf ist es bei ihnen und bei Dir so verzeichnet.“ „Und wie bist Du für mich auf den Namen Franz gekommen?“ „Schau, Du bist doch am 6. Oktober 1817 geboren“, sagte die Mutter und erklärte ihm weiter: „Und zwei Tage vor Deinem Geburtstag ist der Festtag des heiligen Franziskus. Und so haben wir Franz von Assisi, dessen Namensfest die Kirche am 4. Oktober begeht, zu Deinem Namenspatron gewählt. Ich hab‘ nämlich noch zwei Tage vor Deiner Geburt zu dem Heiligen um einen glücklichen Geburtsablauf gebetet und ihm versprochen, mein Neugeborenes nach ihm zu benennen. Und weil die Geburt komplikationslos um sieben Uhr abends zuhause mit der Hebamme verlaufen ist, hab‘ ich mein Versprechen eingehalten und Dich durch den Geistlichen Profisor Lindner auf die beiden christlichen Namen Johannes und Franziskus taufen lassen. Taufpate war übrigens Dein Verwandter Johannes Dippold aus dem Nachbardorf Wiesengich. Das hat ganz gut gepasst, denn der heißt ja wie Dein Vater ebenfalls Johannes. Du kennst ihn schon – wir haben Dich doch immer wieder einmal zu ihm auf seinen Bauernhof geschickt, um Eier zu holen. Kannst Du Dich noch daran erinnern, wie Du einmal das Geldstückel verloren hast, das ich Dir in die Hand gedrückt habe, und Du noch einmal den Weg als Achtjähriger an einem heißen Augusttag gehen musstest?“ „Ja“, sagte Franz, „Gott sei Dank hatte die Bäuerin Mitleid mit mir und gab mir ein Glas Milch zu trinken. Damals war ich noch froh darüber; heute würde ich dankend ablehnen und nach einem Schoppen Bier verlangen.“ Die Mutter schüttelte nur den Kopf über soviel Unverfrorenheit ihres Sohnes, während Franz hellauf zu lachen begann.
In der Nagelschmiede zu Merkendorf
Am Montag in aller Früh vor Arbeitsbeginn übergab Franz das ausgefüllte Gesellenwalzbuch seinem Meister zur Unterschrift mit den Worten: „Würde der Herr Meister so gütig sein und seinen Servus darunter setzen?“ Darauf legte der Meister wert, dass er ihn in der dritten Person anredete, so wie es damals üblich war. Nach dem Durchlesen und der getätigten Unterschrift hakte Franz nach und fragte ängstlich: „Kann ich vielleicht nicht doch bei Ihnen bleiben?“ „Das geht nicht, Franz“, sagte der Meister. „Du kennst doch die Gesellenordnung; und außerdem kann ich Dich als Geselle nicht behalten; denn dann müsste ich Dir mehr Lohn bezahlen und das wirft meine kleine Schmiede nicht ab.“ „Kann ich dann wenigstens in die nahe gelegene Hauptstadt Nürnberg gehen?“, warf Franz zaghaft ein. „Ich habe nämlich gehört, dass sie dort eine neue Herberge gebaut haben für uns Walzbrüder.“ Der Meister schüttelte abermals verneinend den Kopf und gab Franz zur Antwort: „Ich glaube, das ist nichts für Dich, Franz. Du weißt, dass Du als Katholischer im protestantischen Nürnberg nur ungern gesehen bist. Weißt, auf der Walz müssen das Umfeld, das Milieu und die Religion stimmen. Du bist besser dran, wenn Du von Oberfranken mehr ins Niederbayerische oder nach Oberbayern gehst – das sind überwiegend katholische Landstriche.“ Franz schaute ganz entsetzt und meinte: „Was? So weit ins südliche Bayern soll ich gehen und womöglich alles zu Fuß? Das schaff‘ ich doch nie!“ „Ja, so ist es nun einmal“, gab der Meister zur Antwort. „Du darfst nicht mit einem eigenen Gefährt, einem Pferd, einem Einspänner oder gar einer Kutsche unterwegs sein, sondern nur zu Fuß; außer Dich nimmt unterwegs ein vorbeifahrendes Gefährt eine Wegstrecke mit – aber nur eine Etappe, so verlangt es die Zunftordnung.“ „Aber, da brauch‘ ich doch ewig, um an ein Ziel zu kommen“, erwiderte Franz. „Du hast ja als Wandergeselle fast vier Jahre Zeit, und da ist eben auch die Wanderschaft miteingerechnet.“ Franz wollte noch mehr wissen und fragte: „Das sind ja geschätzte 100 bis 200 Kilometer, wenn nicht gar mehr. Ich schaff‘ aber doch höchstens mit dem Wandersack und den darin enthaltenen Utensilien vielleicht fünf Kilometer. Und wo schlaf‘ ich unterwegs?“ „Nun ja“, sagte der Meister, „Du musst natürlich nach jeder Tagesetappe einen Unterschlupf suchen, entweder bei einem Bauern in der Scheune oder in einer Herberge oder in einem Gasthof. Aber die verlangen meist einige Groschen für Essen und Schlafen.“ „Aber das kostet ja Geld. Ich weiß nicht, woher ich das nehmen soll“, gab Franz zur Antwort. Kopfschüttelnd erwiderte der Meister: „Dann musst Du halt unterwegs immer wieder eine kleine Arbeit annehmen und etwas verdienen. So kann es sein, dass Du eben mehrere Tage oder gar Wochen an einem Ort bleiben musst, um bei einem Bauern oder Schmied auszuhelfen. Dann hast Du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: nämlich Unterkunft und Verpflegung und einen kleinen Arbeitslohn.“ Franz schaute ganz verzagt drein, denn so hatte er sich das alles nicht vorgestellt. Mit den Worten: „Jetzt stell‘ Dich nicht so an, es wird schon alles gut werden“, versuchte der Meister ihn aufzumuntern und fuhr dann mit den Worten fort: „Denk‘ an die Worte Deines Namenspatrons, des heiligen Franziskus, von dem der Spruch stammt: ‚Wir müssen jeden Tag von Neuem anfangen!‘ Schau‘ also hoffnungsvoll in die Zukunft und beginne jeden Tag mit den Worten: ‚In Gott’s Nam‘!“ Dann drückte der Meister seinem vor Kurzem vom Lehrling freigesprochenen Gesellen den schweren Schmiedehammer in die Hand und murmelte ihm zu: „Jetzt ist aber genug geredet; fang‘ Dein Tagwerk an, es gibt heute viel zu tun!“
Abschied von den Toten auf dem Friedhof
Am nächsten Sonntag hatte Franz die Großeltern leider nicht beim sonntäglichen Kirchgang in Merkendorf angetroffen, weshalb er sich nach dem Frühschoppen und der Einnahme des Mittagessens nach Laubend begab. Unterwegs am Ortsrand von Merkendorf kam Franz am Gottesacker vorbei. Nach kurzer Überlegung, ob er seinen Weg unterbrechen oder weitergehen sollte, begab er sich doch in den kleinen parkähnlichen Friedhof, um auch von den Toten der Familie Abschied zu nehmen. Durch die Gräberreihen gehend steuerte er auf das Familiengrab der Dillers von Laubend zu. Hier lagen seine Vorfahren, die Ur-, Urgroßeltern, begraben. Auf dem sehr großen, breiten schwarzen Grabstein waren viele Namen, sowie die Geburts- und Sterbedaten seiner Ahnen verzeichnet. Da waren beispielsweise die Namen der Urgroßeltern Andreas Diller mit der Uroma Barbara und die Ururgroßeltern Johannes Diller mit seiner Ehefrau Barbara, geborene Kauffmannin, in den Stein eingemeißelt zu lesen. Man konnte es kaum glauben, dass sein Ururgroßvater, dessen zweiten Vornamen er mit ihm teilte, schon 1679 geboren war.
Wie er es von Kindheit an gelernt hatte, nahm er Weihwasser und besprengte damit das Grab. Franz bekreuzigte sich und betete leise vor sich hin, murmelte ein „Vater unser“, ein „Gegrüßet seist du, Maria“ und „O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe“, wie er es in den Kindheitstagen nach jeder Sonntagsmesse in der Glaubensunterweisung vom Pfarrer gelernt und eingeübt hatte. Mit Schaudern erinnerte sich Franz an so manche Sonntagskatechese zurück. Der hochwürdige Herr Pfarrer konnte nämlich richtig laut und zornig werden, wenn jemand aus der Kinderschar keine oder eine falsche Antwort aus dem Katechisimus gegeben hatte. Außerdem musste bis zur Erstkommunion jedes Kind biblische Geschichten, die Zehn Gebote, verschiedene Gebete, das Glaubensbekenntnis sowie die Antworten, die man bei der heiligen Messe zu geben hatte, auswendig können. Letztere sogar in Latein, so wie das Credo und das Pater noster. Und die vorausgegangene Sonntagspredigt des Pfarrherrn musste man auch sinngemäß wiedergeben können. Und wenn einer etwas nicht wusste oder aufsagen konnte, dann zog der Pfarrer ihn am Ohrwaschel aus der Kirchenbank und musste sich in eine Ecke stellen. Da war einer natürlich schön blamiert vor den anderen, und der anschließende Spott und die Hänseleien der Kameraden waren einem gewiss, ebenso das hämische Gegrinse der Mädchen. Manchmal, wenn dem hochwürdigen Herrn die Zornesröte wegen der Dummheit der ihm anvertrauten Kinder ins Gesicht schoss, dann konnte es auch passieren, dass der Watsch‘nbaum umfiel oder der spanische Rohrstock zum Einsatz kam. Gott sei Dank dämpfte die Lederhose der Buben die Stockschläge etwas ab. Auch eine halbe Stunde auf den kalten Altarstufen knien gehörte zum Strafenkatalog des Pfarrers. Beschwerte man sich zuhause über die rauhen Erziehungsmethoden bei den Eltern, fing man womöglich zusätzlich eine Watsch’n vom Vater ein – mit den Worten: „Du hast es sicherlich verdient, weil Du etwas nicht gewusst oder weil Du wieder gestört und geschwätzt hast.“ Die zusätzliche Watsch’n hätte man ja noch verschmerzen können, aber wenn die Mutter rief: „Ab in die Küchenecke zum Holzscheit‘l knien“, da hörte der Spaß auf, denn das tat verdammt höllisch weh. Aber diese Zeiten, dachte Franz, sind nun schon lange vorbei, schließlich war man nach der Firmung ein vollwertiger Christ und musste nicht mehr in die kirchliche Sonntagsschule gehen. Da war dann der Sonntagsfrühschoppen in der Dorfwirtschaft schon angenehmer, süffiger und rauschiger. Nur das 12-Uhr-Mittagsläuten, den Angelus, vom nahen Kirchturm, durfte man nicht im lauten Wirtshausgegröle überhören. Ansonsten konnte es vorkommen, dass einem die Mutter den zwei Jahre jüngeren Bruder Josef, genannt Sepp, vorbeischickte, um einen abzuholen. Wenn dagegen auch der Vater am Stammtisch den Glockenschlag beim Watt’n oder Schafkopf‘n überhörte, war es nicht so schlimm. In so einem Fall schickte sie zwar auch den Josef, aber der traute sich dann nur zu sagen: „Herr Vater, die Mutter schickt mich und lässt fragen, ob er wohl die Glocken überhört hätte, denn der Schweinebraten sei schon fertig und die Knödel würden schon dampfen.“ Nach dem Sprücherl-Aufsagen drehte sich der Sepp dann immer flugs um und verließ fluchtartig die Gaststube – leicht hätte er sich nämlich eine Watsch’n vom Vater einfangen können. Und die Mutter traute sich schon gar nicht, den Vater zu holen – da wäre etwas los gewesen, schließlich hatten die Weiber ihrem Ehemann zu gehorchen. Trotzdem führte zuhause das Eheweib meist das Regiment und dann war zumindest dort so mancher Sonntag mit Streit und Gezänk im Eimer. Da hieß es dann für die Kinder: am besten auf und davon, verstecken oder zu den Großeltern laufen, um aus der Schusslinie zu sein.
Aus all diesen Gedanken schreckte Franz plötzlich auf, als er das laute Schnalzen einer Pferdepeitsche und die Anfeuerungsrufe eines Kutschers hörte. Er verabschiedete sich schnell von den Verstorbenen, indem er noch einmal kurz Weihwasser spritzte und zu den verstorbenen Seelen sagte: „Also, denkt’s an mich vom Himmel runter und passt‘s auf mich auf, dass mir nichts auf der Walz passiert!“ Mit einem Blick zum wolkenlosen blauen Himmel verließ Franz den Ort der Stille und schloss leise das Friedhofstor hinter sich zu.
Abschiedsbesuch bei den Großeltern in Laubend
Nachdenklich ging Franz seinen Weg zu den Großeltern nach Laubend weiter. Kurz vor dem Bauernhof angekommen wollte er auch noch von der fränkischen Landschaft Abschied nehmen und bog deshalb links in einen Feldweg ein. Zwischen den Äckern und Feldern schlängelte sich der von den Fuhrwerken und Pferdegespannen durchfurchte Weg aufwärts. Da am Sonntag die Feiertagsruhe einzuhalten war, waren heute auf den Feldern keine Mägde und Knechte bei der Feldarbeit zu sehen. Nach einigen hundert Metern war er auf der Anhöhe angekommen und vor seinen Augen breitete sich eine beeindruckende, friedvolle Hügellandschaft aus. Franz konnte alle ihm bekannten Dörfer und Weiler in der Ferne gut erkennen: Weichendorf, Wiesengich, Scheßlitz mit dem Spital St. Elisabeth, für das sein Großvater Martin Diller als Zehntschultheiß (Gemeindevorsteher) in Laubend für das Hochstift Bamberg tätig war, und natürlich Memmelsdorf mit der grandiosen Schlossanlage „Seehof“. Es war einst die Sommerresidenz der Bamberger Fürstbischöfe vor der Säkularisation 1803 gewesen, ehe es in den Besitz von Privatleuten übergegangen war, die sich allerdings mit der Instandhaltung schwer taten. Zwei- oder gar dreimal schon war er dem imposanten, gigantischen Schloss nähergekommen auf dem Weg nach Bamberg, als er dort im Auftrag des Meisters verschiedene Nägel hatte überbringen müssen. Natürlich war er nicht ins Schloss hineingekommen, nicht einmal in die wunderschöne Rokokogartenanlage, sondern der Pförtner am Schlosstor hatte ihm die Kiste abgenommen. Die Hochwohlgeborenen hatten ihre eigenen Bediensteten, Lakeien und Handwerker. Nicht einmal ein Schluck Wasser oder gar ein Humpen Bier wurde ihm für die mühsame Schlepperei und Anlieferung gereicht. Diesen beschwerlichen Weg musste er aber nicht oft zurücklegen; meist kam ein Schlossdiener bei der Nagelschmiede vorbei und holte die bestellten Nägel mit einem Pferdefuhrwerk selbst ab. Franz sog die würzige Landluft in sich auf und nahm gleichzeitig Abschied von der ihm bekannten Heimat. „Wird er sie jemals wiedersehen?“, dachte er wehmütig. Aber alles Sich-dagegen-Sträuben half eh nichts. So drehte er sich abrupt um und ging schnellen Schrittes hinab zum Hof der Großeltern nach Laubend, Anwesen Nr. 4. Auch die ihm vertraute Hofstelle nahm Franz noch einmal in den Blick, und das im fränkischen Stil erbaute steinerne Wohnhaus mit dem angeschlossenen Viehstall und der Scheune aus dunklem, verwittertem Holz prägte sich in sein Gedächtnis ein. Knarrend ließ sich die unversperrte Haustüre öffnen und Franz betrat schweren Herzens den Vorraum und ging von dort in die Küche. Am kantigen Holztisch unter dem Herrgottswinkel saßen die Großeltern vor einem Haferl Malzkaffee. Der Großvater blätterte im Sonntagsblatt mit den amtlichen, kirchlichen und politischen Nachrichten, und die Oma las in einer geistlichen Hauspostille. „Ja, das ist aber schön, Franzl, dass Du bei uns vorbeischaust. Haben es von der Magd schon gehört, dass wir uns letzten Sonntag verpasst haben. Tut uns leid, Franzl!“, rief die Oma freudestrahlend und legte das Gazettenblatt zur Seite. „Setz‘ Dich zu uns!“, forderte ihn der Opa auf. „Was führt Dich denn zu uns? Wissen es ja eh, haben es schon gehört, dass Du jetzt Geselle bist. Glückwunsch! Wirst wohl bald auf die Walz gehen müssen und wir werden Dich lange nicht mehr zu Gesicht bekommen oder gar nicht mehr, wenn wir Alten die Radieserl’n von unten sehen“, witzelte Opa Martin. „Letzteres hoffen wir doch nicht!“, gab Franz zur Antwort. „Aber es ist tatsächlich so, dass ich von Euch Abschied nehmen muss, denn Ende der Woche muss ich wohl oder übel auf die Walz. Und das fällt mir sauschwer.“ „Schau‘, Franz“, sagte Oma Kunigunde zu ihm, „brauchst keine Angst zu haben, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Du darfst nie die Hoffnung verlieren. Denk‘ an den Spruch, den ich Dir schon als kleines Kind beigebracht habe: ‚Wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her‘.“ Da öffnete die Oma eine kleine Holzschatulle und entnahm einen Rosenkranz. „Den hab‘ ich auf dem Markt beim Devotionalienhändler gekauft – extra für Dich. Trag‘ dieses Geschenk immer bei Dir und in schweren Stunden nimm ihn zur Hand und lass‘ die Perlen durch Deine Finger gleiten und bete ein Rosenkranzgesätz. Und Du wirst sehen, schon schaut die Welt wieder anders aus. Und dann hab‘ ich Dir noch ein Heiligenbilderl vom Franziskus gekauft. Auch das will ich Dir geben. Da steht ein aufmunternder Spruch vom heiligen Franz darauf. Den solltest Du auch beherzigen: ‚Tu‘ zuerst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche‘.“ Mit der Plauderei, auch von früheren Zeiten, verging die Zeit, und nach zwei Stunden meinte der Opa: „Du, Franzl, es wird Zeit, dass Du Dich auf den Heimweg machst, ich glaub‘, es zieht ein Gewitter auf, und wir wollen doch nicht, dass Dich der Blitz erwischt und Deine Lehrzeit umsonst gewesen ist.“ So standen sie alle auf und gingen zur Haustüre. Dort griff die Oma in den Weihkessel und bespritzte Franzls Gesicht mit dem Weihwasser, und während sie ihm ein Kreuzerl auf die Stirn zeichnete, sprach sie: „Gott, alle Engel und Heiligen mögen Dich begleiten und auf Dich aufpassen. Bleib‘ so brav und anständig, wie wir Dich kennen. Und jetzt geh‘, bevor ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten kann.“ Nach einer herzlichen Umarmung und einem Handschlag verließ Franz den Hof, ohne zurückzuschauen.
Eine ereignisreiche Abschiedswoche
Wie gewohnt war Franz am Montagmorgen in der Nagelschmiede und erledigte gewissenhaft die ihm vom Meister aufgetragenen Arbeiten. Während der Mittagspause durfte er beim Meister in der Stube die gekochte Gemüsesuppe aus dem gemeinsamen Topf mitlöffeln. „Pass auf, Franz.“, begann plötzlich die Nagelschmiedsfrau Gretl das Gespräch: „Überall auf der Walz lauern Gefahren. Vor allem die Weiberleut‘ sind nicht zu unterschätzen. Da gibt es die ‚Giftspritzen‘, die Falsches und Schlechtes über einen verbreiten, und die weiblichen ‚Schlangen‘, sprich ‚Dirnen‘, die mit ihren Reizen einen Mann verführen und einfangen wollen. Womöglich haben sie schon von einem anderen einen ‚Bangert‘ zuhause und suchen nur bei einem anständigen Mann einen Unterschlupf und Versorgung für sich und ihr uneheliches Kind. Im Umgang mit den Weibern brauchst Du einen gesunden Menschenverstand und darfst Dich nicht hinreißen lassen und Deinen männlichen Trieben nachgeben.“ Da lachte der Meister schallend und fügte hinzu: „Du hast mich doch auch mit dem Fangeisen, sprich Ehering, eingefangen und jetzt komm‘ ich nicht mehr von Dir los.“ „Sag‘ bloß, Dir geht es schlecht bei mir“, erwiderte sie und stemmte drohend, mächtig die Arme in die Hüften. „Dann kochst und wascht Dir die Wäsche in Zukunft selber. Du bist doch zum Vatern gegangen und hast um meine Hand angehalten, oder irre ich mich da?“ „Das ist schon richtig“, sprach der Meister kleinlaut und fügte dann schon etwas mutiger hinzu: „Weil Du von zuhause unbedingt auch fort und mit mir die Bettstatt teilen wolltest. Und ohne den kirchlichen Segen hätten Dich Deine Eltern nicht gehen lassen. Also hast Du mich schon ein wenig überredet und gezwungen.“ Da blieb der Gretl kurzzeitig die Luft weg und sie wusste nicht sofort um eine passende Antwort. Deshalb ergriff Franz die Gelegenheit, bevor die Unterhaltung in ein Streitgespräch ausartete, und erhob sich und verabschiedete sich mit den Worten: „Vergelt’s Gott, Frau Meister, es hat gut geschmeckt; aber ich muss jetzt wieder in die Schmiede, sonst schaff‘ ich mein Tagwerk nicht.“
„Jetzt geht’s also schon los mit den guten Ratschlägen“, dachte sich Franz und überlegte, was in dieser letzten Woche in seinem Heimatdorf er noch alles für gut gemeinte Abschiedsworte zu hören bekommen würde. Tatsächlich ging es abends zuhause bei Muttern gleich weiter; als wenn sich die Meistersfrau und seine Mutter abgesprochen hätten, begann sie das Gespräch: „Franz, bleib‘ mir auf der Walz anständig und geh‘ am Sonntag auch in die Kirche. Vergiss nicht, Dich zu waschen, und auch Deine Leibwäsche gehört öfters mit Wasser und Seife gebürstet und ausgewrungen. Und sei bei den Weibern vorsichtig: Nicht alle meinen es ehrlich und nicht alle sind treu. Überall lauern die Sünde und der Teufel.“ Franz nahm es mit Humor und spitzbübig gab er zur Antwort: „Ich dachte der Satan ist schwarz, mit Hörnern auf dem Kopf, mit einer Fratze und einem Schwanz. Jetzt behauptest Du gar, er hätte eine schöne weibliche Gestalt, mit einem hübschen Gesicht.“ „Jetzt mal ernsthaft, Franz! Du weißt doch, dass der Teufel jede Gestalt annehmen kann, um einen zu verführen. Dein Namenspatron, der heilige Franziskus, hat einmal gesagt: ‚Wer mit dem Weibe verkehrt, der ist der Befleckung seines Geistes so ausgesetzt wie jener, der durchs Feuer geht, der Versengung seiner Sohlen‘.“ Jetzt konnte sich Franz vor Lachen kaum mehr halten und er erwiderte prustend: „Seid Ihr Weiber alle so schlecht und vom Teufel besessen, dass man vor Euch Angst haben muss – auch vor Dir, Mutter? Auf Vaters Füße habe ich noch keine Brandblasen gesehen, obwohl es zwischen Euch auch manchmal feurig zugeht.“ „Aber Franz, ich bin doch eine ehrbare, verheiratete Frau und da ist der Beischlaf sogar von der Kirche geboten, wenn wir ein Kind zeugen sollen. Ich bin auch noch jungfräulich in die Ehe gegangen.“ „Ob ich das glauben kann?“, erwiderte Franz spontan. „Meine Freunde im Wirtshaus sagen immer: ‚Man kauft keine Katze im Sack‘ und ‚Probier‘n geht über studier‘n‘. Was soll ich jetzt glauben?“ Mutters Stimme wurde jetzt schon erregter: „Diese Aufschneider und Sprücheklopfer! Nichts dahinter, nur angeben. Schämen sollen sich Deine Freunderln. Ich an Deiner Stelle wäre vorsichtig im Umgang mit leichtfertigen Weibern. Du bist dann der Ausgeschmierte, wenn Du Alimente für ein Kind zahlen sollst. Eine sittsame Frau erkennst Du daran, dass sie nicht sofort Deinem Begehren und Verlangen nachgibt. Mit so einer kannst Du Dich dann vermählen. Aber solange Du nicht selber Meister bist, noch nichts Erspartes für eine Ehegründung beisammen hast, brauchst Du an eine Eheschließung nicht denken. Also langsam mit der Braut, wie man bei uns in Bayern zu sagen pflegt.“ „O je“, sagte Franz, „bist jetzt fertig mit Deinen Belehrungen und der Moralpredigt.“ „Ich mein‘ es Dir nur gut, Franz, und auf der Walz seh‘ ich ja nimmer, was Du so treibst, und habe keinen Einfluss mehr auf Dich!“ „Soll auch gut sein, denn ich will selbstständig werden und nicht mehr am Rockzipfel hängen“, gab Franz zur Antwort und dachte sich abermals: „Das kann noch heiter werden diese Woche. Wer wird wohl als Nächster einen Redeschwall über mich ausgießen?“
Am Dienstagmorgen schälte sich Franz noch schlaftrunken und müde aus den Federn, wobei Federn gut gesagt ist, denn er hatte nur ein Strohbett und die Halme piksten ganz gemein durch den Leinensack und hinterließen rote Einstiche auf der Haut. Im Sommer kamen dann noch die schmerzhaften Stiche der Mücken hinzu, die einem den Schlaf rauben konnten. Um sieben Uhr hatte er in der Schmiede zu sein, deshalb schlüpfte er sogleich in die bereitliegende Hose und stopfte das Nachthemd, das gleichzeitig das Oberhemd war, hinein. Jetzt noch die schweren Stiefel angezogen und eine Joppe übergezogen. Die Mutter wartete derweil in der Küche mit einem Holzteller voll heißer Milch, und Franz brockte eine Scheibe Brot hinein und löffelte sie aus. Mit einem „Ich geh jetzt“, war er auch schon draußen. Auf seinem Weg zur Arbeit kam er am Schulhaus vorbei und sogleich kamen ihm wehmütige Erinnerungen an seine Schulzeit. Es waren keine leichten Zeiten, denn die Lehrer waren genauso streng wie die geistlichen Herren. Und der ‚Spanische‘ sauste des Öfteren über den Hosenboden oder das Lineal des Lehrers über die ausgestreckte Schülerhand oder die geballte, knöcherne Faust des Lehrers an den Kopf. Wenn man es gar zu bunt trieb, nicht aufpasste und Blödsinn machte, zog der Lehrer einen sogar an den Gänsefedern, den kleinen Haaren vor dem Ohrwaschel, vom Stuhl empor. Meistens traf es die Buben, seltener die Mädchen. Aber im Pausenhof sorgten die Buben dann für ausgleichende Gerechtigkeit und zogen die Mädchen an den Zöpfen, schubsten oder zwickten sie, dass auch sie den vom Lehrer erlittenen Schmerz zu spüren bekamen. Wenn ihnen dann die Tränen über ihre Backen rollten, wurden sie als Heulsusen verspottet. Mit dem ABC-Erlernen und dem Gedichte-Aufsagen, war das ebenfalls so eine Sache, über die man heute nicht mehr so gerne sprach. Auch das Zeugnis mit den Zensuren war meist kein Ruhmesblatt zum Herzeigen. Lobeshymnen waren selten darin zu finden, schon eher abfällige Bemerkungen, so dass es schmerhafte Bestrafungen zuhause gab. Es war keine unbeschwerte Schulzeit und unter wehmütigen Erinnerungen war eher der ‚wehe‘ Schmerz zu verstehen. Zudem hatte man neben der Werktagsschule die sonntägliche Glaubensschule – somit eine 7-Tage-Schulwoche. Überdies musste man noch im Haushalt, auf dem Hof und bei der Ernte helfen. Aber irgendwie gingen die Schuljahre auch vorüber und Franz hatte Glück, eine Lehrstelle als Lehrjunge beim Nagelschmied ergattert zu haben. Die sich anschließende Lehrzeit war zwar ebenfalls kein Honigschlecken, denn beim Meister saß die Hand auch schnell locker. Aber Lehrjahre waren nunmal keine Herrenjahre.
Mit diesen Gedanken dahingehend war Franz in der Schmiede angekommen. Nach dem Morgengruß hatte er den Meister gebeten, ob er nachmittags früher frei bekommen könnte, da die Mutter meinte, er, der Franz, hätte noch einen Besuch beim Bader nötig. Wenn er schon auf die Walz ging, dann sollten die Haare noch kurz geschnitten und die Bartstoppeln abrasiert werden. Auch sollte er noch zum Kramer gehen, einen Rasierpinsel und dazu ein klappbares Rasiermesser für die Walz kaufen, falls der Bader diese nicht vorrätig hätte. Dazu eine Kernseife zum Rasieren, zum Waschen von Händen und Gesicht und zum Waschen der Leibwäsche. Auch beim Schneider sollte er noch vorbeischauen und fragen, ob die weite Schlaghose, die dazu passende Weste und die Jacke, die ihm der Meister geschenkt hatte, auf seine Größe fertig abgeändert sei. So war auch der Dienstag mit Arbeit und Erledigungen ausgefüllt. Der Bader meinte: „Pass auf, so ein neues Rasiermesser ist scharf, und so ein junger Spund hat schnell eine blutige Schnittwunde im Gesicht und schnell ein vernarbtes, zerfurchtes Gesicht und dann bekommst Du keine hübsche Braut mehr – stattdessen, wenn überhaupt, nur mehr eine ‚Schiache‘ oder gar eine Vogelscheuche.“ Und auch der Schneider gab noch seinen Senf dazu: „Gib auf die Knöpfe acht, denn wenn Du einen abreißt und verlierst, dann wirst Du keinen passenden finden. Und welche Dirn‘ wird Dir dann einen annähen? Die haben nur das eine im Kopf, Dir den Kopf zu verdrehen und weniger für Dich zu arbeiten.“ Auch der Kramer verkündete lautstark im Laden, so dass alle anwesenden Kunden es hören und mitverfolgen konnten: „Franz, die Seife ist zum Waschen da, verlier‘ sie nicht, sonst stinkst Du wie ein alter Bock.“ Alle lachten über diesen derben Scherz, während Franz‘ Gesicht rot anlief wie eine Tomate. Für heute hatte er von den sogenannten ‚guten Ratschlägen‘ die Nase voll und ging eilends mit den eingekauften Waren nach Hause.
Am Mittwochvormittag in der Schmiedewerkstatt fing dann plötzlich auch noch der Meister zu reden an und meinte, gute Ratschläge mit auf die Reise geben zu müssen: „Franz, pass gut auf Dich auf. Die Walz- und Tippelbrüder, die Bettler und Hausierer sind oft derbe Gesellen. Die machen auf Deine Kosten ihren Spaß, nützen Dich oft aus und verführen Dich zum Saufen. Der Alkohol, ob Bier, Wein oder Schnaps – alles ist Teufelszeug! Merk Dir das gut und schreib‘ es Dir hinter die Ohren. Du kommst schnell in eine Suffabhängigkeit und das schwer erarbeitete Geld fliegt mit ‚guten Freunden‘ zum Fenster hinaus. Denk‘ an die biblische Geschichte vom verlorenen Sohn, der landete letztendlich bei den Schweinen, weil er das ganze Erbe mit Dirnen und Saufen verschleuderte.
Wenn Du so tief gesunken bist, dann kannst Du kaum mehr Deinem Vater und Deiner Mutter unter die Augen treten und Dich schon gar nicht mehr in Merkendorf sehen lassen.“ Aber Franz wusste darauf sofort eine Antwort: „Der verlorene Sohn ist doch nach Hause gegangen und hat einen barmherzigen Vater gefunden, der ihn in die Arme nahm und ihm verzieh.“ „Ja“, gab der Meister zu bedenken: „So steht es in der Bibel und mit dem barmherzigen Vater ist Gott gemeint. Aber die Mitmenschen sind nicht so gütig, sondern überschütten einen mit Spott und Hohn. Und wer weiß, ob Du nicht vom Dorf dann hinausgejagt wirst. Du kennst doch mittlerweile die Dorfbewohner und weißt, wie gehässig, neidisch und bösartig sie sein können. Auch in den anderen Nagelschmieden musst Du gehörig aufpassen. So manche Schmiedemeistersfrau kann Dir schmeicheln und Dich verführen, wenn der Meister einmal aus dem Haus ist. Da hast Du schneller ein blaues Auge vom gehörnten Meister als Du denkst, wenn er dahinter kommt; im schlimmsten Fall ein Messer im Rücken oder eine durchgeschnittene Gurgel.“ Franz schüttelte ungläubig den Kopf: „Jetzt übertreiben Sie aber gehörig, Herr Meister. Oder haben Sie vielleicht auch schon einmal auf Ihrer Walz ein ‚blaues Veilchen‘ abbekommen?“ Der Meister wollte schon ausholen zu einer Watsch’n, hielt aber dann inne, denn er hätte fast vergessen, dass Franz ja kein Lehrling mehr war, sondern nun Geselle, ermahnte ihn aber weiterhin: „Sei bitte nicht leichtfertig, ich mein‘ es Dir ja nur gut. Aus Dir soll ein ehrbarer Nagelschmiedmeister werden, vor dem man Respekt hat. Wie willst Du einmal Besitzer einer Nagelschmiede werden, wenn Du einen schlechten Leumund hast? Schandtaten sprechen sich herum, und der Klatsch und Tratsch können Dir Deine Existenz kosten!“ Nach dieser Standpauke des Meisters arbeiteten beide in gedrückter Stimmung weiter.
Donnerstagmittag ging Franz wie gewöhnlich während der Mittagspause in die Gastwirtschaft zum Schlachtschüsselessen. Deftige Blut- und Leberwürste mit Kartoffeln und Sauerkraut frisch und dampfend aus der Wirtsküche waren sein Leibgericht. In der Gaststube saß schon – vor einer Halben Dunklem – sein Kumpel und Freund aus Kinder- und Schultagen, der Schreinerlehrling Karl, genannt Kare. „Setz‘ Dich her, Franze, ich hab‘ gleich etwas mit Dir zu besprechen: Nachdem Du doch am Sonntag auf die Walz gehst, gehört es sich schon, dass Du von Deinen Freunden Abschied nimmst und eine Maß und a Stamperl für jeden ausgibst. So ähnlich wie bei einem Polterabend vor der Hochzeit, also Dein Junggesellenabschied für Deine bevorstehende Walz. Die Freude musst uns schon machen und uns einen feucht-fröhlichen Abend schenken.“ Franz verzog das Gesicht und meinte dazu nur: „Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als in den sauren Apfel zu beißen und eine Runde auszugeben. Aber mehr ist nicht drin: Ich brauch‘ das Ersparte für die ersten Tage und Wochen auf der Walz.“ Das Gespräch zwischen den beiden Freunden zog sich während des Mittagsmahls noch eine Weile so hin, bis sie die Zeche zahlten und jeder wieder in seine Werkstatt ging.
Der Nachmittag war ebenfalls sehr arbeitsreich und anstrengend. Für einen Nagel waren je nach Nagelsorte 15 bis 60 Schläge nötig. Das ging an die Substanz beim Franz, schließlich steckte noch das dunkle Bier zur Mahlzeit in seinen Knochen und lähmte die Muskeln. Abermals nahm er ein vierkantiges Stabeisen aus dem Schmelzfeuer und bearbeitete es durch Schmieden und Gegenschmieden auf dem Amboss mit dem Hammer, so dass es zum Ende hin konisch geformt und angespitzt war. Dann drehte er den Stab ab und steckte den zu formenden Nagel mit der Spitze voraus in eines der Löcher am Amboss und klopfte das überstehende Ende zur gewünschten Kopfform zurecht. Dabei stellte er sich dieses Mal so ungeschickt an, dass er vom Dreifußschemel rücklings auf den Boden fiel und der Hammer aus seinen Händen glitt. Fast wäre er dem Meister auf die Füße gefallen. „Was ist denn heute mit Dir los, Franz?“ polterte der Meister. „Ist Dir das Bier in den Kopf gestiegen? Jetzt reiß‘ Dich zusammen und konzentrier‘ Dich.“ Franz rappelte sich wieder auf, wischte den Schweiß von der Stirn und setzte sich wieder auf den Schemel. Dann wollte Franz vom Meister noch einige Informationen zur Walz und zur Meisterprüfung wissen: „Herr Meister, kann Er mir noch sagen, wie es mit meiner Laufbahn als Nagelschmied weitergeht?“ Der Meister gab ihm zur Antwort: „Ich hab‘ Dir doch schon erklärt, wie lange die Gesellenwanderung, also die Tippelei, dauern soll und dass Du wenigstens eine bestimmte Zeit, oft ein halbes Jahr, Dich bei einem Nagelschmied verdingen musst. Erst nach Beendigung der Wanderschaft und einer weiteren mehrjährigen Arbeitszeit, den sogenannten Mutjahren, kannst Du an Deinem letzten Ort den Antrag zur Meisterprüfung stellen und dein Meisterstück anmelden. Voraussetzung für die Zulassung zur Meisterprüfung ist aber, dass Du während all den Jahren neue Arbeitspraktiken kennengelernt und Lebenserfahrung gesammelt hast. Und wenn Du dann Meister bist, kannst Du eine eigene Schmiede übernehmen und auch an eine Heirat denken. Diese Möglichkeit besteht aber erst, wenn Du eingetragener Bürger und Meister einer Stadt oder in einem Dorf bist. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser die Pegnitz hinab.“