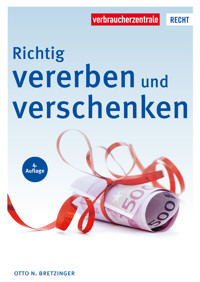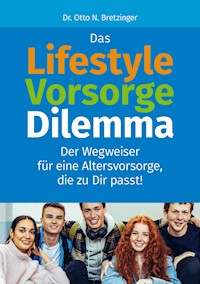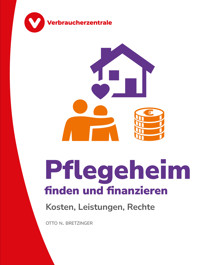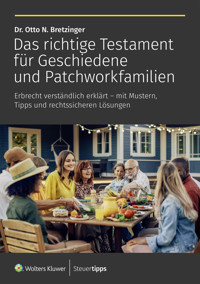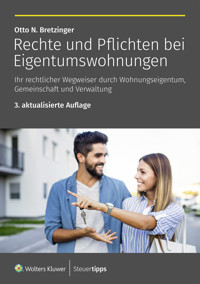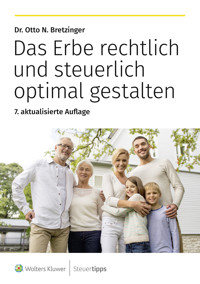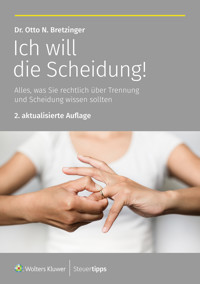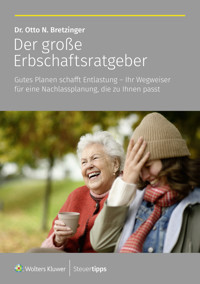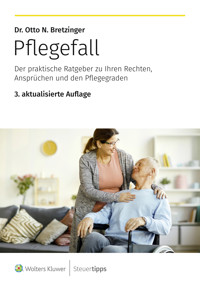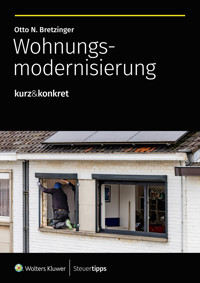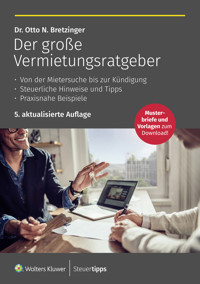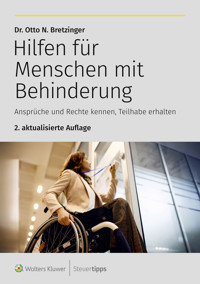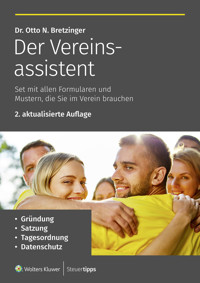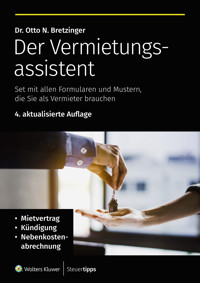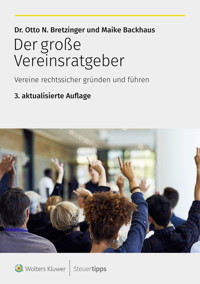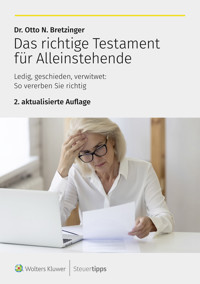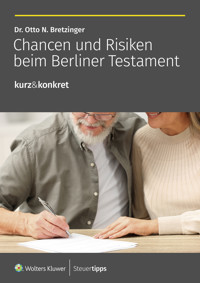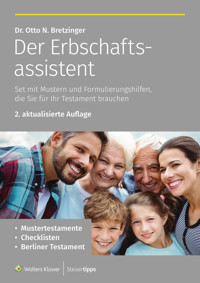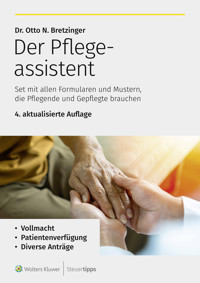
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wolters Kluwer Steuertipps GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Assistenten
- Sprache: Deutsch
Durch die gesetzliche Pflegeversicherung wird das allgemeine Lebensrisiko, pflegebedürftig zu werden und die Kosten der erforderlichen Pflege nicht tragen zu können, abgesichert. Die Pflegeversicherung ist allerdings keine Vollversicherung, weil die gedeckelten Leistungen häufig nur einen Teil der bei der Pflege anfallenden Kosten abdecken. Umso wichtiger ist es, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die die Situation der Beteiligten verbessern. Ihre Ansprüche und Rechte bei der Pflege zu kennen, ist aber für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige nur das eine, das andere ist, diese auch in der Praxis tatsächlich gegenüber der Pflegekasse, Behörden und dem Arbeitgeber geltend zu machen. Hier scheitern nämlich die Wahrnehmung und die Umsetzung der Ansprüche nicht selten daran, dass die Betroffenen nicht wissen, wie sie Verträge und Anträge formulieren sollen, dass gesetzlich vorgeschriebene Formalitäten nicht eingehalten oder die Rechte nicht fristgemäß wahrgenommen werden. Dieser Ratgeber will allen bei der Pflege beteiligten, dem Pflegebedürftigen und den pflegenden Angehörigen, bei den täglichen praktischen Herausforderungen helfen. Sie finden neben Musterverträgen für den Pflegefall viele Musterbriefe und -formulierungen, mit denen Pflegebedürftige und pflegende Angehörige ihre Ansprüche und Rechte geltend machen können. Umfangreiche Checklisten geben Ihnen Handlungsanleitungen und fassen bei den wichtigen rechtlichen Fragen das Wesentliche zusammen. Der Pflegeassistent enthält Musterverträge, Musterbriefe und Formulierungshilfen im Zusammenhang mit - der Feststellung der Pflegebedürftigkeit: U.a. Vollmacht für den Pflegefall, Pflegeantrag, Pflegetagebuch Widerspruch gegen Einstufung in einen Pflegegrad, Antrag auf Einstufung in einen höheren Pflegegrad; - der Vorbereitung und Organisation der Pflege: U.a. Muster eines Pflegevertrags mit ambulantem Pflegedienst, Inhalte eines Heimvertrags; - den Leistungen für Pflegebedürftige: U.a. Anträge auf ambulante Pflegesachleistung, auf Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfe, auf Leistungen der Verhinderungspflege, auf teilstationäre Pflege, auf Kurzzeitpflege, auf vollstationäre Pflege; - den Leistungen für Pflegepersonen: U.a. Anzeige einer kurzzeitigen Arbeitsverhinderung, Antrag auf Pflegeunterstützungsgeld, Ankündigung von Pflegezeit oder von Familienpflegezeit, Antrag auf Bewilligung eines zinslosen Darlehens vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche AufgabenInsgesamt will Sie der Pflegeassistent bei den mit einem Pflegefall zusammenhängenden Formalitäten begleiten und Hilfestellung bei der praktischen Umsetzung Ihrer Rechte und Ansprüche bei der Pflege leisten. Somit ist der Pflegeassistent ihr praktischer Helfer bei allem, was es für Pflegebedürftige, pflegende Angehörige, Pflegepersonen und generell während der Pflege zu tun und zu beachten gibt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2025 by Wolters Kluwer Steuertipps GmbHPostfach 10 01 61 · 68001 MannheimTelefon 0621/[email protected]
Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Angaben wurden nach genauen Recherchen sorgfältig verfasst; eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen.
Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit verwenden wir allgemein die grammatisch männliche Form. Selbstverständlich meinen wir aber bei Personenbezeichnungen immer alle Menschen unabhängig von ihrer jeweiligen geschlechtlichen Identität.
Alternative Streitbeilegung (Online-Streitbeilegung und Verbraucherschlichtungsstelle)Die Europäische Kommission hat eine Plattform zur Online-Streitbeilegung eingerichtet, die unter folgendem Link abgerufen werden kann: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wolters Kluwer ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Inhaltsübersicht
1 Vorwort
2 Feststellung der Pflegebedürftigkeit
2.1 Schritt für Schritt zur guten Pflege
2.2 Wichtige Ansprechpartner im Pflegefall
2.3 Vollmacht für den Pflegefall
2.4 Patientenverfügung
2.4.1 Textbausteine
2.4.2 Muster einer Patientenverfügung mit dem Wunsch auf Maximaltherapie
2.5 Pflegeantrag
2.6 Vorbereitung auf Begutachtung
2.7 Checkliste für den Pflegebedarf
2.7.1 Mobilität
2.7.2 Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
2.7.3 Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
2.7.4 Selbstversorgung
2.7.5 Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen
2.7.6 Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte
2.8 Pflegetagebuch
2.9 Widerspruch gegen Einstufung in einen Pflegegrad
2.10 Antrag auf Einstufung in einen höheren Pflegegrad
3 Vorbereitung und Organisation der Pflege
3.1 Häusliche Pflege oder Pflege im Heim?
3.2 Auswahl des ambulanten Pflegedienstes bei häuslicher Pflege
3.3 Pflegevertrag mit ambulantem Pflegedienst
3.4 Einsatz ausländischer Haushalts- und Betreuungskräfte
3.4.1 Ausländische Haushalts- und Betreuungskräfte engagieren
3.4.2 Form der Beschäftigung
3.5 Pflege im Heim
3.5.1 Auswahl des Pflegeheims
3.5.2 Informationspflichten vor Abschluss des Heimvertrags
4 Leistungen für Pflegebedürftige
4.1 Leistungen bei häuslicher Pflege
4.1.1 Antrag auf ambulante Pflegesachleistung
4.1.2 Antrag auf Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfe
4.1.3 Antrag auf Leistungen bei Verhinderung der Pflegeperson
4.1.4 Antrag auf Zuschuss zur Wohnraumanpassung
4.2 Leistungen bei Pflege im Heim
4.2.1 Antrag auf teilstationäre Pflege
4.2.2 Antrag auf Kurzzeitpflege
4.2.3 Antrag auf vollstationäre Pflege
4.3 Übersicht über die Pflegeleistungen
4.4 Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
4.4.1 Überblick über die Leistungen
4.4.2 Antrag auf Kurzzeitpflege
4.4.3 Antrag auf Haushaltshilfe
5 Leistungen für Pflegepersonen
5.1 Vereinbarung von Pflege und Beruf
5.1.1 Überblick über die Freistellungsmöglichkeiten
5.1.2 Anzeige einer kurzzeitigen Arbeitsverhinderung
5.1.3 Antrag auf Pflegeunterstützungsgeld
5.1.4 Ankündigung von Pflegezeit
5.1.5 Ankündigung von Familienpflegezeit
5.1.6 Ankündigung der Begleitung eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen in der letzten Lebensphase
5.1.7 Ankündigung der Pflege eines minderjährigen pflegebedürftigen nahen Angehörigen
5.1.8 Antrag auf Bewilligung eines zinslosen Darlehens vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
5.1.9 Antrag auf Stundung der Darlehensrückzahlung
5.1.10 Antrag auf Erlass der restlichen Darlehensschuld
5.1.11 Antrag auf Feststellung des Erlöschens der Darlehensschuld
5.2 Soziale Absicherung der Pflegepersonen
Der Pflegeassistent: Set mit allen Formularen und Mustern, die Pflegende und Gepflegte brauchen
1 Vorwort
Fast fünf Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Die meisten von ihnen werden zuhause durch Angehörige oder einen ambulanten Pflegedienst gepflegt. Durch die gesetzliche Pflegeversicherung wird das allgemeine Lebensrisiko, pflegebedürftig zu werden und die Kosten der erforderlichen Pflege nicht tragen zu können, abgesichert. Die Pflegeversicherung ist allerdings keine Vollversicherung, weil die gedeckelten Leistungen häufig nur einen Teil der Pflegekosten abdecken. Die Differenz zu den Leistungen der Pflegeversicherung muss der Pflegebedürftige aus eigener Tasche bezahlen. Das kann schnell das Einkommen übersteigen und die Ersparnisse aufbrauchen. Für den Pflegenden ist die Pflege eines Menschen nicht nur mit einem hohen persönlichen Einsatz, sondern unter Umständen auch mit finanziellen Einbußen verbunden, die durch die Pflegeversicherung nur bedingt ausgeglichen wird.
Umso wichtiger ist es, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die die Situation der Beteiligten verbessern. Besondere Bedeutung haben in diesem Zusammenhang Ansprüche des Pflegebedürftigen auf Sozialleistungen und Rechte der Pflegeperson gegenüber ihrem Arbeitgeber. Allerdings besteht das Problem, sich im Dickicht der verschiedenen Ansprüche und Hilfearten und in der verwirrenden Zuständigkeit der verschiedenen Behördenapparate und Institutionen zurechtzufinden. Ihre Ansprüche und Rechte zu kennen ist aber für Pflegebedürftige und Pflegepersonen nur das eine, das andere ist, diese auch in der Praxis tatsächlich gegenüber der Pflegekasse, Behörden und dem Arbeitgeber geltend zu machen. In der Praxis scheitern nämlich die Wahrnehmung und die Umsetzung der Ansprüche nicht selten daran, dass gesetzlich vorgeschriebene Formalitäten nicht eingehalten oder die Rechte nicht fristgemäß wahrgenommen werden.
Dieser Ratgeber will allen Beteiligten, dem Pflegebedürftigen und den pflegenden Angehörigen, bei den täglichen praktischen Herausforderungen helfen. Sie finden neben Musterverträgen für den Pflegefall (z.B. Vertrag mit dem ambulanten Pflegedienst) viele Musterbriefe und -formulierungen, mit denen Pflegebedürftige und Pflegepersonen ihre Ansprüche und Rechte geltend machen können. Umfangreiche Checklisten geben Ihnen Handlungsanleitungen und fassen bei den wichtigen rechtlichen Fragen das Wesentliche zusammen.
Insgesamt will Sie der Pflegeassistent bei den mit einem Pflegefall zusammenhängenden Formalitäten begleiten und Hilfestellung bei der praktischen Umsetzung Ihrer Rechte und Ansprüche leisten.
Die 4. aktualisierte Auflage berücksichtigt die ab 2025 geltenden Leistungsverbesserungen für Pflegebedürftige.
Dr. iur. Otto N. Bretzinger
!
Tipp: Alle Formulare, Muster und Formulierungsbeispiele in diesem Ratgeber finden Sie auch zum Download im Internet.
Der Link zur Download-Seite befindet sich am Ende des Ratgebers.
2 Feststellung der Pflegebedürftigkeit
Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung erhält nur, wer pflegebedürftig ist. Das Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit beginnt mit einem Antrag bei der Pflegekasse. Ob Pflegebedürftigkeit vorliegt, wird im Rahmen eines Begutachtungsverfahrens des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung festgestellt. Auf der Grundlage des Gutachtens entscheidet die Pflegekasse über den Antrag auf Pflegeleistungen.
Die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst sollte im Interesse der pflegebedürftigen Person und der pflegenden Angehörigen gut vorbereitet sein. Wichtig ist es, in groben Zügen die Kriterien zu kennen, die zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit und des Pflegegrads herangezogen werden. Auf dieser Grundlage und durch ein sogenanntes Pflegetagebuch, das als Nachweis über den konkreten Pflegeaufwand von der Pflegeperson geführt werden sollte, kann der konkrete Pflegebedarf nachgewiesen werden.
2.1 Schritt für Schritt zur guten Pflege
Trotz aller Fragen und Probleme, mit denen Sie konfrontiert sind: Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie müssen auch nicht alle Entscheidungen auf einmal treffen. Es gibt besonders Wichtiges, Wichtiges und erstmal weniger Wichtiges.
Wenn sich eine Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen abzeichnet, sollten Sie in folgender Reihenfolge vorgehen:
1. Schritt: Sozialdienst bzw. Pflegeberatung einschalten
Schalten Sie den Sozialdienst ein, wenn der Angehörige im Krankenhaus liegt, und besprechen Sie mit diesem den voraussichtlichen Pflegebedarf.
Verschlechtert sich der Gesundheitszustand des Angehörigen zu Hause allmählich und zeichnet sich eine Pflegebedürftigkeit ab, sollten Sie die Pflegeberatung der Pflegekasse in Anspruch nehmen und Kontakt mit einem Pflegestützpunkt aufnehmen.
2. Schritt: Antrag auf Pflegeleistungen
Stellen Sie möglichst frühzeitig den Antrag auf Pflegeleistungen. Nach der Antragstellung wird die Pflegekasse tätig und veranlasst das Begutachtungsverfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit und des Pflegegrads.
3. Schritt: Kurzzeitige Arbeitsverhinderung
Wenn Sie berufstätig sind: Nutzen Sie die Möglichkeit, sich anfangs für zehn Tage von der Arbeit freistellen zu lassen, wenn ein naher Angehöriger akut pflegebedürftig wird. So haben Sie Gelegenheit, die kurzfristig anstehenden Angelegenheiten zu organisieren.
4. Schritt: Vorbereitung auf das Begutachtungsverfahren
Machen Sie sich mit den Grundsätzen des Begutachtungsverfahrens des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) vertraut und bereiten Sie sich auf die Begutachtung vor.
5. Schritt: Pflegetagebuch
Dokumentieren Sie den Pflegeaufwand in einem Pflegetagebuch. Auf dieser Grundlage kann dann der objektive Pflegebedarf konkret festgestellt werden.
6. Schritt: Wünsche und Vorstellungen des Pflegebedürftigen
Besprechen Sie mit dem Pflegebedürftigen dessen Wünsche und Vorstellungen bei der Pflege und erörtern Sie im Familienkreis die organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten.
7. Schritt: Pflege zu Hause oder im Heim
Entscheiden Sie sich, ob die pflegebedürftige Person zu Hause gepflegt werden oder in einem Heim untergebracht werden soll, und treffen Sie die notwendigen Vorbereitungen.
2.2 Wichtige Ansprechpartner im Pflegefall
Gerade im Bereich der Pflege können Sie mit Unterstützung und Hilfen von vielen Seiten rechnen. Nutzen Sie diese Hilfs- und Beratungsangebote und nehmen Sie rechtzeitig Kontakt zu den verschiedenen Stellen und Organisationen auf. Die Beratungs- und Hilfsangebote betreffen nicht nur die Formalitäten beim Umgang mit der Pflegekasse und Behörden (z.B. Sozialversicherungsträger, Sozialamt), Beratung und Hilfe können Sie insbesondere auch bei der organisatorischen Bewältigung der anstehenden Pflegeaufgaben erwarten.
Pflegeberatung durch Pflegekasse
Alle Personen, die Leistungen von der Pflegeversicherung erhalten oder die Leistungen beantragt und erkennbar einen Hilfe- und Beratungsbedarf haben, haben einen einklagbaren, individuellen Rechtsanspruch auf umfassende Beratung und Hilfestellung durch die Pflegekasse.
Geht ein Antrag auf Pflegeleistungen ein, muss die Pflegekasse innerhalb von zwei Wochen einen Termin für eine kostenlose Pflegeberatung anbieten und einen Ansprechpartner nennen. Alternativ kann die Pflegekasse einen Gutschein für eine Pflegeberatung einer unabhängigen Beratungsstelle ausstellen.
Pflegestützpunkte
Pflegestützpunkte informieren und beraten zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten, unterstützen bei der Organisation der Pflege, helfen bei Formalitäten wie dem Ausfüllen eines Antrages und unterstützen bei der Suche nach externer Hilfe.
Wo der nächste Pflegestützpunkt liegt, erfahren Sie bei Ihrer Pflegekasse. Eine Übersicht über Pflegestützpunkte in Deutschland finden Sie auf der Internetseite des Zentrums Qualität in der Pflege (www.zqp.de).
Seniorenberatungsstellen
Seniorenberatungsstellen unterstützen und informieren bei Fragen rund um Alter, Krankheit, Behinderung und Pflege. Gute Anlaufstellen sind die kommunalen Seniorenberatungsstellen.
Verbraucherzentralen
In einigen Bundesländern (z.B. Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz) beraten die Verbraucherzentralen in Fragen des Pflegerechts, beispielsweise bei Fragen zur Abrechnung des ambulanten Pflegedienstes oder zum Heimvertrag.
Sozialverbände
Sozialverbände (z.B. Sozialverband Deutschland, Sozialverband VdK Deutschland) bieten ihren Mitgliedern Beratung in Angelegenheiten der sozialen Pflegeversicherung an. Sie helfen bei Anträgen auf Pflegeleistungen und gegebenenfalls bei einem Widerspruchs- und sozialgerichtlichen Verfahren.
Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebedürftige Menschen
Der BIVA-Pflegeschutzbund vertritt die Interessen von Menschen, die Hilfe oder Pflege benötigen und in Pflegeheimen oder anderen Wohn- und Betreuungseinrichtungen leben.
Er informiert unter www.biva.de auch zu rechtlichen und finanziellen Fragen rund um Pflegeheime und andere Betreuungsformen.
Alzheimer Gesellschaften
Die Alzheimer Gesellschaften sind als Verein in vielen Städten und Gemeinden aktiv und bieten Informationen für Demenzkranke und ihre Angehörigen, organisieren Gesprächskreise und kennen in der Regel die Unterstützungs- und Entlastungsangebote vor Ort.
Unter www.deutsche-alzheimer.de sind sämtliche Alzheimer Gesellschaften aufgelistet. Angeboten werden auch telefonische Hilfe und Beratung.
Wohnungsberatungsstellen
Wohnberatungsstellen helfen bei der Frage, wie die Wohnung an das Alter, an eine Behinderung oder eine Pflegesituation angepasst und wie die Maßnahme finanziert werden kann.
Auf der Internetseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung e.V. (www.wohnungsanpassung-bag.de) finden Sie Adressen von Beratungsstellen in Ihrer Nähe.
Hospiz- und Palliativdienste
Menschen mit schweren Erkrankungen, bei denen eine Heilung nicht mehr möglich ist, bedürfen einer palliativen Versorgung, bei der nicht mehr die Heilung und Lebensverlängerung im Vordergrund stehen, sondern der bestmögliche Erhalt der Lebensqualität, Nähe, Zuwendung und die Linderung von Schmerzen und anderen Symptomen. Angeboten werden eine stationäre und eine ambulante Hospizversorgung.
Adressen von ambulanten und stationären Hospizdiensten finden Sie auf der Internetseite des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes (www.dhpv.de).
Selbsthilfegruppen
Selbsthilfegruppen bieten einen Ort für intensive Gespräche oder einen Erfahrungsaustausch an. In vielen Städten bieten Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände oder Pflegedienste Gesprächskreise an, in denen sich pflegende Angehörige austauschen können.
Pflegetelefon
Das Pflegetelefon des Bundesfamilienministeriums bietet unter der Rufnummer 030-20179131 pflegenden Angehörigen telefonische Beratung und schnelle Hilfe rund um das Thema Pflege.
2.3 Vollmacht für den Pflegefall
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung werden nur auf Antrag gewährt. Der Antrag auf Pflegeleistungen muss vom Pflegebedürftigen gestellt werden. Pflegende Angehörige sind nur dann antragsberechtigt, wenn ihnen der Pflegebedürftige eine Vollmacht erteilt hat. Im Falle einer rechtlichen Betreuung des Pflegebedürftigen kann der Antrag vom Betreuer gestellt werden.
Kann oder will sich der Pflegebedürftige nicht selbst um seine Anliegen kümmern, kann er – wenn er nicht bereits eine umfassende Vorsorgevollmacht erteilt hat – eine Vollmacht für den Pflegefall erteilen. Damit kann der Pflegebedürftige seine Angehörigen bevollmächtigen, für ihn wichtige Entscheidungen zu treffen und ihn insbesondere gegenüber der Pflegekasse zu vertreten. Den Umfang der Vollmacht kann der Vollmachtgeber grundsätzlich frei bestimmen.
Grundsätzlich bedarf die Vollmacht keiner besonderen Form. Die Vollmacht sollte aber gleichwohl schriftlich abgefasst werden, da nur eine schriftliche Vollmacht aussage- und beweiskräftig ist. Ohnehin können dem Bevollmächtigten bestimmte Angelegenheiten nur übertragen werden, wenn die Vollmacht schriftlich erteilt wird.
Wenn der Bevollmächtigte berechtigt sein soll, in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff einzuwilligen, bedarf dies der Schriftform.
Der Bevollmächtigte benötigt bei einer schriftlich erteilten Vollmacht das Original der Vollmacht, wenn er für den Vollmachtgeber handeln soll. Am einfachsten ist es deshalb, dem Bevollmächtigten das Original auszuhändigen.
Download als PDF oder Textdatei]
Vollmachtgeber und Bevollmächtigter
Aus der Vollmacht müssen der Vollmachtgeber und der Bevollmächtigte hervorgehen.
Der Vollmachtgeber muss unbeschränkt geschäftsfähig sein. Das heißt, er muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ferner darf keine krankhafte Störung der Geistestätigkeit vorliegen.
Der Bevollmächtigte muss geschäftsfähig sein, allerdings reicht die beschränkte Geschäftsfähigkeit aus. Er kann also auch unter 18 Jahre alt sein. Sinnvoll ist es allerdings, einen voll geschäftsfähigen Bevollmächtigten zu bestellen, weil in diesem Fall gewährleistet ist, dass die betreffende Person alle übertragenen Aufgaben wirksam erfüllen kann.
Umfang der Vollmacht
Den Umfang der Vollmacht kann der Vollmachtgeber grundsätzlich frei bestimmen. Die Vollmacht kann sich auf die Vertretung gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung beschränken, sie kann sich darüber hinaus auch auf allgemeine gesundheitliche und medizinische Angelegenheiten erstrecken.
Vertretung gegenüber der Kranken- und Pflegekasse
Kraft Gesetzes kann sich jeder Beteiligte gegenüber der Kranken- und Pflegekasse durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen (z.B. Anträge auf behördliche Leistungen stellen, Widerspruch gegen behördliche Entscheidungen einlegen).
Vertretung gegenüber anderen Behörden und Ämtern
Sinnvoll ist es, die Vollmacht auch gegenüber anderen Behörden und Ämtern zu erteilen, weil im Zusammenhang mit der Pflege unter Umständen auch mit anderen Behörden Kontakt aufgenommen werden muss. In diesem Fall erstreckt sich die Vollmacht etwa auch auf die Vertretung gegenüber dem Rentenversicherungsträger und dem Sozialamt.
Vertretung gegenüber Pflegeeinrichtungen
Bei einem Pflegefall ist es wichtig, dass sich die Vertretungsbefugnis auf alle Maßnahmen der Pflege erstreckt. In diesem Zusammenhang kann dann der Bevollmächtigte beispielsweise auch einen ambulanten Pflegedienst engagieren oder einen Heimvertrag abschließen.
Aufenthaltsbestimmungsrecht
Der Bevollmächtigte kann auch ermächtigt werden, den Aufenthalt des Pflegebedürftigen zu bestimmen und diesen zu ändern. So ist gewährleistet, dass der Bevollmächtigte für eine situationsgerechte Unterbringung, auch in einem Heim, sorgen kann.
Vertretung in gesundheitlichen Angelegenheiten
Wenn der Bevollmächtigte in allgemeinen gesundheitlichen Fragen für den Pflegebedürftigen entscheiden soll, müssen ihm entsprechende Vertretungsbefugnisse eingeräumt werden. Wichtig ist, dass der Bevollmächtigte die Behandlungswünsche der pflegebedürftigen Person kennt und danach handelt. Deshalb ist es sinnvoll, diese in einer Patientenverfügung niederzulegen, an die sich der Arzt zu halten hat und die der Bevollmächtigte gegenüber dem Arzt durchsetzen muss.
Sinnvoll ist es, den Arzt von seiner Schweigepflicht zu entbinden. Damit kann sichergestellt werden, dass der Bevollmächtigte zuverlässige Auskünfte über Ihren medizinischen Zustand und die ärztliche Behandlung erhält.
Dauer der Vollmacht
In der Vollmacht muss geregelt werden, wann und unter welchen Voraussetzungen sie erlöschen soll.
Die Vollmacht kann grundsätzlich jederzeit widerrufen werden. In diesem Fall gilt die Vollmacht bis zum Widerruf. In der Vollmacht kann auf das dem Vollmachtgeber zustehende Widerrufsrecht nochmals ausdrücklich hingewiesen werden.
Widerrufen kann der Vollmachtgeber seine Vollmacht nur, solange er geschäftsfähig ist.
2.4 Patientenverfügung
Mit einer Patientenverfügung können Sie im Rahmen Ihres Rechts auf Selbstbestimmung für eine medizinische Behandlung Festlegungen über Art und Umfang diagnostischer oder therapeutischer Maßnahmen für den Fall treffen, dass Sie sich in einer konkreten Behandlungssituation nicht mehr persönlich äußern können. Sie legen also verbindlich fest, was Ärzte, Pflegepersonal, Bevollmächtigte und Betreuungsgerichte zu tun und zu lassen haben, wenn Sie sich nicht mehr äußern können.
Für pflegebedürftige Menschen ist die Patientenverfügung eine wichtige Vorsorgeverfügung. Sind Sie als Patient handlungsunfähig (z.B. weil Sie bewusstlos sind oder im Koma liegen), muss der Arzt Ihren mutmaßlichen Willen ermitteln und danach entscheiden, ob der vorgeschlagenen Behandlung zugestimmt oder ob sie abgelehnt wird. Ihren mutmaßlichen Willen muss der Arzt anhand konkreter Anhaltspunkte ermitteln. Maßgeblich für das ärztliche Handeln ist dann, wie Sie als Patient selbst entscheiden würden. Mit einer Patientenverfügung ist gewährleistet, dass medizinisch nur das getan wird, was Sie wünschen. Zudem geben Sie Ihren nahen Angehörigen eine Marschroute bei der Erforschung Ihres mutmaßlichen Willens vor.
2.4.1 Textbausteine
Im Folgenden finden Sie Textbausteine für die wichtigsten Verfügungen in einer Vorsorgevollmacht. Diese sind nach Ihren persönlichen Interessen gegliedert und können nach Ihren Wünschen individuell zusammengestellt werden. Wählen Sie einfach die entsprechenden Verfügungen aus, die Sie übernehmen wollen, und übertragen Sie diese dann in Ihre persönliche Patientenverfügung.
Verstehen Sie die nachfolgenden Textbausteine als Formulierungshilfen und Anregungen. Maßgebend für Ihre persönliche Verfügung sind jedoch Ihre individuellen Lebensumstände. Lassen Sie also Textbausteine weg, die nicht Ihren Interessen entsprechen, und ergänzen Sie den Text um Festlegungen, die Ihnen wichtig sind.
Eingangsformel
Aus der Patientenverfügung, die nur wirksam ist, wenn sie schriftlich verfasst wird, muss zunächst hervorgehen, wer sie errichtet hat und für welche Person sie gelten soll.
Wenn Sie eine Patientenverfügung verfassen wollen, müssen Sie einwilligungsfähig sein. Das ist der Fall, wenn Sie in der Lage sind, Art, Bedeutung, Tragweite und Risiken einer ärztlichen Maßnahme zu erfassen und danach Ihre Entscheidung zu treffen.
Wenn Zweifel an Ihrer Einwilligungsfähigkeit bestehen, sollten Sie eine entsprechende Bestätigung eines Arztes einholen und dies in der Verfügung entsprechend vermerken.
Formulierungsbeispiel