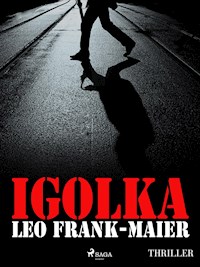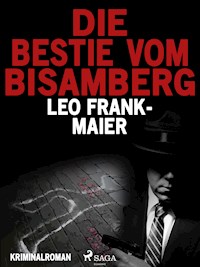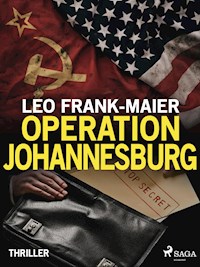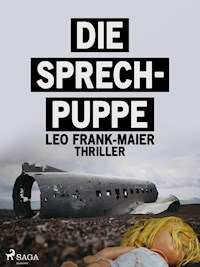Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
1961, das Jahr, als in Jerusalem der Eichmann-Prozess stattfindet. Franz Wallisch, ein österreichischer Journalist, der als Berichterstatter für eine deutsche Zeitung arbeitet, ist vor Ort und beginnt, sich aufgrund der täglichen Konfrontation mit der deutschen Nazivergangenheit mit seiner eigenen Geschichte als deutscher Soldat auseinanderzusetzen, und fühlt sich gleichzeitig schuldig wie nicht schuldig – was auch damit zu tun hat, dass er in Israel neue Freunde gefunden hat. Nach Deutschland zurückgekehrt, wird er in seinem Frankfurter Stammlokal von einem Unbekannten angesprochen, der ihm Informationen über einen gewissen Radebrecher alias Dr. Räder zusteckt. Franz findet heraus, dass Radebrecher ein hoher SS-Offizier war, der am Tod vieler jüdischer Kinder schuld ist, und zeigt ihn an. Als es Radebrecher dennoch gelingt zu entkommen und Franz verdächtigt wird, Beihilfe geleistet zu haben, beschließt Franz, den Mann selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Mit "Der programmierte Agent" hat Leo Frank einen außergewöhnlichen Spionagetriller mit ganz besonderer Note geschrieben. Während Franz Wallisch nur Rache nehmen will, ahnt er nicht, dass alles, was er tut, bereits vor langer Zeit an höherer Stelle geplant wurde ...Leo Frank (auch Leo Frank-Maier, gebürtig eigentlich Leo Maier; 1925–2004) ist ein österreichischer Kriminalautor, der in seinem Werk die eigene jahrzehntelange Berufserfahrung als Kriminalbeamter und Geheimdienstler verarbeitet. In seiner Funktion als Kriminalbeamter bei der Staatspolizei Linz wurde Leo Maier 1967 in eine Informationsaffäre um den Voest-Konzern verwickelt. Man verdächtigte ihn, vertrauliches Material an ausländische Nachrichtendienste geliefert zu haben, und er geriet unter dem Namen "James Bond von Linz" in die Medien. Es folgte eine Strafversetzung nach Wien, wo er nach wenigen Monaten wiederum ein Angebot zur Versetzung nach Zypern annahm. Zwischen 1967 und 1974 war Leo Maier Kripo-Chef der österreichischen UN-Truppe in Nikosia. Auf Zypern begann er seine ersten Kriminalromane zu schreiben und legte sich den Autorennamen Leo Frank zu. Doch dauerte es noch einige Jahre, bis 1976 sein erster Roman "Die Sprechpuppe" publiziert wurde. 1974 kehrte er – in der Voest-Affäre inzwischen voll rehabilitiert – nach Linz zurück. Er leitete verschiedene Referate (Gewaltreferat, Sittenreferat, Mordreferat), bevor er 1980 zum obersten Kriminalisten der Stadt ernannt wurde. Mit 59 Jahren ging er in Pension und zog in seine Wahlheimat Bad Ischl, wo er 2004 verstarb.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leo Frank-Maier
Der programmierte Agent
SAGA Egmont
Der programmierte Agent
Copyright © 1979 by F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Copyright 2017 Leo Frank-Maier og Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711518601
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
Einer sagte: »Was gehen uns die Scheißjuden an?«
Ein anderer sagte: »Ja ja, der Adolf, der hat schon gewußt, warum.«
Und er trank einen kräftigen Schluck aus dem Bierglas.
Einer sagte gar nichts und sah der Kellnerin auf den Hintern.
Die Kellnerin sagte: »Hört’s auf mit dem blöden Politisieren, singt’s lieber was.«
Und sie sangen das Lied von den Blauen Dragonern.
Die reiten und reiten.
Und reiten …
Der kleine Mc Caulley war also doch tot, sie hatten ihn tatsächlich umgebracht.
Colonel Thornton legte bekümmert den Bericht auf seinen Schreibtisch. Irgendwie hatte er doch gehofft, es würde sich alles als harmlos aufklären. Mc Caulley war ein junger und eigensinniger Schnösel gewesen, einer von diesen Nachkriegsleuten, die alles besser wußten. Colonel Thornton hatte ihn nie recht gemocht. Jetzt war er tot.
Der Colonel seufzte. Er ging zu seinem Safe und öffnete ihn umständlich. Zwischen Aktenordnern mit der roten Aufschrift »Secret« und »Top Secret« lag ein Blechschächtelchen. Der Colonel entnahm daraus zwei kleine Pillen und schluckte sie. Dann verschloß er den Safe wieder. Colonel Thornton war jetzt über fünfundfünfzig, und ohne diese Pillen wurde er schnell müde. Und heute stand ihm noch allerhand bevor. Peinlich, diese Geschichte mit Mc Caulley.
Ausgerechnet heute mußte dieser Bericht eintreffen. Im Club gab der General eine Party anläßlich seines 59. Geburtstages. Sicher würde auch der Minister kommen. Und irgendwann mußte doch der General einmal über seine Nachfolge sprechen. Mit sechzig mußte er doch in Pension.
Colonel Thornton graute, wenn er an seine eigene Pensionierung dachte. Und womöglich als Colonel. Er, Patrick B. Thornton, der beste Taktiker im Generalstabskurs, im Range eines Colonels in Pension. Eine Schande. Aber wenn er es jetzt nicht schaffte, war es vorbei.
Er blätterte wieder in dem Bericht. Sein Gedächtnis ließ nach, ärgerlich. Wie lange war Caulley überfällig, er hatte es doch schon gelesen. Aha, sieben Wochen. Unangenehm. Sieben Wochen, und er hatte nichts unternommen. Was hätte er schon unternehmen sollen? Sicher würden sie etwas finden, was er hätte anordnen sollen. Der General, und Colonel Foster vor allem. Damned, hinterher war immer leicht reden. Er hatte gehofft, die Sache würde sich als harmlos herausstellen. Kam ja öfter vor, daß sich ein Agent längere Zeit nicht meldet. Mc Caulley hätte ja einen Unfall haben können oder Schwierigkeiten mit einer Zollbehörde oder Polizei. Der Krieg war schließlich lange vorbei und man dachte doch nicht gleich an das Schlimmste.
»Lächerlich«, sagte der Colonel, aber es klang sorgenvoll. Diese Krauts, diese deutschen Barbaren! Einen Gegenagenten einfach umzulegen, mitten im Frieden. Es war der dritte Fall in den letzten zwei Jahren. Diese Hunnen. Der Colonel war jetzt wirklich böse. Womöglich scheiterte seine Beförderung an diesem Fall. Der Minister mochte solche Dinge nicht. Wenn die Presse davon erfuhr, war er geliefert.
Nun, die Presse würde wohl nichts erfahren. Der Colonel beruhigte sich wieder ein wenig.
Diese alten Nazis mit ihren Gestapomethoden. Man hätte sie nach dem Krieg eben ganz aus dem Verkehr ziehen müssen. Aber nein, da hatten die alliierten Dienste die SD-Leute angeworben, als ob man nicht ohne sie ausgekommen wäre. Die Amis hatten begonnen damit. Diese blöden Amis. Der Colonel war schon immer dagegen gewesen.
Aber auf ihn hörte damals ja keiner.
Er mußte nun etwas unternehmen. Aber was? Früher hatte er oft brillante Ideen gehabt. Schließlich war er nicht umsonst Abteilungsleiter im MI 5 geworden. Und eigentlich müßte er schon lange Chef der Europasektion sein. Wenn nur der General endlich in Pension ginge. Colonel Thornton ging zum Fenster. Er beobachtete gerne den Straßenverkehr, das beruhigte ihn. Die Hampton Street war ziemlich belebt, die Menschen gingen ohne Mäntel und Hüte, es war warm für diese Jahreszeit. Der Colonel hatte plötzlich Lust, in einem Park spazierenzugehen. Sonnige Tage waren selten in London. Aber daran war ja jetzt nicht zu denken, dafür hatte er als Pensionist noch Zeit genug. Was war zu tun?
Eigentlich war die Sache gar nicht so schlimm. Mc Caulley war schließlich nicht im Offiziersrang und nicht einmal pragmatisiert, nur im Vertragsverhältnis. Die geeignete Verständigung seiner Angehörigen war Sache der Personalabteilung. Das ging ihn nichts an.
Colonel Patrick B. Thornton war ein eckiger grauer Mann, dem die Kinder aus dem Wege gingen. Er trug einen grauen Flanellanzug, und wahrscheinlich waren auch alle seine Krawatten grau oder graugestreift, ähnlich seinem Gesicht. Seine Zivilkleidung war ein bitterer Protest gegen die Tatsache, daß im militärischen Nachrichtendienst Ihrer Majestät die Uniform verpönt war. Zumindest im Frieden und im täglichen Bürodienst. Natürlich nicht bei Festveranstaltungen oder Parties, aber solche Gelegenheiten waren ja selten genug.
Es war Zeit für den Tee.
Bevor er die Sprechanlage betätigte, räusperte er sich. Er wollte eine verständliche Stimme haben. Es war lächerlich, er sprach nur drei Worte: »Tee, wie üblich«. Er hätte ebensogut »Blabldibrablditi« sagen können, Miss Rosalie Fletcher würde in fünfundzwanzig Sekunden den Tee bringen. Er hatte es ausgezählt, langsam bis fünfundzwanzig gezählt, so lange dauerte es, bis Miss Rosalie Fletcher mit dem Tee angetanzt kam. Natürlich war Miss Rosalie Fletcher seine Sekretärin. Seit acht Jahren.
Sie stellte das Tablett auf seinen Schreibtisch, wie üblich, und er sah ihr nach, wie sie wieder zur Tür ging, wie üblich.
Und wie immer hatte er den Wunsch, ihr den zu kurzen Rock hochzuheben und sie in den Hintern zu kneifen. Das ging schon acht Jahre so.
Selbstverständlich hätte Colonel Patrick B. Thornton eher unter einer roten Fahne im Hyde Park Mao Tse Tung zitiert, als mit Worten oder Taten dem prallen Hinterteil seiner Sekretärin näher zu treten. Schließlich war er ihr Vorgesetzter.
Als sie bei der Türe war, sagte er: »Äh?«
Sie drehte sich um.
Sie sah von vorne bei weitem nicht so sexy aus, wie ihre Rückseite vermuten ließ. Es war ihr Gesicht, das zu ihrer Rückenfront im Widerspruch stand und Ähnlichkeit mit einem Postkasten oder einem herabgelassenen Rollbalken hatte.
»Ich bitte die Herren Referenten für 17.30 Uhr in den Konferenzraum«, sagte der Colonel.
»Yes Sir, 17.30 conference room«, wiederholte der Postkasten. Die Tür öffnete und schloß sich fast geräuschlos. Er war wieder allein. Mit seinem Tee und zwei trockenen Cakes.
Er würde vorerst einmal seine Mitarbeiter referieren lassen, zum Thema Mc Caulley. Vielleicht hatte einer eine vernünftige Idee. Zur Abwechslung. Verdammt einfallsloser Verein, seine Operationsabteilung. Beamtete Sesselkleber, die alles nach Schema erledigten. Der Colonel verachtete sie. Sie würden berichten und reden und Vorschläge machen und wieder reden und dann auf seine Weisung warten. Und wenn eine Gegenoperation gut verlief, sprachen sie von Teamwork. Ging etwas schief, hatte der Colonel den Rotz am Ärmel.
Im Falle Mc Caulley war so ziemlich alles schief gegangen. Der Colonel seufzte wieder und trank den letzten Schluck Tee. Dann schob er das Tablett angewidert von sich.
Sollte er sich eine Zigarre genehmigen? Es war dann schon die dritte, und er hatte noch die Party vor sich. Den Dr. Doolittle sollten die Würmer fressen mit seinen ewigen Ermahnungen. Was wußte der von den Thorntons! Sein Vater war 80 und dampfte immer noch, der alte Herr.
Die Zigarre glühte.
Eine Gegenoperation war dringend nötig. Die Radebrecher-Leute wurden sonst immer frecher. Diese Kanalratten mußten ausgeräuchert werden. Im Krieg wäre das ein Fall für einen Kommandotrupp gewesen. Hinein in die gute Stube und »peng – peng«! Der Organisation den Kopf abschlagen, dann wäre Ruhe für eine Weile! Aber man schrieb 1961, und alles war friedlich und demokratisch.
Colonel Thornton las wieder in seinem Bericht. Die Zigarrenasche fiel zu Boden. Sicher waren es die Radebrecher-Leute gewesen, die den kleinen Mc Caulley abgemurkst hatten. Wer sonst? Dr. Radebrecher, ehemals Obersturmbannführer im Reichssicherheitshauptamt, Amt IV, Gegnerbekämpfung. Jetzt hieß er Räder und war Rechtsanwalt in Frankfurz. Arbeitete für die Kommunisten, das Schwein. Direkter Draht zum Ministerium für Staatssicherheit in Ostberlin. Colonel Thornton zischte verächtlich. Sollte er dem Westdeutschen Dienst einen Tip geben? Das Problem wäre dann gelöst. Wahrscheinlich würden seine Referenten das vorschlagen. Diese Schwachköpfe! Auf so eine Lösung wäre auch seine Putzfrau gekommen.
So einfach lagen die Dinge nicht. Er kannte die Krauts. Sie würden eine große Polizeiaktion starten und dabei seine eigenen Kreise stören. Und womöglich tauchte der Radebrecher vorher unter, wurde gewarnt. Hockten ja genug alte Nazis in dem Gehlenverein.
Nein, so einfach lagen die Dinge nicht. Leider nicht. Der Colonel öffnete widerwillig ein dickes Kuvert, eine Beilage zum Schlußbericht Mc Caulley. Die Ausweise und Schriftstücke waren drin, die man bei dem Toten gefunden hatte. Wieder so eine Neueinführung, was ging ihn, den Colonel, das an? Eine Liste zum Bericht hätte genügt. Das war schließlich Angelegenheit der Personalabteilung. Er würde ein Wort mit Major Johnson reden müssen. Wenigstens über die Kompetenzen sollten die jungen Herren Bescheid wissen.
Sogar eine Zeitung war bei den Papieren. Ein Hamburger Abendblatt. Eingetrocknete braune Flecken über der halten Titelseite, wahrscheinlich Blutflecke. Widerlich. Der Colonel dämpfte die Zigarre aus. Nächstens würde man ihm noch Leichenteile vorlegen.
Automatisch las er die Schlagzeilen. Der Hamburger Sportverein hatte 3:1 gewonnen. Unbekannte Flugobjekte in Brasilien gesichtet. Leipziger Messe: DDR will ins Westgeschäft. In Jerusalem kam der Eichmann-Prozeß in ein neues Stadium.
Colonel Thornton schlug mit der flachen Hand auf die Schreibtischplatte. Es klang wie ein Startschuß, und er sprang auf und begann im Zimmer auf und ab zu gehen. Große, beschwingte Schritte, Hände in den Taschen. Natürlich, das war sie! Die Idee für die Gegenoperation! Seine brillante Idee!
Die alten Unterlagen über Radebrecher aus seiner NS-Zeit! Nicht mit der Gegenwart, mit der Vergangenheit mußte man operieren! Das war doch jetzt aktuell, die ganze Welt sprach von Eichmann und von dem Prozeß. Der Colonel zündete eine neue Zigarre an. Ha, alle unterschätzten die Thorntons. Er hätte sich gerne selbst auf die Schulter geklopft. Ausgezeichnet, alter Junge!
Er würde seine Referenten bei der Konferenz zuerst herumstottern lassen. Ganz beiläufig würde er dann seinen Plan entwickeln. Sie würden auf dem Bauch liegen – vor Ehrfurcht. Ja, das war der alte Thornton. »Nein, Johnson«, würde er dann sagen, ein wenig mitleidig, »natürlich bleiben wir im Hintergrund, wozu haben wir befreundete Dienste. Na, Johnson, und welche Firma ist wohl die geeignetste? Richtig, Johnson, natürlich die Juden. Die Israelis. Eine zweite Entführung können sie sich nicht leisten, schließlich ist Radebrecher kein Eichmann. Denken Sie an die außenpolitische Situation, Johnson. Was werden die Israelis also tun? Sie werden die Presse mobilisieren. Sie werden den Radebrecher hochgehen lassen, durch die Presse. Radebrecher in Schwierigkeiten bedeutet Lähmung des gegnerischen Apparates. Das Ziel unserer Operation, Major Johnson!«
Es klopfte.
»Die Herren warten im Konferenzraum«, sagte Miss Rosalie Fletcher.
»Ich komme«, sagte der Colonel.
Er war zufrieden mit sich selbst. Die Pillen wirkten, er fühlte sich frisch und energisch. Patrick B. Thornton würde es diesen Mistkerlen schon zeigen.
Frank konnte den rechten Arm nicht bewegen, und das war unbequem. Er wußte, daß Judith mit ihrem Kopf auf seinem Arm schlief, und er wollte sie nicht wecken. So blieb er regungslos liegen, wollte weiterschlafen, nichts denken, nichts wissen.
Nun wäre er gerne allein gewesen.
Er hörte den Muezzin plärren, drüben in der Altstadt von Jerusalem. Es war noch Zeit zu schlafen. Aber der Arm tat weh.
Sein Körper war feucht, und er fror. Schließlich blinzelte er mühsam, drehte sich ein wenig und zog seinen Arm behutsam an sich.
Sie schlief weiter und das war gut so.
Er versuchte mit den Beinen ein Leintuch zum Zudecken zu finden, gab es aber wieder auf.
Von der Straße hörte er das Klingeln des Petroleumverkäufers, der um diese Zeit mit seinem Eselkarren umherzog. Ein vertrautes Geräusch nach fast vier Monaten, die er nun in diesem Land war.
Er wollte weiterschlafen, weil er fühlte, daß da irgend etwas Unangenehmes war, an das er zu denken hatte. Es war zu kalt. Schließlich setzte er sich mühsam auf, fand eine Decke und zog sie über sich.
Noch spürte er den Alkohol von gestern. Mit dem Schlafen war es wohl jetzt vorbei. Er tappte nach einer Zigarette, konnte aber kein Feuerzeug finden und lehnte sich wieder zurück. Eine Weile betrachtete er Judith. Sie war nackt und schlief tief, den Mund halb geöffnet. Das Bett ist viel zu schmal, dachte er.
Er hatte noch nie zuvor mit einer Jüdin geschlafen. Sie roch ein wenig unangenehm nach ungeputzten Zähnen und Schweiß. Einen schönen Körper hat sie, mit ihren zweiundzwanzig Jahren, mußte er denken. Etwas füllig, wie sie wohl mit zweiunddreißig Jahren aussehen würde? Judith war eine Sabre, eines dieser in Israel geborenen Mädchen, deren herbe Schönheit und Natürlichkeit so faszinieren. Der beste Exportartikel dieses Landes, süßer als Jaffa Orangen, verläßlicher als Uzi-Maschinenpistolen, made in Israel, aber leider meist unverkäuflich.
Er fand das Feuerzeug, machte einen tiefen Zug und unterdrückte den Hustenreiz, um sie nicht zu wecken. Er betrachtete ihre schwarzen Schamhaare und ihre makellosen Zähne, und plötzlich wußte er wieder, daß sie schwanger war. Er bedeckte sie behutsam mit einem Leintuch und dämpfte die Zigarette wieder aus.
Er versuchte weiterzuschlafen.
Unter der Decke wurde ihm wieder langsam warm. Der Schlaf ist der Bruder des Todes, sagten sie in diesem Land.
Mit einer Frau ins Bett zu gehen und in der Früh mit ihr aufzuwachen, sind grundverschiedene Dinge.
Sie war zum ersten Mal bei ihm in seinem kleinen Zimmer in der King Georg Street, ganz in der Nähe des neuen Gebäudes, das man eigens für den Eichmann-Prozeß eingerichtet hatte. Vorher war er immer bei ihr gewesen, das war bequemer. Dort konnte er nach Mitternacht wieder gehen, unter dem Vorwand, daß er doch am nächsten Tag frische Wäsche haben müsse.
Er liebte diese nächtlichen Spaziergänge nach Hause, entspannt und müde. Gewöhnlich trank er noch ein Bier in der My-Bar. Die einzige Kneipe, die um diese Zeit in Jerusalem noch offen hatte.
Dort saßen meist ein paar angetrunkene Journalisten, Kollegen, die sich seit Beginn des Prozesses in der Heiligen Stadt langweilten. Ein paar Soldaten von den United Nations, die aus unerfindlichen Gründen in der My-Bar einen Dollar für einen Whisky bezahlten, den sie in der Kantine in ihrem Hauptquartier duty free für zwei Dollar die Flasche haben konnten.
»Jerusalem ist halb so groß wie der Friedhof von Chicago«, sagten alle, »nur doppelt so ruhig.«
In der My-Bar kannten sie ihn und Judith und alle wußten, wenn er von ihr kam. Sie waren neidisch auf ihn, und er genoß ihren Neid. Jeder von den Ausländern kannte jeden in diesen Tagen des Eichmann-Prozesses, und alle wußten alles voneinander. Oder glaubten zumindest, alles zu wissen.
Der Prozeß dauerte nun einmal viel zu lang für die Journalisten und Jerusalem war nichts anderes als ein großes Dorf.
Blöd von ihm, sie diesmal mit nach Hause zu nehmen. Er verspürte den heftigen Drang zum Urinieren, kroch behutsam aus dem Bett, ängstlich bemüht, sie nicht zu wecken.
Im Bad betrachtete er kritisch seine geröteten Augen, es war ihm zum Speien übel. Mit seinen stark ergrauten Haaren sah er glatt um zehn Jahre älter aus. Besonders an so einem Morgen.
»Alter Hund, blöder«, sagte er leise.
Wieder stellte er fest, daß auch seine Bartstoppel grau wurden. Er wollte nicht, daß Judith ihn so sah. Er begann sich zu rasieren. Mit dem weißen Rasierschaum im Gesicht sahen seine Zähne richtig grau aus, und er beschloß wieder einmal, weniger zu rauchen und wußte dabei, daß er zu Mittag schon das zweite Paket aufreißen würde.
»Du bist ein Idiot, Frank«, murmelte er.
Es gefiel ihm, hier in der Fremde Frank zu heißen. Zu Hause sagten sie Franz.
Es gelang ihm, wieder ins Bett zu schlüpfen, ohne Judith zu wecken. Er wußte, daß sie ihn küssen würde, und es war ihm ganz und gar nicht danach. Ihr Körper war jetzt warm und als sie sich schlaftrunken zur Seite drehte und ihm den Rücken zukehrte, war er zufrieden.
Es war noch Zeit zu schlafen.
So sehr hatte er sich um diesen Job bemüht. Es war nicht sein erster Auslandsauftrag, aber er hatte Unwillen und Neid seiner Kollegen mehr denn je zuvor gespürt. Und wie immer in seinem Leben mußte er darauf mit höhnischer Provokation reagieren, es war wie ein innerer Zwang, den er nicht überwinden konnte.
Warum, zum Teufel, mußte er sich immer Feinde schaffen. Er erinnerte sich an Irene, die jetzt schon eine eigene Rechtsanwaltskanzlei in München hatte. Tüchtiges Weib. »Du bist ein hoffnungsloser Zyniker«, hatte sie ihm zuletzt gesagt. Warum hatte er sie eigentlich nicht geheiratet?
»Sie ist mir zu gescheit und hat zu viel Geld«, pflegte er damals seinen Freunden zu sagen, und irgendwie war er verlegen dabei.
Seinen Freunden? Hatte er überhaupt welche? Oft schon hatte er darüber nachgedacht und sich diese Frage gestellt.
Er versuchte zu rechnen. Als er den Job übernahm, schien es ihm der einzige Ausweg aus einer tristen finanziellen Situation. Er konnte es nun drehen wie er wollte, es hatte sich kaum etwas geändert, und er hatte sich solche Hoffnungen gemacht.
Er hatte zu viel Geld ausgegeben in den letzten vier Monaten. Sinnlos, ohne zu rechnen, wie immer.
In etwa vier Wochen würde die Urteilsverkündung gegen Eichmann sein. Dann erwartete man ihn zu Hause. Er würde die üblichen Streitereien wegen seines Spesenkontos haben.
»Mach dir nichts vor«, sagte er sich, »du bist in derselben Scheiße wie vorher. Lucky Frank! Mit dem Unterschied, daß du jetzt noch eine schwangere Freundin am Hals hast.«
Ob sie es darauf abgesehen hatte? Der Gedanke beschäftigte ihn für einen Moment.
Er erinnerte sich an ihr »dont worry, darling, it’s a good time« vor einem Monat. Hatte sie versucht ihn zu täuschen?
Nein. Frauen konnten ihm nichts vormachen. Dachte er. Sie war zu erschrocken, zu ängstlich, als die Regel ausblieb.
Und sie wollte es auch jetzt noch nicht glauben.
Er wußte es besser seit jenem Sonntagmorgen, als sie nach der ersten Zigarette plötzlich blaß wurde und mit der Hand vor dem Mund aus dem Zimmer rannte.
Sie war wohl zum ersten Mal schwanger, dachte er.
Die Wasserspülung der Nachbartoilette hörte sich an wie das gequälte Röcheln eines alten Mannes. Vertraute Geräusche aus seiner Kindheit. Es klang wie zu Hause, in der Gemeindewohnung im 1o. Bezirk in Wien, aus der man seine Mutter 1945 delogierte, weil sein Vater ein Nazi war.
Er war wohl wieder eingeschlafen und hörte im Halbschlaf Judith im Badezimmer herumplätschern. Als sie wieder ins Bett schlüpfte, roch sie nach sie nach Seife und seiner Zahncreme. Sie saß eine Weile neben ihm, er wußte, daß sie ihn beobachtete und hielt die Augen geschlossen.
Sie begann ihn zu streicheln und zu betasten, und nach einer Weile fühlte er, wie sein Blut gehorsam ins Geschlecht strömte, und er zog sie an sich. Unter seinen Händen fing sie an schwer zu atmen. Er beobachtete sie jetzt verstohlen, und ihr gelöster Gesichtsausdruck erregte ihn. Er wollte wissen, wie spät es war, und hatte Angst, es könnte sie irritieren, würde er jetzt nach seiner Uhr greifen, die auf dem Sessel lag. Er richtete es so ein, daß er einen kurzen Blick auf die Uhr werfen konnte.
Es war noch Zeit.
*
Im Gerichtsgebäude war alles wie jeden Tag. Die Verhandlung hatte schon begonnen, er kam ein wenig zu spät. Er ging zuerst in den Presseraum und begrüßte mit Kopfnicken und Handbewegungen seine Berufskollegen, die dort mit ihren Kopfhörern saßen und den Simultanübersetzungen lauschten. Er suchte Jonny Davis von UPI, und als er ihn fand, machte er nur eine fragende Augenbewegung und erhielt als Antwort ein kurzes Abwinken, es gab also nichts Neues. So ging er ans Buffet, trank einen heißen Kaffee und rauchte in Ruhe eine Zigarette zu Ende. Oben an seinem Platz in der Galerie war Rauchverbot. Als er dann dort seine Kopfhörer aufsetzte, stellte er zuerst die englische Übersetzung ein, nach einer Weile wurde es ihm zu anstrengend, und er stellte auf deutsch um.
An Stelle der schon vertrauten Stimme des deutschen Simultanübersetzers hörte er eine Frauenstimme. Eine Weile horchte er und machte ein paar Notizen. Es war wieder von den Vernichtungslagern die Rede, er hörte die bekannten Namen Majdanek, Auschwitz, Sobibor. Die neue Dolmetscherin machte ihre Sache sehr gut. Eine sympathische Stimme, ein klassisches Deutsch. Irgendwie kam ihm die Stimme bekannt vor. Die Stimme erinnerte ihn an etwas, das schon lange zurück lag. Was war es nur?
Frank hatte den angeklagten Adolf Eichmann in seinem kugelsicheren Glaskasten oft und lange betrachtet und versucht sich vorzustellen, wie dieser Mann wohl in seiner SS-Uniform und im Vollbesitz seiner Befehlsgewalt ausgesehen haben mochte. Es gelang ihm nicht recht. Der hagere, nervös wirkende Endfünfziger hinter dem Panzerglas hätte Buchhalter oder Gaskassier sein können, ein Mann den man täglich trifft, in der Straßenbahn oder im Gasthaus, nichts Außergewöhnliches war an ihm. Eichmann sprach in langen Sätzen, eindringlich und beschwörend, verhedderte sich immer wieder und wußte am Ende nie, wie er den Satz begonnen hatte. Sein geschwollenes Amtsdeutsch verursachte dem Journalisten Wallisch oft Zahnweh. Manchmal griff der Vorsitzende des Gerichtes, Dr. Landau, ein, von dem man wußte, daß er einst Richter in Deutschland war. Der Jude Landau sprach ein glockenreines Deutsch, das jedem Sprachästheten das Herz höher schlagen ließ. Und es war grotesk, mitanzusehen, wie Eichmann als Vertreter der einstigen germanischen Herrenrasse der souveränen Persönlichkeit Dr. Landaus Tribut zollte, wie er förmlich buckelte und liebdienerte vor diesem Vertreter einer Rasse, die er zu Hunderttausenden in die Gaskammern geschickt hatte, als minderwertiges Leben, als Abschaum der Menschheit. Es war einfach nicht zu glauben, mit dem Verstand nicht zu fassen. Und doch war es die Wahrheit, waren es Tatsachen. Frank stellte sich vor, wie er als Obergefreiter wohl salutiert haben mochte, wäre er dem Obersturmbannführer Eichmann einmal begegnet. SS-Obersturmbannführer, das entsprach dem Rang eines Oberstleutnants. Dort, wo der Obergefreite Wallisch im Krieg war, hatte man solche hohen Ränge selten gesehen. Ganz seltene Vögel waren das. Man hatte sie höchstens in Autos vorbeifahren oder in Fronturlauberzügen gesehen, natürlich in reservierten Erstklasseabteilen, während sich die Landser auf den Gängen drängten. Und Franz Wallisch hatte die kalte Wut im Bauch, wenn er die Fiktion einer solchen Begegnung überdachte.
Der Journalist Wallisch schämte sich manchmal eines seltsamen Gefühls wegen: Es wäre ihm lieber gewesen, wenn Eichmann nach der Anklageverlesung aufgestanden wäre und einfach »Heil Hitler« geschrien hätte. Wenn er geschrien hätte: »Ich habe Euch, Ihr Juden, millionenfach gemordet, nun habt ihr mich, tötet mich, zu sagen habe ich nichts!«
Aber Eichmann winselte, daß er nur Befehle ausgeführt habe, daß er nur Werkzeug gewesen sei, – es war einfach widerlich.
Und Frank Wallisch schämte sich. Nicht, weil er jemals Nazi war. Er schömte sich, weil er solchen Figuren Ehrenbezeugung erwiesen hatte, als Obergefreiter.
Er bekam wieder Kopfweh von der Sauferei gestern. Er erinnerte sich, daß er mit einem jüdischen Journalisten in der Bar zu streiten begonnen hatte, weil der ihm nicht glauben wollte, daß ein großer Teil der Deutschen von der Judenvernichtung während des Krieges nichts gewußt hatte. Die ungläubigen und zynischen Bemerkungen hatten ihn zornig gemacht, und er hatte seine eigenen Erlebnisse während des Krieges zum Beispiel genommen, hatte versucht zu erklären, daß er als Gefreiter der Infanterie an der Ostfront von all diesen Dingen keine Ahnung haben konnte. Es war alles umsonst gewesen. Warum war das alles für jüdische Ohren so unglaubwürdig?
Die Frauenstimme im Kopfhörer rollte das »R« stark betont, besonders bei den Wortendungen. Es war ein gutes Gefühl, zuzuhören. Wo nur hatte er Ähnliches schon gehört?
Am liebsten hätte der dem Kerl gestern eine Ohrfeige gegeben. Aber das war schließlich kein Argument.
Sobibor, hörte er immer wieder die Stimme sagen – Sobibor.
Irgendwo in seinem Gehirn schloß sich der Kontakt. Natürlich, das war es. Die Sprecherin von BBC London – Feindsender während des Krieges – sie hatte dieselbe Art, das »R« zu betonen, gehabt.
Sobibor.
Und dann erinnerte er sich wieder.
Der Gefreite Franz Wallisch war der einzige Österreicher oder, wie man es damals auch nannte, »Ostmärker«, der 2. Kompanie des Infanteriesturmregimentes der 9. Armee.
Der Gefreite Franz Wallisch verfluchte diesen Umstand täglich mehrmals, und es war um so schlimmer für ihn, als er wußte, daß er daran nicht ganz schuldlos war. Alles hatte ganz normal begonnen an diesem Märztag 1942, als er mit seinem Einrückungsbefehl in einer Sammelstelle im Wiener Prater erschien und von dort mit der Nordbahn in die Tschechoslowakei, in das »Protektorat« fuhr, in eine kleine Garnisonsstadt. Zusammen mit dreihundert gleichaltrigen Burschen, verschieden in Herkunft, Erziehung, Beruf, aber gleich in Sprache und Mentalität. Alles ging normal weiter, die Ausbildung in der Rekrutenkompanie, die Vereidigung auf Führer, Volk und Vaterland, die Abstellung zur Marschkompanie und das große Rätselraten um das »wohin«, Rußland, Frankreich, Afrika, so viele Möglichkeiten gab es.
Für viele junge Deutsche, halbe Kinder, war es eine heroische Zeit. Pausenlos trommelte die Kriegspropaganda: Deutschland siegt an allen Fronten! Alle Räder rollen für den Sieg! Führer befiehl, wir folgen! Es wurde gesungen und marschiert. Man erlebte eine gewaltige Revolution der Gesellschaftsordnung. Geld wurde wertlos, Zivil verachtet. Vorwärts, zum Endsieg. Am deutschen Wesen wird die Welt genesen! Vorwärts, im Gleichschritt, marsch!
Der damalige Grenadier der Großdeutschen Armee Franz Wallisch hatte die günstigen Freizeitmöglichkeiten bei der Marschkompanie zweckvoll ausgenützt und die Bekanntschaft einer molligen Eisverkäuferin gemacht, dabei übersehen, daß dies die Tschechen nicht mochten, und war im Anschluß an eine Tanzveranstaltung von nationalbewußten Sokols verprügelt worden.
Als logische Konsequenz erhielt er darauf sieben Tage Militärarrest, verschärft durch zwei Tage »Wasser und Brot«, da ihm bei der Rauferei trotz heftiger Gegenwehr seine Mütze und sein Seitengewehr abhandengekommen waren und sich übrigens herausgestellt hatte, daß er als Deutscher Soldat dieses Tanzlokal gar nicht hätte betreten dürfen.
Während er aber in der Zelle sein Pech beklagte und sein geschwollenes Auge mit einem nassen Taschentuch kühlte, kam für seine Kameraden der Marschbefehl. Und als er nach Verbüßung seiner Strafe zu einer anderen Marschkompanie kommandiert wurde, fand er sich in einer anderen Welt, hauptsächlich bestehend aus Preußen und Sachsen, mit denen er bald darauf in einem endlosen Güterzug nach Osten rollte. Alles war nun anders, nur die Lieder, die sie sangen, waren die gleichen. Aber auch die klangen unterschiedlich. Das lag wohl nur am Dialekt.
Anfänglich hatten sie ihn behandelt wie einen Menschen, der unverschuldet den Makel eines schweren körperlichen oder geistigen Gebrechens trägt. Als »Ostmärker« wurde er nicht für voll genommen. Dies änderte sich langsam, als er widerwillig begann, statt seines breiten Wiener Dialektes ein ordentliches Schriftdeutsch zu sprechen, und da er zum ungläubigen Staunen seiner Vorgesetzten permanent die besten Schießresultate am Maschinengewehr hatte, machte man ihn nach langem Zögern zum MG-Schützen 1, ein ehrenvoller Platz in einer Infanterieeinheit und für Franz Wallisch insofern begehrenswert, weil er als solcher bei den langen Fußmärschen am wenigsten schleppen mußte.
Oft dachte er noch an die Eisverkäuferin in Kremsier, der er ein gerütteltes Maß von Schuld an seinem Schicksal zuschob. Und nachdem er aus einem Feldpostbrief von dem weiteren Weg seiner ehemaligen Kompanie nach Italien – was er sich immer gewünscht hatte – erfahren hatte, wurden seine Gedanken noch vorwurfsvoller.
Ihretwegen war er nun tief in Rußland, wohin er sich nie gewünscht hatte, im Mittelabschnitt, an der Beresina, umgeben von wenig freundlichen preußischen und sächsischen Kameraden und sehr unfreundlichen sowjetischen Partisanen und regulären Einheiten der Roten Armee.
Umgeben im wahrsten Sinn des Wortes, denn vier Tage zuvor, am 26. 6. 1944, hatte die lang erwartete große russische Offensive im Mittelabschnitt eingesetzt, und die anfänglichen Gerüchte waren nun Wirklichkeit geworden, die 2. Kompanie des Sturmregimentes war trotz massiver Gegenwehr, oder gerade deshalb, eingeschlossen.
Eingeschlossen, das ist ein böses und beängstigendes Wort für einen Infanteristen. Es kann Tod oder Gefangenschaft bedeuten, nicht unbedingt für alle, aber doch für viele.
Als es dunkel geworden war, hatten sie ihre Stellungen an der Beresina verlassen. Es war kein Befehl dazu da, aber die Feldwebel und Unteroffizier Scholz, auf den alle in der Kompanie hörten, weil er das Deutsche Kreuz in Gold hatte, besprachen sich kurz mit dem Leutnant und Kompanieführer und dann wurde das Wort flüsternd durchgegeben, auf das alle seit zwei Tagen gewartet hatten: Absetzen.
Sie waren aus ihren Löchern gekrochen, in denen sie zwei Tage und eine Nacht gelegen hatten. Sie hatten darin gehofft, geflucht und waren gestorben. Die Munition war knapp geworden, und sie mußten die angreifenden Russen immer näher heranlassen und gezielt schießen.
Der MG-Schütze 1 der vierten Gruppe, Obergefreiter Hensel aus Dresden, war am rechten Flügel ohne Munition gewesen, die Russen waren dort eingebrochen, Unteroffizier Scholz war mit einem Brotbeutel voll Eierhandgranaten auf Wurfweite hingerobbt, und nach seinen ruhigen und gezielten Würfen war von dort nur mehr Stöhnen und vereinzeltes Schreien zu vernehmen, und niemand wußte, ob dies die Russen waren oder noch die Kameraden der Gruppe Scholz. Gegen Abend war es dann ruhig geworden.
Die Russen hatten sich wieder zurückgezogen. Gefreiter Wallisch mußte wieder daran denken, um wieviel leichter es war, gezielt und ruhig auf davonlaufende Gegner zu schießen, als auf angreifende. Schließlich hatte er aber an seine knappe Munition und den verzweifelten Schrei des Obergefreiten Hänsel gedacht und das Feuer eingestellt. Warum man nur mit dem MG 42 kein Einzelfeuer schießen konnte, hatte er sich gefragt, mit einzelnen Schüssen hätte er jetzt ein halbes Dutzend umlegen können. Seine Munitionsschützen mit ihren Karabinern hatten jedoch die Nase im Dreck und dachten gar nicht daran, den Kopf hochzunehmen. Sein Schütze 2 lag drei Meter neben ihm und hatte ein kleines Loch zwischen den Augen. Weiter hinten lag der vierzigjährige Grenadier Böttcher aus Chemnitz, es mußte ihm an der Schulter erwischt haben, er schrie dauernd nach dem Sanitäter, weil er sich allein nicht verbinden konnte. Da ihm niemand vor Einbruch der Dunkelheit helfen konnte, hatte er sie alle wild verflucht, schließlich in seine Verwünschungen auch Adolf Hitler und die halbe Reichsregierung einbezogen, aber auch Stalin, Churchill und Roosevelt wären nach seinen inbrünstigen Flüchen in einer vollen Latrine zu ertränken gewesen.
Sie waren dann die ganze Nacht marschiert. Nicht marschiert, sie hatten sich in meist knietiefem Sumpf dahingeschleppt, ängstlich bemüht, keinen Lärm zu machen. Von der Rollbahn rechts von ihnen war ständiges Motorengeräusch zu hören, und sie wußten, daß es die Russen waren, die Richtung Stari Dorogi und Sluzk fuhren. Es war deprimierend, alles schien hoffnungslos, und jeder von ihnen dachte, wie sie wohl die zweihundert Kilometer bewältigen sollten, die die Russen zumindest auf der Rolbahn schon vorgestoßen waren.
Sie dachten daran, aber nur ganz hinten in dem letzten Winkel ihrer müden Gehirne. Wichtiger erschien allen eine Möglichkeit zu essen, zu schlafen.
»Komm Kleener«, hatte Unteroffizier Scholz gesagt, »Komm mal mit«.
Scholz sagte immer Kleiner zu Franz Wallisch, wahrscheinlich wegen dessen Jugend. Scholz war mit seinen sechsunddreißig Jahren doch ein alter Mann. Klar, als Infanterist ein alter Mann.
Sie gingen zum Kompaniegefechtsstand.
Sie waren aus dem Kessel wieder heraus. Sie hatten Glück gehabt. Seit drei Tagen waren sie »hinten«. Schießen hörte man nur von ferne. Der Leutnant war gefallen. Überhaupt waren nicht sehr viele übrig geblieben.
Sie hatten geschlafen, gegessen, sie hatten sich gewaschen und rasiert.
Sie waren wieder Menschen.
»Mal sehen, was es Neues gibt«, sagte Scholz.
Im Kompaniegefechtsstand saßen ein halbes Dutzend herum. Es war warm, heiß in diesem Juli 1944 in dieser Gegend. Die nächste größere Stadt hieß Slonim. War angeblich einmal eine Grenzstadt zwischen Rußland und Polen. Jetzt war dort ein Soldatenheim und ein Puff. Franz Wallisch war noch nicht dort. Die Jüngeren kamen immer zuletzt dran.
Nur der Funker und ein Melder hatten ihre Uniformblusen an. Die anderen saßen mit nacktem Oberkörper in der Sonne.
Scholz sah auf seine Armbanduhr und sagte zu dem Funker: »Na los, dreh an den Kasten«.
Der Funker blickte verlegen.
»Hab nicht so’n Schiß«, sagte er, «schalt ein!«
Der Funker drehte eine Weile an seinem Gerät.
Dann ertönte ein Pausenzeichen. Bumm bumm bumm — bumm. Melodiös.
Germany calling, Germany calling, hier ist BBC London, sagte eine Männerstimme.
Wallisch schaute ein wenig verschreckt. Natürlich war das verboten, jeder wußte es.
Na, Scholz konnte sich das leisten, mit seinem Deutschen Kreuz in Gold.
»Schon was Neues von der Invasion?« fragte Scholz.
»Nix«, sagte der Melder, er war aus München.
»Soldaten der Ostfront!« sagte eine Frauenstimme aus dem Gerät. Eine sympathische Stimme.
»Im Schutze Eurer Waffen …«, sagte die Stimme, »… in den Vernichtungslagern der verbrecherischen SS …«, sagte die Stimme, »… tausende von jüdischen deutschen Bürgern gemordet … in den Vernichtungslagern in Auschwitz, Majdanek, Sobibor … vergast, verbrannt … Frauen und Kinder …«.
»Sag schon was von der Invasion«, sagte Scholz mißmutig.
»Soldaten der Ostfront«, sagte die Frauenstimme, sie betonte das R besonders, sie rollte es, eine sympathische Stimme. »… im Schutze Eurer Gewehre ….. ungeheure Verbrechen … die verbrecherische SS … dreht die Gewehre um … kämpft gegen die SS …… im Namen der Menschlichkeit … Frauen und Kinder … in Auschwitz, Majdanek, Sobibor«.
»Dreh wieder ab«, sagte Scholz, »die redet ja doch nur Blödsinn«.
»Nix von der Invasion«, sagte der Melder, »gestern auch nicht«.
Der Funker schaltete ab.
»Wo ist das?« fragte Franz Wallisch, »Auschwitz, Sobibor«, den dritten Namen hatte er vergessen.
»Keine Ahnung«, sagte Scholz, »möchte wissen, wie die Invasion steht.«
»Seit zwei Tagen nur immer die gleiche blöde Greuelpropaganda«, sagte der Funker.
»Sag mir Bescheid, wenn sie was von der Invasion sagen«, sagte Scholz.
»Mach ich«, sagte der Funker.
»Komm, Kleener«, sagte Scholz.
*
»Beth Hamishpath!«
Der Gerichtsdiener schrie das immer wie ein preußischer Feldwebel.
»Das Gericht!«
Alles stand auf.
Frank war von seinen Erinnerungen ganz benommen. Sobibor. Er hatte den Namen also schon gehört. – Damals!
Die Verhandlung war also beendet für heute, viel hatte er nicht mitbekommen. Er war weit weg.
»Was sagst du zu Giddy?« fragte Jonny, Jonny saß plötzlich neben ihm. Frank hatte ihn gar nicht kommen sehen. Sie sagten Giddy zu Gideon Hausner, dem Ersten Staatsanwalt. Frank wußte gar nicht, daß Giddy einen großen Auftritt hatte. Er hatte es glatt verträumt.
»Adi und Giddy«, sagte er und grinste verlegen.
Jonny lachte.