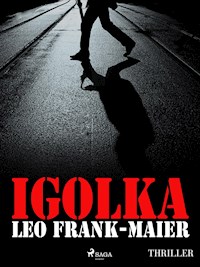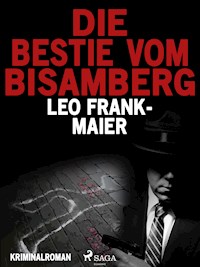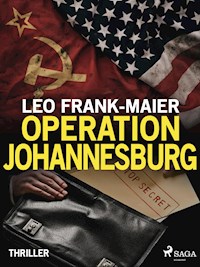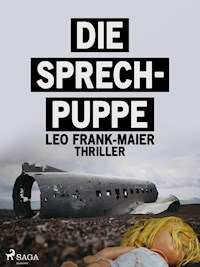Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Sehr ungewöhnlich für einen Krimi, steht das Ende des Romans hier schon von der ersten Seite an fest: Im Beirut der achtziger Jahre wird ein österreichischer Kriminalpolizist erschossen und sein Leichnam zur Beerdigung in die Heimat überführt. Das nimmt der Geschichte allerdings nichts von ihrer Spannung – ganz im Gegenteil! Eigentlicher Beginn des Romans ist dann ein Treffen von Kriminal-Gruppeninspektor Johann Bauer, vor zwei Jahren vom Referat "Gewaltdelikte" im Wiener Sicherheitsbüro auf einen gutbezahlten Auslandsjob in Beirut versetzt, mit dem arabischen Informanten Mechmed Khalil, der ihm die Adresse eines zwielichtigen Geschäftsmanns zuspielt, welcher in eines der üblichen dunklen Geschäfte zwischen Waffenschieberei, Drogenhandel und Terrorismusfinanzierung verstrickt ist. Johann Bauer traut seinen Augen kaum, denn er stößt auf einen alten Bekannten aus Wien: Sebastian Suchy aus der Seidelgasse 7, der ein anrüchiges "Ex- und Importbüro" betreibt und, wie Johann mit Verwunderung konstatiert, noch nicht einmal vorbestraft ist. Dabei ist er doch selbst mit dabei gewesen, bei jenem Raubüberfall in der Seidelgasse, wo er Sebastian Suchy kennenlernen musste – er und sein Kollege und Freund Micky Heidinger, damals beide noch junge Kriminalbeamte im Wiener Sicherheitsbüro, Referat "Gewaltdelikte". Und Micky Heidinger ist auch jetzt wieder an seiner Seite, als Johann Bauer zu ermitteln beginnt und sich bald eingestehen muss, hier wohl in ein Wespennest gestochen zu haben ...Leo Frank (auch Leo Frank-Maier, gebürtig eigentlich Leo Maier; 1925–2004) ist ein österreichischer Kriminalautor, der in seinem Werk die eigene jahrzehntelange Berufserfahrung als Kriminalbeamter und Geheimdienstler verarbeitet. In seiner Funktion als Kriminalbeamter bei der Staatspolizei Linz wurde Leo Maier 1967 in eine Informationsaffäre um den Voest-Konzern verwickelt. Man verdächtigte ihn, vertrauliches Material an ausländische Nachrichtendienste geliefert zu haben, und er geriet unter dem Namen "James Bond von Linz" in die Medien. Es folgte eine Strafversetzung nach Wien, wo er nach wenigen Monaten wiederum ein Angebot zur Versetzung nach Zypern annahm. Zwischen 1967 und 1974 war Leo Maier Kripo-Chef der österreichischen UN-Truppe in Nikosia. Auf Zypern begann er seine ersten Kriminalromane zu schreiben und legte sich den Autorennamen Leo Frank zu. Doch dauerte es noch einige Jahre, bis 1976 sein erster Roman "Die Sprechpuppe" publiziert wurde. 1974 kehrte er – in der Voest-Affäre inzwischen voll rehabilitiert – nach Linz zurück. Er leitete verschiedene Referate (Gewaltreferat, Sittenreferat, Mordreferat), bevor er 1980 zum obersten Kriminalisten der Stadt ernannt wurde. Mit 59 Jahren ging er in Pension und zog in seine Wahlheimat Bad Ischl, wo er 2004 verstarb.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leo Frank-Maier
Ein Fall für das jüngste Gericht
Saga Egmont
Ein Fall für das jüngste Gericht
Copyright © 1987 by F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Copyright © 2017 Leo Frank-Maier og Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711518564
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Eine nicht alltägliche Geschichteaus dem Alltag eines Kriminalbeamten.
Am 23.6.84 wurde in Beirutein Mann erschossen: der Kriminal-Gruppeninspektor Gerhard Loitzenbauer von der Polizeidirektion Salzburg. Er war 46 Jahre alt.
Eine Woche später begruben wir ihn in einer kleinen Stadt in Oberösterreich. Wir, das waren seine Frau, sein Sohn und seine Freunde – fast durchwegs Kriminalbeamte.
Nachher trafen wir uns in einem Wirtshaus. Wir waren traurig und zornig. Zornig wegen der amtlichen libanesischen Erklärung über das Motiv dieses Mordes. Von einem Straßenraub war die Rede. Wir wußten es besser.
Es war schon spät, als mich meine Freunde fragten: »Machen wir was, Leo?« Ich hatte diese Frage erwartet, ja befurchtet. Ich war der Älteste von ihnen, damals noch aktiv im Range eines Obersten.
»Wir machen nichts«, entgegnete ich. »Denn davon wird unser Gert nicht mehr lebendig.«
Alle nickten.
»Dann schreib ein Buch über ihn«, schlug einer vor.
Dieses Buch ist ein Roman über ihn, eine erfundene Geschichte. Sie handelt von einem Kriminalbeamten, der in Ausübung seines Dienstes in Beirut erschossen wurde.
Die beiden fetten Weiber am Nebentisch lachten und kicherten unentwegt; es mußte sehr lustig sein, was sie sich da gegenseitig erzählten. Verstehen konnte Johann Bauer kein Wort, denn die beiden Blondinen sprachen schwedisch. Er war auch nicht neugierig. Er wartete hier auf Mechmed Khalil, der ihm Einzelheiten über einen Waffenschmuggel nach Wien mitteilen sollte. Er wartete schon eine halbe Stunde, aber was bedeutete denn Zeit in Beirut in diesen schwülen Septembertagen? Vor zwei Wochen hatten die Feuergefechte zwischen christlichen Milizen und palästinensischen Organisationen aufgehört, und im Café de Paris in der Rue Hamra war alles wie früher. Sogar die Touristen waren schon wieder da, wie sich am Nebentisch zeigte. Und auch die Menschen an den übrigen eleganten Marmortischchen der Kaffeehausterrasse schienen keine anderen Sorgen zu haben, als den bevorstehenden Abend möglichst angenehm zu verbringen.
Sorgen hatte Johann Bauer auch keine. Trotzdem war er mißmutig, ja fast depressiv, aber das hatte nichts mit Mechmed Khalil zu tun. Der Kerl war ihm ziemlich gleichgültig, und ob er in einer halben Stunde kam oder in einer Stunde oder gar nicht – was machte das schon aus?
Aber Johann Bauer hatte Heimweh.
Und im allgemeinen vermutet man das nicht bei einem neunundvierzigjährigen Kriminalbeamten, der seit neunundzwanzig Jahren im Dienst ist.
Warum eigentlich nicht?
Kriminalbeamte sind Menschen wie du und ich, und Johann Bauer tat jetzt schon mehr als zwei Jahre für die österreichische Botschaft Dienst. In seinem Diplomatenpaß stand die stolze Bezeichnung Attaché«, und in den ministeriellen Akten des Wiener Außenministeriums wurde er als »Sicherheitsbeauftragter« geführt. Beides war nur zum Teil richtig. Er hatte hier mit Leuten Kontakt zu halten und darüber Informationen nach Wien zu schicken, die man dort für wichtig hielt. Mit anderen Worten: Er machte die Drecksarbeit, für die sich »echte« Diplomaten zu schade waren. Weil sich doch auch schwerlich ein Botschaftsrat mit irgendeinem zwielichtigen Waffenschieber oder Terroristen im Café de Paris treffen und verhandeln kann. Das geht nicht.
Dazu hat man Kriminalbeamte. Und die müssen froh sein, wenn sie einen gutbezahlten Auslandsjob kriegen.
Er hatte sich auch darauf gefreut, damals vor zwei Jahren, der Kriminal-Gruppeninspektor Johann Bauer vom Referat »Gewaltdelikte« im Wiener Sicherheitsbüro. Aber zwei Jahre sind eine lange Zeit, und jetzt hatte er die Schnauze voll, wie man so schön sagt. Genau wußte er selber nicht, warum er jetzt von Monat zu Monat trübsinniger wurde, aber wahrscheinlich fehlte ihm ein Mensch, ein Freund. Denn keiner ist eine Insel, und er hatte hier wirklich niemanden, mit dem er hätte reden können.
Plaudern schon – aber nicht reden.
Immer öfter dachte er jetzt an seine Freunde im Sicherheitsbüro, Kriminalbeamte wie er. Man hatte dieselben Sorgen, dieselben Interessen. Das war es, was ihm hier fehlte. Diese Menschen vom Diplomatischen Corps waren anders, lebten in einer anderen Welt. In einer Welt, in der für ihn kein Platz war und die ihn auch nicht sonderlich interessierte.
Mechmed begrüßte ihn wie einen Lieblingsbruder,Johann Bauer war diese Art gewöhnt und spielte das orientalische Theater mit. Was blieb ihm sonst übrig? Er roch nach Schaschlik und Rasierwasser, der Mechmed, betrachtete interessiert die prallen Hinterteile der Schwedinnen vom Nebentisch und begann dann übers Wetter, über sein neues Auto und über die Weltpolitik zu plaudern. Der Abend dauerte ja noch lange. Nach etwa einer Stunde kam Mechmed zur Sache: Nur über die »Bonität« dieses Österreichers wollte Mechmed Khalil Bescheid wissen, über die »Bonität«. Er hatte dieses dumme Wort mindestens siebenmal wiederholt, und Johann Bauer hatte sehr genau verstanden. Das Ganze war für ihn eine Kleinigkeit und durchaus im Rahmen seines Aufgabenbereiches. Der Austausch solcher Informationen gehörte zu seinem dienstlichen Alltag, und geheime Nachrichtendienste, Terroristenorganisationen oder Untergrundbewegungen kümmern sich ja nicht gerade um Datenschutzgesetze, Amtsverschwiegenheit oder solche zivilisierten Einrichtungen. Auch über den Grund der Anfrage nach der »Bonität« hatte Johann Bauer seine fixe Vorstellung: Eine Unterorganisation der PLO wollte mit einem österreichischen Vermittler irgendein großartiges Geschäft abschließen, und natürlich wollte man jetzt wissen, ob man dem Geschäftspartner trauen konnte. Über die Art dieses Geschäftes hatte Mechmed Khalil kein Wort verloren, aber was sollte das schon sein…Waffen, Rauschgift oder Falschgeld. – Höchstwahrscheinlich Kriegsmaterial, denn all diese »Beffeiungs-« oder »Terrororganisationen« überboten einander ja mit der Beschaffung der modernsten Mordinstrumente, und dafür war den reichen arabischen Ölstaaten im Hintergrund keine Dollarmillion zu schade.
Alarmiert war Johann Bauer erst, als er den Zettel mit Namen und Adresse seines Landsmannes las. »Eurotrans«, stand da, »Ex- und Importbüro«, Inhaber Sebastian Suchy, Vienna, Seidelgasse 7. Er hatte Mühe, nicht laut herauszuplatzen und Khalil spontan zu sagen, daß er diesen Suchy für einen Betrüger, für einen Gauner hielt. Aber das wäre wohl taktisch ganz falsch gewesen. So steckte er den Zettel ein, machte ein wichtiges Gesicht und versprach, vertrauliche Informationen einzuholen. In etwa einer Woche könne man mit dem Resultat seiner Recherchen rechnen.
Das Resultat war jetzt gerade aus dem Dechiffrierzimmer der Botschaft gekommen, und Johann Bauer las es mit ungläubigem Staunen: »Keine Vorstrafen«, stand da, »guter Leumund und keine mitzuteilenden Polizeivormerkungen.«
Das konnte ja nicht wahr sein.
Einen Augenblick dachte er daran, daß es sich um zwei verschiedene Personen gleichen Namens handeln könnte, aber er verwarf diesen Gedanken sogleich wieder. Wer heißt schon Sebastian Suchy. Und die Adresse stimmte auch – soweit er sich erinnern konnte. Seine Erinnerung wurde immer deutlicher, je länger er über diesen Raubüberfall in der Seidelgasse Nummer 7 nachdachte:
Sie waren damals auf einer Erfolgswelle geschwommen, sein Kollege und Freund Micky Heidinger und er, beide junge Kriminalbeamte im Sicherheitsbüro, Referat »Gewaltdelikte«. Sie hatten den Ehrgeiz, nach Möglichkeit keine U.T.-Anzeigen schreiben zu müssen – das sind Anzeigen gegen unbekannte Täter –, und erstaunlich lange war ihnen dieses gelungen. So an die vier Monate. Der Polizeirat Dr. Hammerlang war voll des Lobes, und es gab Kollegen, die vor Neid platzten. Im Hauptdienst waren er und Micky damals gewesen, es war ein ruhiger Tag, und gegen 19 Uhr machten sie sich fertig zum Heimgehen, als der Polizeirat in ihr Zimmer kam. »Bewaffneter Raubüberfall, Seidelgasse Nr. 7«, sagte er nur. Anstatt nach Hause fuhren die beiden Kriminalbeamten zum Tatort.
Die Wohnung des Sebastian Suchy war zugleich sein Büro. Damals war es ein Büro für »Eheanbahnung und Kontaktfindung« gewesen, Johann Bauer erinnerte sich jetzt genau:
Als sie in diese Wohnung kamen, waren die Kollegen vom Erkennungsdienst schon an der Arbeit, fotografierten alles und suchten nach Spuren.
Das Opfer des Überfalles, eben der Sebastian Suchy, machte dem diensthabenden Journalbeamten des zuständigen Kommissariates seine Angaben. Ziemlich flüssig.
Der Journalbeamte war ein junger Oberkommissar und hatte sichtlich wenig Freude bei Erscheinen der beiden Kriminalbeamten vom Sicherheitsbüro. Er nickte nur kurz. Johann Bauer und Michael Heidinger hörten sich an, was passiert war:
So gegen 15 Uhr war Herr Suchy in sein Büro gekommen – wie jeden Tag. Die Raumpflegerin, eine ältliche Tante, war noch beim Staubsaugen. Nach einer halben Stunde etwa war sie fertig und ging.
Suchy erledigte seine Büroarbeiten, so sagte er. Gegen 17 Uhr klopfte es an der Tür. Er hoffte auf einen Kunden und rief »herein«.
Ein Maskierter betrat den Raum, Pistole im Anschlag, dunkle Jacke, dunkle Hose, dunkle Haare – alles dunkel also. Der arme Suchy mußte sich fesseln und knebeln lassen, wurde an einen Sessel gebunden und der Räuber durchsuchte das Büro. In einem Wandtresor fand er eine halbe Million Schilling in bar. Das Geld war dort für den Ankauf eines Grundstückes bereit gelegen. Sebastian Suchy wollte nämlich am Stadtrand ein Häuschen bauen.
Ein und eine halbe Stunde werkte der Gefesselte verzweifelt an den Stricken, bis er sich befreien und die Polizei anrufen konnte.
Der Oberkommissar war sichtlich beeindruckt.
Die Beamten des Erkennungsdienstes waren mit ihrer Arbeit fertig und gingen.
Johann Bauer wollte mitfühlend wissen, ob Sebastian Suchy gegen solche Schadensfälle wenigstens versichert wäre. Gott sei Dank, stellte sich heraus, er war versichert. Michael Heidinger steckte die Hände in die Hosentaschen und spazierte herum. Der Oberkommissar fragte höflich, ob Herr Suchy morgen aufs Revier kommen könnte, so gegen 9 Uhr. Seine Angaben würden dann zu Protokoll genommen werden. Sebastian Suchy versprach pünktlich zu sein.
Micky bekam einen Hustenanfall, aber niemand beachtete ihn, nur sein Freund Bauer. Hustend zwinkerte Micky zu einem Aschenbecher, in dem zwei Zigarettenkippen lagen. Hauchdünn konnte man daran Lippenstiftreste erkennen.
Johann Bauer fingerte eine Zigarettenpackung aus der Tasche, zündete sich einen Stengel an und hielt das Paket Sebastian Suchy unter die Nase: »Auf den Schrekken, Herr Suchy«, sagte er. Der wollte nicht. Er war leidenschaftlicher Nichtraucher.
Dann verabschiedeten sich die beiden Kriminalbeamten, und der Oberkommissar murmelte indigniert, daß dieses Sicherheitsbüro doch eigentlich ein Haufen von nutzlosen Wichtigmachern sei. »Schnappen wir uns dieses Arschloch noch heute …?« fragte Johann Bauer, als er und Micky im Auto saßen.
»Immer beim schwächsten Punkt anfangen., grinste Micky. Das war eine stehende Redewendung von ihm. »Immer beim schwächsten Punkt. Wir müssen seine Freundin ausforschen, und die knöpfen wir uns zuerst vor. Am besten morgen um neun, wenn der Suchy am Kommissariat seinen Schmäh zu Protokoll gibt.« Johann Bauer nickte zustimmend.
Für die beiden war es eine klare Sache, daß der Überfall fingiert war und ein Versicherungsbetrug vorlag. Die Freundin von Sebastian Suchy auszuforschen war wirklich kein Problem. Sie hieß Anita Pokorny und arbeitete als Fotomodell für eine Strumpfhosenfirma. Sie war sehr unangenehm überrascht, als ihr diese beiden Kriminalbeamten düster verkündeten, daß ihr Sebastian ein volles Geständnis abgelegt hatte: daß der Überfall fingiert war und die Versicherung hereingelegt werden sollte. Hatte er ihr doch noch heute früh eingeschärft, sich ja nicht zu verplappern.
So ein Trottel!
Die beiden meinten es gut mit ihr. Wenn sie alles genau so schildere, wie es gewesen war, könnte man eventuell von einer Anzeige wegen Beihilfe zum Betrug absehen. Was also blieb ihr anderes übrig? Sie erzählte alle Einzelheiten und war froh, als die beiden wieder draußen waren.
Sebastian Suchy hatte dem Herrn Oberkommissar am Kommissariat soeben den brutalen Überfall in allen Einzelheiten geschildert und unterschrieb gerade das Protokoll, als die beiden Kriminalbeamten eintraten. Er war sehr unangenehm überrascht, als sie ihm düster verkündeten, daß seine Anita ein volles Geständnis abgelegt hatte. Er konnte es zuerst gar nicht glauben, aber dann hielten ihm die beiden Einzelheiten vor, die wirklich nur er und Anita wissen konnten. Als die zwei dann auch noch einen Untersuchungsrichter anrufen wollten wegen eines Haftbefehles, gab er lieber alles zu. Damit wenigstens der Haftgrund der Verabredungsgefahr wegfiel und er nach Unterfertigung seines Geständnisses heimgehen durfte.
Etwa eine Woche später kam ein Beschwerdebriefeines Rechtsanwaltes ins Sicherheitsbüro. Der Herr Anwalt behauptete darin, daß in der »Causa Suchy« die erhebenden Kriminalbeamten die Bestimmungen der Strafprozeßordnung nicht eingehalten hätten. Johann Bauer und Michael Heidinger mußten sich schriftlich rechtfertigen. Sie tippten nur drei Zeilen. Sie hätten die Bestimmungen der Strafprozeßordnung sehr wohl eingehalten, schrieben sie. Dann hörten sie lange nichts von Suchy – erst wieder, als seine Verurteilung in den Zeitungen stand. Neun Monate auf Bewährung hatte er bekommen. Das Gericht hatte sein volles und freimütiges Geständnis als Milderungsumstand anerkannt.
Hans Bauer überlegte jetzt, ob er seinen Freund Micky anrufen sollte. Da stimmte doch irgend etwas nicht, Sebastian Suchy war unmöglich unbescholten und schon gar nicht vertrauenswürdig. Oder wollte jemand im Ministerium, daß dieses Geschäft mit der PLO zustande kam?
Möglich war alles. Er versuchte also zu telefonieren, aber die Leitung nach Österreich war wieder einmal dauerblockiert. So nach 22 Uhr wurde das erfahrungsgemäß besser. Er würde also versuchen, seinen Freund zu Hause zu erreichen, freute sich darauf, Mickys Stimme zu hören.
Gleichzeitig machte er sich Sorgen.
Vor zwei Wochen hatte er mit ihm zum letzten Mal telefoniert, ihn damals im Büro erreicht. Merkwürdig bedrückt hatte Mickys Stimme geklungen.
»Ist was mit dir, oder bist du nur besoffen?« hatte Hans gefragt.
Er wäre strohnüchtern, war Mickys verdrossene Antwort. Aber so eine beschissene Sache habe er am Hals, und darüber wolle er am Telefon gar nicht reden.
Das war außergewöhnlich. Denn normalerweise erzählten sich die beiden freimütig alles – auch am Telefon. Irgend etwas war los mit Micky. Vielleicht hatte er Schwierigkeiten mit Ruth, seiner Frau, dachte Johann. Solches hatte er schon seit langem befurchtet. Diese Frau aus Israel konnte sich in Wien einfach nicht zurecht finden. Wenn er Micky am Telefon erreicht hatte, wollte er ihn unumwunden danach fragen. Man hat schließlich Freunde, daß man sich gegenseitig hilft, und wenn es auch nur ein wohlgemeinter Rat oder ein mitfühlendes Wort sein kann.
»Ist was mit dir, Micky«, hatte ihn der alte Polizeirat fast besorgt gefragt. Das war vor einer halben Stunde, als sie nach dem Frührapport in ihre Büros gingen. Der Kriminal-Gruppeninspektor Michael Heidinger hatte keine Antwort gegeben, und so fragte der Polizeirat noch einmal. – »Was soll denn sein«, erwiderte Micky. Er sagte es leise und unwillig. Der Polizeirat meinte dann noch, daß in der »Sache Kupetzky« sicherlich »was drinnen ist«, und deutete auf den Akt, den Michael Heidinger unter der Achsel eingeklemmt hatte. »Das mach’ ich schon«, nickte der. Dann war man an seiner Bürotür angelangt. Heidinger ging rein und drehte das Licht an, denn es war dunkel an diesem regnerischen Montag. Er schloß die Tür, an der ein Schild mit der Aufschrift: Polizeidirektion wien, sicherheitsbüro. Referat A, Gewaltverbrechen, angebracht war. Irgendein Witzbold hatte mit Kugel-Schreiber »Scheiß-Bullen« daruntergekritzelt. Das war schon vor längerer Zeit gewesen und störte eigentlich niemanden. Am allerwenigsten den Gruppeninspektor Heidinger.
Vom Fenster seines Büros konnte man hinübersehen zum Donaukanal und in den zweiten Wiener Bezirk. Heidinger wohnte dort – in einem Gemeindebau, so einem Beamtensilo, wie die meisten seiner Kollegen. Etwa eine halbe Minute stand er am Fenster, sein Gesicht war so düster wie das Wetter. Vorhin auf dem Flur mit dem Polizeirat hatte er gelogen. Es war schon »was los« mit ihm. Seit Wochen dachte er daran, einen Menschen zu töten – nicht aus Mordlust, aus reinem Selbsterhaltungstrieb. Und solche Gedanken stimmen nicht gerade fröhlich, schon gar nicht einen Kriminalbeamten mit fünfundzwanzig Dienstjahren. Nach und nach kamen die Kollegen seiner Dienstgruppe herein. Sie sagten »Guten Morgen, Chef« oder »Guten Morgen, Micky«, je nach Alter. Als alle da waren, setzte sich Heidinger an seinen Schreibtisch und steckte sich eine Zigarette in den Mund, Inspektor Novotny gab ihm Feuer, er war der Jüngste der Gruppe. Heidinger deutete auf den Akt auf seinem Schreibtisch. »Alois Kupetzky«, stand im Betreff, »Verdacht des Mordes«. Alle wußten das, der Fall war ja beim Frührapport besprochen worden.
»Mit dem Sandler scheißen wir nicht lang herum«, stellte Heidinger fest.« Den nehmen wir auf die kurze Tour.« Alle nickten und murmelten zustimmend.
Der Sachverhalt schien klar:
Gestern – Sonntag – gegen 23 Uhr fanden Passanten auf einer Baustelle beim Floridsdorfer Bahnhof den 44jährigen Frührentner Josef Swoboda mit eingeschlagenem Schädel. Die Leiche war noch warm. Die Passanten waren eine Prostituierte und ein jugoslawischer Gastarbeiter, die sich dort in einer Bauhütte verkriechen wollten, weil es regnete. Die Kollegen des Kommissariates Floridsdorf waren am Tatort, stellten fest, daß der Swoboda mausetot war, veranlaßten dann das Übliche und fuhren wieder ins Kommissariat. Wahrscheinlich auch, weil es regnete. Eine Funkstreifenbesatzung kannte den Swoboda persönlich, ein lästiger, ständig randalierender Saufbold, und sie kannten auch sein Stammbeisel, das Gasthaus »Zum stillen Zecher«. Dort erfuhren die Kollegen, daß der Swoboda noch gegen 22 Uhr im Wirtshaus gewesen war und mit einem Freund, dem Alois Kupetzky, die Fürsorgerente versoffen hatte. Gemeinsam und mit einem Riesenrausch waren sie dann gegangen. Den Kupetzky holte die Funkstreife eine halbe Stunde später aus einem abgestellten Waggon am Bahnhof Floridsdorf heraus. Er war gerade am Einschlafen und redete nur wirres Zeug. An seinen Schuhen fanden sich Blutspritzer.
Wie schon gesagt, der Fall schien klar.
»Soll ich den Häftling holen«? fragte der junge Inspektor Novotny.
»In einer Viertelstunde«, murmelte Heidinger. »Ich geh’ vorher noch auf einen Kaffee in die Kantine.« In der Kantine roch es nach frischem Kaffee. Die meisten Kriminalbeamten gingen nach dem Frührapport noch rasch dorthin, wenn sie die Hauptdiensttour hatten. Der Rapport war täglich um 7.30 Uhr, und der Hauptdienst dauerte bis 19 Uhr. Ein langer Arbeitstag also, und den mußte man ja nicht gar so rasant angehen, wenn es nicht notwendig war. Einiges Gedränge herrschte an der Theke vor der Kaffeemaschine. Heidinger trat hinter die weibliche Kriminalbeamtin, Frau Inspektor Dorothea Hofer, er klopfte ihr auf den Po. »Bring mir einen mit, Dorli«, bat er, »schwarz und ohne Zucker.« Die Frau Inspektor nickte. Das wußte sie sowieso, daß Micky nie Milch und Zucker nahm, schließlich war sie schon zehn Jahre im Sicherheitsbüro.
»Hast du abgenommen?« fragte sie, als die den Kaffee zum Tisch brachte.
Michael Heidinger wußte es nicht. Er stellte sich nie auf eine Waage, Gewichtsprobleme hatte er keine. Sie tranken den Kaffee, und Dorli schimpfte eine ganze Weile auf den alten Polizeirat, weil der ihr beim Rapport wieder einmal einen 17jährigen weiblichen Häftling zugeteilt hatte. Das Mädel war in einem Kaffeehaus geschnappt worden, als es Haschisch-Zigaretten verkaufte. Ordentlich »eingeraucht« war sie auch. Die Frau Inspektor mochte diese Hasch-Fratzen nicht. »Diese Rauschkindergehören der Suchtgiftgruppe zugeteilt«, ärgerte sie sich. Aber der Polizeirat Hammerlang war da anderer Meinung, und wenn ein Häftling noch nicht 18 Jahre alt war, kriegte ihn die »Jugendgruppe«. – »Diese verflixten Gören gehören ordentlich in den Arsch getreten«, fluchte Dorli.
»Hör auf zu keifen«, murrte Heidinger verdrossen.
Sie redeten über andere Dinge. Über die letzten Personalvertretungswahlen und über andere belanglose Dinge. Die beiden mochten einander sehr gerne, obwohl sie noch nie etwas miteinander hatten – oder vielleicht gerade deshalb.
»Wie geht es dir daheim«, fragte Dorli.
Heidinger sah zum Fenster. Regen klatschte jetzt an die Scheiben. »So wie das Wetter«, antwortete er.
Den Häftling Alois Kupetzky hatte man mittlerweile in sein Büro gebracht. Jetzt saß er in einer Ecke, ohne Schuhe, die waren im Gerichtsmedizinischen Institut zur Untersuchung der Blutspuren. Ohne was zu sagen, deutete der Gruppeninspektor zuerst in die Ecke und dann in die Mitte des Büros. Seine Mitarbeiter wußten Bescheid. Sie setzten den Kupetzky jetzt auf einen Sessel in die Mitte des Raumes. Das wäre ja noch schöner, einen Mordverdächtigen bei einem Verhör in einer gemütlichen Ecke mit Rückendeckung sitzen zu lassen! Heidinger nahm einen zweiten Sessel, stellte ihn dicht vor den Häftling, verkehrt, die Lehne nach vorne. Hockte sich rittlings darauf und legte seinen Arm auf die Sessellehne.
Er begann sehr ruhig, fast freundlich. »Du mußt ja ein Volltrottel sein«, fing er an, »fünfmal hast du den angesoffenen Swoboda über den Schädel gehauen. Fünfmal!«
»Was …?« murmelte der Häftling erschrocken. Heidinger nahm ein Papier von seinem Schreibtisch, tat so, als ob er darin lesen würde. »Da«, sagte er jetzt laut, »der Obduktionsbefünd! Da steht es. Todesursache … Bruch der Schädeldecke nach fünf Hieben mit einem kantigen Gegenstand!« Er warf das Papier wieder auf die Tischplatte. Seine Kollegen hatten Mühe, nicht laut herauszulachen. Die Obduktion der Swoboda-Leiche war erst für den Nachmittag angesetzt und der Akt von Heidingers Schreibtisch war die Monatsabrechnung der Überstunden für Oktober. All das konnte Alois Kupetzky natürlich nicht wissen. »Fünfmal …?« stotterte er fassungslos. Er sah von einem zum anderen. Alle nickten grimmig. Jetzt kam Bewegung in den Kupetzky. »Ich schwör’s, Inspektor …!« schrie er, »einmal hab’ ich nur hingehaut! Nur einmal!«
Ungläubig schüttelte Heidinger den Kopf.
»Schrei nicht so herum«, meinte er gemütlich. »Wenn hier einer schreit, bin ich es. Wo hast du es hingeschmissen?«
»Was …? Hingeschmissen …?«
»Du weißt genau, was ich meine. Stell dich nicht so blöd.«
»Die Schaufel …?«
»Natürlich die Schaufel. Mit der du hingedroschen hast. Wo ist sie?«
Kupetzky leckte sich die Unterlippe. »Kann ich ein Bier haben?« bettelte er.
»Erst die Schaufel, dann das Bier.«
»Hinter einem Holzhaufen. Beim Bahnhof. Dort liegt sie.«
Heidinger stand auf.
Die Sache war gelaufen. Nur der Täter konnte das Tatwerkzeug kennen und über das Versteck des Tatwerkzeuges Bescheid wissen. »Wir fahren jetzt«, befahl er. »Du zeigst uns, wo die Schaufel liegt.« Dann wies er den jungen Inspektor Novotny an, noch einen Fotografen vom Erkennungsdienst zu verständigen und irgendwelche Pantoffeln für den Kupetzky zu besorgen. »Jawohl Chef«, bestätigte der junge Novotny eifrig. Es war sein erster Mordfall, und er wunderte sich, wie einfach und schnell alles so ging.
Am Tatort sollte Kupetzky ihnen zeigen, wo die Leiche gelegen hatte. Ganz genau wußte er es nicht mehr, und so halfen sie ihm ein bißchen. »Schön hinzeigen«, rief Heidinger, und Kupetzky folgte brav, der Kollege vom Erkennungsdienst blitzte mit seinem Fotoapparat – erstes Bild für die Tatort-Lichtbildmappe. Dann wurde es fast spannend, weil der Kupetzky den Holzstoß nicht gleich fand. Es waren mehrere solche Haufen von Bauholz da. Alle Kollegen waren erleichtert, als man endlich beim richtigen war. Sogar der Kupetzky. Er zeigte wieder artig auf die Schaufel, und der Erkennungsdienstler knipste von allen Seiten. Die Schaufel war noch blutig, trotz des Regens. Der junge Inspektor Novotny war fasziniert davon, wie zielstrebig seine älteren Kollegen am Werk waren. Anschließend schickten sie ihn um ein Bier für den Kupetzky, denn versprochen war versprochen. Und Heidinger war ja kein Unmensch, und das betonte er auch. Per Funk holte man die Gerichtskommission, und der ganze Vorgang wiederholte sich noch einmal vor den Herren Juristen. Als alles fertig war und man zu den Autos ging, hätte der Novotny am liebsten Beifall geklatscht. Aber das ging nicht, er mußte ja die Schaufel tragen: das Tatwerkzeug.
Ins Büro zurückgekehrt teilte Heidinger seine Leute für die Arbeit ein, die jetzt noch zu machen war: »Joschi und Karl, ihr schreibt das Geständnis. Novotny, du bringst ihn vorher noch zur Erkennungsdienstlichen Behandlung und zum Amtsarzt. Günter, du tippst den Bericht von der Rekonstruktion – genau schreiben, daß er uns freiwillig hingeführt hat, das Tatwerkzeug gezeigt hat, und vergiß nicht die Namen vom U-Richter und Staatsanwalt, … weißt ja eh …!« Die Kollegen sagten »o.k., Micky« und »Jawohl, Chef«, und dann ging Heidinger hinüber zum Polizeirat. Er meldete ihm die Klärung des Falles, und daß alles soweit in Ordnung sei. Dr. Hammerlang ließ sich die Sache kurz erzählen und war zufrieden. Das Motiv der Tat paßte ihm nicht ganz. Daß die beiden betrunken und in Streit geraten waren, schien ihm ein wenig dürftig, denn Kupetzky wollte sich nicht erinnern, warum sie eigentlich stritten. »Glaubst du ihm das?« fragte der Polizeirat. Micky Heidinger meinte, das glaube er ohne weiteres, bei diesen versoffenen Sandlern sei das nicht ungewöhnlich. Außerdem wäre es ja nicht gar so wichtig. Man hatte die Leiche, den Täter, das Tatwerkzeug, das Geständnis, Zeugen … was denn sonst noch? Hammerlang nickte. Er telefonierte dann mit dem Präsidenten wegen der Pressekonferenz.