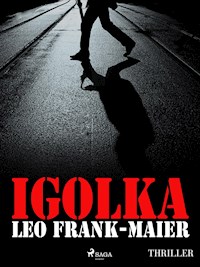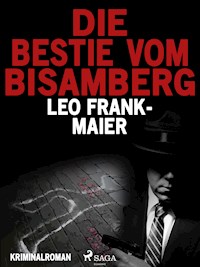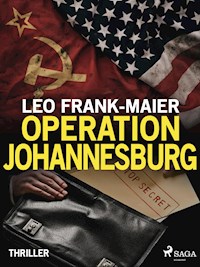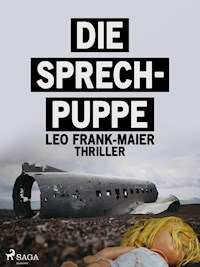Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
"Er sah unter den Bürotischen und -sesseln nur die Beine von vier Geiseln, durchwegs Frauen. Ein Beinpaar war ständig in leichter Bewegung, wahrscheinlich war die Dame nervös, Pierre konnte von Zeit zu Zeit ihr Unterhöschen sehen. Christin hatte gern diese Art von Unterwäsche getragen: Sieben reizende Dinger, in rosa oder blau, in allen Farben eben, und auf allen war der Wochentag gedruckt, von Montag bis Sonntag, praktisch. Man brauchte nur jeden Tag das passende auszusuchen. Ein Verkaufsschlager, damals als er Christin kennenlernte. Christin war damals ganz begeistert. Pierre erinnerte sich an die ersten Schwierigkeiten: Wenn Christin ihre Tage hatte, bevorzugte sie dunkle und stärkere Höschen. Dann kam der ganze Zeitplan durcheinander." Pierre Costeau, Kriminalbeamter im Sicherheitsbüro der Polizeidirektion Paris, hat im Moment eigentlich andere Probleme, als an die Unterhosen seiner verflossenen Frau zu denken. Ein maskierter Mann mit einer Maschinenpistole hat die morgendlichen Kunden und ein paar Bankangestellte der "Banc du National" als Geiseln genommen. Die "Rote Armee Fraktion" verlangt, dass ihre Forderungen im Radio verlesen werden. Zusammen mit Chefinspektor Trudeau ist es Pierre gelungen, in die Bank einzudringen. Während er hinter einem Schalterpult darauf lauert, im entscheidenden Augenblick eingreifen zu können, durchlebt er in Gedanken noch einmal die Geschichte seiner Ehe mit Christin, jener Christin Maginot, mit der er einmal so glücklich war. Ein spannender, fesselnder und ungewöhnlicher Kriminalroman, der auf zwei Ebenen abläuft, von denen eine packender ist als die andere!Leo Frank (auch Leo Frank-Maier, gebürtig eigentlich Leo Maier; 1925–2004) ist ein österreichischer Kriminalautor, der in seinem Werk die eigene jahrzehntelange Berufserfahrung als Kriminalbeamter und Geheimdienstler verarbeitet. In seiner Funktion als Kriminalbeamter bei der Staatspolizei Linz wurde Leo Maier 1967 in eine Informationsaffäre um den Voest-Konzern verwickelt. Man verdächtigte ihn, vertrauliches Material an ausländische Nachrichtendienste geliefert zu haben, und er geriet unter dem Namen "James Bond von Linz" in die Medien. Es folgte eine Strafversetzung nach Wien, wo er nach wenigen Monaten wiederum ein Angebot zur Versetzung nach Zypern annahm. Zwischen 1967 und 1974 war Leo Maier Kripo-Chef der österreichischen UN-Truppe in Nikosia. Auf Zypern begann er seine ersten Kriminalromane zu schreiben und legte sich den Autorennamen Leo Frank zu. Doch dauerte es noch einige Jahre, bis 1976 sein erster Roman "Die Sprechpuppe" publiziert wurde. 1974 kehrte er – in der Voest-Affäre inzwischen voll rehabilitiert – nach Linz zurück. Er leitete verschiedene Referate (Gewaltreferat, Sittenreferat, Mordreferat), bevor er 1980 zum obersten Kriminalisten der Stadt ernannt wurde. Mit 59 Jahren ging er in Pension und zog in seine Wahlheimat Bad Ischl, wo er 2004 verstarb.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leo Frank-Maier
Die 13 Stunden der Christin Maginot
SAGA Egmont
Die 13 Stunden der Christin Maginot
Copyright © 1980 by F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Copyright © 2017 Leo Frank-Maier og Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711518588
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
I
Bevor er überhaupt richtig wach wurde, seine Augen öffnete, wußte er schon, daß er wieder einmal neben ihr lag. Neben dieser dicken Kellnerin Margot. Er konnte es riechen.
Und er wußte, daß es ein übler Tag werden würde, wie meistens. Und dieses Mal ganz speziell sollte er recht behalten. Es war fünf Uhr.
Fünf Uhr morgens also, und er rührte sich nicht, weil er Angst hatte, sie zu wecken. Sein Kopf schmerzte und seine Tochter fiel ihm ein, sie hatte sicher auf ihn gewartet und auf ihre Puppe, die er mitbringen hätte sollen. Statt dessen hatte er bis 23 Uhr im ›Domino‹ gesoffen und war dann mit Margot ins Bett gefallen. Margot war die Kellnerin im ›Domino‹, was sonst.
Wenn er sich rührte, würde sie aufwachen. Wenn sie aufwachte, würde sie ihn anfassen und fragen: Was ist? Sein Kopf brummte, und er sah schuldbewußt die hellblauen Augen seines Kindes. Am liebsten hätte er in diesen dicken Arsch getreten und wäre davongerannt. Aber er zog nur die Knie hoch und Margot wurde wach, faßte ihn an und fragte: »Was ist?«
»Rien ne va plus«, sagte er. »Nichts geht mehr.«
Dann stand er auf und verlangte Kaffee. Die erste Zigarette schmeckte wie verbrannte Schuhsohlen.
Punkt sieben Uhr dreißig war er beim Frührapport im Sicherheitsbüro, war rasiert und roch nach Margots scheußlichem Parfüm. Immerhin hatte er die Zähne geputzt. Und daß Unterwäsche und Hemd die gleichen wie vom Vortag waren, merkte hier ja sowieso niemand.
Er hieß Pierre Cousteau und war Kriminalbeamter im Sicherheitsbüro der Polizeidirektion Paris. Er war jetzt vierzig und sah auch aus wie vierzig. Er war 1,80 groß und spielte noch Fußball in der Kripo-Mannschaft wie ein Dreißigjähriger. Wenn er nicht Fußball spielte und seiner Tochter Geschichten erzählte, sie ins Bett schickte und dann sein Bier trank, fühlte er sich wie hundertzwanzig. Der Frührapport an diesem 28. April 1978 war eine matte Sache, wie meistens. Beim »großen Frührapport« vor allen Beamten des Sicherheitsbüros verlas und verlautbarte der diensthabende Chefinspektor die wichtigsten Vorkommnisse der vergangenen Nacht und was ihm sonst noch wichtig schien. Für die Kriminalbeamten war das ziemlich uninteressant. So glotzten sie gelangweilt, in der ersten Reihe die Gruppenführer, weiter hinten die Stellvertreter und älteren Sachbearbeiter und dahinter die jüngeren und ganz jungen. Inspektor Pierre Cousteau saß etwa in der Mitte.
Der »große Rapport« dauerte fünf bis zwanzig Minuten, je nachdem, welcher Chefinspektor Hauptdienst hatte. Der alte Trudeau brauchte nie länger als fünf Minuten, manchmal nur drei. Heute war Chefinspektor Pasquale dran. Pierre Cousteau machte sich auf eine Viertelstunde gefaßt. »Du Schwein stinkst nach Parfüm wie eine Laternenhure«, flüsterte ihm sein Nachbar zu. »Leck mich«, gab Pierre zurück. Chefinspektor Pasquale redete gerade eindringlich über immer wieder vorkommende Unzulänglichkeiten bei der Handhabung der Fahndungsvorschrift.
»Bei abgängigen Jugendlichen immer Formular C ausfüllen. Dreifach«, rief er, »das kann doch nicht so schwer sein, dreifach, ein Durchschlag muß ans Jugendgericht.« In der ersten Reihe nickten zwei Gruppenführer.
Einer gähnte.
Chefinspektor Pasquale verlas nun den Tagesbericht. Im zehnten Distrikt war ein Juweliereinbruch mit einer Schadenssumme von 170 000 Franc angefallen. Ganz ordentlich. Referat C war zuständig. Im Quartier Latin waren 14 Autos aufgebrochen worden. Besitzer zumeist Ausländer, Touristen. Zwei Raubüberfälle auf Prostituierte beim Gare du Nord. Das mußte die Hauptdienstgruppe pakken. Pierre hatte Beidienst. Ein unbekannter Toter war angefallen, in einer öffentlichen Toilette am Place Pigalle. Keine Spuren äußerer Gewaltanwendung. Keine Ausweispapiere. Pierre Cousteau blickte finster. Wenn er Pech hatte, kriegte er den Toten. Das war Sache des Referats A. Hing von dem alten Chefinspektor Trudeau ab. Wie vermutet, der »große Rapport« von Pasquale dauerte eine geschlagene Viertelstunde. Die Kriminalbeamten beeilten sich anschließend, in die Zimmer der Referatsleiter zu kommen. Dort wurden die angefallenen Akten zugeteilt. Inspektor Pierre Cousteau hoffte, den unbekannten Toten vom Scheißhaus würde jemand anderer kriegen. Es war eng in dem Zimmer und alle Kriminalbeamten mußten stehen, nur der alte Trudeau saß an seinem Schreibtisch, seine Brille auf der Nase und die Akten vor sich, die er nun aufzuteilen hatte. Pierre sah den roten Stempel »Leiche« auf dem Akt, in dem der Chefinspektor gerade blätterte, und befürchtete Schlimmes. Zu seiner großen Erleichterung begann Trudeau jedoch zu knurren, daß heutzutage offenbar niemand mehr die Akten ordentlich lesen würde. Das ging natürlich gegen Pasquale. Auf Seite drei stünde laut und deutlich, daß der Tote eine Injektionsspritze in der Rocktasche hatte. Und Einstiche in der linken Armbeuge hatte der Amtsarzt auch festgestellt. Ein Fixer also. Und eine klare Sache für die Suchtgiftgruppe. Der Chefinspektor strich den Vermerk »Referat A« neben dem Eingangsstempel durch und schrieb genüßlich »Referat B« hin. Pierre nickte zufrieden. Diese Sorge war er los.
Die Akten waren aufgeteilt, und die Kriminalbeamten trollten sich auf ihre Zimmer. Pierre Cousteau war zufrieden. Er hatte zwei »Psychosen« und einen Selbstmordversuch zugeteilt bekommen. »Psychosen« nannte man jene Fälle, wo jemand durchgedreht hatte und schließlich in die Nervenheilanstalt eingeliefert werden mußte. Es war dann festzustellen, ob Fremdverschulden vorläge. Das war selten der Fall. Soweit Pierre am Weg zum Lift in den Papieren blätternd feststellen konnte, war beide Male Volltrunkenheit die Ursache. Also kein Fremdverschulden. Im Lift sah er, daß der Selbstmordversuch nach Einnehmen von Schlaftabletten in St. Denise passiert war. Die Patientin war außer Lebensgefahr. Ein zwanzigjähriges Mädchen. Chronische Depressionen stand in dem Akt. Schon der dritte Versuch. Der Magen war ihr ausgepumpt worden. Das war für Inspektor Cousteau recht erfreulich. Er brauchte den Akt nur zwei Tage liegen lassen. Wenn er dann das Krankenhaus anrief, war die Patientin sicherlich schon entlassen. St. Denise war Gendarmerierayon und er würde den Akt zuständigkeitshalber an den Gendarmerieposten St. Denise abtreten. Die Patientin war im Krankenhaus nicht vernehmungsfähig, würde er dazuschreiben. Pierre war also zufrieden, er konnte seine Beidiensttour nach menschlichem Ermessen ohne größere Schwierigkeiten abbiegen. Für eine echte Arbeit hatte er heute keine Lust. Wirklich nicht. Alles, was er im Augenblick hatte, war ein heftiges Verlangen nach heißem schwarzem Kaffee.
Ähnliche Gefühle hatte Chefinspektor Marcel Trudeau, nachdem seine Kriminalbeamten das Zimmer verlassen hatten. Er füllte noch die Dienstlisten aus, zwei Krankmeldungen, das ging gerade noch. Dann würde er den Akt von der Leiche in der Toilette vom Place Pigalle ins Referat B bringen und in die Kantine gehen. Er zündete sich eine Gauloise an und brummte zufrieden.
Der alte Chefinspektor Marcel Trudeau sah aus, als ob er schon immer alt gewesen wäre. Tatsächlich konnte sich im Sicherheitsbüro kaum jemand erinnern, den alten Trudeau anders gesehen zu haben als in dunklen, grauen Anzügen mit Weste, und immer schon hatte sein Haar die Farbe seiner Anzüge und der Rockkragen war voll von Schuppen und sein Schnauzbart war angesengt. Das kam von den filterlosen Zigaretten, die er nie aus dem Mund nahm. Auch nicht beim Reden. Den alten Trudeau mochten alle im Haus gerne, bis auf die Chefsekretärin, der er manchmal seine Berichte diktierte. Sie klagte, der alte Trudeau wäre beim Diktat kaum zu verstehen und im übrigen stinke er wie ein Bockstall. Aber das war sicherlich übertrieben. Nach Veilchen roch er ja gerade nicht, eher nach einem Aschenbecher. Doch hätte die Putzfrau bezeugen können, daß er sich täglich mehrmals die Hände wusch und grantig wurde, wenn kein frisches Handtuch da war.
Er war schon auf dem Weg zur Tür, den Akt mit dem roten Stempel »Leiche« in der Hand, als das Telefon läutete. Eine Sekunde zögerte er, drehte sich brummend um und hob ab.
Es war sieben Uhr fünfzig, als Pierre Cousteau seine Akten auf den Schreibtisch schmiß – die zwei Psychosen und den Selbstmordversuch – und sich eine Zigarette anzündete. Um acht Uhr würde die Kantine aufsperren, und da gab es Kaffee. Sein Zimmerkollege blickte grantig. Oberinspektor Matisse, ein älterer Beamter, hatte vor zwei Jahren einen Herzinfarkt gehabt. Seither durfte er nicht mehr rauchen. Und sollte auch rauchige Zimmer meiden. Deshalb hatte er keine reine Freude mit Pierre, den er sonst aber gerne mochte.
»Ich geh schon«, sagte Pierre mit der brennenden Zigarette im Mund, »ich geh ja schon.« Eine Sekunde dachte er daran, bei sich zu Hause anzurufen und Madame Croix zu fragen, ob mit seiner Tochter alles in Ordnung wäre. Die Kleine war sicher schon auf dem Weg zur Schule und Madame Croix führte seinen Haushalt, seit Christin weg war. Madame Croix war seine Nachbarin und sicherlich würde sie wieder keifen und fragen, wann er endlich wieder einmal nach Hause käme. Zu einer rechtschaffenen Zeit. Und was mit der Puppe seiner Tochter sei.
»Ich geh schon, Alter«, sagte er zu Matisse. Er würde die Croix später anrufen. »Klappe 451«, sagte er. Höchst überflüssig. Matisse wußte ohnehin, wohin er ging. Klappe 451 war der Telefonanschluß der Kantine.
Er war auf dem Weg zum Lift, als er plötzlich das Gefühl hatte, er hätte doch Madame Croix anrufen sollen, seine Nachbarin. Diese Sache mit der Puppe, er würde das ganz sicher heute erledigen, ganz sicher. Was sollte die Kleine schließlich von ihrem Papa denken. Es war eine Sprechpuppe, aber das Ding konnte nicht mehr sprechen. Die Batterie war in Ordnung, aber sonst irgendwas war kaputt, wenn man den Schalter umdrehte, krächzte es nur. Die Dicke in der Puppenklinik sagte eiskalt, es würde 20 Franc kosten und drei Tage dauern, die Techniker wären überlastet. Er zahlte 10 Franc Anzahlung und erhielt einen Zettel mit einer Nummer. Das war vor einer Woche gewesen.
Christin hatte die Puppe seinerzeit gekauft. Wahrscheinlich hing das Kind deshalb so daran. Am dritten Tag begann seine Tochter zu fragen, was mit ihrer Puppe wäre. Er hatte das Ding vergessen und erzählte irgendwas. Er sah in die Augen seines Kindes und begann zu stottern und versprach schließlich, die Puppe am nächsten Tag zu bringen. Am nächsten Tag hatte er Hauptdienst und um 17 Uhr fiel ein Raub an, der alte Trudeau hatte ihn hinausgeschickt. Eine Prostituierte war beraubt worden. Rita Kuhn, 19 Jahre. Pierre Cousteau kannte sie, hatte schon mit ihr zu tun gehabt. Dienstlich natürlich. Irgendein Idiot hatte den großen Chef gespielt und bei Rita abkassiert, sie zusammengeschlagen und das Geld genommen. 1000 Franc, zwei Tageslosungen. Pierre hatte bis 23 Uhr mit ihrem Zuhälter gesprochen, dem widerlichen Schnurrbart-Pepe. Das war die einzige Chance, den Fall zu klären. Schnurrbart-Pepe strampfte ein bißchen, aber brachte brav am nächsten Tag den heißen Tip. Schnurrbart-Pepe wollte um alles in der Welt nur ja kein Konfident der Polizei sein. Um Gottes willen, da wäre er ruiniert! Aber der Tip war in Ordnung und Pierre Cousteau nahm den Mann fest, der dann zwei Stunden blöde herumredete, aber nach einer Wahlkonfrontation ein Geständnis ablegte. Rita hatte sofort auf ihn gezeigt: »Das ist das Schwein.« Es wurde spät, bis der Akt fertig war und die Puppenklinik war natürlich geschlossen. Pierre Cousteau erzählte seiner Tochter die wundersamsten Lügen und versprach, die Puppe aber ganz, ganz bestimmt am nächsten Tag zu bringen.
Das war vorgestern gewesen.
Im Lift auf dem Weg zur Kantine traf er zwei weibliche Kriminalbeamte vom Sittendezernat. Referat B. Sie fuhren bis in den vierten Stock, also ins Paßamt. Pierre hatte artig guten Morgen gesagt und den Rauch seiner Zigarette in eine Ecke geblasen. Und er hatte sehr wohl die vieldeutigen Blicke bemerkt, die sich die Kolleginnen zuwarfen. Blöde Gänse! Was soll’s. Er drückte den Knopf zum Erdgeschoß, zur Kantine.
»Er hat ein gestörtes Verhältnis zu den Frauen«, tuschelte man in seiner Umgebung. Natürlich hörte er davon, beziehungsweise wurde es ihm hinterbracht. Wie das so ist. Das aber war reiner Blödsinn und zuerst reagierte er wütend. Aber diese Reaktion blieb im wesentlichen bei ihm, sie war sozusagen nur innerlich, nach außen grinste er nur und winkte müde ab, was sonst hätte er tun sollen.
Das angeblich gestörte Verhältnis zum weiblichen Geschlecht war wirklich blanker Unsinn, niemand wußte das besser als er selbst. Jedoch konnte er sich auch vorstellen, wie dieses Gerede entstanden war. Denn eines war richtig, er hatte ein gestörtes oder besser gesagt außerordentliches Verhältnis – nicht zu den Frauen – nur zu einer Frau. Zu seiner Frau.
Das aber war den Menschen seiner Umgebung nicht so ohne weiteres zu erklären und auch schwer begreiflich zu machen. So versuchte er es gar nicht erst.
Als sie ihn endlich verließ, seine Frau, als sie endlich ihre tausendfachen Drohungen wahr machte und ihre Koffer packte und wegflog, damals war er in einer Art Alkohol-Trance gewesen. Sie flog nach den USA, nach Pittsburg, er bezahlte die Flugkarte und wünschte ihr alles Gute. In Pittsburg lebte ihr Bruder, sein Schwager, den er gerne mochte. Und ihr ehemaliger Liebhaber, den er verabscheute. Er bezahlte also die Flugkarte und zusätzlich 500 Franc für ihr Übergepäck – es war sein letztes Geld – und er lächelte und wünschte ihr alles Gute. Das war fast auf den Tag genau vor einem Jahr gewesen.
Geblieben waren ihm Schulden, eine Wohnung, die er allein der Erinnerung wegen am liebsten angezündet hätte, und seine siebenjährige Tochter, sein Liebling, die immerfort nach der Mama fragte und die er täglich mit neuen, großartigen Geschichten belog. Und er wunderte sich wirklich, daß dieses Fragen nach dem Verbleib der Mama nie aufhörte und daß seine phantastischen Geschichten immer phantastischer wurden. Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte der Kleinen von Anfang an die Wahrheit gesagt. Aber wer kann das schon. Wer kann schon in himmelblaue Kinderaugen sagen: »Unsere Mama hat uns verlassen, sie will nichts mehr wissen von uns.« Wer kann das schon! Pierre Cousteau konnte es jedenfalls nicht.
Die Kantine war zu klein für das Sicherheitsbüro, viel zu klein, das sagten alle. Die Kaffeemaschine war zwar schon eingeschaltet, aber noch nicht richtig heiß, es war noch ein paar Minuten zu warten. Es gab nur einen Telefonanschluß – eben die Klappe 451 – und wenn man anrufen wollte, war fast immer besetzt, denn dauernd hing jemand am Hörer. Es wurden ständig Kriminalbeamte der Hauptdienstgruppe gesucht und wenn sie nicht auf ihren Zimmern waren, konnten sie nur in der Kantine sein. Denn im Hauptdienst war permanente Erreichbarkeit oberstes Gebot. Im Augenblick telefonierte Madame Brunhild, die Pächterin der Kantine. Sie gab irgendeine Warenbestellung durch und hielt einen Zettel in der Hand, eine Liste. Es war ein ziemliches Gedränge um die Bar und Madame Brunhild schrie: »Ruhe, seid doch nicht so laut.« Sie gab weiter ihre Bestellung durch. Die Kaffeemaschine begann zu zischen und zu dampfen, gleich würde es soweit sein. Das mußte man ihr lassen, der Madame Brunhild, für Ordnung sorgte sie in der Kantine. Und für Sauberkeit. Und immer war ihr weißer Geschäftsmantel blütenrein und frisch gebügelt.
Die Kriminalbeamten unterhielten sich leiser, sie hatten die Hände in den Taschen und die Schultern hochgezogen, es war ziemlich frisch in der Kantine, um nicht zu sagen saukalt, denn die Heizung war auch eben erst eingeschaltet worden.
Der Kaffee war ordentlich heiß. Pierre Cousteau wartete, bis die Kollegen vom Hauptdienst alle ihre Tassen hatten, denn die mußten ja gleich wieder weg. Pierre hatte keine Eile. Er setzte sich dann auch an einen Tisch und schlürfte den Kaffee im Sitzen, langsam, man mußte sich ja nicht den Schnabel verbrennen. Die Tasse war noch halbvoll, als er seinen Namen schreien hörte. Es war Matisse. »Bankalarm«, sagte Matisse dann noch laut und es wurde ganz ruhig in der Kantine.
Pierre sah Matisse und wußte, das war kein blöder Scherz, schließlich schrieb man den achtundzwanzigsten und nicht den ersten April. Welche Idioten überfallen eine Bank um acht Uhr früh und nicht vor Schalterschluß, dachte er, Matisse hatte ein Lederholster in der Hand, mit Pistole, es war Pierres Dienstwaffe. Er warf das Ding auf das Tischchen, die Tassen schepperten. »Mach schnell, Pierre«, sagte er, »der Alte wartet auf dich im Einsatzwagen. Die anderen sind schon unten im Hof.«
Pierre verbrannte sich nun doch den Mund mit dem heißen Kaffee. Er fluchte und verschluckte sich und mußte husten, rannte mit dem Holster in der Hand zum Aufzug. Die anderen sahen ihm nach, die meisten grinsten schadenfroh und Matisse bestellte sich einen heißen Tee. Kaffee sollte er nicht mehr trinken wegen des überstandenen Herzinfarkts. »Welche Idioten überfallen eine Bank um acht Uhr früh und nicht vor Schalterschluß«, fragten zwei Kriminalbeamte vom Jugendreferat gleichzeitig, aber Matisse hob nur die Schultern hoch und meinte: »Den Tee mit Milch, bitte, Madame Brunhild.«
Madame Brunhild schepperte mit Tassen und wollte wissen, ob Chefinspektor Trudeau wirklich mit zur überfallenen Bank fahre.
»Natürlich«, nickte Matisse, »kennst ja Papa Trud.« Und Madame Brunhild servierte den Tee mit Milch und meinte, in seinem Alter wäre es gescheiter, in einem Park die Tauben zu füttern.
Pierre hatte vor der Aufzugtür seinen Rock ausgezogen und zwischen die Knie geklemmt, dann schnallte er das Holster mit der Pistole um. Im Lift zog er den Rock wieder an, lief dann über den Hof zu den Einsatzwagen und sah mit einem Blick, daß er tatsächlich der letzte war.
Es waren vier Citroën hintereinander abgestellt, die Motoren liefen und die Blaulichter waren eingeschaltet. Die Fahrzeuge waren voll von Kriminalbeamten des A-Referates, im ersten Auto erkannte Pierre den alten Trud neben dem Fahrer, eine rückwärtige Tür stand offen. Pierre ließ sich hineinfallen und der Fahrer schmiß die Tür zu. Es waren Petit und Brune, die neben ihm saßen und zusammenrückten.
»Na endlich«, sagte der alte Trudeau und dann sagte er noch etwas, was Pierre nicht verstehen konnte, weil der Wagen losfuhr und die Sirenen aufheulten. »Scheiße mit der ruhigen Beidiensttour«, brüllte ihm Petit in die Ohren, das verstand Pierre zwar, aber es interessierte ihn nicht. Er lehnte sich vor und schrie: »Pardon, Chefinspektor, ich hab Sie nicht verstanden!« Und der Chefinspektor drehte seinen Kopf nach hinten und sagte nicht einmal allzu laut: »Du stinkst wie ein Puff.« Diesmal konnte Pierre verstehen.
Es war eine Filiale der »Bane du National« in der Rue Arcade, vis-à-vis vom Hotel Arcade. Ein maskierter Mann mit Maschinenpistole hatte gleich nach dem Aufsperren die ersten Kunden und ein paar Bankangestellte zusammengetrieben, hatte dann die fixierten Kameras in der Schalterhalle heruntergeschossen, bevor noch jemand den Bankalarm auslösen konnte. Dann ließ er eine Geisel frei, eine Frau, die auf der Straße fast in Ohnmacht fiel und dem ersten eintreffenden Polizisten die Nachricht übermittelte, der Gangster wäre von den »Roten Brigaden« und erwarte einen Unterhändler der Regierung. Sollte niemand kommen, erschießt er alle Viertelstunde eine Geisel. Dann fiel die Frau tatsächlich in Ohnmacht. Das alles hörte Pierre von Petit in den nächsten Minuten, und sein Trommelfell schmerzte. Dann quietschten die Bremsen, und Pierre flog fast auf den Fahrersitz. Man war in der Rue Arcade.
Die Tür des Bankhauses war geschlossen, es war ein Glasportal. Die uniformierten Kollegen hatten das ganze Gebäude umstellt, die Straßen abgesperrt und den Verkehr umgeleitet. Die Polizisten hatten alle Hände voll zu tun, um die Neugierigen und Gaffer abzuwehren und nur mühselig konnten sie für das Einsatzfahrzeug den Weg frei machen.
Vor dem Eingang zur Bank, dieser geschlossenen Glastüre, stand der Offizier vom Dienst, ein Major. Pierre kannte ihn vom Sehen, von der Kantine. Ein paar Polizisten schrien unentwegt in die Sprechfunkgeräte, ein paar aufgeregte Zivilisten standen neben ihnen, der Direktor der Bank und sein Prokurist und noch ein paar Bankmenschen, wie sich herausstellte. Pierre war als erster aus dem Fahrzeug, er half dem Chefinspektor beim Aussteigen. Der alte Trud schnaufte ärgerlich und murmelte was von Scheißdingern, womit er die Sicherheitsgurte meinte. Dann ging Papa Trudeau langsam zu dem Major und zündete sich eine Zigarette an. Der Major salutierte und sagte etwas, was Pierre nicht verstehen konnte, weil ein Polizist neben ihm ins Funkgerät brüllte, es müßten unbedingt kugelsichere Westen herangebracht werden. »Natürlich sofort«, schrie der Polizist ärgerlich und meinte dann noch, in der Waffenkammer müßten allesamt Idioten sein. Es war gerade, als der Fahrer Pierre zurief, was mit ihm sei, ob er das Einsatzfahrzeug stehen lassen oder um eine Ecke parken sollte, als die ersten Schüsse fielen.
Es war ein kurzer Feuerstoß aus einer Maschinenpistole. Pierre lag flach im Rinnsal, bevor er denken konnte. Der Polizist mit dem Funkgerät neben ihm. »Das Schwein schießt jetzt«, schrie der Polizist, höchst überflüssig, wie Pierre denken mußte.
Glas splitterte. Der Fahrer gab Gas und der Wagen quietschte um die Ecke. »Also gut«, hörte Pierre den alten Trud sagen, »also gut, besorgen sie mir einen Lautsprecher.«
Der Major kniete neben der Eingangstüre, die nun ein paar Löcher und Sprünge hatte. Die Löcher lagen ziemlich hoch, weit über Kopfhöhe und Pierre dachte, daß eigentlich niemand getroffen sein könnte. »Ein Megaphon«, schrie nun der Major, und ein paar Polizisten brüllten es nach: »Ein Megaphon, schnell ein Megaphon!« Es dauerte aber trotz der Brüllerei drei oder vier Minuten, bis ein ganz junger Polizist mit so einem Ding angerannt kam. Chefinspektor Trudeau stand neben der Tür, mit dem Rücken zur Hauswand, und saugte an seiner Gauloise. Pierre sprang auf und stellte sich neben ihn, er hatte plötzlich seine Pistole in der Hand und wußte nicht, wann er sie gezogen hatte.
»Es sind circa zwölf Zivilisten drinnen«, rief der Major. »Nein, mindestens zwanzig«, schrie der Bankdirektor, der weiter weg neben der Hausmauer kniete. »Mindestens zwanzig, davon die Hälfte Frauen. Kunden und Bankangestellte!«
»Aha«, sagte der alte Trud.
Sie gaben ihm das Megaphon und der Chefinspektor spuckte seine Zigarette aus.
Ein Polizist kam in langen Sprüngen über die Straße, als ob er eine ganz wichtige Meldung hätte. »Der Vizepräsident wird in zehn Minuten eintreffen«, schrie er, als er in Hörweite war.
Der Chefinspektor murmelte etwas von »Kraut fett machen«. Pierre hatte das Gefühl, daß jetzt niemand recht wußte, wie es weitergehen sollte. Außer dem alten Trud vielleicht. Aber der sah gerade so abwesend drein, als ob er über etwas ganz Kompliziertes nachdenken müßte. Über ein Schachproblem oder den Sinn des Lebens oder über den richtigen Tototip für nächsten Samstag. Dann fragte Trudeau plötzlich laut: »Ist die Tür versperrt?« Eine Sekunde lang wußte niemand, was er meinte. Es war der Major, der als erster rief, die Tür wäre versperrt, und der Direktor rief dazwischen, er habe persönlich abgesperrt, als der Gangster die Leute zusammentrieb und noch ein Bankmensch rief etwa dasselbe.
»Dann sperrt sie auf«, sagte der alte Trud.
Es dauerte eine Weile, bis ein Schlüsselbund klimperte. Sie gaben dem Major die Schlüssel und der stellte sich so neben die Tür, daß er nicht getroffen werden konnte und sperrte auf. Pierre hörte das Schloß schnappen.
Der alte Trud kramte umständlich unter der linken Achselhöhle und zog dann seine Dienstpistole heraus und gab sie Pierre. »Paß gut auf darauf«, sagte er und grinste. »Also dann«, sagte er noch mehr zu sich selber und bückte sich schwerfällig nach dem Handlautsprecher. Und alle sahen wie gebannt diesem alten Mann zu.
Noch nie zuvor war Pierre der Chefinspektor so alt und umständlich erschienen. »Du bleibst hier, Pierre«, hörte er ihn noch sagen. Dann ging Chefinspektor Marcel Trudeau langsam in das Bankgebäude, umständlich und ruhig, als ob er eben in sein Stamm-Bistro ginge, in den ›Blauen Papillon‹ am Montmartre.
Es wurde ganz ruhig vor dem Bankeingang, als man von drinnen den Lautsprecher hörte. Gedämpft aber doch deutlich war zu verstehen, als Trudeau zweimal sagte: »Achtung, hier spricht die Polizei.« Man konnte sich vorstellen, wie er die lange Schalterhalle langsam nach innen ging.
»Hier spricht die Polizei, Chefinspektor Trudeau. Ich bin unbewaffnet. Machen Sie keinen Blödsinn, und hören Sie auf zu schießen.«
Es klang für Pierre irgendwie beruhigend, er hatte das Gefühl, wenn Papa Trud sagte, aufhören zu schießen, dann wird auch aufgehört. Eine Weile war Ruhe. Pierre hörte das Keuchen des Majors und weiter entfernt den Lärm der Menschenmenge und das Schreien und Fluchen der absperrenden Polizisten.
»Ich bin unbewaffnet, ich will mit Ihnen verhandeln. Sagen Sie mir Ihre Bedingungen, aber hören Sie auf zu schießen. Wenn den Zivilisten bei Ihnen etwas passiert, wird nicht verhandelt. Verstehen Sie?« Es klang entfernter. Papa Trudeau mußte etwa in der Hälfte der Schalterhalle sein.
Du bleibst hier, Pierre, hatte der alte Trud gesagt. Pierre stand noch immer da wie angeschissen, die beiden Pistolen in den Händen. Die Tür stand offen. Du bleibst hier? Das war doch Wahnsinn. Wenn der Irre auf Papa Trud …
In einer Sekunde schlüpfte Pierre in das Bankinnere, lief ein paar Schritte und ließ sich neben dem Schalterpult fallen. Es war das erste Mal seit zehn Jahren, daß Pierre nicht das tat, was der Chefinspektor anordnete.
Es fiel ihm ein, daß er ja schon einmal da gewesen war. Natürlich, damals war er auch im Hauptdienst und weil vom C-Referat keiner mehr da war, schickten sie ihn her, von der Dienstführung. Jemand wollte einen falschen Scheck einlösen. Pierre hatte damals den Mann »gepflückt«, alles war ganz glatt gegangen und ganz unauffällig. Das war etwa bei Schalter zehn gewesen, dort, wo jetzt der Chefinspektor stand und das Megaphon auf das Schalterpult stellte. Die Halle hatte vierzehn Schalter. Seltsam, sie war ihm damals viel kleiner vorgekommen. Jetzt wirkte die Halle unendlich lang. Das kam wahrscheinlich davon, weil sie leer war. Sonst wimmelte es hier von Menschen. Kunden und Angestellten. Pierre kroch weiter vor, er mußte jetzt etwa bei Schalter vier sein, die Numerierung begann beim Eingang. Er sah eine Handtasche liegen, rechts von ihm, und weiter vorn lag ein Damenschuh. Verloren wahrscheinlich in der allgemeinen Panik, als der Gangster die Menschen zusammentrieb.
Eine aufgeregte Männerstimme rief jetzt, er sei der Sprecher des Herrn von der Roten Armee-Fraktion Er hätte den Auftrag zu sagen, der Inspektor solle sofort verschwinden. Der Mann stotterte vor Angst und Aufregung: »Sofort verschwinden sollen Sie! Keine Polizei im Bankraum!« Die Rote Armee werde die Bedingungen später bekanntgeben. »Sie sollen jetzt verschwinden, sonst wird geschossen!« schrie der Mann, er bekam eine ganz hohe Stimme.
»Schon gut«, hörte Pierre den alten Trud sagen, jetzt ohne Megaphon. »Sagen Sie dem Herrn Rote Armee …« Ein paar Weiber kreischten jetzt hysterisch, es hörte sich scheußlich an in der leeren Halle.
»Zurück!« schrie der Mann, »um Gottes willen, gehen Sie nicht weiter, er schießt …«
Trudeau mußte jetzt etwa bei Schalter zwölf sein. Pierre er innerte sich, daß dort die Halle nach links breiter wurde, in einen quadratischen Raum mündete.
Pierre richtete sich langsam am Schalterpult so weit auf, daß er gerade darübersehen konnte. Er erkannte deutlich die Ecke, hinter der sich der Gangster mit dem Großteil der Geiseln aufhalten mußte. Sieben oder acht Frauen konnte er sehen, die mit dem Rücken zur Ecke auf Sesseln saßen. Sie hatten die Köpfe gesenkt und hielten die Hände vor den Gesichtern.
Der Chefinspektor redete ruhig und gütlich wie ein Vater zu seinem vertrottelten Sohn.
»… unbewaffnet …«, hörte Pierre, »… ich bin ein alter Mann und unbewaffnet. Von mir droht keine Gefahr, Sie sollten mich ansehen. Macht keinen Unsinn. Ich komme in einer halben Stunde wieder …« Pierre sah, daß Trud noch zwei Schritte vorwärts ging. Wieder kreischten ein paar Frauen. »Ich geh ja schon«, sagte Trudeau, »bin ja schon weg. Die Rote Armee soll die hysterischen Weiber rausschmeißen. Hörst du mich, Herr Rote Armee? Laß die Weiber raus, die stören ja nur … Ich geh jetzt.« Tatsächlich drehte er sich langsam um. »In einer halben Stunde oder so …«, sagte er noch.
Von Chefinspektor Trudeau sagten alle, er hätte in seinen vierzig Dienstjahren niemals auf einen Menschen geschossen. Allerdings meinten einige, die Älteren, er habe dies manchmal bereut. Doch Pierre waren Papa Truds Worte noch in deutlicher Erinnerung aus den ersten Tagen, als er seinen Dienst im Referat A angetreten hatte. Der so tolerante Chefinspektor bekam bei seinen Routine-Vorträgen ganz schmale Augen, wenn er sagte: Ein Kriminalbeamter … Nein, das waren nicht seine Worte. Ein Flic, so sagte er, ein Flic, der einen Arrestanten mißhandelt, nur »um ein Geständnis zu bekommen«, so einer ist ein Idiot. Und Idioten brauche ich nicht in meinem Referat. Ihr müßt mit den Gehirnen arbeiten, nicht mit Faust und Ellenbogen. Wenn einer frech wird, das ist was anderes. Aber niemals um ein Geständnis zu erreichen, versteht ihr, niemals.
Es wäre ein Armutszeugnis für einen Flic, sagte der alte Chefinspektor dann hinterher, ein Armutszeugnis, wenn ein Kriminalbeamter – diesmal sagte er tatsächlich Kriminalbeamter – kein anderes Mittel zur Beweisführung finden könnte.
»Dreschen ist Scheiße«, sagte der alte Trud, »und außerdem nach der Strafprozeßordnung verboten.« Und schließlich, man müsse auch verlieren können. In allen Sparten des Lebens gäbe es Siege und Niederlagen. Warum also nicht bei der Kieberei. »Beim Kampf gegen das Verbrechertum«, verbesserte sich der Chefinspektor schnell. »Wenn es nicht anders geht, laßt den Kerl laufen. Vielleicht ist er das nächste Mal dran.«
Pierre duckte sich wieder hinter das Schalterpult. Er sah dem alten Chefinspektor entgegen, der langsam näher kam, die Hände in den Taschen. Das Megaphon hatte er auf dem Schalterpult stehen lassen, Pierre wunderte sich, ob es Absicht war. Aber wahrscheinlich hatte es der alte Trud nur vergessen. Er war vielleicht noch sechs Meter entfernt, als sich ihre Augen trafen. Pierre sah das belustigte Zucken in diesem alten Gesicht, das ihm so vertraut war. Na ja, am Boden hockend mit zwei Pistolen in den Händen, mußte es wirklich ein Bild wie aus einem amerikanischen Kriegsfilm sein. Pierre sah den leisen Wink aus den Augen des Chefinspektors und verstand: Er sollte wieder rauskommen. In Hockestellung kroch er dem Alten bis zum Eingang nach. Er kam sich ziemlich blöd vor dabei und die Oberschenkel schmerzten.
Draußen vor dem Eingangstor summte es wie in einem Hornissennest. Die uniformierten Kollegen hatten inzwischen Ordnung gemacht, die Schaulustigen zurückgedrängt und die Zufahrtswege frei gemacht. Der Dienstwagen des Vizepräsidenten stand etwa zwanzig Meter links vom Eingang. Der alte Trud schneuzte sich umständlich und fingerte eine Gauloise aus der Westentasche.
»Alle Ausgänge sind jetzt doppelt gesichert«, meldete der Major. »Die Scharfschützen sind angefordert.«
Trudeau nickte. Er winkte Pierre, mitzukommen und ging zum Auto des Vizepräsidenten. Der Chefinspektor winkte auch noch Petit und Brune heran, die Gruppeninspektoren, und den Major. Es gab also so etwas wie eine erste Lagebesprechung beim Vizepräsidenten, der nun aus dem Auto stieg und irritiert herumschaute. Sie standen nun beisammen bei dem Auto, der Vizepräsident gab dem Chefinspektor die Hand und auch dann dem Major, den anderen nickte er zu. Alle schauten nun dem Chefinspektor auf den Mund und Pierre hatte wieder dieses Gefühl, daß keiner recht wußte, was zu tun sei. Und daß alle hofften, dem alten Trud würde was einfallen und er würde endlich sagen, wie es weitergehen sollte.
»Meine Herren«, sagte Trudeau, seine Stimme klang ganz ruhig und fast ein wenig müde, ganz so wie an den Tagen, wenn er den Frührapport abwickeln mußte. »Meine Herren, es ist jetzt acht Uhr fünfzig.«
Na und, dachte Pierre enttäuscht, acht Uhr fünfzig, das weiß doch jeder, der eine Uhr hat, und er ertappte sich dabei, wie er einen Blick auf seine Armbanduhr warf. Natürlich war’s acht Uhr fünfzig. Und alle Herumstehenden sahen kurz auf ihre Uhren, wie nach einem hypnotischen Befehl. Auch der Vizepräsident. Lächerlich, dachte Pierre wütend.
»… und wir müssen uns auf einen langen Einsatz gefaßt machen. Der Täter ist allein, ein Einzelgänger, soweit ich das beurteilen kann. Er wollte sicherlich nicht die Bank berauben und dann schnell abhauen. Unsere erste Annahme, Herr Vizepräsident …«, Trudeau sprach ihn direkt an, »… war falsch. Wir dachten, der Bankräuber hätte