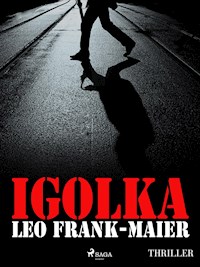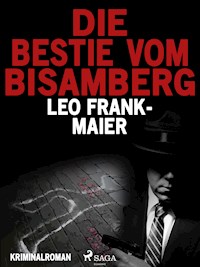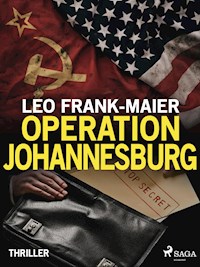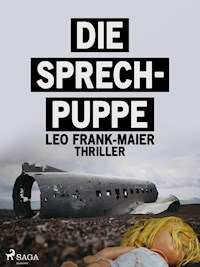Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Rudolf Prinz, einer der erfolgreichsten Kriminalbeamten des Sicherheitsbüros der Wiener Polizeidirektion, will sich nach vierzig Dienstjahren vom aktiven Polizeidienst zurückziehen. Vorher möchte er aber noch einen Fall persönlich aufklären: den mysteriösen Mord an Maria Maier. Zunächst scheint diese Bluttat ein Verbrechen ohne jedes Motiv. Doch im Verlauf der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Maria Maier mit der Rauschgiftszene zu tun hatte. Ihr Lieferant war ein Mann mit undurchsichtigen Machenschaften, dessen Spur sich bis nach Tripolis verfolgen lässt, wo er als Berater der Regierung arbeitet. Von hier führt eine weitere Spur zu dunklen Waffengeschäften großen Stils, was schließlich sogar die CIA auf den Plan ruft ... Bei Ersterscheinen des Buches sprach die österreichische Presse von einem "Schlüsselroman zum Noricum-Skandal": Damals gingen pro forma an Libyen adressierte österreichische Waffenlieferungen in Wirklichkeit an die kriegführenden Staaten Iran und Irak. Auch 25 Jahre später ist Leo Franks spannender Roman über ein zeitloses Thema immer noch spannend und geradezu erschreckend aktuell geblieben!Leo Frank (auch Leo Frank-Maier, gebürtig eigentlich Leo Maier; 1925–2004) ist ein österreichischer Kriminalautor, der in seinem Werk die eigene jahrzehntelange Berufserfahrung als Kriminalbeamter und Geheimdienstler verarbeitet. In seiner Funktion als Kriminalbeamter bei der Staatspolizei Linz wurde Leo Maier 1967 in eine Informationsaffäre um den Voest-Konzern verwickelt. Man verdächtigte ihn, vertrauliches Material an ausländische Nachrichtendienste geliefert zu haben, und er geriet unter dem Namen "James Bond von Linz" in die Medien. Es folgte eine Strafversetzung nach Wien, wo er nach wenigen Monaten wiederum ein Angebot zur Versetzung nach Zypern annahm. Zwischen 1967 und 1974 war Leo Maier Kripo-Chef der österreichischen UN-Truppe in Nikosia. Auf Zypern begann er seine ersten Kriminalromane zu schreiben und legte sich den Autorennamen Leo Frank zu. Doch dauerte es noch einige Jahre, bis 1976 sein erster Roman "Die Sprechpuppe" publiziert wurde. 1974 kehrte er – in der Voest-Affäre inzwischen voll rehabilitiert – nach Linz zurück. Er leitete verschiedene Referate (Gewaltreferat, Sittenreferat, Mordreferat), bevor er 1980 zum obersten Kriminalisten der Stadt ernannt wurde. Mit 59 Jahren ging er in Pension und zog in seine Wahlheimat Bad Ischl, wo er 2004 verstarb.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leo Frank-Maier
Kanonen für Tripolis
SAGA Egmont
Kanonen für Tripolis
Copyright © 1989 by F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Copyright © 2017 Leo Frank-Maier og Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711518656
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
In der englischen Sprache bedeutet das Wort »intelligence« zum einen soviel wie »Verstand«, »Intelligenz«, »Klugheit«, zum anderen aber auch »Nachricht« oder »Auskunft«.
Einen Geheimdienst beziehungsweise eine Spionageorganisation nennt man in dieser Sprache »intelligence service«.
Ich werde niemals begreifen, was ein Geheimdienst mit Klugheit, was Spionage mit Intelligenz zu tun hat.
Leo Frank
Die Erziehung unserer Jugend ist wohl eines der wichtigsten Dinge in unserer Gesellschaft«, dozierte er. »Es hängt so viel im Leben eines Menschen davon ab, wie man im Elternhaus, in der Schule beeinflußt wird.« Dann drückte er seine Zigarette aus. Was rede ich denn, dachte er, was versteht denn dieses junge Ding schon davon.
Das junge Ding nickte und meinte: »Damit haben Sie sicher recht.« Ihre Zustimmung aber war ein reiner Akt der Höflichkeit. Denn sie dachte ganz was anderes. Was versteht der alte Esel schon von moderner Jugenderziehung, dachte sie.
Dieses eher lustlos geführte Gespräch fand im Journalzimmer des Sicherheitsbüros der Polizeidirektion Wien statt, und das »junge Ding« war immerhin eine Angestellte des Fürsorgeamtes. Sie betreute jugendliche Häftlinge und hatte wegen einer ihrer Klientinnen vorgesprochen. Erfolglos allerdings, denn diese sechzehnjährige Rauschgiftsüchtige war bereits in eine Entwöhnungsanstalt gebracht worden. Das hatte sie vom diensthabenden Kriminalbeamten erfahren, eben von diesem »alten Esel«. Die beiden tauschten noch ein paar belanglose Höflichkeiten aus, und dann verabschiedete sich die Jugendfürsorgerin.
Der »alte Esel« hieß Rudolf Prinz und war einer der erfolgreichsten Kriminalbeamten des Sicherheitsbüros. Unmittelbar nach dem Besuch der Fürsorgerin war sein Dienst zu Ende, und er wurde abgelöst. Er machte sich zu Fuß auf den Heimweg, aber es graute ihm vor seiner leeren Wohnung, und so ging er wie so oft noch in sein Stammlokal, in das »Cafe Martha«. Zu bestellen brauchte er dort nicht, automatisch servierte ihm die Kellnerin sein Glas Wein und ein Tellerchen mit Erdnüssen. Er war ja dort wie zu Hause. Und wahrscheinlich hielt er sich dort öfter und länger auf als in seiner Wohnung.
Zwei Weingläser lang dachte Inspektor Prinz über diesen dicken Akt nach, der im Büro auf seinem Schreibtisch lag. »Ungeklärter Mord zum Nachteil der Maria Maier« stand auf dem Aktendeckel. Seit mehr als einem Jahr hatte er diesen Akt auf seinem Schreibtisch liegen, und einige Seiten kannte er inzwischen auswendig. Er glaubte auch, den Täter zu kennen, aber die Sache war ziemlich vermurkst.
Spätestens beim dritten Glas beschäftigten ihn dann andere Gedanken. Er überlegte ernsthaft, ob er vorzeitig in Pension gehen sollte. Rein formell könnte es da keine Schwierigkeiten geben. Der Polizeiarzt war ein Freund von ihm, und er würde schon irgendeinen Pensionierungsgrund finden, wenn er ihm entsprechend vorjammerte. Aber was dann? Den ganzen Tag im »Café Martha« sitzen und saufen war auch kein unbedingt erstrebenswerter Lebensabend. Sicher nicht. Andererseits hatte er nach vierzig Dienstjahren »die Schnauze voll«, wie man so schön sagt. Immer unwilliger machte er seine Arbeit, und daran war nicht nur sein fortgeschrittenes Alter schuld. Seine Vorgesetzten, die Herren Polizeijuristen, wechselten ständig, und sein jetziger Abteilungsleiter mochte ihn überhaupt nicht. Prinz vermochte ihm allerdings auch nur wenig Sympathie entgegenzubringen.
Der nächste Tag war ein Samstag, und Rudolf Prinz hatte nur »Finderdienst«, was bedeutet, daß der Journalbeamte im Sicherheitsbüro für den Fall eines Falles wissen mußte, wo er erreichbar war. Seine Anwesenheit im Büro war demnach nicht notwendig, aber seit seiner Scheidung hielt er sich nur ungern in der leeren Wohnung auf. Er trollte sich also trotzdem auf seine Dienststelle, den Frühstückskaffee trank er in der Kantine. In seinem Büro zündete er sich eine Zigarette an und blies den Rauch in Richtung Mordakte Maria Maier. Es war sehr ruhig im Raum, die Fenster waren geschlossen, der blaue Zigarettendunst hing wie eine kleine Wolke über seinem Schreibtisch. Wie so oft kam er wieder ins Sinnieren. Damals war wirklich so ziemlich alles danebengegangen:
Die 42jährige alleinstehende Maria Maier war Büroangestellte bei einer Rotkreuzdienststelle, sehr verläßlich und gewissenhaft. Als sie an diesem Tag nicht ins Büro kam und sich auch nicht telefonisch entschuldigte, rief eine Bürokollegin bei ihr an, aber es meldete sich niemand. So gegen elf Uhr verständigte die Kollegin eine Schwester der Maria. Es konnte ja etwas passiert sein.
Die Schwester hatte einen Wohnungsschlüssel und hielt besorgt Nachschau. Sie fand Maria im Vorzimmer auf dem Rükken liegend, tot in einer riesigen Blutlache. Man rief die Polizei. Inspektor Prinz erfuhr von der Sache aus dem Polizeifunk in einem Dienstauto. Er war mit einem Kollegen auf Erhebung in einer Raubsache im 21. Bezirk, was ziemlich weit weg vom Tatort war. Als er schließlich dort eintraf, war das allgemeine Durcheinander auf seinem turbulenten Höhepunkt angelangt.
Ein nervöser Polizeihofrat, ein Untersuchungsrichter und ein Staatsanwalt gaben einer Gruppe von Kriminalbeamten unentwegt Weisungen und widerriefen sie dann gleich wieder, ein junger Polizeiarzt zählte die vielen Messerstiche an der Leiche und mußte doch immer wieder von vorn beginnen; ein verzweifelter Kollege vom Erkennungsdienst versuchte vergeblich, in dem allgemeinen Durcheinander Spuren zu sichern, und eine Horde von sensationslüsternen Journalisten belagerte die Eingangstüre, die Fotoapparate blitzten unentwegt. Rudolf Prinz bereute, daß er überhaupt hergefahren war.
Es dauerte dann noch vierzig Minuten, bis er alle diese aufgeregten Menschen aus der Wohnung draußen hatte, hinauskomplimentiert oder gestoßen, je nach Dienstrang. Er war jetzt allein mit einem Sachbearbeiter, dem Erkennungsdienstler und der Leiche. Die Arbeit konnte beginnen. Draußen auf dem Gang gab der Hofrat der Presse ein Interview. »Ein bestialisches Sittenattentat, ein grauenhafter Sexualmord«, hörte man seine aufgeregte Stimme verkünden.
Die Lage der Leiche war nicht wesentlich verändert worden. Sie lag auf dem Rücken, nur mit einem Schlafrock und Unterwäsche bekleidet, die Beine waren leicht gegrätscht. Auf der Brust ein tellergroßer Blutfleck, halb eingetrocknet. Vornehmlich an der rechten Gesichts- und Körperseite viele kleine Messerstiche, nicht sehr tief. Aufmerksam betrachtete Prinz die Abrinnspuren des an den Wunden ausgetretenen Blutes. Sie führten alle senkrecht nach unten, vereinigten sich in der Blutlache am Teppichboden. Und das war es, was Rudolf Prinz nachdenklich machte. »Schau dir das an«, sagte er zu dem Erkennungsdienstler, der eine Erklärung dafür fand: »Schaut so aus, als ob sie den Herzstich zuerst bekam. Sie war schon tot und lag schon da, als der Täter weiterhin auf sie einstach.« Prinz nickte. Warum er das wohl getan hat, dachte er. Draußen vor der Tür hörte er erneut den Hofrat »Sexualmord« rufen, zum wiederholten Male. »Vielleicht deswegen«, dachte Prinz jetzt laut. »Vielleicht wollte er den Sexualmord vortäuschen.« Seine beiden Kollegen nickten zustimmend.
Dann sahen sie sich in der Wohnung um. In der Küche ein Teller mit Speiseresten. Linsen mit Knödel hatte es zum Abendessen gegeben. Im Wohnzimmer auf dem Tisch eine halbvolle Flasche Bier, daneben Brillen. Der Fernsehapparat war zwar eingeschaltet, jedoch der Stecker aus der Dose gezogen. Der Erkennungsdienstler untersuchte ohne viel Hoffnung den Stecker auf Fingerabdrücke.
Inspektor Prinz wollte mit der Schwester sprechen, nach einigen Mühen gelang ihm das, ohne daß jemand zuhörte. Die Schwester sagte aus, daß das Schloß zur Wohnungstür versperrt war. Sie mußte den Schlüssel zweimal umdrehen. Der Schlüsselbund der Ermordeten war nirgends zu finden. Es sah so aus, als ob ihn der Täter mitgenommen, die Tür dann in aller Ruhe von außen versperrt hätte. Irgendwie eigenartig für einen Sexualtäter im Blutrausch. Dann sagte die Schwester noch etwas sehr Wichtiges: »Die Maria hätte niemals einem Fremden die Tür geöffnet«, sagte sie. »Sie schaute immer zuerst durch das Guckloch auf den Gang, bevor sie jemanden einließ.« Inspektor Prinz heuchelte leisen Zweifel, aber die Schwester blieb bei ihrer Aussage. Sie machte als Zeugin einen verläßlichen Eindruck.
Die Tatzeit mußte nach allen Erkenntnissen in den Abendstunden des Vortages liegen. Die Hausparteien wurden befragt, niemand hatte etwas gehört oder gesehen gestern abend. Die meisten saßen vor den Fernsehapparaten, sahen einen Tatort-Krimi.
Die Fragen des Inspektors Prinz nach den Bekannten und Freunden der Toten ergaben nun ein paar Namen. Einen Freund gab es nicht, nur einige Verwandte und wenige Freundinnen. Der Inspektor notierte die Adressen. Die Möglichkeit, daß sie einen heimlichen Liebhaber hatte, konnte natürlich nicht ausgeschlossen werden.
Inspektor Prinz und seine beiden Kollegen durchsuchten noch einmal genau die Wohnung, doch nichts Relevantes wurde gefunden. Bargeld und Schmuck war nicht angetastet worden, was einen Raub als Motiv ausschloß. Nachdem die Leiche zur gerichtsmedizinischen Obduktion abtransportiert worden war, versiegelten die Beamten die Wohnung. Die Journalisten fuhren zurück in ihre Redaktionen, die Polizisten in ihre Dienststellen. Rudolf Prinz fuhr in das Rotkreuzbüro, den Arbeitsplatz des Mordopfers. Denn wo sonst erfährt man zuerst von einem eventuellen Freund oder Liebhaber, von dem Verwandte nichts wissen sollen. Bürokolleginnen sind meist bestens informiert.
An diesem Nachmittag war in der Rotkreuzdienststelle wohl wenig gearbeitet worden. In den Radio-Lokalnachrichten war vom Mord an Maria Maier schon zu hören gewesen, und in einem Kurzinterview hatte der Polizeihofrat seine Version von dem »grauenhaften Sexualattentat« dargelegt. Alle waren aufgeregt, und als jetzt noch dieser Kriminalinspektor auftauchte, überschüttete man ihn mit Fragen. Rudolf Prinz hatte einige Mühe, den Leuten verständlich zu machen, daß er nicht gekommen war, um Fragen zu beantworten, sondern um welche zu stellen.
Das Resultat war für ihn eher enttäuschend. Die Maria Maier war recht zurückhaltend, was ihr Privatleben betraf. Sie wurde im Büro nur selten angerufen, und wenn, dann von ihrer Schwester. Ab und zu rief auch ein Mann an, den sie am Telefon Kurt nannte. Nein, wer dieser Kurt war, darüber hatte sie nie ein Wort verloren.
Auch die Durchsuchung ihrer Schreibtischschubladen erbrachte wenig. Keine Privatbriefe, keine Fotografien. Nur eine Ansichtskarte aus Athen. Auf der stand: »Liebe Urlaubsgrüße, Kurt.« Die Karte war zwei Monate alt.
Rudolf Prinz steckte die Karte in die Rocktasche und fuhr in sein Büro. Er telefonierte mit der Schwester. Nein, sie kannte keinen Mann namens Kurt, hatte keine Ahnung, wer das sein könnte.
Er ging ins Erkennungsamt, fragte den Kollegen, ob irgendeine der gesicherten Spuren verwertbar wäre. Der Kollege fluchte. Der einzige verwertbare Fingerabdruck an einem Pantoffel der Toten stammte von dem Herrn Hofrat. Ein Jammer.
Noch einmal betrachtete Prinz die Tatortfotos, versuchte sich vorzustellen, was passiert war:
Maria Maier hatte sich ihr Nachtmahl zubereitet, gegessen, eine Flasche Bier geöffnet, zur Hälfte getrunken und in den Fernseher geschaut. Dann hatte es an der Wohnungstür geklingelt. Maria Maier schaut durch das Guckloch, ein Bekannter steht draußen. War es dieser ominöse Kurt? Sie öffnet. Der Mann kommt herein, stößt ihr ein Messer in die Brust. Eine tödliche Verletzung. Sie fällt zu Boden. Er beugt sich über sie, sticht immer wieder in diesen leblosen Körper.
Der Fernsehapparat dröhnt. Der Täter geht ins Wohnzimmer, zieht den Stecker heraus, es wird still. Er sucht und findet den Wohnungsschlüssel, verläßt die Wohnung, sperrt von draußen zweimal zu.
Diese vielen kleinen Stiche, vornehmlich an ihrer rechten Körperhälfte. Inspektor Prinz versuchte, das zu klären. Der Täter mußte mit der linken Hand zugestochen haben. Ein Linkshänder?
Die Hoffnung des Rudolf Prinz, dieser Kurt könnte in den nächsten Tagen identifiziert werden, erfüllte sich nicht. Statt dessen ereigneten sich für den alten Inspektor sehr unangenehme Dinge. Der Obduktionsbefund bestätigte zwar seine Vorstellung über den Tathergang: Der erste Herzstich war tödlich, die anderen nur ein bis zwei Zentimeter tief und postmortal. Insgesamt waren es einhundertzwanzig, nach dem Bericht der Gerichtsmediziner. »Immerhin neuer österreichischer Rekord«, hatte Prinz trocken bemerkt, und diese Äußerung wurde von einem Journalisten aufgeschnappt.
Am nächsten Tag stand diese Sache in der Zeitung, mit einem Foto des Inspektors und bissigen Kommentaren über den Zynismus der Kriminalpolizei. Der Hofrat mußte dem Polizeipräsidenten berichten, Prinz mußte sich rechtfertigen, die Empörung war groß. Als erste dienstrechtliche Maßnahme wurde der Abteilungsinspektor von allen weiteren Ermittlungen im Fall Maria Maier ausgeschlossen. Der Hofrat übernahm persönlich die Leitung der weiteren Amtshandlungen.
Wochen und Monate vergingen. Auf Weisung des Hofrates überprüften Kriminalbeamte alle einschlägig Vorbestraften, entlassene Sträflinge und Geisteskranke. Der Mord an Maria Maier blieb ungeklärt. Der alte Prinz rührte keinen Finger mehr in diesem Fall, zumindest nicht offiziell. Seine persönliche Vorstellung über den Tathergang behielt er für sich.
Jeder Beruf färbt ab, und auch Kriminalbeamte sind nur Menschen. Nach vierzig Berufsjahren werden »Kieberer«, die ständig mit Verbrechen und Elend konfrontiert sind, oftmals zu Zynikern. Sicherlich war das auch ähnlich bei Rudolf Prinz. Sein Ehrgeiz im Berufsleben hatte zwar stark nachgelassen, aber war es ein Wunder, wenn ihn gerade der Mordfall Maier nach all diesen Geschehnissen ständig beschäftigte? Er hatte im Alleingang weiterrecherchiert und Erstaunliches erfahren. Die Zeit war gekommen, die ganze Sache noch einmal aufzurollen.
Er hatte auch schon einen fixen Plan. Dazu brauchte er aber eine Kriminalbeamtin und einen sehr jungen Kollegen, auf die er sich bedingungslos verlassen konnte. Was die Frau Inspektorin betraf, war alles in Ordnung. Sie hieß Dorothea Winter, war eine tüchtige Kriminalistin und gehörte schon lange zu seiner Abteilung. Prinz hatte mit ihr bereits die Einzelheiten seines Plans besprochen, und sie war damit einverstanden. Bezüglich des jungen Kriminalbeamten dachte Prinz an Stefan Heiden, einen jungen Polizisten, der in zwei Wochen den Ausbildungslehrgang beendet haben und sich dann bei ihm zum Dienstantritt melden würde. Der Stefan war genau der Mann, den er brauchte.
Oberpolizeirat Dr. Ferdinand Pekarek war Instruktor an der Fachschule für Kriminalbeamte der Polizeidirektion Wien. Seine Lehrfacher waren Kriminologie und Behördenaufbau, und er galt als strenger Lehrer und gnadenloser Prüfer. Das hatte seinen Grund. Der Oberpolizeirat war jetzt über sechzig Jahre alt, hatte einen Bauch und eine Glatze. Seine Schüler, die angehenden Herren Kriminalbeamten, waren im Schnitt fünfundzwanzig Jahre alt und fast ausnahmslos durchtrainierte Sportler. Der Pekarek mochte diese modernen, selbstbewußten Typen nicht so recht. Als er in diesem Alter war, besaß man halt noch Respekt vor dem Vorgesetzten. Subordination war die Devise, Disziplin jedes zweite Wort. Es herrschte, wie man so schön sagt, Zucht und Ordnung. Aber wenn er sich heute diese jungen Leute ansah – allein wie die daherkamen! Zu seiner Zeit trugen Kriminalbeamte Anzüge und Krawatten, hatten die Haare kurz geschnitten und waren ordentlich rasiert. Jetzt lümmelten seine Schüler in Bluejeans und Lederjacken herum, hatten Frisuren wie Rock-Sänger, und einige trugen sogar Vollbärte. Und mit keiner Dienstvorschrift konnte man dagegen angehen, es war ein Jammer.
Einer seiner Schüler, den er womöglich noch weniger leiden mochte als die anderen, das war dieser Polizeiwachmann Stefan Heiden. Der trug zwar keinen Bart, aber er grinste immer so unverschämt, wenn dem Herrn Oberpolizeirat die Hose um den Bauch recht spannte, wenn er beim Stiegensteigen schnaufen mußte wie ein Igel im Birnenhaufen, oder wenn er seine Augengläser nicht finden konnte und hilflos seine Taschen abtappte. Der Pekarek registrierte dieses freche Grinsen sehr wohl. Auch ohne Brille.
Der Lehrgang neigte sich dem Ende zu. Die Abschlußprüfungen standen bevor. Man schrieb Montag, den 3. Mai 1982, und der Oberpolizeirat wußte, daß einige der Lehrgangsteilnehmer zum Wochenende bei dem Fußballspiel in München waren und Bayern Münchens sechsten Pokalsieg miterlebt hatten. Auch dieser Stefan Heiden war bei dem Ausflug dabeigewesen und konnte sicherlich nichts gelernt haben. Die Gelegenheit war günstig. Dr. Pekarek rief ihn auf und stellte ihm eine Reihe recht schwieriger Fragen aus dem Bereich der Kriminalanthropologie und der Phänomenologie. Zu seiner Enttäuschung gab der Heiden aber recht zufriedenstellende Antworten und ließ sich auch durch Zwischenfragen nicht aus der Ruhe bringen. Pekarek schnaufte ärgerlich, und der junge Polizist zog wieder seine Grimasse.
»Warum grinsen Sie eigentlich andauernd?« fragte der Oberpolizeirat böse. Er bereute seine Frage sogleich.
»Ich bin halt ein fröhlicher Mensch«, antwortete der Heiden unbekümmert, und ein paar Schüler kicherten und erwiesen sich damit als ebenso fröhlich.
Die gute Laune werde ihm bei der Kripo schon noch vergehen, murrte der Pekarek. Dann schrillte die Schulglocke. Für heute war der Unterricht beendet, und alle packten ihre Lehrbehelfe ein und trollten sich in die Kantine. Für den Nachmittag stand Sport auf dem Lehrplan, und dabei hatte der Oberpolizeirat nichts verloren.
An einem der nächsten Tage wurde Stefan Heiden in das Sicherheitsbüro gerufen. Der Abteilungsinspektor hätte mit ihm zu reden.
Neugierig war er, der Alte. Das Gespräch dauerte über eine Stunde. An seinem Ende stand ein fast lückenloser Lebenslauf Stefan Heidens:
1956 wurde er in Wien als uneheliches Kind geboren. Seinen Vater hatte er nie kennengelernt, und die Mutter sprach wenig und ungern über diesen Mann. Sie arbeitete als Verkäuferin in einem Textilgeschäft, und der kleine Stefan war tagsüber in einem Kinderhort. Abends holte ihn die Mutti dort ab, und auch an den Wochenenden und Feiertagen war er bei ihr. Sechzehnjährig kam er in eine Lehre und erlernte das Schlosserhandwerk. Als schlanker, hübscher Junge mit viel Interesse für Sport spielte er Tennis und Fußball in einem Unterklassenverein und träumte davon, einmal ein Profi zu werden.
Daraus wurde allerdings nichts, denn nach Abschluß der Lehrzeit fand er eine Anstellung in einer Autofabrik und hatte viel zuwenig Zeit für ein geregeltes Training. Drei Jahre arbeitete er dort, dann spielte seine Mannschaft eines Sonntags gegen eine Polizeiauswahl, und er lernte ein paar Gegenspieler kennen, alles nette Burschen. Es wurde eine Art Freundschaft daraus, und nach Zureden bewarb er sich um Aufnahme in die Polizei. Er absolvierte die Eignungsprüfungen und durchlief dann zwei Jahre die Polizeischule, um anschließend auf einem Kommissariats-Wachzimmer seinen ersten Dienst zu verrichten. In der Polizeischule wurde viel Wert auf körperliche Ertüchtigung gelegt. Man trainierte hart, sehr zur Freude des jungen Stefan. Seit drei Jahren war er österreichischer Polizei-Fünfkampfmeister und recht stolz auf diesen Titel.
Unvermittelt unterbrach der Alte die Ausführungen des jungen Polizisten: »Möchtest du nicht im Sicherheitsbüro Dienst machen?« Das war eine Überraschung für den Stefan.
»Natürlich möchte ich das«, sagte er. »Aber soviel ich weiß, müssen wir zuerst auf einem Kommissariat Dienst machen.«
»Stell ein Gesuch«, empfahl der Alte. »Alles Weitere überlaß mir.« Und so war es dann auch. Der Herr Abteilungsinspektor hatte nicht zuviel versprochen.
Das Dekret zur Bestellung zum Kriminalbeamten war noch druckfeucht, als Stefan Heiden sich im Sicherheitsbüro bei dem Abteilungsinspektor Prinz zum Dienstantritt meldete. Das war ungewöhnlich und gab Anlaß zu einigem Getratsche unter den Kollegen. Denn normalerweise beginnen Kriminalbeamte in den verschiedenen Bezirks-Kommissariaten, lernen dort von der Pike auf. Das Sicherheitsbüro ist eine Art Eliteeinheit, und man muß schon beste Zeugnisse aufweisen, um dorthin zu kommen. Alle wußten, daß der junge Stefan auf ausdrücklichen Wunsch des alten Prinz in dessen Abteilung kam. Natürlich vermutete man sofort Vetternwirtschaft. Aber dem Wunsch des Abteilungsinspektors konnte man sich auch im Präsidium nicht verschließen. Die tatsächlichen Gründe dieses ungewöhnlichen Begehrens ahnte aber niemand.
Zwei Wochen vergingen. Dann rief der alte Prinz die Kriminalbeamtin Winter und den Stefan in sein Büro. Er habe sich alles reiflich überlegt, und es wäre jetzt an der Zeit, in dem Mordfall Maria Maier etwas zu unternehmen, begann er. Aber er müsse sich auf seine beiden Mitarbeiter unbedingt verlassen können. Die Dorothea nickte. Der Stefan sagte: »Alles klar, Chef.« Beide waren mit der Mordsache Maier inzwischen genauso vertraut wie Prinz. Doch eines wußten sie noch nicht, und sie hörten gespannt zu, was der Inspektor ihnen zu sagen hatte.
Bedächtig erzählte er den beiden die Geschichte, die sechs Wochen nach dem Begräbnis der Maria Maier passierte. Und über die er noch mit niemandem gesprochen hatte.
Damals rief ihn eines Tages die Schwester der Ermordeten an. Sie war die alleinige Erbin und hatte, nachdem die Verlassenschaftsformalitäten beendet waren, das persönliche Eigentum der Maria übernommen. Bei der Sichtung all dieser Gegenstände habe sie nun Dinge vorgefunden, die ihr bedenklich vorkämen und über die sie mit dem Inspektor sprechen wollte. Rudolf Prinz beeilte sich, mit ihr zusammenzutreffen. Sie zeigte ihm eine Reisetasche, die sie im Keller der Maria gefunden hatte, versteckt unter altem Gerümpel. Es war eine Tasche, wie sie internationale Fluggesellschaften ihren Passagieren schenken oder verkaufen. Sie trug die Aufschrift UAA – United Arab Airlines – und enthielt eine ungewöhnlich große Menge an Zigaretten und Tabak, verpackt in Zeitungspapier. Dann war da noch ein Blanko-Dienstausweis des Roten Kreuzes, gestempelt mit der Stampiglie ihrer Dienststelle, aber nicht beschriftet. Weiter fand sich ein silberner Pokal mit eingraviertem Tennisracket und der Inschrift »Zweiter Platz Mixed Doppel 1978«. »Die Maria hat niemals geraucht«, sagte die Schwester, »und war auch nie in einem arabischen Land. Tennisspielen konnte sie gar nicht.« Sie wußte sich den Fund in ihrem Keller nicht zu erklären.
Prinz nahm das Zeug an sich, die Schwester wollte damit nichts zu tun haben. Zwei Tage überlegte er, ob er damit zu seinem Hofrat gehen und berichten sollte. Dann ließ er es bleiben. Schließlich hatte man ihn wegen seiner unglücklichen Äußerungen von den weiteren Ermittlungen ausgeschlossen, und er hatte auch seinen Stolz.
Heimlich unternahm er zwei Dinge: Das verwendete Zeitungspapier in der Tasche trug arabische Schriftzeichen, und von einem Dolmetscher ließ er sie übersetzen. Es handelte sich um eine in Bagdad erscheinende Tageszeitung, die zwei Monate vor dem Mord datiert war. Dann nahm er kleine Proben des Tabaks und ließ sie von einem Kollegen der Suchtgiftabteilung untersuchen. Sein Verdacht wurde bestätigt. Es handelte sich um Haschisch. Mit dem Tennispokal konnte er vorerst allerdings nichts anfangen.
Wie kam die Maria Maier zu diesen Gegenständen? Und warum hielt sie sie im Keller versteckt?
Erst Wochen später hatte er auch zu dem Silberpokal eine Idee. Er suchte das Archiv einer Tageszeitung auf und studierte alle Sportberichte aus dem Jahr 1978. Ein mühseliges Unterfangen. Glücklicherweise gab es nicht allzu viele Tennisturniere. Prinz ließ sich die Artikel darüber ablichten, legte das Papier in eine Mappe und dachte schon damals an einen jungen, sportlichen Kriminalbeamten, dem er eines Tages diese Dinge mit entsprechenden Anweisungen übergeben würde.
Stefan Heiden wohnte immer noch bei seiner Mutter. Zum einen, weil er sie nicht allein lassen wollte, und zum anderen aus Kostengründen. Er bezahlte ihr einen Teil seines Monatsgehaltes, weil sie sich doch um seine Wäsche kümmerte, und er wußte, daß sie dieses Geld auf ein Sparbuch einzahlte. Ein Sparbuch auf seinen Namen.
Als sie ihn eines Tages beiläufig fragte, was er denn bei der Kriminalpolizei jetzt so zu tun habe, war sie wegen seiner merkwürdigen Antwort fast beleidigt. »Weißt du, Mutti«, hatte er gelacht, »ich suche einen Mörder mit Vornamen Kurt, der mit Suchtgift handelt, in arabischen Ländern verkehrt und Tennis spielen kann.« Die Mutter hielt das für einen wenig humorvollen Scherz ihres Stefferls. Und doch war es so.