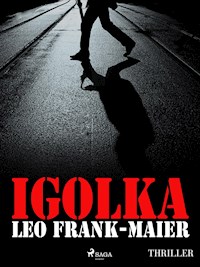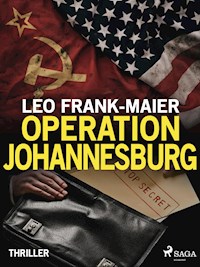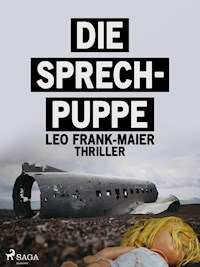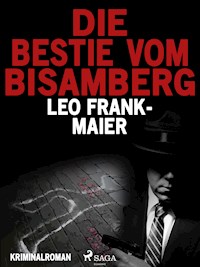
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
"Es macht mich richtig betroffen, jetzt, als ›alter Mann‹, sehen zu müssen, daß viele der Krimis, die in Kinos und im Fernsehen gezeigt und auch als Buch veröffentlich werden, nicht die geringste Sachkenntnis in der Behandlung der Themen erkennen lassen. Und ein wenig selbstgefällig erlaube ich mir, Bertrand Russell zu zitieren: ›Es ist ein Jammer auf dieser Welt, daß die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel.‹" So schreibt Leo Frank im Vorwort zu "Die Bestie vom Bisamberg". Diese Zeilen machen zugleich deutlich, was Franks Kriminalromanen so besonders macht: Leo Frank war selbst jahrzehntelang bei der Kripo tätig; er weiß, wovon er schreibt, und so gehören seine Krimis auch zu den seltenen Vertretern ihrer Gattung die tatsächlich auch etwas mit dem realen Polizeileben zu tun haben – und trotzdem und wahrscheinlich gerade eben deshalb unglaublich spannend sind! So auch der vorliegende Roman. Mit der "Bisambergbestie" sieht sich die Abteilung "Gewaltverbrechen" des Wiener Sicherheitsbüros seit längerem konfrontiert ("Mordkommissionen", so erfährt der überraschte Leser ebenfalls schon im Vorwort, gibt es im wirklichen Leben nämlich gar nicht ...). Ein frischgebackener Kriminalbeamter nimmt sich mit unkonventionellen Ideen des rätselhaften Falles an, und eckt dadurch zugleich erst einmal mächtig bei seinen skeptischen Kollegen an. Das sind aber wahrlich nicht die einzigen Probleme und Gefahren, mit denen er es im Zuge seiner Ermittlungen zu tun bekommt ... In diesem packenden Roman, der auf dem Drehbuch zum gleichnamigen Fernsehfilm basiert, lässt der beliebte österreichische Kriminalautor Leo Frank seine in vierzig Jahren bei der Kriminalpolizei und im Geheimdienst gesammelten Erfahrungen Revue passieren. Und das zahlt sich aus!Leo Frank (auch Leo Frank-Maier, gebürtig eigentlich Leo Maier; 1925–2004) ist ein österreichischer Kriminalautor, der in seinem Werk die eigene jahrzehntelange Berufserfahrung als Kriminalbeamter und Geheimdienstler verarbeitet. In seiner Funktion als Kriminalbeamter bei der Staatspolizei Linz wurde Leo Maier 1967 in eine Informationsaffäre um den Voest-Konzern verwickelt. Man verdächtigte ihn, vertrauliches Material an ausländische Nachrichtendienste geliefert zu haben, und er geriet unter dem Namen "James Bond von Linz" in die Medien. Es folgte eine Strafversetzung nach Wien, wo er nach wenigen Monaten wiederum ein Angebot zur Versetzung nach Zypern annahm. Zwischen 1967 und 1974 war Leo Maier Kripo-Chef der österreichischen UN-Truppe in Nikosia. Auf Zypern begann er seine ersten Kriminalromane zu schreiben und legte sich den Autorennamen Leo Frank zu. Doch dauerte es noch einige Jahre, bis 1976 sein erster Roman "Die Sprechpuppe" publiziert wurde. 1974 kehrte er – in der Voest-Affäre inzwischen voll rehabilitiert – nach Linz zurück. Er leitete verschiedene Referate (Gewaltreferat, Sittenreferat, Mordreferat), bevor er 1980 zum obersten Kriminalisten der Stadt ernannt wurde. Mit 59 Jahren ging er in Pension und zog in seine Wahlheimat Bad Ischl, wo er 2004 verstarb.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leo Frank-Maier
Die Bestie vom Bisamberg
SAGA Egmont
Die Bestie vom Bisamberg
Copyright © 1988 by F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Copyright © 2017 Leo Frank-Maier og Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711518625
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Die Bestie vom Bisamberg
Vorwort
Herr Kommissar, was bearbeiten Sie denn gerade für einen Fall?« fragte die alte Dame lüstern, und es wurde totenstill in der Stammtischrunde.
Ich habe solche und ähnliche Fragen oftmals gestellt bekommen. Vierzig Jahre lang war ich Kriminalbeamter, und nie habe ich verstanden, warum viele Zeitgenossen diesen Beruf für besonders interessant halten. Und warum über die Arbeit eines Kriminalbeamten so erschreckend falsche Vorstellungen herrschen.
Doch wie bin ich zu meinem Beruf gekommen?: Ich bin 1925 in Wien geboren, mein Vater war Fabrikarbeiter, meine Mutter Hausfrau, bescheidene Verhältnisse. »Bub, lern was«, hörte ich von meinem Vater immer wieder. »Nur was du im Kopf hast, kann dir niemand wegnehmen.« Unter großen finanziellen Opfern ließ er mich ein Gymnasium besuchen. Noch nicht achtzehn, werde ich großdeutscher Soldat, Gefreiter der Infanterie, nach Rußland geschickt, zweimal verwundet – ein Schicksal wie das so vieler anderer. Nach dem Krieg finde ich die elterliche Wohnung ausgebombt, den Vater in Gefangenschaft, die Mutter in einem Barackenlager. Ich werde Polizist, weil mir sonst nichts einfällt und ich Lebensmittelmarken brauche.
Mein Vater hatte recht: Was man im Schädel hat, kann einem niemand nehmen. Ich spreche englisch und russisch, kann mich also mit den Herren Besatzungsoffizieren verständigen. Und Leute mit diesen Sprachkenntnissen sucht man bei der Kriminalpolizei, also werde ich Kriminalbeamter.
Es ist in diesem Beruf wie in jedem anderen auch. Der eine hat Glück, ist erfolgreich. Der andere bringt es trotz Fleiß nur zur Mittelmäßigkeit. Ich hatte unerhört viel Glück, immer wieder. Hätte ich dieses Glück auch in meinem Privatleben gehabt, ich wäre heute Multimillionär und vielleicht Haremsbesitzer. Und bräuchte keine Krimis zu schreiben. Aber das kam alles viel später.
Vorerst wirbelt es mich, den Inspektor Maier, ordentlich herum. Ich habe in allen Sparten der Kripo gearbeitet, mit Ausnahme der Abteilung Wirtschaftsbetrug. Dazu muß man schon ein regelrechter Buchhalter sein, muß Bilanzen lesen können. Doch da Mathematik schon immer meine große »Schwäche« war, würde ich mir nie erlauben, einen Kriminalroman zu schreiben, der in der Welt der Großbetrüger spielt. Meiner Meinung nach kann oder zumindest sollte man nur über die Dinge schreiben, von denen man etwas versteht. Es macht mich richtig betroffen, jetzt, als »alter« Mann, sehen zu müssen, daß viele der Krimis, die in Kinos und im Fernsehen gezeigt und auch als Buch veröffentlicht werden, nicht die geringste Sachkenntnis in der Behandlung der Themen erkennen lassen. Und ein wenig selbstgefällig erlaube ich mir, Bertrand Russell zu zitieren: »Es ist ein Jammer auf dieser Welt, daß die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel.«
Damit sind wir beim Thema. Seit zehn Jahren schreibe ich Kriminalromane, seit zwei Jahren auch Drehbücher für Kriminalfilme. Was bedeutet, daß ich mich in beiden Sparten informieren muß – ich schmökere in Krimis und sehe mir Kriminalfilme an, was ich früher nie getan habe. Und dabei kommt mir das Grausen. Langsam beginne ich zu begreifen, wie die vielen falschen Vorstellungen über den Beruf des Kriminalbeamten entstehen konnten.
Erstaunt erblicke ich am Bildschirm den smarten Kommissar im Nadelstreif, wie er am Tatort verdachtschöpfend um sich blickt. Die Leiche wird abtransportiert. Kamera groß auf die seelenvollen Augen des Kommissars. »Seltsam«, murmelt er. Kamera schwenkt auf die elegante Einrichtung des Tatortes, einer eleganten Villa. Natürlich hatte dieser Mord im gehobenen Milieu Stil: Der Herr Direktor hat ein Verhältnis mit seiner Sekretärin, was keinem verborgen bleibt. Seine ermordete Frau ging fremd mit dem Gärtner. Aha, denkt Lieschen Müller, entweder war es die Sekretärin oder doch wieder, wie üblich, der Gärtner. Enttäuscht gehe ich schlafen. Meine Frau und Tochter gucken weiter.
Als Kriminalbeamter war ich immer sehr ehrgeizig. Wieso, weiß ich eigentlich heute gar nicht mehr so recht. Aber als Drehbuchautor habe ich jetzt auch Ehrgeiz entwickelt. Ich will einmal einen Stoff liefern, in welchem kein Mord, keine Schießerei und keine Verfolgungsjagd vorkommt. Und der trotzdem spannend ist. Je besser ich aber die Regisseure kennenlerne, desto pessimistischer werde ich, ob mir das gelingt.
Ich muß also Konzessionen machen. Natürlich gebe ich zu, daß professionelle Regisseure, TV-Redakteure und Produktionsleiter eben von der Filmbranche mehr als ich verstehen. Aber ihren Argumenten kann ich mich nicht anschließen. »Leo«, lächeln sie milde, »das verstehst du nicht. Was wir brauchen, ist Action. Die Zuschauer wollen das. Ohne Knallereien und Bremsenquietschen schlafen uns die Leute ja ein.«
Ist das wirklich so?
Ich kann es nicht glauben. Und ich stelle mir die Frage: Soll man schreiben und produzieren, was die »Leute« (angeblich) wollen? Oder soll man versuchen, den Menschen etwas anderes zu bieten? Etwas zum Nachdenken, nicht nur »Action«. Menschliche Werte lassen sich in allen Stoffen vermitteln. Auch in Krimis.
Der Alltag des Kriminalbeamten beginnt überall auf der Welt mit einer Art Frühbesprechung, bei welcher die angefallene Arbeit verteilt wird. In Österreich nennt man das den Frührapport, in England morning briefing, in Deutschland hat man verschiedene Bezeichnungen dafür. Das System aber ist überall das gleiche. Die Akten werden nach Sachgebieten den einzelnen zuständigen Referaten zugewiesen. Die Referatsleiter bestimmen, wer was zu bearbeiten hat und wie das geschehen soll. Arbeitsgruppen werden zusammengestellt, je nach Notwendigkeit der Sachlage wird Verbindung zu anderen Dienststellen aufgenommen. Auch sind die Sachgebiete im wesentlichen überall gleich. Da gibt es die Abteilung für politische Delikte, für Gewaltverbrechen, für Einbruch, Diebstahl, Betrug, Jugend und Sitte, Rauschgift, Brand. Und natürlich die Kriminaltechniker, das sind die Spurensucher usw. Der oft zitierte Ausdruck »Mordkommission« ist blanker Unsinn. Ist ein Mord passiert, wird er von den Kriminalbeamten der Gruppe »Gewaltverbrechen« bearbeitet. Und diese sind für alle Bereiche zuständig, in denen Gewalt im Spiel ist. Vom schweren Raubmord bis zur leichten Körperverletzung. Was gewiß einleuchtet, denn glücklicherweise passieren Morde seltener als Ladendiebstähle, und eine reine »Mordkommission« hätte ja, wäre sie wirklich nur für Mord zuständig, kaum etwas zu tun. Auch die Bezeichnung »Mordspezialist« ist falsch und einfach lächerlich. Jeder Mord ist anders, und man kann sich nicht darauf spezialisieren. In der Realität. Anders ist es natürlich bei dem eingangs zitierten TV-Kommissar im Nadelstreif.
Und damit sind wir wieder beim eigentlichen Thema. Mit den Kritiken meiner bisher ausgestrahlten »Tatort«-Filme kann ich ganz zufrieden sein. Bemängelt wurde verschiedentlich nur die vulgäre Ausdrucksweise der handelnden Personen. »Muß das sein?« werde ich gefragt. Aber ich kann doch nicht Zuhälter, Huren oder Rauschgifthändler wie Burgschauspieler sprechen lassen! Die wirkliche Sprache der Kriminalszene kann ich im Drehbuch ohnehin nicht wiedergeben. Sie wäre nur ganz wenigen verständlich. Aber doch annähernd will ich mich an die Wirklichkeit halten. Denn meine Stoffe sind keine Mordfälle in besseren Kreisen.
Ich habe es mir in den Kopf gesetzt, Kriminalfälle in Romanen darzustellen. Natürlich werden auch in den sogenannten »besseren Kreisen« Verbrechen begangen. Aber das ist ganz und gar nicht typisch. Manchmal, so glaube ich, siedeln Regisseure und Drehbuchautoren ihre Handlung nur deshalb in höheren Gesellschaftskreisen an, um mit der gezeigten Eleganz der Wohnungen, der neuesten Mode und einer Menge Schmuck den Neid des Publikums zu wecken …
Wenn ich diese Ansichten in Freundes- oder Feindeskreisen vertrete, höre ich sinngemäß immer wieder folgenden Einwand:
Das Schreiben von Spannungslektüre kann doch nicht nur den Kriminalbeamten bzw. Kriminellen vorbehalten sein. Wo käme man denn da hin? Der Verfasser eines Ärzteromans muß ja auch nicht Mediziner sein, der Autor eines Zirkusromans nicht unbedingt Feuerschlucker oder Seiltänzer.
Das ist richtig.
Aber in den beiden letztgenannten Fällen informieren sich die Autoren zweifellos bei den Spezialisten. Sie recherchieren. Warum geschieht dies bei Krimi-Autoren so selten? Es wäre doch ganz einfach. Überall würden freundliche Kriminalbeamte gerne jede gewünschte Auskunft geben. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, denn vierzig Jahre war ich in diesem Beruf tätig. Doch bei mir hat sich nie jemand nach Details meiner Arbeit erkundigt. Bei meinen Kollegen ebensowenig.
Die Kriminalbeamtin der Abteilung »Gewaltverbrechen« des Sicherheitsbüros in Wien hieß Birgit Herzog und war eine ebenso hübsche wie resolute Frau. Sie war 35 Jahre alt und seit zehn Jahren in diesem Beruf. In zehn Jahren Kriminaldienst erlebt man einiges, und sie hatte gelernt, sich durchzusetzen, sowohl bei ihren männlichen Kollegen als auch bei ihren »Kundschaften«. Das waren vornehmlich Prostituierte oder Ladendiebinnen, aber auch weibliche Verbrechensopfer, Jugendliche und Kinder. Es ist nun einmal so, daß Frauen oftmals zu ihren Geschlechtsgenossinnen mehr Vertrauen haben und bei Verhören einer weiblichen Beamtin Einzelheiten preisgeben, die sie einem Mann niemals sagen würden. Diese Erkenntnis hat sich auch die Kriminalpolizei zunutze gemacht: Sie bildet für alle Dienststellen Kriminalbeamtinnen aus. Im Durchschnitt kommt in Wien allerdings auf vierzig Kriminalbeamte nur eine Frau. Viel zuwenig, nach Ansicht von Birgit Herzog.
An diesem schwülen Nachmittag im August 1982 war die Frau Inspektor besonders übellaunig. Von Freunden hatte sie eine Eintrittskarte zu einer Aufführung bei den Salzburger Festspielen bekommen und hätte sich gerne zwei Tage Urlaub genommen, um sich den »Jedermann« anzusehen. Doch ausgerechnet da wurde wieder ein Notzuchtattentat auf eine junge Frau am nördlichen Stadtrand Wiens verübt, schon der siebte Fall dieser Art in drei Monaten. Keine Spur vom Täter, das Opfer war lebensgefährlich verletzt und lag auf der Intensivstation im Krankenhaus. »Du kannst jetzt keinen Urlaub nehmen, Biggi«, hatte der Chefinspektor gesagt, »das mußt du doch einsehen.« Natürlich sah sie es ein, aber das besserte ihre Laune keineswegs. So fuhr sie also ins Krankenhaus und hoffte, dort irgendwelche Hinweise auf den Verbrecher zu erhalten. Alles hing davon ab, ob die Frau überleben würde oder wenigstens noch etwas sagen konnte, bevor sie starb. Am Telefon hatte der Arzt mitgeteilt, daß die Patientin noch ohne Bewußtsein wäre. Biggi machte sich auf eine lange Nacht am Krankenbett gefaßt.
Im Spital befragte sie vorerst einmal den Arzt. Die Schädeldecke der Frau war zertrümmert, erfuhr sie, nach mehreren wuchtigen Schlägen mit einem schweren, stumpfen Gegenstand. Die Kriminalbeamtin wußte, daß es ein faustgroßer Stein gewesen war. Man hatte ihn am Tatort gefunden. Der Doktor machte ein bedenkliches Gesicht, dann eilte er zu einer Notoperation von dannen.
Biggi Herzog hatte darauf einen heftigen Streit mit der Stationsschwester, die ihr partout den Eintritt in das Zimmer der Schwerverletzten verwehren wollte.
Schließlich, nach einem harten Wortwechsel, kapitulierte die Krankenschwester. »Auf Ihre Verantwortung!« rief sie der in ihren Augen unverschämten Polizistin böse nach.
Die Verletzte hieß Maria Weber. Ihr Kopf war dick verbunden, die Augen geschlossen, sie atmete kaum hörbar. Biggi schob einen Sessel neben das Bett, setzte sich, ergriff eine Hand der Frau und streichelte sie zärtlich. Die Hand fühlte sich kalt und feucht an.
»Frau Weber«, sagte sie nach einer Weile leise, »können Sie mich hören?«
Das Gesicht der Frau blieb ausdruckslos. Biggi seufzte.
In der nächsten Stunde stellte sie diese Frage immer wieder. »Können Sie mich hören? Geben Sie mir ein Zeichen, wenn Sie mich hören können.« Aber es gab kein Zeichen.
Die Kriminalbeamtin kannte die sechs vorangegangenen Überfälle nicht nur aus den Akten, sie hatte die Opfer auch direkt befragt. Der Tathergang war immer der gleiche gewesen. Jede der Frauen war auf ihrem Heimweg von der Arbeit nach Einbruch der Dunkelheit in den menschenleeren Gassen des Wiener Vorortes überfallen worden. Der Täter hatte ihnen aufgelauert, sie zu Boden gerissen und gewürgt, um Hilfeschreie zu ersticken. Nachdem er seine Opfer wehrlos gemacht hatte, vergewaltigte er sie. Die Frauen vor Maria Weber hatten leichte Verletzungen erlitten, Kratzer am Hals und Hautabschürfungen. Nie aber hatte der Täter so brutal zugeschlagen wie im Fall der Maria Weber. Was die Kriminalbeamtin auf die Idee brachte, daß diese den Täter erkannt, ihn vielleicht sogar beim Namen genannt hatte. Woraufhin er ihr in der Absicht, sie zu töten, mit einem Stein den Schädel einschlug.
Es gab eine vage Personenbeschreibung des Täters: ein großer, schwerer Kerl, dessen Atem nach Alkohol stank. Für die Polizei stand fest, daß es immer ein und derselbe gewesen sein mußte.
Mehr als eine Stunde war mittlerweile vergangen.
Zuerst glaubte Biggi, sich getäuscht zu haben. Dann aber wurde es ihr zur Gewißheit: Die Augenlider des Opfers begannen zu flattern, als Biggi ihre Frage zum x-ten Mal wiederholte: »Sie können mich hören, Frau Maria, nicht wahr …? Ich bin Kriminalbeamtin. Wir müssen dieses Schwein erwischen, das Sie so zugerichtet hat. Ich glaube, Sie haben ihn erkannt. Ist das richtig …? Haben Sie ihn erkannt …?«
Maria Weber atmete jetzt heftiger. Wieder dieses Zittern in ihrem Gesicht, als ob sie verzweifelt versuchte, die Augen zu öffnen.
»Beruhigen Sie sich, Frau Maria. Ich glaube, Sie zu verstehen. Sie haben ihn erkannt, nicht wahr …? Sie haben ihn erkannt.«
Der Hauch eines »Ja« hing in der Luft.
»Wer war es, wer war dieses Schwein?« Sie streichelte jetzt die Wangen der Frau.
Unverständliche Laute. Das Gesicht begann sich zu verkrampfen.
»Beruhigen Sie sich, Maria. Ich hole jetzt den Arzt, bin gleich wieder da.«
Sie stand auf, eilte auf den Gang. Der Arzt trank gerade im Schwesternzimmer Kaffee. »Kommen Sie bitte rasch«, rief Biggi, »ich glaube, sie kommt jetzt zu Bewußtsein.« Es klang wie ein Befehl. Der Doktor ließ seinen Kaffee stehen und eilte mit ihr zur Intensivstation.
Dort warf er einen kurzen Blick auf die Apparaturen, an die Maria Weber angeschlossen war. Fühlte dann ihren Puls und hob mit dem Daumen ein Augenlid. »Die Frau ist tot«, sagte er dann und nickte der Stationsschwester zu, die ihn fragend angesehen hatte.
Als Chefinspektor Fichtl den Bericht der Kriminalbeamtin gelesen hatte, fiel ihm nur noch ein Wort ein: »Scheiße«, sagte er.
Birgit Herzog hatte einen knapp gehaltenen schriftlichen Bericht über den Tod der Maria Weber abgeliefert. Da sie jedoch Vertrauen zu ihrem Chef hatte, konnte sie ihm darüber hinaus auch ihre Empfindungen und Vermutungen mitteilen. »Es ist ein Jammer, daß sie nicht mehr reden konnte«, sagte sie. »Aber sie hat meine Fragen verstanden, und ich bin ganz sicher, daß sie den Täter erkannt hat. Das konnte ich natürlich im Bericht nicht schreiben, sonst hieße es gleich wieder, das sei Weiberphantasterei. Kennst ja unseren Hofrat.«
Fichtl stimmte ihr zu. Er war sehr nachdenklich geworden. »Wenn du recht hast, Biggi, dann müssen wir den Bekanntenkreis der Frau unter die Lupe nehmen«, sagte er. »Und die Gendarmerie muß uns dabei helfen.«
Die Überfälle waren alle knapp am Stadtrand passiert, wo die örtliche Kompetenz der Wiener Kriminalpolizei endet und die Zuständigkeit der Gendarmerie Niederösterreichs beginnt. Natürlich arbeiten beide im Normalfall zusammen, doch wenn zwei verschiedene Wachkörper eine Sache bearbeiten müssen, kann es schon einmal zu Kompetenzüberschreitungen kommen. Ohne gute persönliche Beziehungen geht da nichts: Das war es, was der Chefinspektor mit seinem letzten Satz gemeint hatte.
Die beiden waren noch mitten im Gespräch, als Hofrat Putner ins Büro kam, in der Hand einige Zeitungen und eine Personalakte. Der Hofrat war ein Mann um die sechzig und Leiter des Sicherheitsbüros. Auch Ambitionen auf den Posten des Wiener Polizeipräsidenten wurden ihm nachgesagt. Ein sehr ehrgeiziger Polizeijurist also. Jetzt war er, wie seine Miene zeigte, aufgeregt und verärgert.
»Das hat mir gerade noch gefehlt!« rief er und warf die Zeitungen auf einen Schreibtisch. »Diese verdammten Zeitungsfritzen! Das müßt ihr lesen … hier … Die Bestie vom Bisamberg hat wieder zugeschlagen! Grauenvoller Sexualmord in Stammersdorf! Polizei unfähig und hilflos! … nach dem siebten Überfall der Bestie …!«
Chefinspektor Fichtl blieb gelassen. Er kannte diese Pressemeldungen, sie regten ihn nicht mehr auf. »Wir werden ihn schon kriegen, Hofrat«, meinte er nur.
Dieser Satz beruhigte den Hofrat natürlich nicht, doch er hörte wenigstens auf zu schimpfen und wechselte das Thema. »Hat sich der Neue noch nicht gemeldet, dieser Inspektor Brucker?« fragte er nervös.
»Der tritt seinen Dienst doch erst morgen an«, antwortete Fichtl ruhig.
Der junge Peter Brucker hatte den einjährigen Lehrgang für Kriminalbeamte und die vorgeschriebene Abschlußprüfung eben erst bestanden und war von der Personalabteilung dem Sicherheitsbüro zugeteilt worden. Was außergewöhnlich war, denn das SB ist eine Art Elitetruppe bei der Kripo, und man mußte zuvor auf den Bezirks-Kommissariaten seine Meriten erworben haben, um dorthin versetzt zu werden. Es war Chefinspektor Fichtl gewesen, der seinen ganzen Einfluß geltend gemacht hatte, diesen Brucker in seine Abteilung zu bekommen. Das aber wußte Hofrat Putner nicht.
»Da ist die Personalakte des jungen Herrn«, sagte er anklagend. »Na, da haben wir ja einen schönen Fang gemacht! Ich habe die Akte gelesen. Neigt zur Oberflächlichkeit und Unpünktlichkeit, steht da drin. Und als sehr eigenwillig wird er beschrieben, und von seinen Vorgesetzten nimmt er wenig Notiz, steht da. – Ich verstehe nicht, wie man uns einen solchen Typen überlassen kann!«
Die Kriminalbeamtin kicherte leise. Sie kannte den Grund von Fichtls Bemühungen. Indigniert verließ der Hofrat das Büro, jetzt lachte Biggi laut. »Bin schon echt neugierig auf deinen Schützling, Chef.«
»Daß du dich bloß nicht verliebst in den Brucker«, grinste der Chefinspektor, »so wie ich vor einem Jahr.«
Vor einem Jahr war im 12. Wiener Gemeindebezirk ein Großkaufhaus überfallen worden, kurz nach Ladenschluß. Der unbekannte Täter war mit fast einer Million Schilling geflüchtet. Chefinspektor Fichtl recherchierte am Tatort. Er fluchte, weil gar kein Anhaltspunkt, keine Spuren zu finden waren. Ein dunkel gekleideter Mann mit dunkler Brille war plötzlich wie aus dem Boden gewachsen vor den Kassierern aufgetaucht und hatte mit einer Pistole gedroht, die Geldsäcke geschnappt und war darauf sofort wieder verschwunden. Als die Kassierer den Alarm auslösten, war von dem Täter nichts mehr zu sehen. Nur eine Zeugin, eine ältere Dame, wußte zu berichten, daß auf dem Parkplatz vor dem Kaufhaus, gerade als die Alarmsirenen zu heulen begannen, ein Auto wegfuhr. Es war schon dunkel, und ihr fiel auf, daß der Fahrer die Autoscheinwerfer nicht eingeschaltet hatte. Kennzeichen und Automarke konnte die alte Dame nicht angeben. Ein rotes Auto war es, mehr wußte sie nicht. Diese Nachricht war über Funk an alle Polizisten durchgegeben worden. Es wurden Straßensperren errichtet, und Polizeistreifen kontrollierten alle roten Autos in der Umgebung des Tatortes. Die Chance, den Täter zu finden, war gering.
Als die Tatbestandsaufnahme schon beendet war und Fichtl und seine Leute im Kommissariat Niederschriften und Berichte tippten, kam der diensthabende Wachkommandant herein und flüsterte Fichtl etwas ins Ohr. »Der Täter sitzt bei uns im Wachzimmer«, sagte er. »Geld und Tatwaffe sind sichergestellt, er ist geständig.«
Chefinspektor Fichtl glaubte zu träumen.
Unten im Wachzimmer deutete ein junger Polizist namens Peter Brucker auf einen gefesselten Mann, dann auf die Geldsäcke und eine Pistole. »Das ist der Trottel«, sagte der junge Polizist freundlich. Er hatte den Räuber festgenommen. Fichtl ließ sich den Sachverhalt von ihm unter vier Augen berichten.
Wachmann Brucker hatte an einer ungeregelten Straßenkreuzung Verkehrsdienst gehabt. Eine Stunde lang hatte er Halte- und Freizeichen gegeben. »Luftmischen« nennt man das bei der Sicherheitswache. Von dem Raubüberfall und der Fahndung nach dem roten Auto hatte er aus seinem Handfunkgerät gehört. Auf dem Weg in sein Wachzimmer mußte er an seinen Wachkommandanten denken, der mit ihm wieder unzufrieden sein würde. Im Rahmen eines sogenannten »Schwerpunktprogramms« sollte unverschlossen abgestellten Autos besondere Aufmerksamkeit gelten. Die hohen Herren Polizeistrategen waren nämlich der Ansicht, daß dieser Leichtsinn an den vielen Autodiebstählen schuld wäre. Der junge Wachmann Brucker teilte diese Ansicht allerdings nicht. Er hatte vor einigen Jahren einen Urlaub auf Zypern verbracht und festgestellt, daß dort kaum jemand sein Auto abschließt. Trotzdem wird selten gestohlen. Weil die Strafe für Diebstahl beträchtlich hoch ist und Diebe geächtet sind. Wachmann Brucker hatte also, im Gegensatz zu seinen Kollegen, noch kein unverschlossen abgestelltes Auto gemeldet.
Bis er vor einem Wohngebäude eines sichtete, einen roten Opel. Er wollte schon vorbeigehen, als ihm der Raubüberfall im Kaufhaus einfiel. Routinemäßig prüfte er Motorhaube und Auspuff, beides war noch warm.
Vom Hausmeister des Wohnblocks erfuhr er den Namen des Fahrzeugbesitzers. Ein paar Minuten später läutete er an dessen Wohnungstür. Als geöffnet wurde, grüßte er höflich, murmelte etwas von einer Routinekontrolle und fragte, wie lange der rote Opel schon vor dem Haus stehe.
Anton Germek, so hieß der Autobesitzer, erklärte überzeugend, daß er den ganzen Tag das Auto noch nicht bewegt habe, und wollte schon die Tür schließen. Das sollte ihm jedoch nicht gelingen. Erschrocken sah er, daß der freundliche Polizist plötzlich eine Pistole in der Hand hielt. Im Nu waren ihm Handschellen angelegt. Die Geldsäcke und die Pistole fand Peter Brucker im Wohnzimmer, Germek hatte ja noch keine Zeit gehabt, beides zu verstecken. Wieso die Polizei ihm so rasch auf die Spur gekommen war, verstand dieser ganz und gar nicht.
Chefinspektor Fichtl gefiel die Schilderung des Wachmanns ganz ausgezeichnet. Besonders imponierte ihm dessen bescheidene Darstellung, wonach das Ganze purer Zufall war. Er hätte sich ja als Sherlock Holmes aufspielen können, wie das so oft geschieht.
»Du hörst in den nächsten Tagen von mir, junger Kollege«, sagte der Chefinspektor. Dann befaßte er sich intensiv mit dem immer noch verwirrten Anton Germek.
Kurz danach erlebte Peter Brucker etwas Erfreuliches: Wegen außergewöhnlicher Dienstleistung wurde ihm ein lobendes Zeugnis überreicht – ein Zeichen besonderer Anerkennung für einen jungen Beamten wie ihn. Fichtl hatte das veranlaßt. Und dann wurde er eines Tages ins Sicherheitsbüro gerufen. Der Chefinspektor hätte mit ihm zu reden.
Der machte es sehr kurz. »Möchtest du Kriminalbeamter werden?«
Für Peter kam diese Frage völlig überraschend. »Natürlich möchte ich das«, sagte er. »Die Uniform los sein und mehr Geld verdienen, das wäre nicht schlecht. Aber ich habe doch keine Chance. Soviel ich weiß, kommen auf einen Dienstposten bei der Kripo fünfzig Bewerber. Oder noch mehr.«
»Bewirb dich trotzdem«, sagte Chefinspektor Fichtl, »alles weitere überlaß mir.«
»Keine Angst, Chef«, lachte Biggi Herzog. »Ich bin mehr für die reiferen Jahrgänge.« Dann wurde sie ernst. »Willst du den Brucker schon bei der Bisambergbestie einsetzen?« fragte sie.
Fichtl schüttelte den Kopf. »Zuerst muß er einmal bei uns das Gehen lernen«, sagte er. Dann telefonierte er mit dem Gendarmerieposten der Ortschaft Bisamberg. Er wollte mit dem Postenkommandanten reden. Der war aber im Außendienst. »Dann ruf ich morgen wieder an«, sagte Fichtl und legte auf. »Auf einen Tag wird es wohl jetzt nicht ankommen«, brummte er.
Am nächsten Morgen klingelte das Telefon, kaum daß Fichtl sein Büro betreten hatte. Es war der Bisamberger Postenkommandant, der meinte, es wäre höchste Zeit, sich einmal zusammenzusetzen. Dieser Meinung war der Chefinspektor ebenfalls und versprach, gleich hinauszufahren, bevor noch irgendein Hofrat oder Gendarmerieoberst etwas anderes anordnen konnte. Fichtl mußte so etwas wie eine Vorahnung gehabt haben, denn kaum war er draußen, kam Hofrat Putner herein und reagierte wie immer ziemlich verärgert, als Birgit Herzog ihm von Fichtls Weggang berichtete.
»Warum meldet er mir das nicht?« fauchte er. »Immer diese Eigenmächtigkeiten.«
»Aber Herr Hofrat«, versuchte Biggi zu beschwichtigen, »er wird Ihnen halt berichten, wenn er zurückkommt.«
»Dann ist es zu spät«, brummte Putner. Er erzählte daraufhin der Kriminalbeamtin, daß der Innenminister im Falle »Bisambergbestie« die Bildung einer Sonderkommission angeordnet hatte. Offenbar unter dem Druck der Presse sollte eine solche Kommission die Ermittlungen in diesem Fall koordinieren. »Die Zusammensetzung der Sonderkommission steht noch nicht fest, die einzelnen Mitglieder aus Polizei und Gendarmerie werden vom Ministerium bestimmt«, sagte der Hofrat.
Während er noch einmal seinen Unmut äußerte, klopfte es an der Tür, und ein junger Mann trat ein, grüßte freundlich. Er trug Bluejeans, darüber ein Jeanshemd mit aufgesetzten Taschen, die Ärmel hochgekrempelt. In einer Hand hatte er eine Plastiktasche.
»Sie wünschen bitte?« fragte der Hofrat knapp.
»Eigentlich nichts«, lächelte der junge Mann. »Ich soll mich hier zum Dienst melden. Mein Name ist Peter Brucker.«
Der Hofrat blickte scharf über seinen Brillenrand.
»Ach, Sie sind der Neue«, sagte er nur. Dann zu Birgit Herzog: »Der Chefinspektor soll sofort zu mir kommen, wenn er zurück ist.« Dann ging er. Unter der Tür drehte er sich noch einmal um. »Haben Sie keine Krawatte?« fragte er Brucker in scharfem Ton.
»Sogar fünf habe ich«, lächelte dieser, »sogar fünf.« Der Hofrat knallte die Tür zu.
»Wer war denn dieser Komiker?« fragte Brucker die Kriminalbeamtin. Mit unterdrücktem Lachen sagte sie: »Das war Hofrat Putner, der Leiter des Sicherheitsbüros.«
»Sieht so aus, als ob er mich nicht mag«, meinte Brucker unbekümmert. »Beruht aber ganz auf Gegenseitigkeit«, lächelte er wieder. »Und darf ich wissen, wer Sie sind?«
»Biggi Herzog, ich bin Kriminalbeamtin. Leider die einzige.«
»Tag, Biggi«, sagte er und streckte ihr die Hand hin. »Man sieht Ihnen an, daß Sie mehr kriminalistischen Verstand unter dem Rock haben als der Hofrat im Kopf.«
Sie wußte nicht, ob sie beleidigt reagieren oder lachen sollte.
»Bitte fassen Sie das als Kompliment auf«, sagte Brucker.
Da mußte Biggi doch laut und herzlich lachen.
Nachdem die Situation nun einigermaßen entspannt war, wollte Brucker wissen, ob es hier so etwas wie einen Schreibtisch für ihn gäbe. »Der Tisch dort in der Ecke«, sagte Biggi, »er wackelt zwar ein bißchen, aber daran gewöhnen Sie sich.«
Brucker ging in die Ecke.
»Das also ist mein neuer Arbeitsplatz«, sinnierte er. Der Schreibtisch wackelte wirklich beträchtlich. »Gibt es hier auch eine Dienstvorschrift für Kriminalbeamte?« Die Frage kam einigermaßen überraschend.
»Dort im Bücherregal, ganz rechts oben, in Leder gebunden«, sagte die Kriminalbeamtin.
Brucker holte sich das Büchlein.
Er ging wieder zu seinem Schreibtisch, schob die Dienstvorschrift unter das kürzere Tischbein. »Paßt genau«, sagte er. »Ich hab’ schon immer gewußt, daß eine Dienstvorschrift praktisch anwendbar sein kann.«
Peter Brucker wurde 1952 in Wien als uneheliches Kind geboren, seinen Vater hatte er nie kennengelernt. Die Mutter sprach wenig über ihn. Sie arbeitete als Verkäuferin in einem Textilgeschäft, und der kleine Peter war tagsüber in einem Kinderhort. Abends holte ihn seine Mutter dort ab. Die Wochenenden und Feiertage verbrachte er ganz bei ihr. Mit sechzehn begann er eine Lehre als Schlosser. Erst ab dieser Zeit vergaß er allmählich den Makel seiner unehelichen Geburt und die hämischen Fragen taktloser Mitschüler nach seinem Vater. Er war ein schlanker, gutaussehender junger Mann mit großem Interesse an Sport. Er spielte Tennis und Fußball in einem Unterklassenverein und träumte davon, einmal ein Profi zu werden.
Daraus wurde nichts, denn nach Abschluß seiner Lehrzeit fand er eine Stelle in einer Autofabrik und hatte viel zuwenig Zeit für ein geregeltes Training. Drei Jahre arbeitete er dort, dann spielte seine Mannschaft eines Sonntags gegen eine Mannschaft der Polizei. Unter seinen Gegenspielern waren ein paar nette Burschen, zu denen sich eine Art Freundschaft entwickelte. Er interessierte sich für deren Arbeit, und sie rieten ihm, sich doch einfach bei der Polizei zu bewerben. So absolvierte er die Eignungsprüfungen und besuchte dann zwei Jahre die Polizeischule. Anschließend fand er eine Stelle auf einem Kommissariats-Wachzimmer. In der Polizeischule wurde viel Wert auf körperliche Ertüchtigung gelegt, man trainierte hart, sehr zur Freude des jungen Brucker. Seit drei Jahren war er stolzer Titelverteidiger des österreichischen Polizei-Fünfkampfmeisters.
Abgesehen vom Sport interessierte sich Peter Brucker vorwiegend für zwei Gebiete. Erstens für das weibliche Geschlecht und zweitens für Psychologie. So selbstverständlich das eine war, so ungewöhnlich war das andere Hobby bei einem jungen Mann. Mit beidem befaßte er sich in Theorie und Praxis gleichermaßen intensiv, wenn auch seine praktischen Aktivitäten bei den Weibern bei weitem überwogen. Mit der Psychologie war das umgekehrt, da hatte mangels praktischer Möglichkeiten die Theorie Vorrang. Immerhin studierte er sehr ernsthaft die Werke von Wertheimer, Köhler und natürlich die von Sigmund Freud.
Seine Mutter hatte mittlerweile einen Lebensgefährten gefunden. Um die beiden nicht zu stören, und wohl auch, um selbst nicht gestört zu werden, mietete er sich eine kleine Junggesellenwohnung. Sie bestand nur aus einem einzigen Raum und einer Duschkammer, entsprach aber ansonsten all seinen Wünschen. Die Einrichtung bestand aus einem riesigen Bett mit vielen Decken und Polstern, daneben hatte er quer durch das Zimmer eine Hängematte gespannt. An der Wand hatte er ein Regal mit vielen Büchern festgemacht. Das war alles. Kleider, Schuhe und andere weniger wichtige Gegenstände des täglichen Lebens wurden mehr oder minder sorgfältig in den Zimmerecken verstaut.
Als Chefinspektor Fichtl von dem Gendarmerieposten Bisamberg zurück in sein Büro kam, hatte Hofrat Putner bereits zweimal nach ihm telefoniert. So blieb Fichtl gerade so viel Zeit, seinem Schützling Brukker die Hand zu drücken und eine Zigarette zu rauchen. Dann ging er hinüber in das Büro des Abteilungsleiters. Er blieb fast eine Stunde dort. Biggi Herzog meinte, das verheiße nichts Gutes. Und sie sollte recht behalten.
Als Fichtl in sein eigenes Büro zurückkam, schenkte er sich erst einmal einen Schnaps ein. Einen doppelten. Er trank langsam und wortlos. Das war bei ihm üblich, wenn er ein ernstes dienstliches Problem hatte. Beim zweiten Glas schilderte er seinen Mitarbeitern die Situation:
Die Sonderkommission zur »Bisambergbestie« war konstituiert, sie bestand aus sechs Mitgliedern: einem Gendarmeriegeneral, einem Gendarmerieoberst, einem Ministerialrat des Innenministeriums und dem Hofrat Putner vom Sicherheitsbüro, dem Chef des Gerichtsmedizinischen Instituts und zuletzt – und das war für Fichtl das schlimmste – aus einem Psychiater. Die Kommission würde ab morgen täglich um 10 Uhr zusammentreten, um den Stand der Ermittlungen zu diskutieren und die weiteren Fahndungsmaßnahmen zu beschließen.
Mit anderen Worten: Fichtl mußte Hofrat Putner täglich um 9 Uhr berichten und gegen elf die Weisungen der Kommission in Empfang nehmen. Er hielt überhaupt nichts von dem Ganzen, denn was sollte schon dabei herauskommen, wenn ein halbes Dutzend Theoretiker gescheit und wissenschaftlich daherredet. Leute, die ihre kriminalistischen Kenntnisse aus Lehrbüchern, Fachschriften oder Seminaren geschöpft hatten. Und von denen keiner auch nur einen Fahrraddiebstahl geklärt hatte.
Dabei hatte der Tag für Fichtl so hoffnungsvoll begonnen. Der Bisamberger Postenkommandant, den er getroffen hatte, hieß Hans Binder und war ein Mann ganz nach dem Geschmack des Chefinspektors. Ein Praktiker, der das Leben und auch die Menschen in seiner Abteilung kannte, dem gesunder Hausverstand über alles ging. Die beiden hatten sich vom ersten Augenblick an gut verstanden. Als Fichtl erzählte, daß nach Ansicht seiner Kriminalbeamtin der Verbrecher eventuell von der Ermordeten erkannt worden war, hatte Binder zustimmend genickt. Beide hatten daraufhin beschlossen, daß der Postenkommandant sich nun auf den Bekanntenkreis der Maria Weber konzentrieren werde. Auch vereinbarte man gemeinsame Nachtstreifen in der kritischen Gegend zu den kritischen Zeiten. Der Erfolg dieses Unternehmens fand sich aber jetzt, da die Sonderkommission das Sagen hatte, in Frage gestellt.
»Was haben denn die Gescheitwascheln in der Kommission vor?« fragte Biggi, nachdem Fichtl ihr von der Zusammenkunft berichtet hatte.
»Was die Polizei immer tut, wenn gar keine Spur vorhanden ist«, seufzte Fichtl. »Aufrufe an die Bevölkerung zur Mitarbeit, das heißt Aussetzung einer Geldprämie für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, Aufforderung an Frauen, nach Einbruch der Dunkelheit die betreffende Gegend zu meiden. Der übliche Blödsinn halt.«
In den nächsten Tagen lernte Peter Brucker also »das Gehen« bei der Kriminalpolizei, wie es der Chefinspektor formuliert hatte. Er lernte die Aktenerledigung und das Priorieren, er lernte seine Kollegen kennen, stellte fest, daß es hier wie überall hilfsbereite, abweisende und gleichgültige Mitarbeiter gab. Er erfuhr von den Möglichkeiten und Grenzen der Kriminaltechnik und des Erkennungsdienstes, und er lernte die Polizeijuristen des Sicherheitsbüros zu schätzen oder aber zu verabscheuen – zumeist war letzteres der Fall.
Er informierte sich über die Methoden der Fahndungsgruppe und war beeindruckt von den Lokal- und Personalkenntnissen dieser Kollegen. Sie kannten tatsächlich nicht nur die Ganoven, Zuhälter und Huren der einzelnen Bezirke persönlich, sondern waren auch mit deren Lebensgewohnheiten vertraut. Vieles zeigte sich in der Realität ganz anders, als man es ihm in der Kriminalbeamten-Schule beigebracht hatte, und oftmals dachte er über die Gründe nach, warum bei der Kriminalpolizei zwischen Theorie und Praxis eine so große Kluft besteht.
Wann immer er Zeit hatte, studierte er die dicke Akte über die Verbrechen der Bestie vom Bisamberg und versuchte von der Kriminalbeamtin Herzog weitere Einzelheiten zu erfahren, die nicht in der Akte standen. Biggi war grundsätzlich freundlich und hilfsbereit, aber sie hatte eben auch ihre eigene Arbeit mit ihren Problemen und war nicht immer zu Plaudereien mit dem neuen Kollegen aufgelegt. Chefinspektor Fichtl konnte sich um die praktische Ausbildung von Peter Brucker auch nicht so intensiv kümmern, wie er es gerne getan hätte. Denn all seine Befürchtungen bezüglich der Sonderkommission waren eingetreten, und er war ständig mit den Anweisungen von Hofrat Putner beschäftigt. »Alles leere Kilometer«, antwortete er nur auf neugierige Fragen des jungen Brucker.
Die »Hinweise aus der Bevölkerung«, die nach den massiven Presseverlautbarungen der Sonderkommission über die Bisambergbestie eingelangt waren, füllten einen eigenen Ordner. In Aktenvermerken hatten alle Sicherheitsdienststellen festgehalten, was brave Staatsbürger schriftlich oder mündlich den zuständigen Ordnungshütern anvertraut hatten. Der Chefinspektor blätterte in diesem Ordner nur flüchtig. Er fluchte und meinte, ebensogut wie diese Aussagen könnte er ein Mickey-Mouse-Heft lesen, es käme auf dasselbe heraus. Tatsächlich enthielt der Ordner überwiegend Meldungen von seiten älterer Menschen, die Nachbarn verdächtigten, weil diese ihre Hunde mißhandelten, öfter betrunken randalierten oder einen »stechenden Blick« hatten. Nur Biggi Herzog widmete diesen Meldungen täglich Aufmerksamkeit. Nach der Lektüre schien sie jedoch immer wieder enttäuscht zu sein. Neugierig fragte Brucker sie daher eines Tages, was sie denn von den »Hinweisen aus der Bevölkerung« eigentlich erwarte. Ihre Antwort überraschte ihn:
»Ich hoffe immer noch, daß sich einmal eine bisher unbekannte Frau meldet, die behauptet, ebenfalls überfallen worden zu sein«, sagte sie.
»Eine Frau, die wir noch nicht kennen …?« fragte er. »Was meinst du damit?«
»Ich bin ganz sicher, daß es einige gibt«, sagte Biggi. Und dann erklärte sie: Nach ihren Erfahrungen erstatten viele Frauen nach einem Sexualattentat keine Anzeige. Aus Schamgefühl und Angst vor dem dummen Gerede, das dann in ihrem Bekanntenkreis entsteht. Weil die Zeitungen solche Fälle gerne bis ins Detail berichten und bei Gerichtsverhandlungen die Verteidiger der Täter peinliche Fragen stellen: Ob die Opfer die Notzucht vielleicht durch provozierendes Verhalten selbst verursacht, eingeleitet hätten. Ob ihnen vielleicht der ganze Notzuchtvorgang gar nicht so unangenehm gewesen wäre.
»Ich bin ganz sicher«, wiederholte Biggi heftig, »daß es einige gibt, von denen wir gar nichts wissen. Und die uns helfen könnten. Aber es ist ja kein Wunder, wenn die das Maul halten. Wer will schon in der Zeitung namentlich und mit Foto als Opfer der Bisambergbestie vertreten sein.«
Peter Brucker hatte darauf geschwiegen. Aber als Biggi den Ausdruck »provozierendes Verhalten« gebraucht hatte, da war ihm zum ersten Mal der zündende Gedanke gekommen. Die Idee, wie man den Täter vom Bisamberg ausfindig machen könnte …
Für seine privaten Hobbys hatte Peter wenig Zeit in diesen turbulenten Tagen. Statt Sigmund Freud las er die Akte über die Bisambergbestie, und seine lockeren Mädchenkontakte reduzierte er auf Erika. Nicht daß er etwa in das Mädel verliebt gewesen wäre, umgekehrt war das wohl auch nicht der Fall. Aber es schmeichelte seiner männlichen Eitelkeit, wenn er mit Erika in ein Lokal ging und alles rundherum sie angaffte und tuschelte. Sie war ein außergewöhnlich hübsches Mädchen, die blonde Erika, mit guten Chancen, die Wahl zur Miss Vienna oder Miss Popo zu gewinnen. Doch sie hätte so etwas wie einen Manager zum Freund gebraucht, keinen Kriminalbeamten. Denn ihr Beruf, sie war Friseurin, brachte sie kaum mit einflußreichen Leuten zusammen, und ohne die landet man als Fotomodell – und das wollte sie werden – höchstens in drittklassigen Porno-Heftchen.
Peter saß mit seiner schönen Erika in einem Bistro in der Nähe seiner Wohnung, und sie beschwerte sich schon seit einer Viertelstunde, weil er sie so lange hatte warten lassen. Sie waren zum Kino verabredet gewesen, und nun verpaßte sie Rhett Butler in »Vom Winde verweht«. Erikas Lieblingsfilm. Peter hatte seine Unschuld beteuert und ihr zu erklären versucht, daß Kriminalbeamte ihre Arbeit nicht einfach nicht acht Stunden hinlegen können, aber Erika hielt das für eine faule Ausrede. Als sie dann, immer noch wütend, mit wiegenden Hüften auf die Toilette ging und er ihr interessiert nachsah, fiel ihm wieder Biggis Formulierung vom »provozierenden Verhalten« ein, worauf er beschloß, mit Erika über seinen Plan zu reden.
Er tastete sich sehr vorsichtig an das Thema heran, als sie wieder an seinem Tisch saß.
»Wollen wir vielleicht nach Stammersdorf fahren?« fragte er einschmeichelnd. »Nach Bisamberg?«
»Zum Heurigen?« reagierte sie erfreut.
»Na, nicht direkt«, schränkte er ein. Dann erklärte er ihr, wie er sich das vorstellte: Sie sollte von der Straßenbahn-Endstation Stammersdorf über den Feldweg in Richtung Bisamberg spazieren. Er würde in angemessener Entfernung folgen. So ein abendlicher Spaziergang würde sicher nicht schaden, und nachher könne man in Bisamberg ja ein Heurigenlokal besuchen, etwas essen und trinken.
Ihr Gesicht war jetzt so finster wie vorhin nach dem versäumten Film.
Sie zischte: »Du willst mich als Köder benutzen, du Dreckskerl. Denkst du, ich lese keine Zeitungen? Du willst diese Bisambergbestie fangen, und ich soll den Lockvogel spielen …«
Er versuchte sie zu beruhigen: »Ich bin ja in deiner Nähe, passe auf dich auf …«
Sie war aufgestanden, nahm ihre Handtasche.
»Das ist doch das Letzte!« sagte sie wütend. »Du mieses Polizistenschwein, ich will dich nie wieder sehen …«
Sie verließ das Lokal, und er mußte die schadenfrohen Blicke anderer Gäste ertragen. Mit Erika ging es also nicht. Und dabei hatte er sich alles so einfach vorgestellt. Wenn der Täter über sie hergefallen wäre, hätte er ihn sofort überwältigen, festnehmen und der Gendarmerie übergeben können. Und er wäre der Held des Sicherheitsbüros geworden. Doch eigensinnig wie er war, gab er seinen Plan nicht auf. Irgend jemand würde sich finden, der mitmachte.
Am nächsten Morgen musterte ihn der Chefinspektor eine Weile und fragte dann, ob er für den Abend schon etwas vorhabe. Peter verneinte erstaunt.
Fichtl erklärte, daß er mit der letzten Straßenbahn nach Stammersdorf fahren und dort ein Lokal besuchen wolle. Ob der junge Inspektor Brucker mitkommen wolle …? Jetzt verstand Peter überhaupt nichts mehr. Sein Chefinspektor konnte eine Nachtstreife doch einfach anordnen und mußte nicht höflich herumfragen, ob er Zeit habe.
Fichtl wurde jetzt deutlicher: Es sei ja bei der Kriminalpolizei so, daß außerplanmäßige Nachtdienste als Überstunden bezahlt werden. Solche Dienste bedürften jedoch der Unterschrift des Abteilungsleiters. Was Fichtl vorhatte, wollte er aber Hofrat Putner nicht unbedingt sagen. Also müßten beide sozusagen privat und ohne Bezahlung auf Tour gehen.
Peter war mit dem Plan einverstanden. Da erzählte ihm sein Chef, was der Postenkommandant Binder festgestellt hatte: Jede der sieben überfallenen Frauen war mit der letzten Straßenbahn der Linie 31 von der Innenstadt bis zur Endstation Stammersdorf gefahren und von dort zu Fuß weitergegangen. Fichtl wollte sich das jetzt einmal ansehen und dann mit Binder plaudern. Nicht am Gendarmerieposten, in einem Wirtshaus. Wenn er diese Tatsache jetzt Putner melden würde, wüßte es am nächsten Tag die hohe Sonderkommission, und das wollte sowohl Fichtl als auch Binder vermeiden.
Die letzte Bahn der Linie 31 fährt vom Schottenring im ersten Bezirk um 23.30 Uhr nach Stammersdorf und bleibt dort in der Remise bis zum nächsten Tag um 5 Uhr früh. An der Haltestelle Schottenring mischten sich Fichtl und Brucker unter die wartenden Menschen und taten so, als wären sie sich fremd.
Man konnte beobachten, daß diese Straßenbahn von fast immer denselben Menschen benutzt wurde. Man kannte einander vom Sehen, nickte einander zu und wechselte belanglose Worte. Männer und Frauen, die in der Innenstadt arbeiteten und jetzt nach Hause fuhren. Sie wirkten müde und abgespannt nach einem anstrengenden Arbeitstag. Alle waren einfach gekleidet. Die Frauen trugen Taschen, einige Männer hielten Plastiktüten in der Hand, in denen Werkzeug schepperte oder auch Bierflaschen klirrten.
Im schwach beleuchteten Waggon war noch etwa ein Drittel der Sitzplätze frei. Die Fahrt dauerte dreißig Minuten, von Haltestelle zu Haltestelle wurde es leerer. Ab Groß-Jedlersdorf waren noch zwanzig Fahrgäste im Wagen, Fichtl und Brucker inbegriffen.
Man döste vor sich hin, denn das Rattern der Straßenbahnen wirkt einschläfernd. Ein dicker Mann, der Brucker schräg gegenüber saß, öffnete eine Flasche Bier und trank gierig. Eine offensichtlich schwangere Frau neben ihm strickte an einem Babyjäckchen. Der Dicke wollte mit ihr ins Gespräch kommen, aber die Schwangere sah nicht auf und gab kaum Antwort.
»Endstation Stammersdorf, alles aussteigen«, tönte es krächzend aus dem Lautsprecher. Alle stiegen aus. Nach wenigen Minuten hatten sich die Fahrgäste verstreut, waren auf dem Weg zu ihren Wohnungen. Fichtl und Brucker waren allein. »Wie geht es weiter, Chef?« fragte Brucker.
»Wir gehen jetzt in den Schwarzen Adler«, sagte Fichtl. »Das ist gleich da drüben. Und wenn ich mich dort in ein Gespräch einmische, dann hörst du nur zu und mischst dich nicht ein, ist das klar?«
»Alles klar, Herr Kommissar«, grinste Brucker.
Der Wirt vom Schwarzen Adler empfing die beiden mit »Sperrstunde, meine Herren«. Aber er hatte es nur spaßhaft gemeint, denn er ließ sie eintreten und sich zum Postenkommandanten Binder setzen. Binder war zwar in Zivil, doch da im kleinen Stammersdorf jeder jeden kennt und der Herr Inspektor jetzt für die beiden Fremden je ein Viertel Wein bestellte, war natürlich von Sperrstunde noch lange keine Rede.
Nur noch wenig Gäste waren im Schwarzen Adler.
Genaugenommen waren Binder und die beiden Fremden die einzigen, die an einem Tisch saßen. An der Theke standen noch fünf Männer und tranken ihr Bier. Der Dicke mit der Bierflasche aus der Straßenbahn war auch darunter. Alle fünf waren leicht angesäuselt und schimpften lauthals über die Politik und die Politiker. Dann war das Wetter dran, weil es schon so lange nicht mehr geregnet hatte und die Weinstauden am Bisamberg verdorrten, und schließlich ließen sie sich über die unfähige Polizei aus, die einem zwar wegen eines oder zwei Viertel Wein zuviel den Führerschein abnahm, die Bisambergbestie aber immer noch nicht gefunden hatte. Ängstlich beobachtete der Wirt die drei am Tisch, er wollte keinen Ärger haben.
»Das hätt’s unter dem Hitler net gegeben!« schrie der Dicke. Er war jetzt sichtlich betrunken.
»Kusch, Ferdl«, sagte der Wirt, »da bist du noch zu jung dazu, das verstehst du net.«
»Die Todesstrafe gehört wieder her!« schrie der Ferdl und trank sein Glas leer. Seine Freunde murmelten zustimmend. »Kusch, Ferdl«, sagte der Wirt noch einmal und warf einen Blick zum Postenkommandanten. Der aber kümmerte sich nicht um die Schimpfenden. Die drei am Tisch hatten die Köpfe zusammengesteckt und unterhielten sich sehr leise.
Hans Binder hatte eine Liste von den Männern der Ortschaft zusammengestellt, welche die Maria Weber gekannt haben mußte. Es ergab sich, daß ein einschlägig als solcher bekannter Sittlichkeitsverbrecher nicht darunter war. Einige hatten Vorstrafen wegen Körperverletzung, aber alles in allem nichts Aufregendes. Die üblichen Wirtshausraufereien. Fichtl erhielt einen Durchschlag der Liste ausgehändigt. Von draußen hörte man jetzt Hundegebell.
»Das ist meine Sonderstreife«, erklärte der Postenkommandant. »Ich habe einen Fährtenhund angefordert, mit dem ab jetzt meine Leute täglich von dreiundzwanzig Uhr bis zwei Uhr früh in der Gegend patrouillieren.«
»Weiß das die Sonderkommission?« fragte Fichtl.
»Sie werden es morgen erfahren«, antwortete Binder verdrossen.
»Wir werden den Täter damit zwar verscheuchen, aber nicht erwischen«, sinnierte Fichtl.
Binder meinte, er wäre sehr froh, wenn nichts mehr passieren würde. Dann machte er Fichtl einen leisen Vorwurf: »Ihr hättet der Presse nicht sagen sollen, daß die Weber Mitzerl nicht mehr reden konnte. Hätte in einer Zeitung gestanden, sie hätte noch geredet – wer weiß, der Strolch hätte vielleicht reagiert und sich dadurch verraten.«
Fichtl nickte. »Ja«, gab er zu, »das ist versäumt worden.«
Brucker hatte den beiden aufmerksam zugehört, dabei immer wieder die Männergruppe an der Theke beobachtet. Jetzt gab er seinem Chef ein Zeichen. Er sollte ja nicht unaufgefordert reden.
»Was ist?« fragte Fichtl.
»Wer ist denn der besoffene Fettling dort?« fragte Brucker. »Er ist mit unserer Straßenbahn gekommen.«
»Ferdinand Polacek«, sagte der Postenkommandant. »Arbeitet als Tankwart in der Stadt. Ihr findet ihn auf der Liste. Er wohnt neben dem Elternhaus der Weber Mitzi. Viermal die Woche besoffen, aber sonst harmlos.«
Die Tür ging auf, und ein unangenehmer Typ kam herein. Jüngerer Mann mit langem Haar, Ohrstecker, schwarze Lederjacke, auf der Bildchen von nackten Weibern klebten.
»Der steht auch auf der Liste«, sagte Binder. »Leopold Kucharsky, ein Cousin des Wirts. Arbeitet hier aushilfsweise als Kellner. Hat es bei der Weber Maria immer wieder probiert, sie hat ihn aber abgelehnt.«
»Kann ich verstehen«, murmelte Fichtl und beobachtete den Leopold.
»Ich brauch’ dich heut’ nicht, Poldl«, sagte der Wirt, »ist ja nichts los.«
Der Poldl nickte, schenkte sich ein Glas ein und stellte sich zu den anderen. »Draußen ist alles voller Gendarmen«, sagte er. »Einen Hund haben’s jetzt auch. Das wird denen auch nichts nützen. Mit einem Hund werden’s die Bestie nicht fangen.«
Es entwickelte sich eine rege und laute Diskussion über den Wert eines Polizeihundes bei der Verbrechensbekämpfung. Mit jedem Schluck Wein wurden die vorgebrachten Argumente heftiger.
»Hör sie dir an«, meinte Binder. »In einer haben Stunde gehen dann alle heim, voll von Alkohol und Aggressionen. Und dann ist jedem alles zuzutrauen. Oder fast alles.«
Fichtl und Brucker fuhren mit einem Taxi zurück in die Innenstadt. In einem Café am Schottenring genehmigten sich die beiden noch ein Glas Wein. Dem Chefinspektor war anzumerken, daß er mit der Situation im Fall »Bisambergbestie« gar nicht zufrieden war.
»Er wird jetzt nicht zuschlagen, solange die Gendarmeriestreifen unterwegs sind«, sinnierte er. »Aber ewig kann man ja die Gegend nicht lückenlos überwachen. Ich muß mir da etwas einfallen lassen.«
»Wie wäre es mit einem Köder?« fragte Brucker unvermittelt.
»Ein Köder …?«
Brucker erklärte, er könne schon irgendwo eine junge Frau auftreiben, die für ihn die Feldwege nach Bisamberg benutzen würde. Sie müßte aber mit der letzten 31 er nach Stammersdorf fahren und das Ganze einige Nächte lang in aufreizender Kleidung durchexerzieren. »Es kann nichts passieren, Chef«, sagte er eifrig. »Ich bin immer in ihrer Nähe. Wenn er zuschlägt, dann fass’ ich ihn.«
»Vergiß diesen Blödsinn«, sagte Fichtl ernst.
»Aber warum, Chef?« Brucker war enttäuscht.
»So etwas nennt man ›agent provocateur‹, das ist nach der Strafprozeßordnung streng verboten. Wenn Hofrat Putner das erfährt, reißt er uns den Arsch auf.«
Für den Chefinspektor war dieses Thema hiermit erledigt. Nicht aber für den eigensinnigen jungen Brucker.