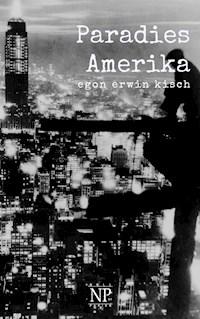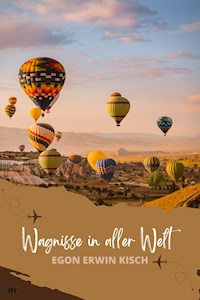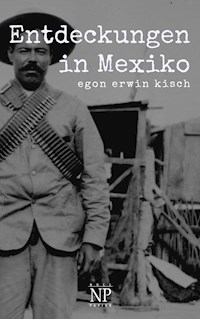Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kisch bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Fassung in aktueller Rechtschreibung Mit einem Vorwort von Kurt Tucholsky Egon Erwin Kisch gilt als einer der bedeutendsten Reporter in der Geschichte des Journalismus. Nach dem Titel eines seiner Reportagebände wurde er auch als "der rasende Reporter" bekannt. "Schreib das auf, Kisch!" wurde zum geflügelten Wort in den 1920ern. Lesen Sie hier 48 seiner gelungensten Reportagen und Essays. "Reportage ist eine sehr ernste, sehr schwierige, ungemein anstrengende Arbeit, die einen ganzen Kerl erfordert. Kisch ist so einer." [Kurt Tucholsky] Mit 238 Fußnoten Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Egon Erwin Kisch
Der rasende Reporter
Egon Erwin Kisch
Der rasende Reporter
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: E. Reiss, Berlin, 1925 (317 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962816-85-8
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Der rasende Reporter
Unter den Obdachlosen von Whitechapel
Ein Spaziergang auf dem Meeresboden
Wie der Einbrecher Breitwieser erschossen wurde
Die Weltumseglung der ›A. Lanna 8‹
Experiment mit einem hohen Trinkgeld
Der Flohmarkt von Clignancourt
Erkundungsflug über Venedig
Totenfeier in Kopenhagen
Versteigerung von Castans Panoptikum am 24. Februar 1922
Ada Kaleh, Insel des Islam
Meine Tätowierungen
Eine Nacht beim Türmer von St. Stephan
Elf Totenköpfe auf dem Katheder
Shipping Exchange
Das Nest der Kanonenkönige: Essen
Mit Auswanderern durch Frankreich
Bombardement und Basarbrand von Skutari
Übungsplatz zukünftiger Clowns
Die Hochschule für Taschenspieler
Bei den Heizern des Riesendampfers
Referat eines Verbrechers über die Polizeiausstellung
Schweineschlachten am Roeskildefjord
Erregte Debatte über Schiffskarten
Nachforschungen nach Dürers Ahnen
Geheimkabinett des anatomischen Museums
Stahlwerk in Bochum, vom Hochofen aus gesehen
Der Raubmord im Hotel Bristol
Heringsfang
Streifzug durch das dunkle London
Fahrt unter Wasser
Missgeburten des Porzellans
Bürgerkrieg um die Festung Küstrin
Luftbahnhof und Regenbogen
Abenteuerliche Schicksale einer Königskrone
Wallfahrtsort für Kriegshetzer
Faschingskostüme
Eines Scharfrichters Lebenslauf
Elliptische Tretmühle
Fürst Bolkonski am Grabe Trencks
Prüfungssorgen, Prüfungssorgen
Nachtleben auf dem Polesaner Kai
Dies ist das Haus der Oper
Generalversammlung der Schwerindustrie
Das Fuchsloch des Herrn von Balsac
Wat koofe ick mir for een Groschen?
Jiddisches Literaturcafé
Tote Matrosen stehen vor Gericht
Mittwoch in Kaschau
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Kisch bei Null Papier
Paradies Amerika
Der Mädchenhirt
Schreib das auf, Kisch!
Geschichten aus sieben Ghettos
Der rasende Reporter
Entdeckungen in Mexiko
Marktplatz der Sensationen
Hetzjagd durch die Zeit
Wagnisse in aller Welt
Der rasende Reporter
(Ja, du kriegst deine Besprechung –!)
Egon Erwin Kisch, der tschechische Journalist, hat (bei Erich Reiß in Berlin) ein bunt eingeschlagenes Buch herausgegeben: ›Der rasende Reporter‹. »Na, rasend ... «, würde Christian Buddenbrook sagen ... Kisch – von dem die entzückende Geschichte geht, dass Alfred Polgar ihm einst als Dedikation in ein Buch geschrieben habe: »Dem feinsinnigen Revolutionär und unerschrockenen Journalisten« – gibt hier eine mannigfaltige Sammlung seiner Berichte aus aller Welt: Whitechapel und die Erschießung des Wiener Einbrechers Breitwieser und etwas von den Heizern des Riesendampfers und Heringsfang und Taucher auf dem Meeresgrunde und der Golem und Fürst Bolkonski am Grabe Trencks. Das liest sich glatt und unterhaltsam, und dazu wäre nun weiter nichts zu bemerken.
Aber das Vorwort hat mich mehr gefesselt als das ganze Buch. »Die spärlichen Versuche«, heißt es darin, »die gemacht werden, die Gegenwart festzustellen, die Zeit zu zeigen, die wir leben, leiden vielleicht daran, dass ihre Autoren nicht ganz gewöhnliche Menschen sind ... Der Reporter hat keine Tendenz, hat nichts zu rechtfertigen und hat keinen Standpunkt.«
Das gibt es nicht. Es gibt keinen Menschen, der nicht einen Standpunkt hätte. Auch Kisch hat einen. Manchmal – leider – den des Schriftstellers, dann ist das, was er schreibt, nicht immer gut. Sehr oft den des Mannes, der einfach berichtet: Dann ist er ganz ausgezeichnet, sauber, interessant – wenngleich nicht sehr exakt, nicht sachlich genug. Denn Schopenhauer, den er da im Vorwort heranholt, hat etwas andres gemeint. (»Ganz gewöhnliche oder platte Menschen können vermöge des Stoffes sehr wichtige Bücher liefern, indem derselbe grade nur ihnen zugänglich war, zum Beispiel: Beschreibungen ferner Länder, seltener Naturerscheinungen, angestellter Versuche, Geschichte, deren Zeugen sie gewesen, oder deren Quellen aufzusuchen oder speziell zu studieren sie sich Mühe und Zeit genommen haben.«) Man lese einmal die bescheidenen, demütigen, beinahe unpersönlichen älteren Berichte dieser Art, und man wird den Unterschied zwischen diesen Reisenden und einem modernen Reporter erkennen, der überall ein Quäntchen ›Geist‹, ein Zitatchen, eine Schmeichelei über die Bildung seiner Leser – kurz: Der ›Zeitung‹ in seinen Bericht bringt. Nicht zu vergessen, wo diese angeblich unpersönlichen Berichte stehen: in einem Wust von Nachrichten, dummem Zeug, Telegrammen, Feuilletons und Inserenten.
Kisch hat recht; es ist töricht, in das Geschrei: »Das ist nur ein Reporter!« mit einzustimmen. Reportage ist eine sehr ernste, sehr schwierige, ungemein anstrengende Arbeit, die einen ganzen Kerl erfordert. Kisch ist so einer. Er hat Talent, was gleichgültig ist, und er hat Witterung, Energie, Menschenkenntnis und Findigkeit, die unerlässlich sind.
Vieles ist gut gesehen, fast alles ganz unbestochen. Aber wie ›sachlich‹ man auch oder wie weit weg vom Thema man auch schreiben mag: Es hilft alles nichts. Jeder Bericht, jeder noch so unpersönliche Bericht enthüllt immer zunächst den Schreiber, und in Tropennächten, Schiffskabinen, Pariser Tandelmärkten und Londoner Elendsquartieren, die man alle durch tausend Brillen sehen kann – auch wenn man keine aufhat –, schreibt man ja immer nur sich selbst.
Peter Panter (Kurt Tucholsky) Die Weltbühne, 17.02.1925, Nr. 7, S. 254.
Unter den Obdachlosen von Whitechapel
Auch die Männer und Burschen, die in schmutzigen Fetzen in den Haustoren und Fenstern der Lumpenquartiere Ostlondons zu sehen sind, sind schon bedauernswert genug. Aber sie haben wenigstens ihre Schlafstelle, sie haben doch das Glück, sich in den niedrigen Stuben mit einigen anderen Schlafgenossen auf den Fußboden betten zu dürfen, sie haben also immerhin ein Heim. Sie sind reich gegen die Obdachlosen, die sich müde durch die Schlammdistrikte schleppen; hoffnungslos hoffen sie, von den anderen Armen einige Pence zu kriegen, damit sie nicht auf dem Embankment1 an der Themse im Froste nächtigen müssen.
Und diese Allerelendsten der Elenden sind noch in Gesellschaftsschichten geteilt, noch unter diesen Obdachlosen bestehen Vermögensunterschiede. Wer sieben Pence erbettelt hat und sie für das Nachtlager zu opfern bereit ist, kann in einem der fünf Lord Rowton Lodging Houses2 oder in einem der vom Londoner County Council3 errichteten Bruce Houses ein Kämmerchen mit Bett und Stuhl mieten; wem der Tag nur sechs Pence beschert hat, kann im Volkspalast Logis beziehen und sich bei etwas Fantasie in einen Klub versetzt glauben. Allein wer selbst diese spärliche Zahl von Pfennigen am Abend nicht beisammen hat und gar nicht daran denkt, in den »Casual Wards«4 das bisschen Nachtquartier am Morgen mit harter Steinklopfarbeit zu bezahlen, der zieht in eines der acht Londoner Heilsarmee-Nachtasyle, von denen natürlich das Whitechapler die traurigsten Gäste beherbergt. Allabendlich wankt ein Zug mühselig, schmutzstarrend, frierend, altersschwach und notgebeugt in die Middlesex Street, die am Sonntag der Tandelmarkt mit lautem Gewoge erfüllt. Hier steht an einer Straßenecke das Asyl der Heilsarmee. Mein Kostüm war mir fast übertrieben zerfetzt erschienen, als ich es angelegt hatte. Ein Blick auf meinen Nachbar belehrte mich eines Besseren. Der Mann, der hier vor der Eingangstür in seinen Lumpen den Dienst eines Heilsarmee-Funktionärs versah, hielt mich auch noch der Frage wert: »Bett oder Pritsche?«
»Um drei Pence.«
»Also Pritsche. Die Treppen hinunter.«
So steige ich denn die Stufen zur Unterwelt hinab, während die Reichen, die im Vermögen von fünf Pence waren, es sich oben im Schlafsaal gut gehen lassen können. Am eng vergitterten Schalter, wo mein Name in das Logierbuch eingetragen wird, bezahle ich meine Miete und erhalte eine Quittung darüber mit der Bettnummer 308 zugewiesen. Dann trete ich in den Versammlungssaal ein: ein dreieckiger, großer Kellerraum, von Reihen grob gezimmerter Bänke erfüllt. An der Wand ein Podium mit einem von Wachsleinwand bedeckten Harmonium – anscheinend ist der Abendgottesdienst schon vorbei. Die Kellerdecke ist von sechs Eisenträgern gestützt, längs der Wand verlaufen Heizröhren.
Was die Stadt in ihren tiefsten Abgründen nicht mehr zu halten vermochte, was selbst Whitechapel, dieses Asyl der Desperados aller Weltteile, nicht mehr aufzunehmen gewagt hatte, was zu Bettel und Verbrechen nicht mehr geeignet ist, scheint hier abgelagert worden zu sein. Da sitzen sie und verderben die warme Luft. Der eine schnallt seinen Holzfuß ab und lehnt ihn an die Bank. Der andere macht Inventur, einige hundert Zigaretten- und Zigarrenstummel neben sich ausbreitend. Einer holt aus seinem Schnappsack die Dinge hervor, die er wahllos aus dem Rinnstein aufgelesen: Stücke alten Brotes, den Rumpf einer Puppe, zusammengeballte Zeitungen (er glättet sie sorgfältig), den Rest einer Brille, das Rudiment eines Bleistiftes. Einer bindet sein Bruchband zurecht, einer wickelt seine Fußlappen ab, einer verdaut hörbar – alle Sinne werden gleichzeitig gefoltert.
Die Mehrzahl der Gäste sind Greise, mit grauen Haarsträhnen, zerzaustem Bart und Augen, die sich nicht mehr zu der Arbeit aufraffen können, einen Blick zu tun. Teilnahmslos starren sie ins Leere. Nur wenn ein Essender oder etwas Essbares in den Bannkreis dieser Augen kommt, flackert in den matten Pupillen Leben auf, und sie richten sich gierig, neidisch, sehnsüchtig auf den Schmaus.
Am Schalter der Kantine hängt ein Zettel, auf dem steht, zu welcher Stunde Mahlzeiten erhältlich sind, jedoch man kann die Schrift nicht lesen, denn eine Armee von Mauerasseln hockt auf dem Papier. Der Kantineur ist einäugig. Vielleicht ist er – wie die meisten Funktionäre der Heilsarmee – früher selbst ein Obdachloser gewesen und hat in einer der blutigen Schlachten, die im Bereich des einstigen Jago Court5 noch heute manchmal entbrennen, sein Auge verloren. Nun reicht der bekehrte Polyphem den Hungrigen Speise und Trank. Ein Stück Brot kostet einen Farthing6 – die Scheidemünze, die man im übrigen England gar nicht mehr kennt, hat hier ihren Geldwert. Jede der übrigen Speisen ist für einen halben Penny zu haben. Auf Tassen aufgeschichtet, liegen geräucherte und gesalzene Heringe, aus einem Kessel wird ein Blechgefäß mit Suppe gefüllt, aus einer Schüssel reicht man dem Käufer eine Portion Haferschleim, und aus einem an der Wand stehenden Kupfersamowar strömt beim Aufdrehen des Hahnes fertiger Tee. Von Zeit zu Zeit schreitet ein Asylbediensteter die Bankreihen ab, um die geleerten Schalen zu sammeln.
Und schon beginnt der Totentanz. Meine Zimmerkollegen haben ihre Lumpen von sich geworfen, nun stehen die vielen, vielen Gerippe nackt oder in Totenhemden an ihren Särgen und lupfen ihr Bahrtuch zurecht. Dann schlüpfen sie in ihre Ruhestätte.
Manche suchen erst mit einem brennenden Streichhölzchen ihr Lager ab. Haben diese von tausendfältigen Bissen und Stichen des Lebens zerfleischten Leiber noch aus längst vergangenen besseren Tagen den Abscheu vor dem Ungeziefer gerettet? Oder aber wollen sie diese Empfindlichkeit nur vortäuschen? Es wird kaum mehr als »Hochstapelei« sein. Denn alle die Suchenden legen sich schließlich in die ihnen zugewiesene Schachtel zur Ruhe, und es bliebe ihnen ja doch auch dann nichts anderes übrig, wenn ihr Suchen von noch so großem Erfolg begleitet gewesen wäre.
Ich möchte gern warten, bis das Licht verlöscht, damit ich unbemerkt in Kleidern und Stiefeln ins Bett schlüpfen kann. Aber leider hat sich zwischen meinem Nachbar zur Linken, einem ungefähr zwanzigjährigen Rowdy, und einem etwas älteren Kollegen ein Gespräch entsponnen, das sich neben meinem Bette abspielt.
»Woher kenne ich dich?« fragt der Ältere. »Ich kann mich nicht erinnern.«
»Aus Pentonville.« Der Junge sagt das ostentativ laut. Anscheinend will er, es mögen auch andere vernehmen, dass er schon im Zuchthaus war.
»Bist du schon lange draußen?«
»Oh, seither war ich wieder im Police Court.«7
»Wie kamst du heraus?«
»Danny Rowlett stood bail for me.«8
»Weshalb?«
»Er brauchte mich.« Das ist noch stolz gesagt, und mehr verrät der Junge nicht.
Der Ältere gibt sich keineswegs mit der Auskunft zufrieden, dass Danny Rowlett sein Vorrecht, steuerzahlender Bürger Londons zu sein, zur Bürgschaft für den jungen Kriminellen nur verwendet habe, weil er diesen brauchte. Das hatte auch ich mir schon gedacht, obwohl ich nicht die Ehre habe, den Mister Danny Rowlett zu kennen, dessen Diminutivtaufname darauf schließen lässt, dass er in den Kreisen derer von Pentonville eine gewisse Popularität genießt. Wozu jedoch hat er meines Bettnachbarn so dringend bedurft? Ich werde es nie erfahren. Wohl aber erfährt es der Zuchthauskollege. Mein Anrainer hat ihn wichtigtuerisch mit einem längeren Blick geprüft, und nun beginnen sie zu tuscheln. Ich sehe mich gleichermaßen um die Fortsetzung des Gespräches wie um meine Nachtruhe in Kleidern betrogen. Warten kann ich nicht gut, denn das Geschäft am Nebenbett mag noch lange dauern. Wahrscheinlich hat Danny Rowlett durch seine Bürgschaft den jungen Mann aus der Zelle im Polizeigefängnis nicht deswegen befreit, um ihn hier, im Massenquartier von Whitechapel, nächtigen zu lassen. Der opferwillige Bürge hätte ihm doch leicht auch ein schöneres Nachtlager verschaffen können. Der Grund, weshalb der gute Boy zur Armee des Heiles zu Gaste kam, wird also ein geschäftlicher sein. Er sucht einen Kompagnon.
Ich muss mich dazu bequemen, dem älteren der Burschen den Tausch unserer Lagerstätte vorzuschlagen, damit er besser mit seinem Associé9 verhandeln könne und mich nicht weiter störe. Der Mann nimmt an, ohne meine Freundlichkeit besonders zu quittieren – er empfindet sie zweifellos als einen Akt des Respekts, der ihm, dem Absolventen von Pentonville, von Rechts wegen zukommt. Mit einer knappen Handbewegung zeigt er mir sein Bett, das von nun an meines ist.
Meine neuen Nachbarn sind längst in den Chor des Schnarchens eingefallen, der den Saal hundertstimmig erfüllt. Der eine hat die schwarze Wachsleinwanddecke über den Kopf gezogen, des anderen zerzauste Gehirnschale lugt aus dem grauen Groblinnen schaurig hervor. Die Lichter verlöschen, und nur das schwerfällige Knarren von hundert Särgen sagt mir, dass ich in Gesellschaft bin. Manchmal dringt ein Anfall von verzweifeltem Husten zu der Truhe herüber, in der ich, auf meinen Arm gestützt, gerne einschlafen möchte.
Früh um sechs Uhr: ein Pfiff. In den Särgen zuckt es, dann tauchen Schädel auf, Knochen recken sich empor, von Strahlen des Morgens fahl beleuchtet. Wie Lebende reiben sich diese Toten die Augen und strecken sich. Dann stehen sie auf und ziehen die Lumpen an, die sie abends über den Stuhl gelegt haben. »In den Waschraum«, heißt das Aviso. Nur wenige leisten der Aufforderung Folge. Sie sind keine Gecken mehr, sie haben beim Fechten ums Dasein die menschlichen Eitelkeiten abzulegen gelernt. Im Waschsaal, an den braunirdenen Wasserbecken, stehen meist nur jüngere Kollegen, die der kosmetischen Wirkung des Waschwassers in ihrem Berufe als Geliebte ihrer Geliebten nicht entraten können. An Rollen hängen lange hellgraue Handtücher für viele. Nun geht es wieder hinunter in den Kellerraum, woher wir abends gekommen sind. Ein Mann von der Heilsarmee liest ein Gebet, es folgt eine kurze fromme Ansprache und wieder ein Gebet. Jetzt kann man um einen Halfpenny Tee und um einen Farthing Brot erhalten, und das Tor öffnet sich. Endlich, denke ich und atme der Luft entgegen. Die anderen aber ducken sich vor dem ersten Hieb der Kälte.
(engl.) Kai. <<<
(engl.) Logierhäuser, Pensionen. <<<
(engl.) Grafschaftsrat. <<<
(engl.) Obdachlosenasyle. <<<
(engl.) Gericht. <<<
(engl.) Kleinste englische Münze, ¼ Penny. <<<
(engl.) Polizeigericht. <<<
(engl.) Danny Rowlett bürgte für mich. <<<
Teilhaber, Partner <<<
Ein Spaziergang auf dem Meeresboden
Die Taucherplätte fährt, gefolgt vom Ambulanzwagen für Taucherunfälle, auf dem die Dekompressionskammer ist, zur Suchstelle. Dort wird das Lot ausgeworfen. Siebzehn Meter zeigt die Senkschnur.
Ich bin abergläubisch, und siebzehn ist – wie ich schnell ausrechne – die Summe von dreizehn und der an sich bedeutungslosen Zahl vier. Die »Dreizehn« stört mich – kein gutes Omen. Aber jetzt ist nichts mehr zu machen. Ich bin nicht schuld, wenn es schlecht ausgeht. Der Taucher von Schiller ist schuld mit seiner Wichtigtuerei und seinem ewigen Abraten: »Da unten aber ist’s fürchterlich, und der Mensch versuche die Götter nicht …« und so weiter. Ich lasse mir aber nun einmal nicht abraten. Justament nicht.
Und den Gürtel werf ich, den Mantel weg und auch Gamaschen, Stiefel, Rock und Hosen. Es waren keine Ritter da und Frauen, den kühnen Jüngling verwundert zu schauen. Und wennschon: meine Wäsche habe ich ja anbehalten. Darüber kommen noch eine Unterhose und zwei Hemden aus Trikot und außerdem der Taucheranzug. Er ist aus gummigetränktem Stoffe und aus einem Stück geschnitten und passt für alle Körpergrößen mehr oder weniger. (Mir: weniger.) Über die Schenkel bis zu den Hüften kann man ihn noch selbst hinaufziehen, dann muss man aufstehen, mit angezogenen Ellenbogen die Hände auf den Bauch pressen, und zwei Henkersknechte zerren das Gewand so hoch hinauf, dass der Kautschukkragen den Hals umschließt. In die engen, allzu engen Kautschukmanschetten hilft dir ein Tauchergehilfe mit zwei schuhlöffelartigen Dehnern. Man bedenke: Trikotwäsche, Kautschukmanschetten! Es ist doch gut, dass keine Ritter da sind. Ein gestreifter Zwillichanzug wird übergezogen, das Gummikostüm zu schonen. Na, ich muss ja fein aussehen! Um den Hals und über die Schultern stülpt man mir den metallenen Koller, den kugelrunden Kupferhelm hebe ich mir selbst auf das Haupt. Der Gummikragen des Anzuges, der Helmkragen und der Helmkopf werden nun von eifrigen Händen und mächtigen Schraubenschlüsseln zu ewiger Einheit geschmiedet. Zum Glück ist das mittlere der drei Rundfenster (ein viertes, ungefähr in Stirnhöhe, ist vergittert) noch offen, sodass ich auf normalem Wege atmen, hören und sprechen kann. Inzwischen sind meine Füße zu Blei geworden, denn riesige Rindlederschuhe mit Sohlen aus diesem Metall wurden mir umgeschnallt, jeder sechs Kilo schwer.
Ich schleppe mich, unfreiwillig die Gangart des Golems kopierend, zur Taucherstiege, die vom Deck ins Meer führt. Allein auf der dritten Stufe habe ich, das Gesicht gegen das Boot gewendet, stehenzubleiben. Ich bin also nur bis zu den Hüften im Wasser und muss meinen Kopf auf das Deck legen – die Schwere des Helmes würde mich sonst umwerfen. Das Bleigewicht der Füße spüre ich nicht so sehr, da sie im Wasser sind. Man hängt mir einen stolzen Orden um den Hals, wie ein Lebkuchenherz aussehend und ebenso groß. Er ist aber keineswegs aus Lebkuchen, sondern aus Blei und wiegt zehn Kilogramm. Das Rückenblei – mir bleibt doch nichts erspart auf dieser Welt! – wiegt sieben. Indes ich, die Stirne reuig auf den Erdboden gepresst, alles mit mir geschehen lassen muss, schnallt man auf meinem Rücken auch noch den Lufttornister an. Der ist durch den Luftschlauch mit der vierzylindrigen Luftpumpe an Bord der Taucherplätte verbunden und führt durch ein Rohr im Helm und den kleinen Atmungsschlauch in meinen Mund. Guter Tornister, du wirst da unten mein einziger Freund sein, nicht wahr, du wirst für mich sorgen? Du weißt doch: für je zehn Meter Wassertiefe schenkst du mir Luft von einer Atmosphäre mehr. Braver Tornister! (Ich streichle ihn geradezu mit meinen Gedanken.)
Noch ist die Ausrüstung nicht vollendet, die zum »Skafander« – so nennt die Marine den Tauchapparat Rouquayrol-Denayrouze1– gehört. Ein Hanftau, die Führungsleine, schlingt man mir mittels eines Leibstiches um die Hüften, Handschellen aus Kautschuk presst man mir über die Gelenke, damit die Gummimanschetten noch fester anliegen und meine Hand sich blutig rötet, und einen Dolch in bronzener Scheide reicht man mir, und ich stecke ihn in den Gürtel. Ha, jetzt sollen sie nur kommen, die Haifische und Delphine – oder die Seeschlange!
Der Tauchermeister dämpft meine kriegerische Stimmung etwas herab. Er ist ein erfahrener Mann, hat schon manches Schiff auf dem Meeresgrund betreten und wurde oft geholt, in Seen und Flüssen des Binnenlandes zu tauchen; unter anderem hat er im Veldeser See nach der versunkenen Glocke gesucht. Er ist ein erfahrener Mann, und auf sein Wort muss man hören, solange das Mittelfenster des Helmes noch offen ist. O weh, wie viele Lehren gibt er mir! Ich muss, um Gottes willen, immer das Mundstück des Atmungsschlauches schön im Munde behalten und kann, um Gottes willen, ja nicht durch die Nase atmen und soll, um Gottes willen, ja nicht die Führungsleine loslassen und darf, um Gottes willen, die Orientierung nicht verlieren, und wenn ich Nasenbluten oder Ohrensausen bekomme, so macht das gar nichts, und ein Ruck an der Führungsleine bedeutet, dass ich den Grund erreicht habe, zwei Rucke, dass ich zuwenig Luft habe und dass man daher oben rascher pumpen müsse, drei Rucke bedeuten Gefahr, vier, dass ich nach rechts, fünf, dass ich nach links, sechs, dass ich zurückgehen will, und ähnliche Dinge. Das hätte er mir früher sagen sollen, der Herr Tauchermeister, dann hätte ich mir’s wohl überlegt …
Aber schon wird an der Luftpumpe gearbeitet, ich habe das Mundstück, das vor mir einige hundert wackere Taucher in den Mund genommen haben, zwischen Zähne und Lippen gepresst, und das letzte Fenster wird mit erschreckend großen Schlüsseln festgeschraubt. Ade, schöne Luft, die man da oben nach Gutdünken einatmen kann, durch Mund oder Nase, in x-beliebigen Atmosphären … Ich bin hermetisch von dir abgesperrt, ich sehe dich, aber ich fühle dich nicht mehr! Ade!
Es geht die Treppe abwärts, meine rechte Hand umklammert die Führungsleine, die linke ist frei. Ein paar Stufen, dann hört die Treppe auf, und ich schwebe, schwebe tief hinab. Ich segne das verfluchte Gewicht auf meinen Stiefeln – das bewirkt jetzt, dass ich meine Abwärtsfahrt in aufrechter Haltung zurücklege und mit den Füßen zuerst auf den Meeresboden komme. Nun, ehrlich gesprochen, ich segne meine Bleisohlen derzeit nicht, ich habe ganz andere Dinge im Kopf.
In Augenblicken der Erregung pflege ich mir vor allem eine Zigarette anzuzünden – daran ist jetzt nicht zu denken. Ich denke zwar doch daran, aber ich weiß, dass es nicht möglich ist, und so verzichte ich. Ich denke also an andere Dinge, an die ich in meinem Leben noch nicht gedacht habe: dass du mir nicht durch die Nase atmest, Kerl, und dass du das Mundstück um Gottes willen nicht aus dem Maul fallen lässt, der Helm, zum Teufel noch mal, ist der Helm schwer! Nein, das ist nicht der Helm, das wird der Wasserdruck sein, siebzehn Meter, keine Kleinigkeit. Nein, auch der Wasserdruck ist es nicht, es ist der Kautschukanzug, der drückt das Blut aufwärts gegen den Kopf und schröpft mich; wie war das doch, was der Tauchermeister sagte, ein Ruck heißt hinaufholen, zwei Rucke heißen, dass ein Haifisch da ist, drei Rucke bedeuten Kautschukmanschetten, vier Rucke, dass ich nach links will … Aber schließlich gewöhne ich mich daran, auf dem Meeresgrunde zu sein. Ich trete meine Wanderung an und komme mir wie ein Kind im Storchenteiche vor. Nun, da bin ich eigentlich doch schon weiter: Die Nabelschnur fehlt mir nicht, und sogar einen Gummilutscher habe ich im Mund. Nicht verlieren, Bubi, sonst kommt der böse Tauchermeister!
Nur meine Hände sind nackt und greifen in die Nässe, es ist keine Feuchtigkeit zu spüren, bloß zu sehen. Rings um mich überall Wasser, blaues Wasser. Ich gehe trockenen Fußes durch das Meer: Das Wunder, das der Gesamtheit der Kinder Israels widerfahren war, vollzieht sich nun an mir einzelnem. Ich tappe schweren Schrittes über kalkige Steine, Austernmuscheln und Muschelkalk, überwachsen mit Seegras, Algen, Tang, Moos oder Gott weiß was. Dort die Muschel will ich aufheben, sozusagen als Edelweiß des Meeres; ich lege sie mir dann zu Hause auf den Schreibtisch als Andenken für mich, und wenn mich Besucher nach der Besonderheit dieser Muschel fragen, so bemerke ich leichthin: »Ach nichts, die habe ich einmal so vom Meeresgrund aufgelesen, siebzehn Meter unter der Oberfläche.«
Ja, hat sich was mit »aufgelesen«. Ich knie nieder, um sie »aufzulesen«. Aber erstens kann ich sie nicht packen, denn bald greift meine Hand viel zu nahe, bald viel zu weit. Ich habe zwar in der Schule einmal etwas von der Brechung des Lichtes im Wasser gehört, ohne es zu glauben. Es ist doch so – ich kann die Muschel nicht finden, die ich vor mir sehe. Schließlich finde ich sie. Sie ist aber so fest angewachsen, dass ich sie nicht loskriege. Ruhig fasse ich eine andere – ganz vergeblich, auch die bewegt sich nicht. Na, liegt auch nichts dran, ich kaufe mir morgen irgendeine Muschel und lege sie auf meinen Schreibtisch. Nach ein, zwei Jahren werde ich schon selber steif und fest glauben, dass ich sie vom Meeresgrunde aufgelesen habe.
Ich stehe auf und gehe weiter. Also, dieser Schillersche Taucher, das war ein Lügner: Es wallet nicht und siedet nicht und brauset nicht und zischt nicht, und kein dampfender Gischt spritzt bis zum Himmel, und von Salamandern und Molchen und Drachen, die sich laut Aussage des Mauldreschers der Ballade hier in dem »furchtbaren Höllenrachen« regen sollen, habe ich nichts bemerkt, geschweige denn von einem grausen, zu scheußlichen Klumpen geballten Gemisch des stachlichten Rochens, des Klippenfischs und des Hummers gräulicher Ungestalt, auch wies mir nicht dräuend die grimmigen Zähne der entsetzliche Hai, des Meeres Hyäne. Schiller ist da einem Hochstapler tüchtig aufgesessen. Oder hat sein Taucher in submariner Angst in den braven Sardinen so grimmige Meeresungeheuer gesehen? Die schwimmen nämlich wirklich in großen Mengen umher, kommen bis an mein Visier und schauen mir treuherzig in die Augen. Sie halten mich wohl für irgendeines der seltsamen leblosen Dinge, die ihnen in den Kriegsjahren von freundlicher Seite als Spielzeug auf den Meeresgrund gesandt wurden. Da ich mir ein solches Fischlein haschen will, springt es schnell davon. Nach einem mehr als halbstündigen (dreiunddreißig Minuten, um präzis zu sein) Spaziergang komme ich ohne irgendein Corpus delicti an das Tageslicht. Und doch habe ich das Meer von Grund auf gesehen und ein Erlebnis gehabt, das mir nirgends vorgekommen ist, außer heute auf dem Meeresgrunde. Auf die Gefahr hin, dass man mich für einen noch größeren Aufschneider halten werde, als ich den Taucher Schillers, will ich es verraten: Ich bin während der ganzen Promenade keinem Bekannten begegnet.
Rouquayrol-Denayrouze ist die Bezeichnung für ein Tauchgerät, welches von 1864 bis weit ins 20. Jahrhundert gebräuchlich war. Es ist benannt nach seinen Erfindern, dem Bergbauingenieur Benoit Rouquayrol, dem Marineoffizier Auguste Denayrouze und seinem Bruder Louis. Besonders bemerkenswert ist, dass das Gerät sowohl schlauchversorgt als auch autonom, also ohne Schlauch benutzt werden konnte. Insofern ist der Rouquayrol-Denayrouze der Urahn der heutigen unabhängigen Tauchgeräte, die im Tauchsport gang und gäbe sind. (Wikipedia) <<<
Wie der Einbrecher Breitwieser erschossen wurde
Die Verfolger haben Angst vor dem Verfolgten.
Dabei kann es sein, dass die fünfeinhalb Leute, die mit der Bahn zur Jagd hinausfahren, zu spät kommen, erst zum Halali. Denn eine Partie der Jäger und Treiber ist mit dem Auto voraus ins Revier.
Die fünfeinhalb sind der Sukkurs1 und sollen ganz unauffällig folgen. Vor der Halle des Franz-Joseph-Bahnhofes stehen sie auf den Stufen und warten, bis sich die linke der drei Türen öffnen wird. Sie haben nichts zu tun als so, als ob sie einander nicht kennen würden.
Solcher Müßiggang fällt ihnen sicherlich schwer: In Reichweite sind Burschen, die sich – unbefugterweise – zum Koffertragen anbieten und auf ihren Militärkappen ein Flügelrad angeheftet haben, damit sie dem Reisenden Vertrauen einflößen. Die könnt man so schön schnappen, in flagranti, »Beilegung falschen Amtscharakters«.
Wär eh g’scheiter, als da rausfahren, Jagd machen auf aan, was ka Faxen macht …
Friedliche Passagiere mit Rucksäcken lassen in ihren Gesprächen Namen von Dörfern und Adressen von Bauern fallen, bei denen man gegen Wäsche oder Schmucksachen oder gar bloß Geld Butter eintauschen kann und Kartoffeln und Eier. Sonst würden solche Angaben auch die fünfeinhalb interessieren, denn auch Detektive der Polizeidirektion Wien haben eine Frau, die es ihnen unter die Nase reibt, wenn der Nachbar Lebensmittel nach Hause bringt …
Wär eh g’scheiter, als da rausfahren …
Sie lassen es sich nicht anmerken, dass sie Jagdfieber haben, Angst vor dem Wild. Aber man erkennt ihre Angst daran, dass sie sich nichts anmerken lassen wollen. Die Virginia in ihrem Munde verlöscht nicht …
Endlich öffnet sich die Tür – »Aber net drängeln, meine Hörrschaften, wer wird denn a soo drängeln.« – »Oha, Sö Pimpf, Sö!« –, und man ist vor dem Kassenschalter: »Fahrkartenausgabe zu Lokalzügen bis Tulln«. Auf einem Zettel stehen die Abfahrtszeiten, und gegenüber der Herr Göd des Bahnhofs, der selige Franz Joseph im Krönungsmantel, und hält eine halb eingerollte Staatsbeamtenlegitimation in der Hand, bei deren Vorweisung er nur den halben Fahrpreis bezahlen muss. Zu seinem Glück ist er aus Gips und wird nicht nervös von der öden Drängerei und Warterei, auf die alle schimpfen – bis auf die fünfeinhalb, die einander noch immer nicht kennen und riesig phlegmatisch sind. »I? Gor ka Spur!«
Gerät man zu guter Letzt doch in den Waggon, so ist er gespickt voll, und die Füße frieren. Es ist kein Vergnügen, mit der Bahn nach Sankt Andrä-Wördern zu reisen. Ein Verbrecher wird sie kaum benützen, umso weniger, wenn er Radrennpreise errungen hat. Sicherlich setzt er sich, nachdem er in Wien seine Geschäfte erledigt hat, einfach aufs Rad und fährt entlang der Donau oder über Neuwaldegg, an keine Abfahrtszeit gebunden (keinem Gequetsche und keiner kalten Eisenbahnzugluft ausgesetzt, den Fahrpreis ersparend), nach Hause, nach Andrä-Wördern.
Ob er tatsächlich in Andrä-Wördern wohnt?
Hinter Kahlenbergerdorf, in Klosterneuburg, in Kierling, auf den Dünen von Kritzendorf, in Höflein und Greifenstein ist die Mehrzahl der Hamsterer ausgestiegen, der Eisenbahnwagen ist halb leer, die fünfeinhalb kennen einander schon ein wenig, und man kann den Nachbarn leise fragen: ob’s auch wirklich ganz gewiss ist, dass ✳✳✳ in Andrä-Wördern steckt? Ob’s nicht ein Aprilscherz ist? (Wir schreiben heute den 1. April 1919.)
Nein, nein, kein Aprilscherz, wie alle gedacht haben, als sie es heute hörten … Diesmal ist es sicher. Vor drei Wochen hatte man erfahren, dass ✳✳✳ in der Atzgersdorfer Mühle sei; in der Scheuer hatte er seine Werkstätte. »Wie wir hineinkommen in die Scheune – ist sie leer. Wohin er sich gewendet hat, hat niemand gewusst, trotzdem er alle seine Apparate mitgenommen hat. Wir haben in der Umgebung nachgeforscht nach neuen Mietern – umsonst.« Der Waggon hat sich ganz geleert, nur fünfeinhalb Menschen sind noch darin. Man kann einander wieder kennen und ungeniert sprechen. »Erst gestern haben wir erfahren, dass der Breitwieser« – heraus ist das Wort! – »in einer ganz anderen Gegend steckt. In Sankt Andrä, wo das Haus schon hergerichtet worden ist, wie er noch in Atzgersdorf war.«
Und ist das zuverlässig?
»Total zuverlässig! Wir haben schon alles recherchiert. Es ist die sogenannte Käferlsche Villa. Vor zwei Monaten hat sie der Rudolf Schier gekauft, als ›gewesener Holzhändler‹ hat er sich ausgegeben. Achtundzwanzigtausend Kronen war der Kaufpreis. Schier hat sie gleich bar bezahlt, ohne zu handeln, hat alles ausmalen lassen, Möbel sind aus Wien angekommen, und zuletzt ist ein verdeckter Streifwagen abends im Hof abgeladen worden. Es ist klar, dass da die Instrumente darin gewesen sind. Na, vielleicht werden wir’s heute schon wissen!« An der Virginiazigarre wird fest gesaugt, obwohl sie gar nicht auszugehen droht.
Glauben Sie nicht, dass er Wind bekommen hat und auf und davon ist?
»Heute früh war er noch da, und die Villa ist bewacht – in allen Nachbarhäusern sind unsere Leute. Wenn er jetzt entwischt ist, muss das viel Blut gekostet haben. Schießen tut er gleich!«
Ja, schießen tut er gleich. Zwei von den fünfeinhalb zeigen Wunden, die sie von Breitwieser haben. »Bevur i hin bin, müssen no a paar Kiwerer hinwern.« Dies sei sein stereotyper Schwur. Beteuern die Kiwerer hier im Zug.
In Wördern steigen fünfeinhalb Leute aus, die einander anscheinend noch nie gesehen haben. Ein Soldat lungert am Bahnhof und kommt mit einem von ihnen ins Gespräch, wobei er ihm so en passant mitteilt, dass er mit einem anderen im Garten des Hauses Lehnergasse Nummer elf Wache zu halten habe. Dann muss der Soldat mal austreten und trifft auf dem Pissoir zwei Zivilisten, die durch ihn erfahren, dass sie sich an den beiden Ecken der Riegergasse zu postieren haben.
Einzeln geht man vom Dorfe Wördern entlang den Weiden, die die Donau und dann den Hagenbach umsäumen, bachaufwärts bis zum Marktflecken Sankt Andrä. Dort oben ist das Wild, ahnungslos, obwohl die Fallen bereits aufgestellt sind.
Von der Lehnergasse biegt als erste Seitenstraße die Riegergasse ab, eine Linie von Villen, durch Staketenzäune zu einer freundlichen Fassade verbunden. Nummer fünf ist die hübscheste: ein Einfamilienhaus. Die Veranda nimmt die ganze Frontseite ein, durch blaue Glastafeln kommt ihr Licht zu, ohne dass man hineinsehen kann. Wer in das Haus will, muss durch die Türe, die in den Hof führt: das Haustor ist auf der Rückseite. In der Mitte des Hofes steht ein Schwengelbrunnen, an den ein Fahrrad angelehnt ist, links eine Laube und ein Ziergärtchen, rechts ein Holzschuppen. Neben dem Schuppen eine kaum zwei Meter breite Verschalung, mannshoch – der Zaun, der die Breitwieser-Villa vom Haus Riegergasse sieben trennt.
Gegen den Hintergrund zu: eine hohe Planke, hinter der der Gemüsegarten von Lehnergasse elf ist, wohin der Bahnhofssoldat zwei Mann des Sukkurses beordert hat – der Stand, von wo man die Haustüre im Auge hat, den Bau, aus dem man das Wild hervorkommen lassen will, um es zur Strecke zu bringen.
Eindringen, hineinschießen, offen belagern will man nicht. Es würde viele Opfer kosten und viel Zeit, wenn Gefahr gewittert würde.
Desto fester ist das Gehege von der Treiberkette umschlossen. Am Zaun lauern sie, in den Nachbarhäusern, an den Straßenecken. Ein Jagdhund ist dabei. Sie warten, bis das Wild wechseln wird. Ein Mädchen geht in den Schuppen und kehrt, Holzscheite auf dem Arm, ins Haus zurück. Die Verfolger lauern, die den Verfolgten fürchten. Karl Breitwieser, der jüngere Bruder des großen, war schon dreimal im Hof, auch zwei Frauen – Luise Schier und Anna Maxian, ein siebzehnjähriges Mädchen, die Geliebte Johann Breitwiesers, des Einbrecherkönigs.
Nur er selbst, er selbst ist noch nicht ein einziges Mal aus dem Haus getreten. Zwei Uhr wird es, drei Uhr, vier Uhr, drei Viertel fünf …
Da – da: »Hände hoch!«
Breitwieser, der sich am Fahrrad zu schaffen machen wollte, zuckt auf. Von hinten, vom Garten schallt die Aufforderung. Er dreht sich um: Auch vom Hoftor her sind Revolvermündungen auf ihn gerichtet. Bleibt nur die Flucht flankenwärts. Ohne Rock, ohne Hosenträger ist er, aber nicht eine Sekunde lang denkt er an Übergabe, jagt davon, mit einem Sprung ist er über dem mannshohen Zaun, die Wirtschafterin der Nachbarsleute, die Wäsche aufhängt, rennt er über den Haufen, will durch das Nachbarhaus auf die Straße, auch hier die Kiwerer, Revolverschüsse krachen, der Verfolgte fürchtet die Verfolger nicht, er reißt seinen Browning aus der Hosentasche, taumelt getroffen; einen Blutstrom verspritzend, springt er in den Schuppen von Nummer sieben und schießt von dort. Von allen Seiten feuert man in die Holzwand, Polizeihund »Ferro« jagt in die Hütte, wirft sein Opfer zu Boden, nun wagen sich auch die Verfolger mit erhobener Waffe hinein. Breitwieser streckt die Hände aus: »Net schießen, i tu eh nix mehr.«
Man nimmt seinen Browning, der neben ihm im Stroh liegt. Schmerzverzerrt tastet Breitwieser nach seinen Wunden. Sie schmerzen, obwohl er weiß, dass er jetzt sterben wird.
Karl Breitwieser, der Bruder, hat sich inzwischen ohne Gegenwehr ergeben. Auch er war im Hof, als das Hands-up-Signal erscholl, sprang in den Holzschuppen, kam aber sofort mit erhobenen Händen hervor. »Nicht schießen!« bat er und ließ sich fesseln, während sein Bruder noch schoss. Die beiden Frauen hatten das Haus von innen versperrt, doch öffneten sie, als die Detektive an den Fenstern erschienen und zu schießen drohten. Einen Überfall aus dem Innern des Hauses befürchtend, schoben die Polizisten den Knaben Karl als Schild vor sich her. Luise Schier und Anna Maxian wurden festgenommen.
Johann Breitwieser wird in die Laube getragen und von dort, da ihn fröstelt, in seine Wohnung; er wird auf den Diwan gebettet, vom Gemeindearzt verbunden und – schon in Agonie – dreifach bewacht im Auto nach Wien gebracht. Die Beute. Halali!
Hausdurchsuchung. Als man in den fensterlosen Teil des Kellers trat, erstarrte man vor Staunen. Hier standen fünf mächtige Kassenschränke – Versuchsobjekte für die streng wissenschaftliche Arbeit in diesem vollkommenen Laboratorium der Technologie; hier lagen Stahl- und Eisensorten, etikettiert und sortiert, zur Materialprüfung; hier waren Hefte und Papiere mit Formeln und Bemerkungen von Breitwiesers Hand; hier hingen in transportablen Schränken Werkzeuge nach der Reihenfolge ihrer Verwendung: Wachstabletten, Schlüsselbunde, Dietriche, Feilen, Schraubenzieher, Brecheisen, Bohrer für Handbetrieb und Schwachstrom, in allen Ausführungen, Größen – Werte von vielen Tausenden. Das meiste: eigenes Fabrikat. Maschinen, Drehbänke, Schraubstöcke, eine Feldschmiede fehlten dem Atelier nicht. Ein autogener Schweißapparat für Hitzeentwicklung von dreitausendsechshundert Grad war vollständig aufmontiert, gebrauchsbereit, die zwei Meter hohe Flasche mit fünftausend Liter komprimierten Sauerstoffs stand daneben.
Oben im Bücherschrank: die technische Bibliothek Breitwiesers; das dreibändige Werk »Der Maschinenbau« von R. Georg, »Das Buch der Technik« von G. Neudeck, Bände der autotechnischen Bibliothek, »Räder und Felgen« von Schmidt und die Bücher »Die autogene Schweißung«, »Stahl und Eisen« …
Diese sachlichen Werke hatte Johann Breitwieser, Einbrecher, Gewalttäter und gewesener Markthelfer, ununterbrochen gelesen und nach ihnen seine exakten chemischen und technologischen Versuche gemacht. Ein Mann der Tat, des Mutes, des Ernstes und der Intelligenz – schade, schade, dass er ein Gewerbe gewählt hatte, das schwierig und gefährlich ist und letzten Endes nichts einbringt als den Tod von der Hand der Verfolger, die den Verfolgten fürchteten!
(schweizerisch) Hilfe, Unterstützung, Beistand <<<
Die Weltumseglung der ›A. Lanna 8‹1
I. Von Prag nach Pressburg über die Nordsee
An Bord der ›A. Lanna 8‹, auf hoher See, 8° 30′ ö. L.; 53° 58′ n. B.; 6. Okt. 1920
Pressburg liegt südöstlich von Prag. Also muss man, wenn man von Prag nach Pressburg will, zuerst nördlich fahren, immer nördlich, bis dorthin, wo der europäische Kontinent aufhört, Kontinent zu sein, hinter Hamburg, hinter Cuxhaven, noch immer nördlicher bis in die Nordsee. Und dann nach Westen, auf Kanälen und Flüssen unausgesetzt nach Westen, über die Weser bis zur deutsch-holländischen Grenze und weiter bis zum Rhein … Das ist so die Logik der Wasserstraßen …
Pressburg liegt 350 Kilometer von Prag entfernt, etwa 250 von Budweis. Die Moldau hat (bei Hohenfurt) einen Abstand von bloß 35 Kilometern von der Donau (bei Linz). Aber will man von der Moldau auf die Donau, so muss man 2170 Kilometer fahren, ›bis Babitz‹, sechs Wochen lang, acht Wochen lang – ich weiß noch selbst nicht, wie das alles werden soll. Moritzl, wo hast du dein linkes Ohr?
Der Tender »A. Lanna 8«, der bisher beschaulich im Holleschowitzer Hafen oder am Frantischek lag oder Elbkähne für die Moldauregulierung schleppte oder Kohlenkähne aus Aussig am Gängelband schleifte, ward plötzlich zu Höherem ausersehen: Zu Baggerungsarbeiten muss er nach Bratislava. Dort soll ein Hafen für zwei Millionen Tonnen ausgebaut werden, und für die Arbeiten braucht man die Moldauflottille. Wie sie hinkommt? Die tschechoslowakischen Eisenbahnbehörden gaben die Auskunft: »Per Bahn geht das nicht.« So fuhr »A. Lanna 8« – als erstes Schiff der Republik, das von Prag nach Pressburg auf dem Wasserwege abgeht – am Donnerstag, dem 23. September 1920, um sieben Uhr früh, vom Holleschowitzer Hafen mit sechs Tonnen Kohle ab. Es ging bis Mirschowitz, dann Lobositz und weiter nach Aussig, wo vier Tage Aufenthalt war, bis wir endlich am 30. einen Waggon Kohle von Petschek nehmen konnten. Auch ein Haupter kam hier an Bord, der um 1400 Mark unser Schiff nach Dresden, Coswig, Werben, Lauenburg führte. Am 4. Oktober, um zehn Uhr vormittags, legten wir in Hamburg am Zollkanal an.
Vom Kai des Dowenfleth und von der Wandrahmbrücke schauten die Mädchen in kurzen Röcken interessiert auf den niedrigen Dampfer mit den neuen Farben. Und wir, wir schauten vom niedrigen Dampfer mit den neuen Farben nicht minder interessiert zu den Mädchen in kurzen Röcken auf dem Kai des Dowenfleth und auf der Wandrahmbrücke hinauf.
Ein neuer Lotse kam an Bord, der uns für 1300 Mark über das Wattenmeer nach Wilhelmshaven führen soll, und an der Landungsbrücke stand wieder ein Flusslotse, der uns in Wilhelmshaven erwarten und durch die Kanäle und über Rhein und Main auf die Donau bringen wird; der kriegt 8000 Mark. Der Seelotse besah unsern Kasten mit unverhohlenem Misstrauen. Aber schließlich (1300 Mark sind viel Geld!) sagte er, es werde schon gehen, und traf einige Sicherheitsmaßnahmen. Eine Abflussgatte für Meerwasser, das bei Seegang auf Deck schlagen könnte, müsse hergerichtet werden; der herbeigeholte Schlosser verlangte dafür 300 Mark, woraufhin wir uns die Abflussgatte selbst in die Bordwand hackten. Das Rettungsboot, bisher frei auf den Klampen ruhend, wurde mit Ketten seefest gemacht. Der Kamin wird durch Trossen gestützt werden müssen, aber vorläufig schieben wir diese Arbeit noch auf, da wir Elbbrücken zu passieren haben. Wir nahmen vier Tonnen Steinkohle, ein Kompass wurde eingeschifft, die große Seekarte auf dem Kapitänsstand aufgespannt.
Mittwoch, den 6. Oktober, zehn Uhr fünfunddreißig Minuten vormittags, stachen wir, erstes Schiff tschechoslowakischer Flagge, von Hamburg aus in See. Durch den Binnenhafen und den Niederhafen fuhren wir, rechts Sankt-Pauli-Landungsbrücken, die Hallen des Elbtunnels, der Riesen-Bismarck schaut vom Postament auf den Tender mit der rot-blau-weißen Flagge, dann sind wir en face2 der Davidstraße, Altona, gestern Abend waren wir darin, in ihren Seitenstraßen, Heinrichstraße, Marienstraße, Friedrichstraße bis zur Reeperbahn, Lupanar3 an Lupanar, eine Welt, in der sich unter dem Schreien von Musikautomaten in Riesenschaukeln und Karussels und Kinos und Hippodromen und Schenken und Schaubuden und Tanzrädern der tollste Weltgroßhandel der Sexualität vollzieht. Steuerbords bleibt hinter unserem Schiff der Steinwärder zurück mit dem verödeten Hapaghafen; die Schiffe sind abgeliefert, davor aber sehen wir gleichzeitig ein eisernes Firmament von tausendfach ineinandergeschobenen Gerüsten und Gestängen, die Werft »Blohm und Voß«, Hellinge und Docks sind besetzt, Krane fahren aufwärts und seitwärts, Hämmer dröhnen, und auf der Vulkanwerft ist es nicht anders.
An Heringsloggern aus Rügen fahren wir vorüber, an Islandfischern von Cuxhaven, an Segelschiffen, die das weiße Kreuz auf rotem Grund tragen, wenn sie aus Dänemark, und das gelbe Kreuz auf blauem Feld, wenn sie aus Schweden sind, ein amerikanischer Kargodampfer überholt uns bei Blankenese, fast immer eilen die Matrosen an die Reling, rufen ihre Offiziere herbei und zerbrechen sich sichtlich die Köpfe über das Liliputanerschiff mit unbekannten Farben.
Von einem deutschen Dreimastschoner werden wir durch das Sprachrohr angepreit: »Hallo! Was haben S’ da für Flaggen?«
Wir haben leider kein Sprachrohr an Bord, können keine Antwort geben, und der Dreimaster fährt mit unbefriedigter Neugier von dannen.
Auf Finkenwärder arbeitet die Deutsche Werft, weit rückwärts ist ein Komma auf dem Horizont: der Kirchturm von Buxtehude; dort übt ein Schmied von alters her sein Gewerbe aus und ist so populär, dass temperamentvolle Frauen ihren schlappschwänzigen Ehegatten die Verwünschung zuzurufen pflegten, sie mögen sich vom Buxtehuder Schmied eine Eisenstütze zur Stärkung ihrer Energie anschmieden lassen. Aus dieser ehelichen Verwünschung ist dann die Redensart »Geh nach Buxtehude« geworden und in Gegenden gedrungen, von wo der Weg in dieses »Eisenach« (dieses Wort ist in Analogie zu »Steinach« gebildet) zu weit wäre! Backbords und steuerbords wird das Land immer kahler und flacher, es passt sich gleichsam in seiner Form dem Meere an, und schließlich sieht die Heide nicht bloß wie erstarrte See aus, sondern sie ist noch wellenloser als diese. Nur hie und da dreht eine Windmühle ihr Hakenkreuz, als winke sie uns zu, »hier ist noch deutscher Boden«. Punktiert sind schmale Sandbänke von rastenden Möwen. Unsere Straße ist von roten und schwarzen Bojen markiert – wir brauchen den Kompass nicht zur Steuerung.
Hinter den Kegelschloten der Brunsbütteler Zementfabrik (»Hier sieht’s wie in Podol aus«, sagt Struha, der alte Maschinist.) fahren wir an der Mündung des Kaiser-Wilhelm-Kanals vorüber, er führt nach Kiel, in die Ostsee. Links Hannover. Rechts rückt die schleswig-holsteinische Küste immer weiter und weiter. Mit dem Glas luge ich nach den Helgoländer Felsen aus. Aber ein Moldautender ist kein Aussichtspunkt.
Die Elbe ist hier schon meerhaft. So weit sind die Ufer! Grünlich wird das Wasser. Der Nordwestwind lässt das Schiff rollen. Der Tag macht seine Polster zurecht und blinzelt schläfrig.
Gasflammen auf Leuchtbojen, die auch tagsüber brennen, werden sichtbar. Die Flut schlägt uns entgegen, verzögert das Tempo der »A. Lanna 8«. Salzig und nass ist die Kälte, die sich uns in Mund und Poren drängt. Manche Leuchttürme sind ruhigen Blicks, andere zucken ununterbrochen mit den Wimpern. Um sechs Uhr fahren wir den großen Kai von Cuxhaven entlang. Vor sechs Jahren habe ich ihn auch gesehen, den großen Kai von Cuxhaven. Da war er schwarz von Menschen, von jubelnden Zehntausenden, die den größten Dampfer der Welt sehen wollten. Ich stand oben auf dem Promenadendeck, elf Stockwerk hoch, und nur durch den Zeiß konnte ich die Gesichter da unten unterscheiden. Die Bordkapelle spielte: »Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus …«, unsere schwimmende Stadt fuhr ab, Tücherschwenken.
Wehmütiger als damals die Abfahrt muss mich heute die Ankunft stimmen. Von unten blicke ich zum Molo4 empor. Und kein Mensch ist auf dem herbstabendlichen Steinwall zu sehen. Nein, es ist nicht mehr das größte Schiff der größten Flotte, auf dem ich da bin. 8 Tonnen hat »A. Lanna 8«, 55.000 hatte die »Vaterland«. Keines ihrer Rettungsboote war so klein wie unser heutiges Vehikel. 1200 Mann Besatzung und 4080 Passagiere – unser Dampfboot hat drei Mann Besatzung für seine Seefahrt und nur einen Passagier, mich.
Und für den Zeugen dieser beiden Ereignisse von gleicher Begriffskategorie und ungeheurem Dimensionsunterschied ergibt sich bei den Vergleichen, die er unsinnigerweise anstellt, nichts anderes als das, was jedem Menschen unserer Zeit überall und stündlich einfällt: dass es nie einen größeren Divisor gegeben hat als diese sechs Jahre.
II. Der Moldaudampfer im Seesturm des Wattenmeeres
An Bord »A. Lanna 8«, Ems-Jade-Kanal, am 8. Oktober 1920
Schon am Abend der Ankunft in Cuxhaven war der Lotse, den wir in Hamburg für die Fahrt übers Meer geheuert hatten, an Land gegangen und gleich darauf an Bord zurückgekehrt: Er habe eben aus Hamburg die telegrafische Nachricht bekommen, sein Schwiegervater sei gestorben. Hoffentlich finde er einen Kollegen, der uns von der Elbmündung über das Meer führen werde.
Als wir morgens aus den allzu eng in die Wand geschnittenen Kojen der »A. Lanna 8« krallten, brachte er den Kollegen und empfahl sich von uns, »zum Begräbnis des Schwiegervaters«. Dem Stellvertreter hatte er allerdings dieses Märchen nicht aufgebunden, sondern ihm aufrichtig gesagt, er traue sich nicht mit unserem Süßwasserkasten über eine bewegte See. Weniger ehrlich war er in seiner Auskunft über den Führerlohn gewesen; nach langem Zögern hatte er für die Stellvertretung 400 Mark bewilligt und hinzugefügt, jetzt bleibe ihm nichts mehr als das Reisegeld für die Rückfahrt nach Hamburg. (Wir erfuhren dies freilich erst auf hoher See von dem Ersatzmann, der nicht wenig ungehalten darüber war, nun von uns zu hören, dass sein Kollege morgen in Hamburg für die Führung 1300 Mark einstreichen wird.)
Unser neuer Lotse, ein Krabbenfischer, kennt sich auf dem Wattenmeer so genau aus wie in den Taschen seiner trangetränkten Hose – jedoch kann er nicht in diese Taschen, da seine Wasserstiefel bis zum Schritt reichen. Auch er besieht unsern Maschinenraum nicht besorgnislos, denn einen Dampfer ohne Süßwasserreservoir und ohne Destillator für Salzwasser hat er wohl noch nie in seinem langen Seeleben gesehen. Mit dieser Nussschale soll man über den Ozean? Er lugt auf Ventilator und Glasständer, klopft Röhren und Kondensator ab; auf unserer Fahrt durch das Brackwasser hat sich noch nicht viel Salz angesetzt, und unsere Kessel könnten auch drei Tage durch Salz aushalten, entscheidet er. Die Trossen, mit denen Kamin und Rettungsboot festgemacht sind, prüft er nochmals.
Um neun Uhr morgens (7. Oktober) stach T. M. S. »Lanna 8« in See, die »Alte Liebe«, den Molokopf von Cuxhaven, rundend. Fort Kugelbake, sozusagen der Grenzstein zwischen Elbe und Weltmeer, liegt erst vor uns, aber wir spüren das Jenseits schon jetzt. Luft ist wie Meer: salzig und nass. – Und der Wind lässt uns taumeln. – Der alte Maschinist Struha, seit sechzehn Jahren haust er da unten im Kesselraum von »A. Lanna 8«, hat kein Vertrauen zu dem flüssigen Salz, das auch den Speiseröhren seines Kessels gar nicht schmecken will. Podskal hat keinen Molo und Pelc-Tirolka keinen Leuchtturm – hier aber steckt alles voll von solchen Kinkerlitzchen (sracicky), und Kompass und Riesenseekarte sind auch nicht dazu angetan, beruhigend zu stimmen: Wie soll man sich auf dem Wasser auskennen, wo keine bekannten Ufer, ja überhaupt keine Ufer und keine bekannten Gasthäuser, ja überhaupt keine Wirtshäuser sind? Beim Wenza Kucera im Hafenwirtshaus in Holleschowitz wäre uns allen wohler, obwohl der ein alter Grobian ist.
»Wenn’s sakramentisch wird«, so macht der alte Struha sein Testament, »wenn’s sakramentisch wird, dann verkriech ich mich im Maschinenraum, dass es mich nicht hinauswerfen kann …«
Der Kommandatore von »A. Lanna 8«, Herr Jirsch, war Zugführer bei den Pionieren und hat die Tagliamentomündung befahren, und der Bootsmann, der Franta Cihlarík, ist sehr stolz auf seine Karriere bei der k. u. k. Kriegsmarine. »Já byl5 Bootsmannsmaat-Torpedoinspektor pane!«6
An »Elbe V« kommen wir vorüber, dem ersten der fünf Leuchtschiffe, die die Hafenausfahrt flankieren; die Bemannung dieser Signalschiffe ist sechs Wochen an Bord, dann vierzehn Tage auf Urlaub an Land, jahraus, jahrein. Ein Motorboot jagt hinter uns her und preit uns an: »Reichswasserschutz! Halt!« Die Polizisten springen auf Deck und lassen sich unsere Papiere vorweisen; es ergibt sich, dass wir keine Schieber sind, die unter fremder Flagge ein deutsches Schiff ins Ausland verschachern wollen, wir haben bloß in Unkenntnis der Verhältnisse es unterlassen, das Duplikat der Ausfahrtsbewilligung, vom Reichsverkehrsministerium (Schifffahrtsabteilung) ausgestellt, abzugeben.