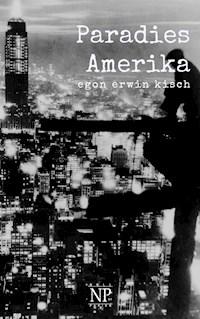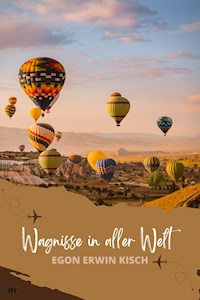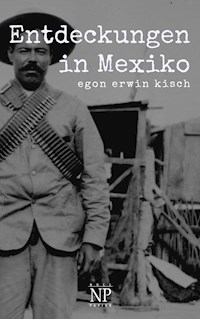Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Über die großen und kleinen Momente im Kriegsalltag: Der als "der rasende Reporter" bekannt gewordene Kisch hält in diesen Tagebucheinträgen während seiner Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg die Dinge und Gedanken fest, die seinen Alltag an der Front, im Schützengraben und im Feldlager ausmachen. Dabei ist nicht nur ein authentischer Kriegsbericht entstanden, sondern auch ein literarisch anspruchsvolles Werk.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Egon Erwin Kisch
Schreib das auf, Kisch! Ein Kriegstagebuch
Saga
Schreib das auf, Kisch! Ein KriegstagebuchCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1930, 2020 Egon Erwin Kisch und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726511291
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Der Bleistift zitterte und das Herz zitterte, als dieses Manuskript entstand, das du jetzt lesen wirst.
Du bist klüger, als der Soldat war, der all das in sein Notizbuch kritzelte – sechzehn Jahre sind vergangen, Krieg und Frieden sind vergangen mit Lehren, mit Kämpfen um die Mächte und Personen, die wir damals nicht sahen, weil wir in den Schützengraben befohlen waren und auf den Schützengraben gegenüber zu lugen hatten.
Der Herausgeber K. ist mit dem Protokollführer K. nicht mehr identisch.
Die heute erfolgreichen Kriegsbücher sind ohne Zweifel weiser. Sie stellen die Tatsachen von damals auf Grund der Erfahrungen von heute dar, auf Grund der Verhältnisse und Absichten von heute.
Vor dem Resultat sah der Krieg im Grunde überall gleich aus, in den Argonnen wie vor Saloniki, in Serbien wie in den Karpaten, vor Przemysl wie vor Verdun, 1914 wie 1918, auf der sauberen ersten Seite des Notizbuchs wie auf der blutbefleckten letzten. Kriegstagebuch wie Kriegstagebuch.
In das meinige stenographierte ich ununterbrochen. Es war nicht für den Druck gedacht, hat aber dann doch, noch während des Krieges, vergebliche Versuche unternommen, aus dem Schützengraben zu dringen, um sich hörbar zu machen. Schließlich erschien ein Teil davon, und auch das ist schon viele Jahre her, bei K. André in Prag unter dem Titel „Soldat im Prager Korps“. Zur Einleitung wurde damals gesagt:
Wenn einer beim Ausheben der Deckung auf einen verdutzten Maulwurf stieß, so lachte er: „Schreib das auf, Kisch!“
Zwei stritten halb im Scherz: „Wenn du noch mal mein Handtuch benützen wirst, so schmier ich dir eine Ohrfeige, daß man dir gleich die Erkennungsmarke abnehmen kann!“ Und damit diese Warnung auch ordentlich gebucht sei, rief mir mindestens einer der Streitenden zu: „Napiš to, Kischi!“
Wenn ein Kamerad gefallen war, den alle rühmten, dann sagten sie mir: „Er war ein feiner Bursch. Schreib das auf, Kisch!“
Hatte man Rum gefaßt, ging einer auf die Latrine: „Napiš to, Kischi!“
So forderte man (ironisch und ernst) den Journalisten auf, der auch als Soldat stets die Blätter seines Notizbuches bekritzelte, und der Soldat bekritzelte immerfort die Blätter seines Notizbuches, weil man ihn (ironisch und ernst) aufforderte.
Und schließlich wurde das „Schreib das auf, Kisch!“ ein geflügeltes Wort, angewendet auch, wenn ich nicht in der Nähe war.
Nicht in Schlagworten habe ich meine Eindrücke niedergeschrieben, sondern genau in der gleichen Form, wie sie hier im Druck vorliegen. Meist mitten im Abenteuer, niemals aber später, denn vierundzwanzig Stunden nach dem Erlebnis. Während die anderen wuschen, gruben, kochten oder schliefen. Als ich dann verwundet ins Hinterland kam und meine inzwischen aus dem Stenogramm der Notizbüche übertragenen Eindrücke durchsah, versuchte ich anfangs, hier und da einen Satz zu verändern, der mir unwichtig oder falsch erschien, manchmal ein Wort einzufügen, manchmal einen Gedanken fortzulassen. Aber immer wieder mußte ich diese Korrektur beseitigen, denn sie erwies sich im weiteren Verlaufe als unlogisch und unrichtig: was mir heute falsch erscheint, war damals richtig. Und ich mußte eben das Damals gelten lassen und änderte nichts mehr.
So wird freilich der Leser dieses Protokollbuches erkennen, wie ich mich in Charakteristiken und in Voraussagen im Felde häufig getäuscht habe. Wenn man über die Tage Buch führt, dann verzeichnet man nicht bloß die geglückten Spekulationen, und wenn man die Aufzeichnungen in Druck legt, so darf man sich nicht klüger machen, als man war. So ließ ich auch die Fehler und Wiederholungen stehen. Manche Tage waren eintönig. Und doch habe ich ihren Verlauf genau verzeichnet, denn dieses Buch schreibt vor allem den gewöhnlichen Tag des gewöhnlichen Soldaten im Kriege.
Das Buch ist den Soldaten des Prager Korps gewidmet: den Freunden, die man dort unten rasch gewann und die man rasch verlor. Oft allzu rasch.
Freitag, den 31. Juli 1914.
Als zehnjähriger Junge habe ich ein Tagebuch zu führen begonnen. Wenn ich heute, da ich zwanzig Jahre älter bin und andere Möglichkeiten besitze, mich zu äußern, wieder die Führung eines Tagebuches aufnehme, so bestimmen mich dazu mehrere Gründe: das Gefühl, eine historische Zeit zu erleben, die Unmöglichkeit, die wichtigsten meiner Erlebnisse derzeit publizistisch preiszugeben, die persönlichen Ereignisse, die, im Zusammenhang mit der politischen Lage, in den letzten Tagen mich getroffen haben und die in mir die Erwartung wecken, daß ihnen weitere folgen werden.
Allerdings sind die Erlebnisse dieser letzten Tage größtenteils nur von schmerzhaft erotischer Natur, wodurch die Einleitung meiner Kriegsnotizen sozusagen den Memoiren eines Casanova von trauriger Gestalt ähneln wird.
Ich bin auf Grund der alarmierenden Nachrichten aus Binz auf Rügen am Dienstag, dem 28. dieses Monats, nach Berlin abgereist. Am Mittwoch bekam ich einen Expreßbrief meines Bruders, daß ich sofort zum Regiment abzugehen habe. Ich holte mir im k. k. Konsulat meine Beglaubigung für die Freifahrt und eine Wegzehrung von einer Mark und fünfundfünfzig Pfennigen. Meine Freundin Trude sagte mir zum Abschied, sie habe mir noch etwas zu beichten, sie möchte nicht, daß zwischen uns eine Lüge sei, wenn ich in den Krieg ziehe. Sie wollte lange nicht mit der Sprache heraus, dann gestand sie mir, sie habe einmal einen Eingriff an sich vornehmen lassen.
Um 11 Uhr 13 Minuten abends fuhr ich vom Anhalter Bahnhof nach Prag. Auf dem Bahnsteig Tausende von Menschen, die Deutschen sangen die Wacht am Rhein. Nach vielen Irrwegen, Stockungen und Verschiebungen kam der Zug endlich am Donnerstag um 11 Uhr vormittags in Prag an. Schon in Bodenbach hatte ich die gelben Plakate gelesen, darauf stand, daß sich jeder zum 8. Korps gehörige Reservist bei seinem Truppenkörper zu melden habe. Bis jetzt hatte ich geglaubt, daß man auf die Einberufung warten müsse; auch im Berliner Konsulat war mir das gesagt worden. Nun brachten mir die Plakate doppelte Post: ich werde also jedenfalls in den Krieg ziehen, möglicherweise aber noch bestraft werden, weil ich nicht schon am Sonntag bei meinem Truppenkörper eingetroffen war, dem k. u. k. Infanterieregiment Nr. 11 in Pisek, bei welchem ich Reservekorporal bin.
Vom Bahnhof fuhr ich sofort nach Hause und packte meine Sachen. So viel, daß sie ein winziges Handtäschchen füllten, das ich nur auf Ausflüge mitzunehmen pflege. Eine Zahnbürste, Kamm, Seife, vier Taschentücher, drei Hemden, zwei Unterhosen. Meine Mutter wollte mir noch eine dritte Unterhose und ein Nachthemd einpacken, aber ich lehnte ab: „Du glaubst wohl, daß ich in den Dreißigjährigen Krieg ziehe?“
Dann fuhr ich in die Vorstadt Smichow zu Klara. Ich hatte sie schon sechs Monate nicht mehr gesehen, aber statt freudig aufzuspringen, als ich eintrat, wurde sie kreidebleich. „Warum bist du so erschrocken?“ fragte ich sie. Sie war kaum imstande, mir eine Antwort zu geben, so mußte ich von neuem fragen: „Warst du mir nicht treu?“ Sie zeigte mir, ohne mich anzusehen, einen Ring, den sie an der linken Hand trug. „Du bist also verlobt?“ Sie nickte. Nach einer Weile erst begann sie zu sprechen: ich hätte ihr so selten geschrieben, ihr in meinen spärlichen Briefen immer hur zugeredet, daß sie tanzen, sich unterhalten, Ausflüge machen solle, so daß sie längst den Eindruck gewonnen habe, ich möge sie nicht mehr. Das war nun wahr und nicht wahr. Ich hatte ihr allerdings absichtlich so wenig geschrieben, damit sie sich nicht an mich gebunden fühle, damit sie ihre Freiheit habe, wenn ich mich in Berlin unterhalte. Aber insgeheim hatte ich doch geglaubt, sie würde mir auch treu bleiben, wenn sie andere Leute kennenlernen und an verschiedenen Vergnügungen teilnehmen werde.
Um 6 Uhr 20 Minuten abends ging mein Zug nach Pisek. Zu Hause aß ich zu Mittag und sprach mit meinen Brüdern, die nicht einrücken, da sie zu jenen Korps gehören die nicht mobilisiert sind. Wir machten Witze, um Besorgnisse der Mutter zu zerstreuen, und dann fuhr ich zur Bahn. Dort drängten sich Hunderte von Reservisten um die Kasse, in ihrer Mitte ein hübsches Mädel.
Ich bot mich an, ihr die Fahrkarte zu lösen, was sie gern annahm. Wir kamen ins Gespräch, und während wir im Eisenbahnzug zusammengepfercht nebeneinandersaßen, erzählte sie, daß sie nach Pisek fahre, wo morgen ihre Kriegstrauung mit einem ins Feld abgehenden Reserveoffizier stattfinde. Sie hegte nur die Befürchtung, daß ihr Bräutigam sie nicht auf dem Bahnhof erwarten werde, da man auf dem Postamt die Absendung ihres Telegramms abgelehnt hatte und die Züge unregelmäßig verkehren. Ihre Befürchtung steigerte sich, als sie von den Mitpassagieren erfuhr, daß in Pisek die Züge in zwei Stationen halten, in „Pisek Haltestelle“ und in „Pisek Stadt“, und daß es ganz ausgeschlossen sei, dort im Hotel ein Zimmer zu bekommen, weil die Stadt voll von Offizieren und jedes Zimmer mit sieben bis acht Personen belegt sei. Nun war sie verzweifelt, so spät abends dort einzutreffen und vielleicht allein in der Stadt die ganze Nacht umherirren zu müssen, da sie doch das Haus Pisek 217 nicht finden und – fände sie es auch – ein fremdes Haus nicht alarmieren könne. Die Passagiere rieten ihr, in Přibram die Fahrt zu unterbrechen, zu übernachten und um 6 Uhr morgens weiterzufahren. Ich nahm diese Anregung auch für mich auf und erklärte, es ebenso machen zu wollen, um nicht die Nacht in den Straßen Piseks zuzubringen. In Přibram sprang ich dann mit ihr aus dem Waggon. Wir gingen in das nächste Hotel und aßen Abendbrot. Sie gewann Vertrauen zu mir, erzählte mir von ihrer langjährigen Beziehung zu ihrem Bräutigam, dem sie ziemlich kritisch gegenüberstand und den sie hauptsächlich deshalb heiraten wolle, weil er pensionsberechtigt sei. Im übrigen gewann ich aus dem Gespräch, vor allem aus ihrer Schilderung der Eifersuchtsszenen und der Vorwürfe, die ihr der Bräutigam gemacht habe, die Überzeugung, daß sie selbst nicht allzu einwandfrei sei. Ich verschob nun das Gespräch auf lustigere Basis und bestach draußen den Kellner, daß er erkläre, nur ein einziges Zimmer mit zwei Betten zur Verfügung zu haben, aber kein einziges Zimmer mit einem Bett.
Morgens um 6 Uhr fuhren wir nach Pisek. Ich begab mich sofort in die Kaserne. Hunderte von Reservisten standen im Hof, teils eingekleidet, teils noch nicht. Unzählig viele alte Bekannte. Doch wie hatten sich die meisten seit unserer gemeinsamen Dienstzeit verändert! Solche, die ohne parfümierte Schützenschnur damals die Kaserne nicht verlassen hätten und sogar in der Anordnung der Distinktionssterne Koketterie bewiesen hatten, hielten es jetzt nicht mehr der Mühe wert, sich einen herabhängenden Knopf festzunähen oder die allzulangen Ärmel einzusäumen. Sie sahen verwahrlost aus; das Zivilleben, das sie damals so ersehnt hatten, hatte ihnen übler mitgespielt als der Feldwebel. Sie waren gealtert, trugen Vollbärte und waren Familienväter geworden, und es berührte mich seltsam, als ein einstiger Kompaniekollege, der ein Riesenlausbub gewesen und mit mir monatelang im Arrest gesessen hatte, erzählte, daß er Vater von fünf Kindern sei.
Man sprach über Serbien, über den Selbstmord des Magazinoffiziers Hauptmann Thoma, von dem das Gerücht verbreitet ist, daß er sich heute wegen Unterschlagungen getötet habe. In Wirklichkeit soll das Magazin in Ordnung sein und Thoma die Tat nur aus Nervosität und Angst vor dem Rummel begangen haben.
Am Nachmittag wurde plakatiert, daß der Kaiser die allgemeine Mobilisierung angeordnet habe. Mir fiel meine Mutter ein: meine vier Brüder werden wohl jetzt einrücken müssen; mein Herzschlag stockte, als ich mir vergegenwärtigte, wie jetzt zu Hause alles in der gräßlichsten Aufregung wegen der Abreise in einen großen Krieg sei. Die Leute lasen das unheilverkündende Plakat ohne Verständnis: „Es ist gut, daß auch die anderen Länder drankommen.“ – „Das bedeutet, daß auch die Jägerbataillone einrücken müssen“ usw.
Abends hatte ich meinen Tornister zu packen und den Mantel daraufzuschnüren. Pfui, war das eine Arbeit! Ich glaube, ich würde „im Felde“ lieber erfrieren als den Mantel anziehen. Müßte ich ihn doch wieder einrollen.
Samstag, den 1. August 1914.
Ich habe den Abend bei einem Kaufmann verbracht, den ich aus der Zeit kenne, da er in Prag Funktionär der Sozialdemokratischen Partei war. Er bewirtete mich und prahlte vor seiner Frau mit seinen Beziehungen zur Literatur, wozu er mich als Zeugen anrief. Er erzählte, daß er vor drei oder vier Jahren jede Nacht mit Hugo Salus durchgebummelt und ihm in einem Bordell 20 Kronen geborgt habe; Salus habe das Geld versoffen, aber nicht zurückbezahlt. Guter Salus! Du hast wohl in deinem ganzen Leben noch nie 20 Kronen versoffen, am allerwenigsten aber ausgeliehene! – Die Frau des Kaufmanns ängstigte sich, daß ihr Mann als Landsturmmann in den Krieg ziehen werde. Er selbst bestärkte sie durch absichtlich ungeschickte Tröstungen in ihrer Besorgnis, um sich als Krieger großzutun und ihre Liebe durch Befürchtungen zu stärken. So hatte ich die mißliche Aufgabe, die Frau trösten und – um des Mannes willen – gleichzeitig hervorheben zu müssen, daß ihm Gefahr drohe.
Des Morgens faßte ich in der Kompanie mein Gewehr und die Patronentaschen. Ich hängte nun den Tornister und die übrige Rüstung um und wankte unter der Last. Dabei sind die scharfen Patronen noch gar nicht verpackt! Auch eine Legitimationskapsel, das Verbandpäckchen und ein Säckchen mit Salz erhielten wir.
Vormittags wurden wir rangiert; ich bin Flügelmann des vierten Zuges, zweites Glied, und Kommandant des vierten Schwarmes. Zwölf Leute sind meiner Führung unterstellt. Nachmittags erhielt jeder Mann zweihundert scharfe Patronen, ich als Schwarmführer nur vierzig. Ich empfinde dies jetzt als Glück, denn ich weiß nicht, wie ich diese bleierne Last zu meinen anderen Lasten getragen hätte.
In Pisek starb ein Fähnrich vom Train auf dem Marktplatz an Herzschlag. Ein Soldat von der Landwehr hat sich erschossen, ein Kadett von der Artillerie, tödlich angeschossen, liegt im Spital. Die Gattin eines Reservisten in Purkraditz ist wahnsinnig geworden. Obwohl wir solches erfahren, sind wir in bester Laune. Es ist weniger Galgenhumor als Leichtsinn und vielleicht Unkenntnis der Sachlage. Auch hier berührt sich die Wirkung der höchsten Dummheit mit der der höchsten Klugheit: was kann man Besseres tun als sorglös sein? Und es ist ein Glück, daß die gute Stimmung ansteckend wirkt. Die ausgegebenen Kaffeekonserven werden von uns an die Dorfjugend verteilt. Den steinernen Zwieback und die Fleischkonserven pakken wir in die Brotsäcke, mit dem Kommißtabak wird von den Nichtrauchern ein schwunghafter Handel getrieben. Distinktionssterne sind in Pisek nicht erhältlich, die Chargen haben sie sich deshalb mit Kreide oder Bleistift auf die Egalisierung gemalt. Hotelier Seitmann aus Prag, der eben mit dem Automobil hier angekommen ist, erzählt, daß Jaurès wegen seiner Kriegsgegnerschaft ermordet und daß der Lovčen von den Österreichern im dritten Sturm genommen worden sei. Ich kann diese Nachrichten nicht glauben.
Auf dem Markt war um 7 Uhr Vereidigung. Der Platz konnte die Menschen nicht fassen; wie in einem Heringsfaß war man gedrängt. Oberstleutnant Haluska umarmte seine alten Kompaniesoldaten, aus den Fenstern des Rathauses wurden Blumen gestreut, und jeder der armen Reservisten, die gestern verzweifelt von Weib und Kind fortgezogen sind, bezog die Kußhände der eleganten Damen nur auf sich und erwiderte sie. Als die Regimentsfahne unter den Klängen der Volkshymne auf den Platz getragen wurde, stieg die Erregung, und in der Pause zwischen den beiden Befehlen „Zum Gebet“ und „Vom Gebet“ sandte gewiß fast jeder ein Stoßgebet zum Himmel, obwohl bei den hundertfachen Wiederholungen dieser Übung auf den Exerzierfeldern niemandem jemals gesagt worden war, daß dieser Zeitraum für ein Gebet verwendet werden solle. Nach kurzer Messe las Hauptmann Turner mit Schwung, Pathos und erstaunlichem Organ den Schwur deutsch für die deutsche Mannschaft, die ihn wiederholte; dann kam der tschechische Schwur. Es war falsch organisiert, daß man nicht aus den Deutschen ein Bataillon formiert hatte, das getrennt von den anderen geschworen hätte. So stand bei jedem Schwur die Mannschaft der nichtbeteiligten Nation bedeckten Hauptes in „Ruht“-Stellung dabei. Die Worte der Schwurformel sind überdies in jämmerlichem Stil abgefaßt, die Zäsuren unsinnig, die Sprache ist phrasenhaft und geschwollen. Es folgte eine an Hand des kaiserlichen Manifestes ausgearbeitete Rede des neuen Regimentskommandanten, des Obersten Karl Wokoun, die vom Major Lašek ins Tschechische übersetzt wurde. Hierauf brachte der Oberst ein Hurra auf den Kaiser aus, die Mannschaft schwenkte die Kappen, die Offiziere zückten die Säbel, das Publikum in den Fenstern winkte mit Hüten und Taschentüchern. Nachdem noch vom Bürgermeister die Fahne mit einem rot-weißen Band geschmückt worden war, begann der Abmarsch, Blumen regnete es aus manchen Fenstern, Frauen und alte Männer im Publikum weinten, und die Erregung pflanzte sich auf die Mannschaft fort, die sich mühte, die Rührung unter Zynismen zu verbergen.
Sonntag, den 2. August 1914.
Heute nacht ist ein ehemaliger Freiwilliger des Regiments, ein Serbo-Kroate, der sich freiwillig zur Dienstleistung gemeldet hatte, unter Spionageverdacht festgenommen und verhört worden. Es wurde ihm bis jetzt nichts nachgewiesen. Um 2 Uhr nachts ist die erste Kompanie mit dem Zug über Tabor südwärts abgegangen. Wir anderen lungern vor der Kaserne herum. Die einen erzählen, daß es bestimmt gegen Rußland gehe, aber Offiziere und Bahnbeamte glauben aus verschiedenen Anzeichen schließen zu können, daß wir gegen Serbien bestimmt sind. Mittags wurde die Löhnung verteilt. Angeblich wurde ein Mann verhaftet, dessen Buckel nicht echt war, sondern ein Paket von Giften – was die Leute so erzählen! Um halb 6 Uhr abends formierten wir uns auf der Straße zum Abmarsch. Wir wurden mit Blumen beschenkt, eine alte Frau verteilte an die Soldaten broschierte Exemplare des Evangelium Johanni, und die Abschiednehmenden und die Zurückbleibenden bekreuzigten einander. Wir formierten uns in vier Kompanien (die drei anderen Bataillone sind bereits im Laufe des Tages abgegangen), der Bataillonskommandant ließ die Straße absperren und die Zivilisten verjagen, wobei er laut und erregt schimpfte, weil die Frauen sich nicht vom Anblick ihrer abziehenden Männer losreißen konnten. Die Maßregel schien mir nicht opportun und nicht unbedingt notwendig; den Reservisten traten die Tränen in die Augen, als sie ihre Frauen davongejagt sahen. Waren nicht auch die drei anderen Bataillone ohne Absperrungsmaßregeln ordnungsgemäß abgereist? Überdies kletterten einige Reservistenfrauen durch die Fenster wieder in unser Karree und brachten den Soldaten Wasser, von neuem ihre Männer unter herzzerreißendem Schluchzen umarmend.
Bis halb 12 Uhr nachts saßen und standen wir in der Einteilung. Einige Sänger hatten sieh zusammengetan und ließen Choräle und Volkslieder ertönen, mehrere Soldaten spielten auf Pflanzenblättern hübsche Lieder. Manche hatten sich besoffen, die Offiziere übersahen dies im allgemeinen. Dann marschierten wir, von wenigen Menschen begleitet, durch die sternenlose Nacht an einem Teich vorbei, der matt schimmerte, zum Bahnhof.
Montag, den 3. August 1914.
Um Mitternacht stiegen wir in den Militärzug, die Waggons sahen in dieser umwölkten Nacht schwarz aus, und mir fiel ein, daß ich noch nie im Innern eines Güterwagens gewesen war. „Für 40 Männer oder 6 Pferde“ stand auf dem Waggon, dreiunddreißig Mann nahmen darin Platz, und unser Raum war knapp genug bemessen. Durch die Längsmitte liefen zwei Bänke mit gemeinsamer Rückenlehne, an den beiden Längswänden war je eine Bank, nur die Mitte des Waggons war zum Ein- und Aussteigen frei gelassen. Wir legten Gewehr, Tornister und Brotsack unter die Bank und schlossen die Augen.
Ich saß in einer Ecke, an meinen hilfsbereiten Waffenübungskameraden Wenzel Marek, Kanalarbeiter aus Pisek, gelehnt, und versuchte einzuschlafen. Aber wir drückten einander zu sehr, jede Bewegung des einen störte den anderen. Deshalb betteten wir uns auf den Boden zwischen die Mittelbank und die Bank an der Wand. Es war nicht leicht, denn auch der Boden war von Menschen vollkommen belegt. Die schweren Tornister waren in der Dunkelheit und räumlichen Beschränktheit nicht von der Stelle zu schieben – so mußte man Rumpf und Beine in die vorhandenen Lücken pressen. Aber man schlief in dieser Stellung eines Schlangenmenschen immerhin ein. Durch kleine vergitterte Fenster hoch oben im Waggon, die den Luken eines Polizeiwagens ähneln, schauten einige Piseker den Lichtern nach, die in der Stadt brannten. Sie versuchten sich zu orientieren und fragten einander trübselig, was wohl dieser oder jener Bürger, dieses oder jenes Mädchen eben machen möge.
Morgens um 7 Uhr hielt der Zug in Tabor. Dort wurden Erinnerungen anderer Natur laut. Im Vorjahr hatten wir hier im Kaisermanöver friedlich gekämpft, viele – darunter auch ich – in der Überzeugung, daß sie zum letzten Male Bajonett und Tornister trügen. Und Kommandant war der Erzherzog Franz Ferdinand gewesen.
Wir kamen an Hütten vorüber, an Wächterhäuschen und an Dorfbahnhöfen, an Bahnschranken, Feldern; überall standen Leute am Bahndamm und segneten den Zug, Weiber rangen die Hände und schrien vor Leid. An manchen Stellen Gattinnen unserer Reservisten, sie waren herbeigekommen und hatten stundenlang den Zug erwartet (wann er kommen werde, konnte ja niemand wissen), nur um ihren vorbeifahrenden Männern ein Wort der Liebe zurufen zu können. Um 9 Uhr fand in Veseli-Mezimosti die Kaffeeverteilung statt. Der Kaffee war auf den flachen, ungedeckten Waggons gekocht worden, auf denen je drei Fahrküchen die ganze Nacht hindurch gedampft hatten – kleine Lokomotiven mitten im Eisenbahnzug. Ich verzichtete auf den elenden Kommißkaffee und wollte mir im Bahnhofsrestaurant einen besseren kaufen. Aber der Schanktisch war voll von Soldaten, die Semmeln erstehen wollten, so daß ich nüchternen Magens den Zug wieder besteigen mußte.
In Wittingau wurde wieder Station gemacht, dort erzählten uns die Leute, daß Rußland auf die befristete Anfrage über den Zweck der russischen Rüstungen mit der Kriegserklärung geantwortet habe. Die Soldaten sind sich im allgemeinen der Tragweite dieser Mitteilung nicht bewußt, die nicht viel anderes zu bedeuten scheint als einen großen europäischen Krieg, einen – Weltkrieg.
Um halb 10 Uhr waren wir in Chlumetz. Auf dem Bahnhof stand der kleine Herzog Max von Hohenberg mit der jüngsten Schwester seiner Mutter, der Gräfin Henriette Chotek, und einem jungen Geistlichen. Er sah aus, als ob er seinem Vater, dem Erzherzog Franz Ferdinand, aus dem Gesicht geschnitten wäre. Der Prinz war aus dem Schloß Chlumetz herbeigekommen, um den Generalmajor Prziborski, einen Freund des erzherzoglichen Hauses, bei der erwarteten Durchfahrt der 21. Landwehrdivision zu begrüßen. Da diese nicht kam, betrachtete er mit Interesse die aussteigenden Truppen unseres Regiments und freute sich, daß man ihn umstand. Dann bestieg er das Auto, das – man kann dies als symbolisch bezeichnen – der Geistliche lenkte. Die Offiziere und einige Soldaten riefen Hoch, und der Bub dankte im Wegfahren durch begeistertes Schwenken seiner Matrosenmütze den Truppen, die auszogen, um den Mord an seinen Eltern zu rächen.
Bei der Station Erdweiß verließen wir Böhmen und waren um halb 12 Uhr in Gmünd. Da nur den Offizieren der Besuch des Bahnhofsrestaurants gestattet war, versuchte ich zum erstenmal die Menage zu essen, ohne Erfolg. In Sigmundsherberg hörten wir von der Ermordung Poincarés und von den ersten Kämpfen an der russischen Grenze. In Eggenburg verteilten Rote-Kreuz-Pamen Liköre und Aprikosen an die Offiziere, Zigaretten und Bier an uns.
Bei Tulln wurde die Donau passiert, und einige Infanteristen beugten sich aus dem Fenster, um zu sehen, wo – Belgrad liege. Mir wurde elendiglich schlecht. Mein zimperlicher Magen, das unregelmäßige Stoßen und Rattern des Güterzuges, eine Erkältung, die ich mir beim Waschen auf dem morgenkalten Bahnhof zugezogen hatte, die Unmöglichkeit, Wäsche zu wechseln, und andere Unbequemlichkeiten bewirkten, daß ich unter Kopfschmerzen erbrach, und meine Kameraden schüttelreimten: „Ihr werdet ihn noch sterben sehen, bevor wir vor den Serben stehen.“
Dienstag, den 4. August 1914.
Es war 6 Uhr früh, als wir auf dem Wiener Ostbahnhof landeten. Dreißig Stunden haben wir zur Fahrt von Pisek nach Wien gebraucht. Nach einer halben Stunde ging’s weiter, durch Floridsdorf, rechts und links lachte auf allen Bäumen der August mit Blüten und Früchten. Kleine Bauernhäuser nahmen sich seltsam aus angesichts der riesigen Gasanstalten, Schlote, Kuppeln und Türme im Hintergrund. Wir fuhren über Brücken, vor denen graubärtige Landstürmer mit Aufschlägen der Deutschmeister Wache hielten; sie hatten Werndlgewehre mit dem langen Bajonett und winkten uns mit den Mützen zu. Um halb 10 Uhr waren wir in Preßburg, wo Menage eingenommen wurde. Im Schaufenster der Bahnhofsbuchhandlung, in der wir ein serbisch-deutsches Konversationsbüchlein kauften, sahen wir den „Mädchenhirt“. Auch Zeitungen wurden gekauft, in denen wir den Beginn des deutsch-französischen Krieges und die Besetzung von Czenstochau und Kaliseh durch die Deutschen lasen.
Viel zu schöne Mädels schenkten uns in allen Stationen Zigaretten, Schnaps, Feldpostkarten. In Nagymaros brachten uns Jüdinnen (Sommerfrischlerinnen) Blumen, Zigaretten und Obst an die Bahn und sandten uns Küsse nach, in Waizen besorgten Pfadfinder unsere Bewirtung, kurz, die Strecke durch Ungarn glich einer Via triumphalis. Diese Vorauszahlung stimmte mich trüber als die Tränen der Zurückbleibenden in Böhmen. Wird man uns verhöhnen, umjubeln oder bedauern, wenn wir zurückfahren, oder werden wir nicht mehr zurückkehren? Um 9 Uhr waren wir in Budapest, kauften dort etwas Salami und tranken Bier. Gegen halb 11 Uhr fuhren wir weiter.
Mittwoch, den 5. August 1914.
In der Nacht an Moorlandschaften vorüber, in denen sich der Mond spiegelte. Der Kompaß belehrte uns, daß unsere Fahrtrichtung die südliche ist. Also, es steht fest: wir ziehen gegen Serbien. Kukuruzkolben, Tabakstauden und Hopfenranken standen rechts und links von uns. Der ehemalige (degradierte) Korporal Valta, ein Prager Strizzi, sang Bänkel, ein Vorreiter unseres Trains, im Zivilverhältnis Zirkusartist, produzierte sich in unserem Waggon als Feuerfresser und Entfesselungskünstler, aus einem Tränkeimer holte er mit dem Munde Zwanzig-Heller-Stücke heraus. In Tomboracs, Südungarn, bekamen wir um halb 1 Uhr nachmittags Menage. In Csasvar-Masor trafen wir einen Zug mit Kadettenschülern aus Temesvár, dann Züge mit Eisenmaterial, mit Kanonen, mit Munition.
Diese kriegsgemäßen Transporte schoben sich zwischen uns und eine Landschaft von biblischem Frieden und herrlicher Fülle. Die Sonne leuchtete über die sanften Höhen, die Sonne leuchtete über die grünen Rübenblätter und roten Mohnblüten, die Sonne leuchtete über das reife Obst und über die Weinranken an den Bäumen, die Sonne leuchtete. Wird die Sonne jedoch so leuchten, wenn wir marschieren werden, so trifft uns alle der Hitzschlag.
Man fühlt nicht mehr, daß man schon drei Tage in der Eisenbahn steckt, man ist schon immunisiert gegen das Rattern, die Leute haben die Zeltblätter von Fenster zu Fenster gespannt und liegen darin wie in Hängematten, die Taschentücher müssen den Dienst von Moskitonetzen versehen, denn die Stechmücken haben keinen von uns mit ihren Stichen verschont. Niemand denkt mehr an die Wollust des Bettes daheim. In Hidas-Bonyhad wurden wir von Deutschen mit Wein bewirtet. Es waren Bewohner der Sprachinsel „Dolnaer Hütte“. Ein Riesentunnel folgte mit Lärm und Rauch, und Ruß flog uns in die Augen. In den Stationen überall deutsche Bauern und Bäuerinnen. Sie sprechen bayrische Mundart und haben schwäbische Namen, tragen schwarze Stickereien von kostbarer Schönheit.
In Moragy erzählte man uns von Spionage und Spionageverdacht, aber auf allen Waggons der Truppentransporte sind gekritzelte Aufschriften zu lesen: „Es lebe das 28. Landwehrregiment“, „Hoch die Prager Sanitätssoldaten“, „Drum san mer Landsleut, Leitmeritzer Buben“ usw.
In Bataszek menagierten wir und hörten vom Stationsvorstand, daß ein russisches Luftschiff mit zwei Offizieren gestern heruntergeschossen und die Piloten gefangengenommen worden seien. In Baja (dem alten Bajae) trafen wir mit unserem dritten Bataillon zusammen.
Donnerstag, den 6. August 1914.
An einem Zaun, an dem sich die Ranken eines Lebensbaums emporstreckten, sah ich, als der Zug abends im Freien hielt, einen Jungen, mit dem ich ins Gespräch kam. Er stand schon die zweite Nacht draußen und sah den Militärzügen nach. Volkmann Josef spricht nicht Ungarisch, aber er versteht es und kann es lesen, denn er hat es in der Schule gelernt. Deutsch kann er jedoch nicht lesen, obwohl er ein Deutscher ist, denn er hat es in der Schule nicht gelernt.
Um 8 Uhr früh fuhren wir über die starkbewachte Donaubrücke. Im Wasser standen bizarre Bäume und seltsame Inselformationen. Alles ist hier Überschwemmungsgebiet. Die Leute am Ufer trugen serbische Trachten und riefen uns in serbischer Sprache Segenswünsche auf den Weg nach. Die Brücke mündet in Erdut, alles ist bereits doppelsprachig: ungarisch und kroatisch. In Dalj ließen sich alle Soldaten auf der automatischen Waage, die am Perron stand, wiegen. Ich wog 74 Kilo ohne Ausrüstung. Wir sandten Ansichtskarten ab. Man darf nicht schreiben, wo man ist und wohin man fährt. Man darf nur schreiben: „Mir geht es gut, was macht Mariechen?“ Und auch das nur auf offenen Karten. Aber alle hielten die Hände über ihr Gekritzel, damit niemand erfahre, was sie ihrem Mädel für wichtige Geheimnisse mitteilen.
England soll an Deutschland den Krieg erklärt haben, Japan an Rußland – wer weiß, ob’s wahr ist.
In Neu-Dalj, einer Militärstation, 2 km von uns entfernt, sind gestern um 6 Uhr früh durch einen Zugzusammenstoß (?) zwei Militärzüge entgleist. 16 Tote und 47 Verletzte vom 62. Infanterieregiment aus Ungarn. Wir passierten auf der Weiterfahrt die Unglücksstätte, schrecklich zertrümmerte Waggons, die Puffer verbogen wie altes Blech, die Räder aufwärts gestreckt wie die Beine eines verreckten Hundes, die Wände sind Späne geworden.
Durch diese Katastrophe wird sich unser Aufmarsch um mindestens zwei Tage verzögern.
Bajaer deutsche Schnitter kamen von der Pußta Slawoniens, wo sie Erntedienste verrichtet hatten. Bosnische Reservisten, manche mit österreichischen Militärmedaillen, sahen wie Greise aus, obwohl sie höchstens vierzig Jahre alt waren.
Die Hitze ist so stark während unserer Fahrt durch die unendlichen Maisfelder Slawoniens, daß einige Ohnmachtsanfälle vorkommen und schwere Befürchtungen laut werden. Um halb 7 Uhr fallen – ein einstimmiges Gottseidank begrüßt sie – große Regentropfen in die Waggonfenster. Aber schon in Borovo an der Donau hörte es leider zu regnen auf. Um 7 Uhr abends stiegen wir in Vinkovce mit umgehängter Rüstung aus. Dann wurden wir wieder einwaggoniert und kamen um 10 Uhr abends in Zupanye an.
Nach einigen Kontrollen marschierten wir 6 km bis zum Ufer der Save bei Orasze.
Der Durst klebte unsere Zunge an den Gaumen, wir wankten auf dem Marsch unter der Tornisterlast, da wir nichts gegessen hatten und vier Tage lang durchgeschüttelt worden waren. Am Ufer rollten wir uns in unsere Zeltblätter ein und legten uns auf den feuchten Wiesen schlafen. Gegen 2 Uhr wurden wir geweckt und froren wie die Spatzen. Alle zogen sich Westen an und Leibbinden.
Wir bestiegen drei Lastkähne der Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft, in denen – wie Heringe eingepfercht – zweitausend Mann Unterkunft fanden. Die drei Schiffe wurden von einem Dampfer ins Schlepptau genommen und die Save aufwärts gezogen. An Bord wurde ein Soldat ohnmächtig, ein anderer von religiösem Wahnsinn befallen.
Freitag, den 7. August 1914.
Gegen halb 11 Uhr früh wurden wir, bedeckt mit Kohlenstaub und Dreck, in Jamena ausgeschifft. Wir marschierten. Die Sonne brannte wie irrsinnig, von unseren Gesichtern floß es in Bächen, unsere Hosenträger waren naß zum Auswinden, meine Unterhosen hatten sich schon vorher in der Hitze an die Haut geklebt und waren so beim Aufsteigen und Aussteigen während der Eisenbahnfahrt zerrissen worden, daß jetzt meine Haut an der Tuchhose klebte, was zum Schreien weh tat, die Strümpfe drückten, und ich spürte blutige Fußblasen. Halbtot machten wir im Dorfe Oberska nach acht Kilometern Rast, wo es wenigstens Wasser gab.
An einem orthodoxen Kirchhof vorbei, dessen Kreuze wie Scheiben zum Vogelschießen aussahen, kamen wir um halb 8 Uhr abends nach Bjelina. Wir hatten ein Nest erwartet und fanden eine Stadt mit allen Merkmalen des Orientalischen und doch auch mit vielen modernen Bauten; und inmitten der Menge verschleierter Frauen, der kleinen Mädchen in Pluderhosen und der weißbärtigen Türken, inmitten des Blumengartens von roten, grünen, weißen und blauen Fezen und Turbanen sah man elegante Dragoneroffiziere, Automobile, Generäle und derlei. Ähnlich ist es voriges Jahr im albanischen Skutari bei der Übergabe an die Mächte zugegangen, aber diese ungeheueren Massen von Militär, von einem Militär, das mit der orientalischen Umgebung durchaus kontrastiert, hätte es dort nicht gegeben. Wir wurden in einer Scheuer einquartiert und durften dann durch die Stadt schlendern. Das Rathaus ist jetzt vom Kommando des 8. Korps okkupiert.
Bei einem Kaufmann trank ich für einen Kreuzer Kukuruzbier und aß Sultansbrot – bisher hatte ich geglaubt, daß der Gauner Duko Patkovic diesen Schmarren eigens für die Märkte der Großstädte erfunden habe.
Auf dem Marktplatz steht ein Galgen, ein Pflock mit einem Nagel oben. Heute sind ein Pope und ein Student gehängt worden. In der Nacht hörten wir Schüsse, es gibt schon Vorpostengeplänkel.
Samstag, den 8. August 1914.
Vormittags fand das Begräbnis eines 73ers statt, der gestern nacht auf Feldwache erschossen worden ist. Um 4 Uhr nachmittags hörte ich das Gebet des Muezzins. Im gelben Gebetmantel sang er eine Kol Nidre-Melodie, rings um den filigrangeschnitzten Balkon des Moscheeturmes schreitend. Ich ließ mich von dem Mann auf dem Kampanile nicht zweimal einladen und begab mich sofort zum Gottesdienst in die Moschee. Dort sprach der Hodscha kroatisch darüber, daß die moslemischen Soldaten im Kriege nicht fasten müssen. Der Raum war quadratisch und mit Teppichen bedeckt. Die Moslems hielten die Hände zum Gebet ausgebreitet und bewegten rhythmisch ihren Körper.
Im Café erfuhren wir von zeitungslesenden Männern, spaniolischen Juden, England habe wirklich den Krieg an Deutschland erklärt. Sie teilten uns auch mit, daß die Nachrichten von der Ermordung Poincarés und von der Erstürmung des Lovčen nicht richtig seien. In einem Wagen fuhr eine verwundete Serbin vorüber. Sie hatte angeblich einen Brunnen vergiftet und war dabei ertappt worden; als sie flüchtete, sandte man ihr einen Schuß nach. Ein Serbe wurde mittels Automobil ins Korpskommando eingeliefert. Er trug die Uniform eines Infanteristen unserer bosnischen Regimenter. Der Junge – er soll ein serbischer Offizier sein – hatte die Augen verbunden. In seinem Gesicht zeugte kein Fältchen von Besorgnis oder gar von Angst, obwohl ihm der Tod von Henkershand gewiß ist. Denselben entschlossenen, gleichmütigen Eindruck mußte ich von einem Komitatschi gewinnen, der in seiner tiaraartigen, schwarzen Fellmütze mit Handschellen in das Gendarmeriekommando eingeliefert wurde. So leicht, wie man sich’s denkt, wird der Kampf nicht sein gegen diese zum Tode entschlossene Welt!
Man glaubt auf der Prager Grabenpromenade zu sein. Vor dem Korpskommandogebäude und dem Hotel sah man fast alle Mitglieder des böhmischen Adels: Lobkowitz, Schönborn, Thun, Windischgrätz, Schwarzenberg, Lažansky, Kolowrat, Ringhoffer.
Sonntag, den 9. August 1914.
Das Regiment marschierte etwa vier Kilometer bis zu einem freien Platz, wo eine Feldmesse abgehalten wurde. Der Divisionspfarrer hielt eine Predigt, in der er mitteilte, Papst Pius X. habe den Soldaten einen Ablaß von allen ihren Sünden gewährt. Dann wurde „Zum Gebet“ geblasen. Unsere Kompanie bezog mittags den Wachtdienst. Im Militärlager, wohin wir zunächst abmarschierten, erzählten uns die Dragoner und die dort in den Baracken untergebrachten Prager Landsleute des 28. Infanterieregiments von den Verwundeten, die am Morgen von den Feldwachen in das Spital gebracht worden waren, darunter ein Infanterist mit elf Maschinengewehrschüssen und ein Zugführer, der zweimal in den Kopf getroffen wurde. Gerade werden fünf Frauen vorbeigeführt, bei denen man Anilin fand; man beschuldigte sie, daß sie damit Obst vergiften wollten, aber sie erklärten, den Farbstoff zum Färben von Wolle zu benötigen. Die Militärbehörden sind unendlich mißtrauisch, denn die ganze Bevölkerung ist hier serbophil gesinnt. Mit Serbien verbindet sie die Sprache und die gemeinsame Religion, der sie fromm angehören und deren Autonomie Gelegenheit zu irredentistischer Politik gab; drüben, jenseits von Save und Drina, sitzen die Kirchenfürsten, aus Belgrad und Schabatz kommen alle Bücher und alle Zeitungen.
Auf der Stationswache sind die Spionageverdächtigen. Ich schaute in die Arreste. In der ersten Zelle stand der junge serbische Offizier in der Bosniakenuniform, den man gestern im Auto ins Korpskommando gebracht hatte. In der nächsten Zelle waren drei zerlumpte Burschen, Ziegenhirten. Im dritten Raum war ein dunkelfarbiger Mann untergebracht, der die Uniform eines österreichischen Feuerwerkers trug. In der vierten Zelle lag auf einer Pritsche ein Mann mit langem, pechschwarzem Prophetenhaar und Christusbart. Seine Augen funkelten auf, als sich der Dekkel über dem Guckloch bewegte, und ich sah, daß sie schwarz, feurig und intelligent waren. Er dürfte ein Pope sein. Ich schaute noch in der Nacht in seine Zelle: er ging schlaflos auf und ab, während alle anderen schliefen. Der Feuerwerker ist angeblich von der Behörde gesucht worden, da sich bei der Untersuchung des Sarajevoer Doppelmordes herausgestellt habe, daß er ein Mitwisser gewesen; er war nicht zu finden, erst jetzt habe man ihn bei seinem Artillerieregiment entdeckt, wohin er bei der Mobilisierung als Reservist in der Hoffnung eingerückt war, dort nicht gefunden zu werden. In der letzten Zelle waren etwa zwölf Tschužen (so nennen wir die Landleute), darunter ein ganz alter mit weißem Vollbart, schwarzer Lammfellmütze und roten Strümpfen; auch er soll ein Anhänger des Sarajevoer Princips gewesen sein.
Im oberen Stockwerk: die Geiseln. Es sind Honoratioren aus österreichischen Landstrichen, wo Hinterhältigkeiten gegen das Militär vorkamen. Sobald sie sich wiederholen sollten, werden die Geiseln hingerichtet – die einzigen, die an diesen Feindseligkeiten nicht direkt beteiligt sein können, weil sie eben in Präventivhaft sind. Das riecht noch stark nach Mittelalter. Die zwölf Geiseln sind teils Popen, teils europäisch angezogene und europäisch aussehende Männer, die sich sorgfältig wuschen und die Zähne putzten. Aus ihrem Fenster läßt sich alles beobachten, was im Militärlager vorgeht, und wenn sie für Serbien spionieren wollten, so können sie sich nicht beklagen: man macht ihnen die Recherchen leicht.
Ich hatte die Meldung, daß in der Nacht Bäume im Militärlager gesprengt werden würden, um Plätze zur Landung von Militärballonen zu schaffen, an die Regimentskommandos von 11 und 73 und an den Divisionär Scheuchenstuel zu bringen, damit die Truppen durch die Detonationen nicht alarmiert werden mögen. Die Meldung war auch in der Divisionskanzlei auszurichten. Auf dem Korridor hielt mich eine Ordonnanz an. Was ich hier wolle. Wir erkannten einander: es war ein Herr Stohl, dessen Schwestern die Pionierinnen des Hosenrocks und des Tango in Prag gewesen waren. Wir sprachen von besseren Zeiten, dann trat ich in die Divisionskanzlei ein. Der Oberleutnant ließ sich im Schreiben nicht stören. Ich begann meine Meldung, als er aufsprang: „Wie heißen Sie?“ Nun wiederholte sich die Erkennungsszene, die sich eben vor seiner Tür abgespielt hatte. Es war ein Oberleutnant Dr. von Schönfeld, mit dem ich viel verkehrt hatte. Schönfeld war eben aus der Kriegsschule zum Generalstab ausgemustert worden. Er erinnerte sich, daß er mich schon einmal vor zwei Jahren in meiner schäbigen Uniform als Kommißkorporal mit zwei hocheleganten Damen auf dem Graben gesehen hatte. „Der Bruder der zwei hocheleganten Damen ist Ihre Ordonnanz, Herr Oberleutnant.“ – „Wer? Der Stohl?“ Und schon rief er den Stohl herein, und wir unterhielten uns in kollegialer Gleichheit.
Montag, den 10. August 1914.
Nachts ging unser Schwarm auf Patrouille in die Umgebung des Militärmagazins und besetzte dann die Posten in dessen Innenräumen, um Automobile, Benzinlager und Stallungen zu bewachen. Die ganze Nacht war Kanonendonner zu hören, am Morgen ratterten Aeroplane durch den Äther, und auch einen Meteor sah ich fallen. Eben habe ich die ersten Leichen dieses Krieges gesehen. In der Totenkammer des Militärlagers lagen zwei Leichen auf Brettern. Einer in Infanteristenuniform des 73. Regiments, der andere nackt, beide blutüberströmt, von Projektilen durchlöchert, die Hände gefaltet, beide von unheimlichem Gelb und von Myriaden von Fliegen umschwärmt.
Ich habe Feldpostkarten gelesen, die die Leute nach Hause schrieben. Mich interessierte es, weil man ja nichts Sachliches mitteilen darf. Einer schrieb seiner Braut: „Ich ergreife den Bleistift und das Papier, um an Dich einige Zeilen zu richten. Dein inniger Gottlieb.“ Ein anderer: „Liebe Eltern! Mir geht es gut, Obst habe ich genug gegessen, besonders Zwetschgen, herzliche Grüße von Euerem Franz.“ Andere Karten, auf denen die Absender schon von blutigen Gefechten, überstandenen Gefahren und vollbrachten Heldenstückchen faseln, werden wohl nie ihr Ziel erreichen, denn die Zensur ist streng.
Am Nachmittag war dienstfrei, und ich wollte mir ein Freudenhaus ansehen, in der Erwartung, es werde irgendeinen orientalischen Charakter haben. Statt eines Harems fand ich aber die beiden tolerierten Häuser in der Račanska ulica nur als typische Bordelle von Militärlagern vor. Der Preis für einen Zimmerbesuch beträgt eine Krone und darf – Anordnung des Militärkommandos! – nicht erhöht werden. Die meisten der Frauen saßen gerade an einer langen Tafel unter einem Taubenschlag im Hof und stärkten sich mit einem Abendessen. Die Soldaten standen zu Hunderten begierig vor den Zimmern, auf den Korridoren und im Flur bis auf die Straße hinaus, unterhielten sich durch entsprechende Gespräche oder versuchten durch die Schlüssellöcher zu gucken. Die Dirnen waren fast durchweg Magyarinnen und einige hübsche Kroatinnen. Der Kuppelwirt saß schwarzbärtig und streng hinter dem Büfett, um seinen Arm schlang sich die Binde des Roten Kreuzes ...
Einige 73er von der 1. Kompanie erzählten mir, sie hätten gestern in der Nähe des Franz-Josef-Feldes einen Zehnerjäger gefunden, dessen Kopf abgehackt und dreißig Meter weit geworfen war, beide Arme seien abgetrennt und von den Unterschenkeln die Haut abgezogen. Es habe den Eindruck gemacht, als sei er bei lebendigem Leibe geschunden worden. Wenn die Geschichte wahr ist, woran ich zweifle, so haben die Serben den armen Kerl nicht aus Lust an der Bestialität geschändet, sondern um uns vor den ersten Gefechten Entsetzen und Angst einzuflößen.
Dienstag, den 11. August 1914.
Im gestrigen Befehl waren die Nachrichten verlautbart, die wir über die Serben besitzen, die Dislokation der Hauptarmeen und der Vortruppe, daß Pavlovič das Kommando des Generalstabs an Stelle des Herzogs Putnik übernommen habe, und über angebliche Mängel der Proviant- und Munitionsnachschübe. Morgens übten wir auf dem Bjelina-Exerzierfeld das Vorrücken im Kukuruzfeld und den selbständigen Aufmarsch der Schwärme, die fast so groß sind wie unsere Kompanien im Frieden. Außerdem wurden wir über das Vorgehen gegen die Komitatschi, gegen Weiber und Kinder, welche Waffen gebrauchen, belehrt. Als wir an der Leichenbaracke vorüberkamen, sahen wir darin den Hauptmann Pokorny von den 73ern auf der Bahre; er war gestern nacht an der Drina erschossen worden. Wir marschierten bald nach Hause. Von zwei Leuten wurde mir gesagt, daß gestern ein Brief für mich eingelangt sei, aber die Tagchargen und der Rechnungsunteroffizier erklärten, von nichts zu wissen. Ich war in Besorgnis, daß der einzige Brief, den ich seit einem Dutzend von Tagen bekommen sollte, verlorengegangen wäre. Bisher hatte ich das Fehlen von Post nicht empfunden, aber jetzt, da ein Brief hier war und nicht in meine Hände kam, wurde ich ganz nervös und rannte von Pontius zu Pilatus, um nach ihm zu forschen, und ich weiß nicht, was ich für ihn gegeben hätte. Endlich – ich war bereits überzeugt, daß die Leute falsch gelesen hätten und nichts für mich eingelangt sei – übergab mir ein Soldat unseres Schwarmes den Brief, den er für mich eingesteckt und in der Tasche vergessen hatte. Er war von meiner Mutter. Sie zwang sich darin zu einem gefaßten, beruhigten Ton. Aber alle meine Brüder sind bereits Soldaten geworden, und mein seit kurzem verheirateter Bruder Wolfgang, der als Fähnrich nach Stryj eingerückt ist, dürfte bereits heute im Feuer stehen. Meine Mutter hatte einige Ausschnitte von Zeitschriften beigelegt, die sich mit meinem letzten Buch befassen und während meiner Abwesenheit erschienen waren. Sie prophezeiten mir eine Zukunft. Zukunft! Heute nacht gehen wir an die Drina.
Unserem Zug wurde die Fahne zugeteilt, dann verließen wir Bjelina. Daß dies unwiderruflich die letzte Station der Kultur und der Heimat sei, war uns allen klar, und zum erstenmal zog die Truppe in trübseliger Stimmung los. Wir sangen ein Lied, das wir im Frieden hundertmal angestimmt hatten und das heute zum erstenmal zur Situation paßte: das Lied von dem Soldaten, der fühlt, daß er niemals mehr über die Grenze heimmarschieren werde. Der Tornister war schwer, Staubwolken lagen über den Kolonnen, und Müdigkeit machte sich bald geltend. Da Hunderte von Train- und Geschützwagen die Passage erschwerten, stockte jeden Augenblick der Zug. Bei jeder Stockung warfen wir uns auf die Landstraße, obwohl wir wußten, daß das Aufstehen mit der schweren Rückenlast eine mühselige Arbeit sei.
Die vorrückenden Truppen boten ein Nocturno von gewaltiger malerischer Wirkung. Werestschagin, du Stümper! Am Himmel ein Armeekorps von Sternen, wie man es kaum je im Abendlande sieht, und von dem fast hellblauen Nachthimmel hob sich die Silhouette der kriegerischen Figuren und ihrer Gewehre und Säbel düster und bedrohlich ab; an der rechten Straßenseite war eine Böschung, auf der einzelne Leute neben ihrer Kolonne marschierten, um nicht soviel Staub zu schlucken. Von unten sahen sie aus wie Giganten unheimlichster Art.
Nach sieben Kilometer Marsch gegen Osten via Konvaluka machten wir hinter Amalijah, einem Ort hart an der Drinakrümmung, auf einem niedergemähten Kukuruzfeld halt. Vor uns schossen unsere Schwarmlinien. Wir lagen da, von Mücken belästigt. Manchmal surrten große Fliegen laut vorbei. Es dauerte einige Minuten, bis wir erkannten, daß es keine Fliegen seien, die das Surren verursachten, sondern – – Gewehrkugeln. In kurzen Intervallen pfiffen sie über unsere Köpfe hinweg. „Pzing, das war eine“, lachten die Leute, „und wieder eine.“ – Das waren die ganzen Bemerkungen, die wir machten, und der Gefreite Hevera, der, durch die Zähne pfeifend, den Schall der Kugeln täuschend nachzumachen wußte, hatte großen Lacherfolg. Was hatte ich nicht schon über die Gefühle im ersten Kugelregen gelesen! Aber keinen von uns berührte die Feuertaufe besonders. Vielleicht nur deshalb, weil wir keinen Feind sahen und die Schüsse nicht direkt gegen uns gerichtet, sondern für die Schwarmlinie vor uns bestimmt waren. Als uns erlaubt wurde, uns in die Zeltblätter einzuwickeln, legten wir uns nieder und schliefen ein.
Mittwoch, den 12. August 1914.
Um 12 Uhr nachts wurde ich von dem Hauptmann als Ordonnanz zum Regimentskommando beordert. Ich legte mich dort auf meinen Tornister und wollte eben einschlafen, als ich vom Regimentsadjutanten geweckt wurde, um dem Bataillonskommandanten Banauch die Meldung zu überbringen, daß er nach Einstellung des Artilleriefeuers eine Kompanie selbständig für sich verwenden könne. Ich konnte den Major eine Stunde lang nicht finden und irrte auf Wegen umher, die trotz der ungeheuren Truppenzusammenziehungen menschenleer waren und wo es rechts und links hinter Hecken und Kukuruzfeldern aus zehntausend Flinten krachte. Endlich brachte ich ihm die Meldung.
Um Viertel 5 Uhr ging ein grausames Krachen los. Es war unsere Artillerie, die, um unseren Pionieren den Brükkenbau zu erleichtern, die in dem jenseitigen Gehölz versteckten Serben verjagen und die Büsche rasieren wollte. Diese eigenen Schüsse wirkten auf die Stimmung schrecklicher als die fremden. Die Pferde bäumten sich auf, die Enten und Hühner rannten wie verrückt umher. Die Ordonnanzen und Offiziersdiener sprangen von ihrem Faulbett, alles wurde nervös, der Oberst begab sich zum Divisionär Scheuchenstuel und dann weiter bis zur kleinen Drinainsel, die von der zweiten Kompanie durch eine provisorische Brücke in der Nacht besetzt worden war. Über unseren Häuptern schoben sich, unsichtbaren Riesenvögeln gleich, die Geschosse der hinter uns postierten Kanonen vorwärts. Als einmal ein Schrapnell durch die Krone eines Baumes huschte, unter dem wir standen, griff sich ein alter Generalmajor erbleichend ans Herz: „Herrgott, das Geschoß hätte leicht krepieren können! Ich gehe lieber zurück.“
Übrigens trog der Instinkt nicht, der eine größere Unruhe vor den eigenen Kanonenschüssen als vor dem fremden Feuer hervorgerufen hat. Vier Schrapnelle unserer Artillerie waren zu kurz eingestellt oder platzten vorzeitig: von der vierzehnten Kompanie unseres Regiments, die gefechtsmäßig in Schwarmlinie vor den Haubitzen als Geschützbedeckung lag, wurden von eigenen Füllkugeln 21 Soldaten verletzt. Andere Geschosse unserer Kanonen krepierten in der Drina, große Wasserhosen bildend, statt am jenseitigen Ufer niederzufallen. Ordonnanzen der Infanterie rannten zurück, um der Artillerie zu melden, daß sie zu kurz schieße. Eine Batterie schob die Schuld auf die andere.
Die serbischen Schüsse verstummten, und man entsandte eine Patrouille auf das serbische Ufer. Der Generalstabshauptmann Stojan von Lasotič sprang mit dem theatralischen Ruf „Für Kaiser und Vaterland“ als erster ins Wasser, um hinüberzuschwimmen. Die Patrouille gab übrigens bald die Nachricht, daß sich die Serben unter dem Druck des Artilleriefeuers zurückgezogen hatten. Nur einige Komitatschis müssen drüben versteckt sein, denn hier und da bohrt sich eine Gewehrkugel ins Wasser oder surrt an uns vorbei. Die Pioniere begannen sofort auf großen Holzzillen, die in Lastautomobilen ans Ufer gefahren kamen, eine Brücke zu bauen. Neben uns etablierte sich die k. u. k. Feldtelefonstation. Wenn ich so jetzt nach Haus telefonieren könnte! Was wäre die Stimmung in Werfels „Interurbanem Gespräch“ gegen diese!
Wir lagerten den ganzen Morgen vor der Brücke, die die Pioniere über die Drina bauten.
Trinkwasser gab es nicht, da die zahlreichen bosnischen Schwengelbrunnen vergiftet sein sollen. Wir sandten nach Amalijah, aber in den Trinkeimern kam nur trübes, von Infusorien bevölkertes Wasser zu uns. Ich trank es durch einen blauen Nackenschützer, den ich an den Mund legte. Durch diesen Nackenschützer, der bisher auf dem Halse eines Infanteristen geklebt hatte und den nun schon der halbe Zug als Filter im Mund gehabt hatte, schmeckte das Wasser besser als Sekt.
Ich saß auf der Straße und kritzelte in diesem Notizbuch, als mich Leutnant Görner fragte, ob ich ihn schon in meinem Tagebuch verewigt habe. „Zuerst müssen Sie etwas Besonderes getan haben“, entgegnete ich. Etwa eine halbe Minute später pfiff eine verirrte Serbenkugel durch die Luft, und Leutnant Görner äußerte schnell, aber nicht erregt: „Ich bin getroffen.“ Er wies auf seinen Fuß. Wir wollten es zuerst nicht glauben, sahen aber bald darauf, daß er die Wahrheit gesprochen hatte. „Es schmerzt wie ein Peitschenhieb“, sagte Görner und humpelte in der Richtung zum Sanitätsplatz davon; er hatte seine Verwundung, die eine Heimreise bedeutet.
Um 1 Uhr mittags überschritten wir die Pontonbrücke und waren auf der ersten Drinainsel, auf serbischem Gebiet. Die südlich von dieser großen Insel gelegene Gutič Ada war schon in der Nacht von der 2. Kompanie besetzt worden. Die Insel, auf der wir in Gefechtsform als rechter Flügel des Regiments vormarschierten, ist auf der Spezialkarte nicht als Insel eingezeichnet, da die sie umgebenden und durchfließenden Drinateile als tote Arme dargestellt sind. Aber die Drina ändert jedes Jahr ihren Lauf, und so geschah es, daß wir beim Vormarsch dreimal bis an die Hüften im Wasser, von der Strömung fast umgeworfen, mit Gewehr und Gepäck von Ufer zu Ufer marschieren und dann steile Böschungen hinaufklettern mußten.