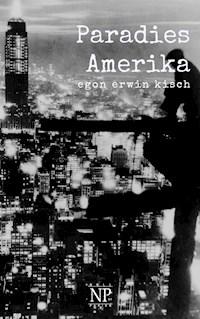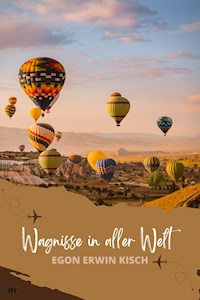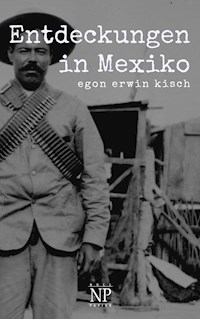Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kisch bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Fassung in aktueller Rechtschreibung Egon Erwin Kisch gilt als einer der bedeutendsten Reporter in der Geschichte des Journalismus. Nach dem Titel eines seiner Reportagebände wurde er auch als "der rasende Reporter" bekannt. "Schreib das auf, Kisch!" wurde zum geflügelten Wort in den 1920ern. Lesen Sie hier 30 seiner gelungensten Reportagen und Essays. "Reportage ist eine sehr ernste, sehr schwierige, ungemein anstrengende Arbeit, die einen ganzen Kerl erfordert. Kisch ist so einer." [Kurt Tucholsky] Mit 153 Fußnoten Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Egon Erwin Kisch
Hetzjagd durch die Zeit
Reportagen
Egon Erwin Kisch
Hetzjagd durch die Zeit
Reportagen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Aufbau-Verlag, 1926, 1974 2. Auflage, ISBN 978-3-962817-13-8
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Schollenjagd und Haifischfang
Eilige Balkanfahrt
Im Wigwam Old Shatterhands
»Monna Vanna« auf der Hochzeitsreise
Verbrechen in den Hochalpen
Il Equilibrista
Werften und Docks
Es spukt im Mozarthaus
Gässchen der Unterröcke
Die Befreiung Orsovas
Was die Wöchnerinnen singen
Wilde Musikantenbörse
Mysterien des Hydrografischen Instituts
Erste und letzte Ausfahrt der Flotte
Der Naturschutzpark der Geistigkeit
Besuch beim Prager Schinken
Die Festung Bouillon
Prag – Wysotschan – Paris
Der Herr der Waggonvilla
Pistyaner Schwefel
Die Dame in Trouville
»Handeln mit alte Kleider …«
Zürcher Zuchthaus
Die Giftschränke der Deutschen Bücherei
Polizeiakten des Baumgartens
Sonntagsfahrt durch Nordseeland
Raubtiere fressen
Böhmisches Dorf in Berlin
Lenins möbliertes Zimmer
Die Geheimnisse des Salons Goldschmied
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Kisch bei Null Papier
Paradies Amerika
Der Mädchenhirt
Schreib das auf, Kisch!
Geschichten aus sieben Ghettos
Der rasende Reporter
Entdeckungen in Mexiko
Marktplatz der Sensationen
Hetzjagd durch die Zeit
Wagnisse in aller Welt
Schollenjagd und Haifischfang
I. Ausfahrt eines Finkenwärder Fischkutters
»Die Steuerämter und die Zollbehörden müssen eben von Amts wegen jeden als Spitzbuben ansehen«, warf ein alter Seemann in die Debatte der Schiffer, die auf dem Pier von Schulau standen und zu unserem Kutter1 hinabschauten; auf Deck manipulierten zwei Zollbeamte. Vom Transitlager wurde das amerikanische Gasöl in Kannen gepumpt, je zehn Liter goss der Beamte durch einen Trichter in die Verschraubung des Brennstofftanks und senkte einen Metallstab in die Öffnung; die Stelle, an der die Stange fettig zu werden begann, markte er mit einer Feile. Wieder zehn Liter, wieder eine Kerbe, wieder wurde das Öl sorgsam mit Werg vom Messstock abgewischt, dieser von Neuem in den Tank gesteckt; sechs Fässer waren bereits eingefüllt, der Stab, zur Skala geworden, bekam die amtliche Plombe. Nun kann man jederzeit feststellen, ob der Verbrauch des zollfreien Öls der Fahrtdauer entspricht oder ob der Schiffer etwa ein Quantum verkauft hat, was als Schmuggel zu qualifizieren wäre. »Nur Schikanen«, brummten die Zuschauer auf dem Kai, »das haben uns die Flussfischer eingebrockt. Die hetzen, wo sie hinkommen!« Stundenlang dauerte die Prozedur. Manchmal war ein neuer Eimer eingegossen worden, und auf der Leiste lag die Feuchtigkeitsgrenze tiefer als vorher. Wieso? Ein großer Dampfer kreuzte Schulau, und die Wellen bewirkten, dass sich unser Kutter neigte, für uns unmerklich, aber auch unmärklich für den Zollbeamten.
Um drei Uhr morgens, zu Beginn der Ebbe, gingen wir aus dem Hafen. Großsegel und den Besan zog man hoch – mächtige Trapeze, rotbraun von Eichenlohe, nur die geflickten Stellen in der grauen Urfarbe des Segeltuchs. Der Bugspriet2 wurde ausgeschoben, wie ein Kanonenrohr, und mit der Hand der Klüver3 darauf gehisst, ein spitzwinkliges Leinendreieck, das bisher in der Koje gelegen hatte. Zuletzt wurde am Fockstach, einem Drahtseil, die Fock gesetzt.
einmastiges Küsten- und Fischerfahrzeug <<<
über den Bug hinausragende Segelstange <<<
ein dreieckiges Vorsegel <<<
II. Begegnungen auf der Unterelbe
»RMS1 Elsaß« dampft nach W’haven2 zum Übungsschießen; zwei feldgraue Minenräumer fahren an Groden vorbei, wo ehedem das Minendepot war, und träumen vielleicht von entschwundener Herrlichkeit. Boote des Reichswasserschutzes, von denen es noch 1922 hier wimmelte, sieht man nicht mehr. »Holsatia« kommt stolz des Weges, leer sind die Promenadendecks, die Passagiere erster und zweiter Klasse reisen von Cuxhaven mit dem Sonderzug bis Hamburg, die armen Leute vom Zwischendeck müssen sich Zeit lassen. Viele Bagger, die großen Eimer an einer Kette ohne Ende, arbeiten von Staats wegen, auf dass die Ozeandampfer freie Fahrt haben; die emporgeholte Erde wird bei Finkenwärder eingedeicht und aufgedämmt – man braucht Platz für die Deutsche Werft und Platz für jugendliche Sträflinge, backbord liegt Hannöversund, Gefangenenlager für etwa fünfhundert Jungen, auch hierher liefert man Elbgrund als Ackerboden. Beim Belumer Außendeich sind Saugbagger in Tätigkeit, die Schlamm und Kohle schlucken, diese Beute auf die Nordseite der Elbe bringen und außerhalb der Fahrrinne ausspeien. Personendampfer, einst deutscher Besitz, nach dem Kriege an Nordamerika abgetreten, tragen die Flagge von Panama; die dortigen Filialen der Schifffahrtsgesellschaften figurieren als Eigentümer, damit das Alkoholverbot an Bord nicht gelte. »Senator Oswald« ist einmal umgetauft worden und hat zweimal die Farben gewechselt. »Cleveland« führt den alten Namen, aber die Alkoholflagge.
Hinter Brunsbüttel dreht der Wind herum, und die Segel fangen das Klappern an, wir nehmen Fock und Klüver herunter, stöhnend windet sich der Gigbaum um seine Achse, den Großmast. Acht Mastbänder schlagen an die Riesenstange.
Reichsmarineschiff. <<<
Wilhelmshaven. <<<
III. Der Krieg der Fischer
Kleine Segler der Elbfischer liegen in Stromrichtung vor Anker; ein Ruderboot haben sie längsseits, auf dem sie ihr Garn, sechs geknüpfte Wände von je dreißig Meter Länge, aussetzen und alle fünf Stunden, wenn Ebbe und Flut wechseln, wieder einholen, Butte, Aale, Stinte und Hechte erntend. Die Verbindungslinie von Ostemündung zum Ort Neufeld bei Holstein ist eine Grenze: Oberhalb dürfen die Hochseefischer keine Netze auswerfen, sie tun es dennoch, von Oktober an, bis zum Eingang, trotz Verbots und trotz der Proteste der Elbfischer, trotz der Verhandlungen vor den preußischen Landgerichten in Stade, Freiburg und Marne (Dithmarschen), trotz der (oft mit Revolvern erzwungenen) Wegnahme von Fischereigerätschaften und trotz Geldstrafen bis zu zweihundert Mark. Ein veritabler Krieg ist das zwischen Elbfischern und Seefischern. Das Gesetz stammt aus dem Jahre 1887 und ging von der Annahme aus, das Grundnetz ruiniere die Buttbestände, sodass im Sommer keine Fänge gemacht werden könnten. Aber obwohl die Seefischer, denen im Krieg das Meer versperrt war und denen noch immer im Winter jede Verdienstmöglichkeit fehlt (unter anderem gibt es keine Austern mehr in den deutschen Meeren), südlich der Grenzlinie die »Kurre« aussetzen, ergab sich auf den Märkten von St. Pauli und Cuxhaven keine Verringerung des Buttauftriebs. Außerdem wurde wissenschaftlich festgestellt, dass der Butt zum Laichen nach See geht, zumeist an die holländische Küste, und von dort in alle in die Nordsee mündenden Flüsse zurückwandert, also durch das Schleppnetz auf der Elbe die Laiche nicht gestört werden kann. Die Elbfischer jedoch beharren auf dem Gesetz, das sie vor Konkurrenz schützt, und die preußischen Behörden, besonders der Oberfischmeister von Altona, kommen ihnen mit strengen Strafen zu Hilfe.
IV. Wir laden Eis
Kurz vor Cuxhaven, wir hatten schon den Turm der Garnisonkirche und den Windsemaphor in Sicht, machten wir den Rest der Segel unter der Gaffel fest, denn es war windstill geworden. Der Motor stieß uns in den Alten Hafen. Die Landungsbrücken »Alte Liebe«, mit Häusern aus Fachwerk im Hintergrund, und »Seebäderdienst«, auf der der Hafenbahnhof steht, und eine Drehbrücke mit Handbetrieb schließen das Bassin ein. Zwei Tonnenleger, Staatsschiffe, schwarz, mit gelbem Schornstein, einige Lotsenschoner, zahllose Kleinboote der Krabbenfischer, drei Bergungsschiffe, »Seefalke«, »Wotan« und »Hermes« – Erste Hilfe für havarierte Schiffe –, sind verstaut. Wir legten uns längsseits eines Fischerfahrzeugs, und als dieses mit dem Löschen fertig war, konnten wir an den Pier verholen.
Das Eis, das zur Konservierung der zukünftigen Beute gebraucht wird, lädt man erst in dem Augenblick, da man in See sticht. Angestellte der Kühlwerke erwarten die von der Elbe kommenden Schiffe, einer notierte unsere Bestellung, viertausend Pfund für insgesamt vierundzwanzig Mark, und ein einstiger Militärtrainwagen, von einem Auto geschleppt, effektuierte sie. Die kalten Kristalle rollten von der Mole in den Gefrierraum, der sich Unterdecks hinzieht und doppelte Schotten hat, damit nicht etwa die animalische Wärme aus dem Logis1 das Eis schmelze.
Zigarren, Schnäpse und Konserven besorgt ein Agent aus dem Freihafen, spottbillig ist alles, aber wir dürfen von dieser zollfreien Ware nichts nach Deutschland zurückbringen. Bei den von See kommenden Schiffern erkundigen wir uns nach den Fischgelegenheiten und Fangergebnissen. »Wi hebbt fischt to Spiekeroog, Langeoog un Norderney, up veertein bis siebentem Faden; twee, drei bis süß Stieg Zungen, und’s Korb anderthalb goute Schollen un veer bis fiew Stücker Mattgut im Strich, darunner fiew bis süß groute von stückerwat twölf bis fievtein Pound twischen.« Ähnlich lauten alle Auskünfte, und wir wenden morgens gegen vier Uhr gegen Spiekeroog.
Mannschaftsunterkunft auf Segelschiffen <<<
V. Schiffer Hein Hinrichsen verteilt
Zwischen Feuerschiff II und Feuerschiff I, eine gute Stunde hinter Cuxhaven, wies Hein Hinrichsen mit dem Arm ostwärts. »Sühst du doar den swarten Punkt?« Es waren mehrere schwarze Punkte zu sehen. »Dat sünd luder Wracks, ober wieter backbord up Wittsand, doar sitt mien Kotter, de ›Emma-Katherine‹.« Er blickte hinaus. »1903 hab ich sie bauen lassen bei Schedelgarn auf der Werft in Üttesen. Dreiundzwanzigtausend Mark hat sie gekostet mit dem Motor zum Netzeheben, acht Pferde stark, zehntausend Mark war ich noch schuldig, fast sieben Jahre bin ich darauf gefahren. Im November 1909 blieben Stücker neun von den Finkenwärder Kuttern in See, nur den ›Senator von Mölle‹ hat ein Dampfer nach dem Sturm bis Esbjerg geschleppt, ohne Masten und Setborte, voll von Wasser, die Mannschaft halb tot – von unseren anderen neun Fahrzeugen mit den dreißig Mann hat man keinen Span gefunden. Ich war auch draußen, mit der ›Emma-Katherine‹, den Tag vor dem schweren Wind trafen wir sechs von der Finkenwärder Flotte, den einen hab ich angesprochen, den Ewer ›Friese‹ des Kapitäns Klausen, und redete mit ihm über das Wetter, weil das Barometer auf siebenhundertzweiundzwanzig zeigte, doch dachten wir, der Sturm muss anderswo sein. ›Wi wollt man hier blieft, dat ward woll so schlimm nich wesen‹, hat Klausen gemeint. Ich aber sagte: ›Wi wollt weg.‹ Wir hatten die Reise beendigt, sechzehn Tage hat sie gedauert. Fünfzig Meilen Südsüdost von Helgoland konnten wir die Küste nicht und nicht beholen, so braßten wir denn, kriegten das Schiff wieder rum und trieben nach See, morgens war der Wind südlicher, wir setzten den großen Klüver auf und liefen mit sechs Meilen Fahrt nach Elbe zu. Nachmittags, sechs Uhr, querab von Helgoland, wurde ich ausgepurrt, Klüver und Toppsegel mussten weg, die Brise nahm zu, und wir hatten schon fast die Büx voll, weil das Barometer noch immer so furchtbar schlecht stand; Wind ging von vorne, beim dritten Feuerschiff flog uns die neue Fock weg, nur die Sturmfock blieb uns, zum Reffen1 war keine Zeit. Der Kutter lag mit der Reling zu Wasser, dick von Regen und Schmutz, wir klarten Ketten und Schlepptrosse und Rettungsboot, für den Fall, dass noch mehr brechen sollte – aber es ist nichts passiert. Glock2 neun vormittags vertäuten wir an der Auktionshalle Cuxhaven. Die Fischersleute im Hafen hatten die ganze Nacht vor Sorge kein Auge geschlossen. Fischereiinspektor Duge kam an Bord. ›Onkel Hein, wie schall dat woll noch wärn?! Doar sünd jo noch een ganzer Haufen buten!‹ Da meinte ich: ›Wenn de Wind man rumloopen deit, wie he gewöhnlich deit, denn is jo nix im Weg – wenn er ober südwest blift, denn seeht dat man nich fein ut for unser Komeroden, denn se stahn all nördlich.‹ Wir löschten die Fische, und nachmittags um vier Uhr fuhr ich mit der Bahn nach Finkenwärder, anderntags wieder nach Cuxhaven, den Tag darauf mit aufgehendem Barometerstand in See. Als wir rausgehen bei Kugelbake, trafen wir den Kutter ›Landrat Köster‹ mit Schiffer Friedrichs. ›Na, Jacob, woar hett goh?‹ – ›Bös Wetter, wenn se man bloß al wedder rin sünd?!‹ Achtzig Meilen Nordwestwest segelten wir zum Austernfang, und nachdem wir neun Tage gefischt hatten, wollten wir heimmachen. Nahe vom Norderneyer Feuerschiff lief der Wind rum, das Barometer fing das Fallen an, und wir kriegten ein Utscheider, haben die ganze Nacht getrieben; morgens wurde es flauer, und wir setzten Kurs auf Elbefeuerschiff. Vierzehn Tage nach dem Sturm bin ich zu Hause, geht die Fragerei los: ›Hest du mien Vadder ne sehn?‹ – ›Hest du mien Mann ne sehn?‹ – man mochte kaum den Deich entlanggehn. Mein Mut war weg, und ich snacke zu meiner Frau: ›Nu, wollt wi man Wiehnacht füern. Denn wür’s jo ook woll anners.‹ Bin aber doch den nächsten Tag losgefahren nach Cuxhaven, da meint mein Schwager, der Bruder meiner Frau: ›Du kannst jo mal an Land blieven, Hannes Schramm, de is hier, de kann jo mit buten gohn.‹ Ich sage: ›Junge, Junge, wullt du noch annere Lüt mit’n Fohrtüch schicken, wenn de Schiffer sülben keen Mut doarzu hett?‹ – ›Ach wat‹, macht er, ›lot uns man losgohn.‹ – ›Na, denn mientwegen. Un pass man gout ups Loot, mock jo to rechte Tied lütte Segels, denn schall wi gohn.‹ Nach fünfzehn Tagen kamen sie zurück, hatten Scherbretter und Netz verloren und fragten: ›Nu, komm’ wi woll ne wedder los?‹ Ich beruhigte sie, das hätte mir auch passieren können, die Brille ist ja noch nicht erfunden, mit der wir auf Meeresboden kieken, und gab ihnen noch ’ne Ermahnung, und sie lichteten wieder Anker. Auf dem Heimweg kriegten sie Regen, Sturm und Stromversetzung, liefen bei Wittsand auf. Ein Telegramm aus Cuxhaven traf ein: ›Seefischer Hinrichsen, Finkenwärder. Kutter Emma-Katherine auf Wittsand gestrandet.‹ Da war Holland in Not! Die Tränen liefen mir über die Backen, hab an das Hafenamt telefonieren lassen und den Bescheid erhalten: ›Leute und der Hund geborgen.‹ Sofort bin ich nach Wittsand, um zu sehen, ob etwas zu retten wäre; leider war der Boden herausgeschlagen, und so liegt es noch da, das Gerippe neben zwei anderen Wracks – dort der schwarze Punkt. Nur das Barometer hab ich von der ›Emma-Katherine‹. Vom Feuerschiff II war ein Rettungsboot hin, das hatte die Leute aufgenommen, meinen Schwager Karl Helmcke, den Hannes Schramm, die beiden Jungs und den Hund Molly. Versichert waren wir nur auf fünfzehntausend Mark, und ich war viel schuldig – nicht daran zu denken, einen anderen Kasten anzuschaffen. Ich hab allerhand gearbeitet, als Ersatzschiffer Heuer3 genommen und so. Mein Schwager Helmcke hat die Seefahrerei an den Nagel gehängt und ist Zimmermann auf der Werft in Finkenwärder.
Mit sechstausend Mark Reichsdarlehen konnte ich dann dieses Schiff kaufen, im April 1910 von Sittas auf Kranz-Neuenfelde, ›Landrat Theßmann‹, es war schon neun Jahre alt, der bisherige Eigentümer ist bei einem Sturm verrückt geworden. Neue Anschaffungen musste ich machen und ein Jahr lang ohne Maschine fahren. Ich wollte das Fahrzeug umtaufen, wieder auf ›Emma-Katherine‹, den Namen meiner Frau, das hat man nicht bewilligt – die Ehrung eines Landrats darf nicht beseitigt werden. Als ›H. F. 262‹ ist es in die Schiffsliste eingetragen und 1917 (damals zogen wir nach Schulau, weil’s uns in Finkenwärder zu eng wurde) auf ›S. S. 68‹ geändert.«
Segeln durch Einrollen einzelner Bahnen in der Fläche verkleinern <<<
Uhr <<<
Lohn eines Seemannes <<<
VI. Der Fang
An den ostfriesischen Inseln, 53,55 nördlicher Breite und 7,30 östlicher Länge. Bei stürmischem Wetter, Windstärke neun, Seegang sechs bis sieben, furcht unser Kutter durch unruhige See. Mittags, Glock zwölf, wird das Netz an die beiden Scherbretter steuerbords geschlagen und ausgesetzt; die Bretter, an zwei achtzig Faden langen Drahtseilleinen hängend, schießen in der Strömung davon wie Kinderdrachen in der Luft, infolge der ungleichen Einfallswinkel jedes in anderer Richtung – aber in einer Distanz von hundertvier Fuß können sie nicht weiter voneinander, das Grundtau verbindet sie, und das ist nun gespannt. Der Motor wird erst auf langsam gestellt, wenn das Netz unten ist, sonst würde es über die auf dem Meeresgrunde sitzenden Fische hinweggerissen werden. Am Besanmast wird der Fischerball hochgezogen (eigentlich kein Ball, sondern ein Korb), das Zeichen für anfahrende Schiffe, dass wir schwer manövrierfähig sind.
Drei Stunden lang schleppen wir eine Falle, die dreißig Meter breit ist und hundertzweiundvierzig Meter hinter dem Achtersteven unseres Kutters ihr Ende hat.
Um drei Uhr nachmittags wird das Netz gehoben, die Bremsen der Motorwinde gelöst, die Schiffsschraube losgekoppelt, die Drahtleine aufgerollt, und das Fahrzeug treibt. Sind die Scherbretter wieder auf Deck, fassen alle Hände an, das Strickgeflecht über die Bordwand zu bringen, bis der Beutel erreichbar ist, genannt »Steert«. Zwei Fischtraillen, an den Mastbäumen mit zehn Meter langen Trossen befestigt, werden jetzt in den Steert eingehakt und dieser motorisch über die Reling geholt.
Unheimlich schwebt der nasse Riesensack auf den beiden Kranhaken hoch in der Luft. Aus seinen Maschen schieben sich Fischköpfe, Kiemen sind aufgespießt, runde Augen glotzen, Krebsscheren greifen ins Leere, Flossen flattern, heraus ragen Zacken von Seesternen, Muscheln, Strickreste, Flaschenhälse, Knochen, Tang, Kohle, Organisches und Unorganisches. In ohnmächtiger Bewegung sind die Gefangenen um ihre Befreiung bemüht, vergeblich, denn wenn es ihnen gelingt, purzeln sie auf Deck. Taumelnd, baumelnd, triefend ist dieser Ballen zu unseren Häuptern – leblos und doch belebt in seiner Gesamtheit, von tausendfältigem Kiemengezappel, Flossenschlag und Scherengreifen im Detail. Ein Sack nur, ein Sack jedoch, der nach allen Seiten mit lebendigen Augen über entsetzt aufgesperrten Mäulern starrt!
Einer der Fischer, unter diese Dusche springend, reißt den Schlippknoten mit beiden Händen auf, die Verfallenen stürzen hinab.
Schon wird drüben das zweite Netz ausgesetzt, aber hier, steuerbord, brodelt ein Berg. Fische, den flachen weißen Bauch nach oben. Fische, den schleimig braunen Rücken nach oben, dass man sie vom Schlamm nicht zu unterscheiden vermag. Muscheln mit aufgeklappten Schalen. Enorme Taschenkrebse, in ihren wie Papageienschnäbel aussehenden Scheren eine Scholle haltend: sie haben sie im Netz erhascht und lassen sich den Fang nicht entwinden. Einsiedlerkrebse, die rot und gelb aus dem Schalengehäuse kriechen, begnügen sich mit einem Seestern. Einen halben Meter lang sind die Steinbutte. Fischbandwürmer, vielleicht in der Todesangst exkrementiert, umschlingen klebrig das Gefangenenlager. Seezungen, als wären sie sich ihres Marktwertes genau bewusst – sie sind besondere Ernte –, pressen den Kopf an eine Planke,1 sodass sie nicht zu greifen sind, denn der schleimige Rumpf glitscht aus jeder Hand. Die Krebse zwicken, ohne ihre Beute loszulassen, mit Scheren oder stechen mit Krallen; die hintersten Füße, bei denen man sie ungefährdet packen könnte, verstecken sie. Es schlägt der Butt und gar manche Scholle mit respektabler Wucht dem auf die Finger, der sie in den Korb werfen will. Knurrhähne streben geradenwegs zur Abflussgatte in der Bordwand – wissen sie, dass dort der Weg ins Freie führt? Scharben, Kabeljau, Schellfische und Stinte zappeln oder springen, Tintenfische, Seeigel, Quallen, Totenkopfmuscheln, Seeanemonen, Seerosen, Schwämme, Spinnen, Seemäuse, minderwertige Krabben, genannt »Klaus Dedels«, und anderes Unkraut und Ungeziefer wünscht der Unheimlichkeit von Tageslicht und Menschennähe zu entrinnen.
langes, dickes Brett; Bauholz für den Schiffsbau <<<
VII. Auch menschliche Spuren sind auf dem Meeresboden
Erstaunlich ist die Zahl der Menschenspuren am Meeresgrund: große Kohlenstücke, intakte und leere Konservenbüchsen, ein Sack Mais, Knochen, Holzpantinen, ein zerrissener Strandkorb, Bierflaschen, eine Matrosenmütze, ein Südwester, Antennendraht, ein Seidenschal und ein Eimer kamen schon mit dem ersten Fischzug in unser Fundbüro. Reste eines Liegestuhls waren zwischen den Fischen, morsch das Holz, die Leinwand fehlte, und man erkannte die Stellen des einstigen Eisenbeschlags an einem Hauch von Rost und an unversehrten, golden glänzenden Metallschrauben. Einen Landungssteg erbeuteten wir auf der Fahrt und einen Poloball. Die Tafel einer Badeanstalt ließ entziffern: »Schwimmhose 10 Pf., Handtuch 5 …« Froh wurde eine Flasche französischen Kognaks, Originalpackung mit Korkband, begrüßt, trübselig stimmte es die Fischer, als sie ein Fischernetz im Fischernetz fanden, ein Scherbrett mit sechs Meter leinengeknüpften Rhomben. Ein Krebs hielt ein zusammengeknülltes Stück Papier in der linken Schere, nur mit Mühe konnte man es ihm entreißen; es war ein in portugiesischer Sprache bedrucktes Blatt. Zwei Pfund wog wohl die Scholle, die einen schwarzen Druckknopf aus Hartgummi mit dem Datum 1.5.1913 links unten am Rücken eingepresst hat: sie ist von der »Poseidon«, dem biologischen Versuchsschiff, zur Feststellung von Wachstum und Lebensalter ausgesetzt, in Hamburg müssen wir den Fisch bei der Staatlichen Fischereidirektion gegen Belohnung von drei Mark und gegen Bezahlung nach Gewicht abliefern. Höchstens zwanzig Sterne noch und kaum vier Wellenlinien mehr hat der Union Jack, der im Netz lag. Auf einem Gummischwamm, Fabrikware, saß ein Meeresschwamm, naturgeboren. Überhaupt nisten in den meisten dieser menschlichen Überreste Muscheln, Seesterne und Seerosen. Ein schmaler, kleiner Damenschuh war derart garniert, der herausschauende Rest eines Seidenstrumpfs passte gut zu den Farben; mit Scherzen: »Schade, dass das Frauenzimmer nicht darin steckt!«, ging der Schuh von Hand zu Hand, bis jemand ein wenig an dem Strumpf zog und ein Fuß zum Vorschein kam – allerdings nur für einen Augenblick, denn schon flog das grause Stück dorthin, woher es gekommen war. – In der vierten Nacht machen wir einen noch unheimlicheren Fang. Der Mond leuchtet, und das Wasser strafft sich in den matten Farben, die wir tagsüber nur am Kühlwasserabfluss sehen, wenn der Motor stoppt, jetzt aber sind das oxydierte Silber und das Perlmutt mächtige Flächen des Hintergrunds, vor dem der Netzbeutel, heute zum achten Mal gehisst, ungeduldig über uns Ungeduldigen schaukelt. Man öffnet, und ein Mensch stürzt herab – ein nackter Mann, mit grauenhaften Glanzlichtern auf einem Körper von giftgrüner Grellheit und ungeheurer Breite, Tang und Getier an allen Stellen und in allen Haaren, sinkt auf Deck in die Knie, schlägt mit der Stirn auf das Rettungsboot, die Ellenbogen an die Hüften gepresst. Wir jedoch springen, von sinnloser Feigheit gepackt, der Luke unseres Logis zu und fallen die Leiter hinab, einer auf den anderen, ohne zu fluchen. Der erste, der flucht, ist Steuermann Klaas, er kriecht wieder hinauf, wir anderen ihm nach, stumm, mit zusammengebissenen Zähnen. Nur der Schiffsjunge faltet die Hände, kaum dass sie frei sind, und stammelt in dieser Haltung weiter: »… also auch auf Erden … vergib uns unsere Schuld …«
Ein Schlippknoten wird gemacht, und man versucht, ihn dem Leichnam um den Hals zu werfen. Aber der tote Gast stützt unentwegt seine Stirn an die Wanten des Rettungsbootes, ganz fest, kein Zwischenraum bleibt für das Lasso. Der Hüne Klaas geht hin und stößt dem Knienden, ohne ihn zu berühren, ein Tau um die Brust und knüpft eine Schlinge. Jetzt erst fasst der Kapitän das Seil, es wird an die beiden Fischtraillen gebunden, der Motor zieht hoch, und der Kranhaken mit der schauerlichen Last dreht sich außenbords, schwebt mitten in den fahlen Strahl des Mondes hinein. Der Leichtmatrose öffnet den Knoten, und blass und wortlos schlagen die Schiffer ein Kreuz. Bloß der Boy klappert: »… zukomme uns dein Reich …« Wir nehmen die Schaufeln, und alles, was im Steert gewesen, fette Steinbutte, stattliche Zungen, Riesenkrebse – alles fliegt über Bord, in die Freiheit. Dann scheuert man das Deck.
Noch zehn Tage dauerte unsere Fahrt, doch wurde von diesem Fischzug niemals ein Wort geredet.
VIII. Der Hai
Nur einmal, am 14. Mai, der Fischbeutel tauchte gerade aus dem Wasser, fragte der Leichtmatrose scheu, ob er nicht außenbords öffnen solle. Es schien, dass abermals eine Leiche im Netz sei, und er wollte die Arbeit der Beseitigung ersparen. Wir schauten vorgeneigt und durchdringend auf das Netz und erkannten, der große weiße Korpus bewege sich. Ein lebender Mensch also? Nein, ein Haifisch. Es wurden »Stropps« geholt, eine Art Wurfschlinge, und die Holzkeule; wir standen mit Hacken zur Notwehr bereit. Der Matrose, der immer den Knoten aufreißt, war noch nie so schnell beiseite gesprungen wie diesmal. Heraus spritzten die Fische, und krachend sauste Meister Hai hernieder. Das Schiff erbebte. Zweimal schlug er mit der Schwanzflosse, Butt und Scholle von Bord fegend, schon jedoch warf ihm der Steuermann eine Schlinge über den Kopf, das Tau, das vorher durch einen Bolzen gezogen war, zwei Mann holten zu, und der Hai lag wehrlos im Ring. Wehrlos, wohl wehrlos, doch keineswegs leblos, toll trommelte sein Hinterleib auf den Boden. Ein Schlag auf den Schädel betäubt ihn – ein Stich, hart an der zackigen Afterflosse – das Blut sprudelt hoch – durchschnitten ist die Schwanzader – in zwei Minuten verendet er – ein Koloß von ungefähr hundertfünfzig Pfund.
Wir schlitzten ihn auf. Den größten Eimer füllte die Leber, im Magen steckte ein Konglomerat von Butten, Kabeljaus, Scharben, Seezungen sowie von Fischen ganz ferner Gegenden, halbverdaut und manche unversehrt. Ein Klumpen von Eiern, die größten wie Hühnereier, die kleinsten mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar, klebte an jedem Eierstock, in zwei Beuteln saßen ungeborene Junge, etwa vierzehn Tage vor der Geburt. Hatten wir kommen müssen, um ihr Leben zu verhindern?
In Bottichen lösten wir das Fett auf, verkochten es und die Leber zu Tran, legten das Fleisch auf Eis. (Fünfzehn Mark wird in Altona der Fischhändler bezahlen, der das Haifischfleisch als »Seeaal ohne Gräten in Gelee« oder als Fischkarbonade weiterverkauft.) Zwei Stunden dauerte die Arbeit, und es wurde Zeit zum Einholen des nächsten Netzes. Die Fischer prophezeiten wieder einen Hai, denn sie glauben an das Gesetz der Serie; im vorigen Jahr haben sie bei Helgoland vier Stück auf einmal gefischt, und Dampfer bringen oft zehn Korb nach Hamburg. Der Fischbeutel tauchte empor, wir sahen keinen Hai. Und doch war einer darin. Als ausgeschüttet wurde, lag er auf dem Boden, nicht so groß wie die Dame, die wir vorher gefangen hatten und die vielleicht seine Mutter war, aber immerhin fünfundzwanzig Pfund schwer. Trotzdem wir unvorbereitet waren, gelang es uns, ihn aufs Haupt zu schlagen.
IX. Verkehr auf flüssigem Platze
Nördlich von Wangeroog, Spiekeroog, Langeoog und Baltrum pendeln wir seit vierzehn Tagen, zehn Seemeilen Nordnordwest, Netz aufziehen, umkehren, zehn Seemeilen Südsüdost, Netz aufziehen, umkehren, Tag und Nacht, niemals stockt der Motor, alle drei Stunden ruft der Wachehabende sein »Reise, reise, intejn« in die Kojen,1 die Schläfer springen auf, das Netz wird gehisst, ausgeworfen, die Dutt durchsucht, Fische sortiert, ausgeweidet, der Kahn wendet, zehn Seemeilen Nordnordwest, zehn Seemeilen Südsüdost. Manchmal sind die Wellen ruhig, manchmal steht der Steven senkrecht, manchmal scheint der Mond, manchmal ist hohe See. Dann haut der Gigbaum wie ein Tobsüchtiger um sich, dass Mast und Takel stöhnen, das Bullentau reißt und vom Großsegel frei herabbaumelt, unheimlich bald hier, bald dort auftauchend. Wind und Meer sind ein ziemliches Einerlei, fragt man aber, ob man hinauf- oder ob man hinuntersegelt, kriegt man grobe Antwort: »Du Mottenkugel, kennst du dich auch nicht aus, wenn du mit der Straßenbahn denselben Platz hundertmal auf und ab fährst? Siehst du nicht steuerbord den Helgoländer Leuchtturm, achteraus die drei festen Lichter der Weserschiffe, das dreimalige Blitzen vom Norderneyer Feuerschiff?«
Die Seeleute fühlen sich nicht verlassen. »Dort ist der Kutter vom Hannes, den nennen wir nur ›Admiral Hannes‹, weil er Disziplin hält wie auf einem Panzerkreuzer, sogar Teppiche hat er im Logis, man sagt, er schrubbt die Ecken hinter den Bullern mit der Zahnbürste.« – »Der ›Landrat Lahusen‹, der gehört dem Fietje, sein Kompagnon hat in Finkenwärder eine Gastwirtschaft übernommen, seinen Anteil am Kutter einem Fischhändler verkauft, und der will den Fietje rausekeln, weil ihm das halbe Fahrzeug nicht genug einbringt.« – »Der ›H. F. 192‹ fährt mit voller Kraft und fischt mit siebzig Faden, wir fahren halbe Kraft mit hundertsechzig Faden – so sind die Motoren verschieden.« Die Schiffe wenden aufeinander zu, und die Hand am Mund, berichtet man schreiend das Fangergebnis der letzten Stunden. Kommt einer vom Hafen, so erkundigt man sich, wie der Markt ist und wie es daheim geht.
Einmal, morgens um sieben, vier Meilen westlich vom Norderney-Feuerschiff, erhält unser Schiff einen Stoß, dass es jäh dreht und beide Galgen, die an Bord befindlichen Rahmen für die Scherbretter, nach außen gedrückt werden, als wären sie aus Pappe. Wir sitzen fest, die Trossen haben sich in einem Wrack verfangen. Ein aufgeregtes Manöver beginnt, hinten wird gestoppt, vorne gehievt. Morsches Gebälk, Teile von alten Masten, wohl eben abgebrochen, sind in den Maschen verfitzt. Unversehrt die Trossen, sie verraten nichts von dem Geheimnis, mit dem sie uns verbanden, verraten nicht, was unmittelbar unter uns ist; vielleicht ungeheure Schätze, vielleicht modernde Menschen, vielleicht Skelette von Seeräubern … Nie werden wir es erfahren, unser Kahn ist wieder flott, wir wenden nach Nordnordwest, versuchen, die Galgen geradezuhämmern und das zerrissene Netzwerk auszubessern. Der Schaden ist nicht groß, vor drei Monaten war es ärger, da ging durch ein solches Wrack der ganze Kandudel zum Teufel, Grundtau, Scherbretter und Kurrleine.
Holländische Dampfer, erkennbar daran, dass sie kein Back und keine Türme haben, aus Ymuiden an der Zuidersee, kreuzen unsere Reise, und dänische Motorschiffe mit wehendem Danebrog bringen Schollen nach Hamburg, dort die Preise zu verderben. – Schau, der Jonas Hinrich zieht schon ein! – Tungenknieper kommt achtern auf, er ist aus Eisen, sein Motor hat hundert Pferdekräfte, und sechs Mann sind an Bord, aber er rentiert sich ebensowenig wie unser Kasten.
Wir verbrauchten für zweihundertzwanzig Mark Gasöl bis jetzt, für fünfundvierzig Mark Schmieröl zur Maschine, für vierundzwanzig Mark Eis. Als vor einem Vierteljahr unser Schiff vom Netz und von den Scherbrettern überhaupt nichts wiedersah, war der Schaden fünfhundertachtzig Mark hoch und außerdem beinahe kein Fang. Im Herbst flog der Zylinderdeckel vom Motor weg, ein paar Wochen später ist die Pleuelstange gerissen und das Kurbellager ausgebrannt – hat auch schönes Geld gekostet. Über dreitausend Mark Schulden lasten auf dem Fischerkahn.
Unsere Reise von vierzehn Tagen bringt achthundert Mark brutto. Was bleibt bei diesen Spesen? Beinahe dreihundert Mark gehen also ab für Motoröl und Eis. Der Matrose kriegt zehn Prozent, das sind fünfzig Mark, der Schiffsjunge fünf Prozent. Um achtzig Mark wurde Proviant gekauft; der Mann, der uns helfen wird, in St. Pauli die Fischkisten an Land zu tragen, muss auch entlohnt werden, tausend Mark zahlt man jährlich für Versicherung. So hat jeder der beiden Eigentümer (Klaas ist Onkel Heins Sozius) für vierzehn Tage ununterbrochener Arbeit, Tag und Nacht, und das ganze Risiko kaum hundertfünfzig Mark. Und wie viel Mann sind schon in See geblieben?
schmales, fest eingebautes Bett auf einem Schiff <<<
X. Behandlung der Beute
Ist das Netz hochgezogen, wird die Ernte geschlichtet. Zu Füßen des schleimigen, schmutzigen und zuckenden Berges stellt man vier Behälter. Der erste nimmt Mattgut auf, Seezunge, Steinbutt und Tarbutt, Bottich Nummer zwei die größeren Schollen und Kabeljau, der dritte das »Schomom«, Schollen von weniger als einem Pfund, Scharben, Knurrhähne und Rochen. In Nummer vier, eine Kiste, fliegen die Kohlenstücke, die man mitgefischt hat und die sich nach ein paar Tagen zu Meterzentnern häufen; Taschenkrebse – sie haben aber gar nicht Taschenformat, sondern sind oft dreißig Zentimeter lang – fasst man bei den Hinterfüßen, bis zu denen die Scheren nicht reichen, und wirft sie in den Bünn,1 das offene Wasserbassin mittschiffs;2 bei Cuxhaven müssen wir sie allerdings, damit sie noch lebend auf dem Hamburger Markt um je einen Groschen verkauft werden können, in einen Korb packen, denn Trockenheit vertragen sie eher als Süßwasser.
Weitaus der größte Teil des Emporgezogenen ist unbrauchbar; Einsiedlerkrebse, Quallen, Sterne, Muscheln, Knochen, Holzstücke, durchlöcherte Körbe, Flaschen mit zerbrochenen Hälsen, morsche Stricke, verfaulte Säcke, zerschlissene Kleidungsstücke und vor allem die halbwüchsigen Exemplare der Butt- und Schollenwelt. Widerstandslos lassen sich die unverwendbaren Tiere mit der Hand oder mit der Schaufel aufnehmen, als wüssten sie, dass es ihnen nicht ans Leben geht. Ins Meer zurückgekehrt, schießen sie, die noch vor einer Sekunde so leblos auf Deck lagen, mit weitem Stoß davon. Eine halbe Stunde lang arbeitet der Spaten, um den Großteil dessen, was man dermaßen mühselig der See entrissen hat, der See wieder zurückzugeben.
Die Eingeweide schleudert man gleichfalls über die Bordwand – aber sie kommen nicht bis ins Wasser: Möwen umlungern unser Fahrzeug, Aasgeier des Ozeans, und schnappen das Futter im Fluge. Bevor man den Steinbutt in den zuständigen Bottich warf, hat er einen Messerstich an die Wurzel der Schwanzflosse bekommen, auf dass das Blut abfließe und das Fleisch weiß bleibe, nun werden unterhalb der Kiemen die Innereien herausgeschnitten. Groß ist die Leber und delikat – die meisten Konservenfabriken stellen Gänseleberpastete nicht aus Gänseleber, sondern aus Steinbuttleber her. Das ausgeweidete Herz eines Butts legen wir auf die Setzborte, genau dreißig Minuten zuckt es noch regelmäßig. Geschlachtet wird auch die Seezunge, Galle, Blase, Leber, Herz und Darm fliegen möwenwärts. Von Schollen und Scharben spült man Schleim und Schlamm ab und bettet sie in flachen Kisten auf Eis. Im Gefrierraum wird alles geschlichtet. Über Deck klatscht das Wasser aus vielen Eimern, den Unrat beseitigend. Sechzig bis siebzig Minuten dauert normalerweise die Arbeit; da alle drei Stunden hochgezogen wird, hat man Tag und Nacht abwechselnd zwei Stunden Rast und eine Stunde Fron; einer der Matrosen bleibt als Wache am Steuerrad.
Der in der Mitte der Seefischerfahrzeuge eingebaute große Behälter für die Fische. <<<
die Mitte der Quer- wie der Längsschiffsrichtung <<<
XI. Interieur
Die anderen stecken unten im Logis: Die Kombüse ist wie eine Kiste, gerade so groß, dass die Holzleiter stehen kann, und unter dieser »Stiege« der Herd. Angrenzend die Kajüte;1 sie hat vier Meter im Geviert, die Petroleumlampe schwelt, alte Stiefel und Kleider und Papiere dunsten, Küchengeruch dringt intensiv ein. Sechs Menschen schlafen und rauchen und priemen und spucken und essen und verdauen darin. Vier hölzerne Schränke mit luftdicht verschließbarer Tür, auf der die Namen des Fischers und seiner Ehefrau geschnitzt sind, dienen als Schlafstellen. An den Kojen der Bemannung ist ein Spruch: »Hier eben öberhin – Is besser als up’n Bünn.« Allerdings bleiben die Türen zu den Bettstätten meistens offen, und die Schiffer schlafen, indem sie die Beine mit den bis zum Schritt reichenden Stiefeln heraushängen lassen. Es lohnt sich nicht, sie aus- und wieder anzuziehen – in zwei Stunden ruft der Wachehabende sein »Reise, reise, intejn« hinab, und das heißt: aufstehen, aufstehen, einziehen. Zum Waschen ist keine Gelegenheit, so nötig man es auch hätte; Schlamm und Blut vom Sortieren und Ausweiden der Fische, Teer und Tran vom Ausbessern der Netze, Schmieröl und Ruß von der Bedienung des Motors haften an unseren Händen. Was tun? Meerwasser nimmt keine Seife auf und reinigt nicht, mit dem Süßwasser in der Tonne ist sparsam umzugehen! Außerdem bringt es Unglück, wenn man sich während der Fahrt wäscht, das weiß jeder Seemann.
Zum Ersticken dick ist die Luft im Logis, die Luke wird nicht geöffnet. Nur Muffigkeit bedeutet der Besatzung, nach zehn bis zwölf Stunden täglicher Arbeit in mehr als frischer Luft, vollkommene Traulichkeit (ähnlich wie sich der Bauer in eine verräucherte, dumpfe, niedrige Stube setzt oder in eine drückende Last von Daunen bettet). Diese Überkompensation kommt auch in der Kleidung der Schiffer zum Ausdruck, zwei Trikots, einen Sweater und noch eine Islandjacke tragen sie, Wollschal um den Hals, Unterhose aus blauem Tuch, zwei Paar Wollstrümpfe, Seestiefel bis zu den Oberschenkeln, Anzug aus dickstem Stoff. So schlafen sie in den Federbetten der Koje, dass ihnen Schweiß aus allen Poren strömt, so roboten sie, noch um Flottenmütze oder Südwester bereichert, selbst bei Sonnenschein und Windstille, während eine Landratte barfüßig und barhäuptig und halbnackt auf Deck bleibt.
Gegessen wird gut, denn Arbeit und Seeluft machen hungrig und erfordern Kräfte. Um achtzig Mark wurde in Cuxhaven für die vierzehntägige Reise Proviant eingekauft, Speck, Erbsen, Butter, Kaffee, Salz, Kartoffeln, Salami und so weiter, aber schon vom dritten Tage an essen wir das, was wir erbeuten, gebratene Fische, Steinbuttleber, Krabbensalat, gebackene Seezunge, so frisch bekäme man es an Land selbst zu höchsten Preisen nicht. Auch süße Speise gibt es manchmal, die ein hierherverschlagener Literaturausdruck »Frühlings Erwachen« nennt. Koch ist der fünfzehnjährige Schiffsjunge, der »Moses«, und er macht seine Sache ganz gut, obwohl uns zu wünschen wäre, es bestünde wenigstens für ihn eine Möglichkeit, sich zu waschen. Schlimm genug, dass sie für uns nicht vorhanden, wir müssen mit den Händen essen, und die Hände gleichen den Schollen, die wieder ihrerseits eine chromatische Anpassung an den Schlamm durchgemacht haben. Wasserklosett ist das Meer; als einziger Etikettefehler gilt es an Bord, auf die falsche Seite zu gehen, dorthin, woher der Wind kommt, weshalb man sich den Schüttelreim einpräge: Seeleute machen’s auf der Leeseite.
Ist der Fischzug gut, ist die Laune gut. Man erzählt von den goldenen Tagen des Spritwechselns, da die Kutter von den Schmugglern zur Fahrt nach Skandinavien gemietet wurden, wiederholt verdiente man massig Geld, wiederholt wurde man erwischt, der Bruder unseres Steuermannes hat sein Fahrzeug in einem norwegischen Hafen stehen, es ist beschlagnahmt. Einträglicher Fänge wird gedacht, nicht immer muss die Rentabilität von Fischen stammen, vor ein paar Wochen fand ein Blankeneser Ewer im Netz einen Totenkopf mit goldenem Gebiss und der Büsumer Krabbenfischer Thieß eine Menschenhand mit platingefasstem Brillantring. Nahe von Norderney ist vor Monatsfrist ein Schiff gestrandet, das Goldbarren und Silberkisten nach Deutschland bringen sollte, für die Bergung bekamen die Norderneyer hunderttausend Mark. Mit Schiffbrüchigen hat man hier überhaupt viel zu tun; als bei Borkum-Riff die »Bulgaria« unterging, zogen die Finkenwärder Fischer mehr als fünfzig Leichen aus der Tiefe. Mannigfach sind die Gefahren: Im März nahmen Hamburger Seeleute einen Passagier mit, der die Mannschaft erschoss und den Kutter in England zu verkaufen suchte; in London wurde er verhaftet und hingerichtet. Seither ist man misstrauisch, und unsere Schiffer sind von ihren Kameraden beschworen worden, mich nicht mitzunehmen; da wir Glück hatten, schönes Wetter und reichen Fang, lachen sie jetzt über diese Warnung.
Von Erlebnissen an Land, vom Jahrmarkt in Finkenwärder spricht man, streitet, welche Fischerkneipe der Nordsee den steifsten Grog serviert, und schickt den Schiffsjungen, wenn das Gespräch noch stärker abbiegt, aus der Kajüte, indem man ihn anschreit: »Musst du jümmer touhören, wenn Vadder snackt?!« Manchmal vertreibt man sich die Zeit mit einem Spiel, das darin besteht, Worte wegzulassen aus dem Lied:
Unser Hans hot Büxen2 an, Un die sinn bunt, Er hat bannig Knöppe dran, Und die sinn rund.