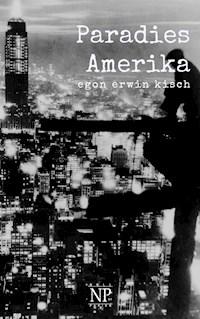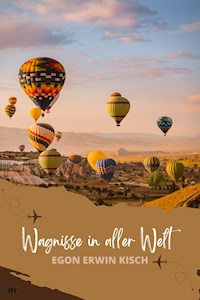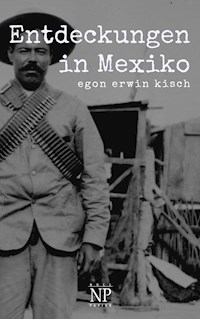Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kisch bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Kisch, der rasende Reporter, in seinem Element. Durch Wüsten, nach Arabien und China und wieder zurück nach Europa führen uns 22 kleine Reportagen zum "Mitlesen". Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Egon Erwin Kisch
Wagnisse in aller Welt
Egon Erwin Kisch
Wagnisse in aller Welt
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Universum-Bücherei, Berlin, 1929 2. Auflage, ISBN 978-3-962818-89-0
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Ritt durch die Wüste und über den Schott
Seine Majestät die Nickmaschine
Die Fahrt der Flößer
Auf der Reeperbahn von Rotterdam
Justiz gegen Eingeborene
Verwundung
Silvesternacht in Marseille
Käsemarkt zu Alkmaar
Chinesenstadt
Das Vermächtnis der Frau Mende
Vatikan in der Sahara
Westfront 1918 – Französische Revolution – Goethe
Der, der das Radio sieht
Die Kasbah von Algier
Protest gegen eine Verurteilung
Wer mag wohl in diesem Schlosse wohnen
Kuriositätenkabinett des Viehhofes
Städtebilder, perspektivisch verkürzt
Die tunesischen Juden von Tunis
Polizeischikanen in Sardinien
Memoiren eines Filmstatisten
Die Polizei und ihre Beute
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Kisch bei Null Papier
Paradies Amerika
Der Mädchenhirt
Schreib das auf, Kisch!
Geschichten aus sieben Ghettos
Der rasende Reporter
Entdeckungen in Mexiko
Marktplatz der Sensationen
Hetzjagd durch die Zeit
Wagnisse in aller Welt
Ritt durch die Wüste und über den Schott
Stundenlang begegnet man keinem Lebewesen, außer einem sandfarbenen, stelzenden Vogel, der, vor Mensch und Pferd nicht erschreckend, seinen Monolog fortsetzt.
Felsiger Boden wechselt mit sandigem, man schlägt die Steigbügel nach arabischer Manier dem Gaul in die Flanken, auf dass er galoppiere; zwar hat man nichts weniger als Eile, aber die Luft wird kühler, wenn sich das Tempo erhöht.
Ein Weg ist da, ein deutlicher Weg, doch schwer zu sagen, wodurch er sich vom übrigen Terrain unterscheidet. Ist er anders als graubraun, ist er nicht steinig, ist er nicht sandig wie alles ringsumher, was man seit Sonnenaufgang durchritten hat und was man durchreiten wird bis zum Sonnenuntergang? Nein, er ist durchaus nicht anders, es sei denn, dass er im Sandgebiet etwas härter erscheint als seine Umgebungsflächen, dass im Felsengebiet weniger Blöcke auf ihm als neben ihm liegen; wo er eine Furche überquert (ein Rinnsal vielleicht in der Regenzeit), stützt ein Palmenstamm seinen Rand, ein versandeter, verstaubter, halb versteinter Palmenstamm, wer weiß, wer ihn hierherbrachte.
Gegen Mittag sprengt man eine Sanddüne hinauf und sieht in der Ferne einen kleinen See. Die Straße durchschneidet ihn als Damm, Palmen stehen an seinem Ufer und nicht weit von ihnen das quadratisch gemauerte Grabmal eines Marabut,1 eines Heiligen aus Mohammeds Nachkommenschaft. Menschen singen, ist’s auch nur eine gutturale Elegie, sie erfrischt, so wie der Anblick des salzigen Wassers erfrischt, obwohl sich keine noch so kleine Brise erhebt, von seiner Kühle etwas ins Gesicht zu fächeln. Die Sänger sitzen in der Palmerei und achten darauf, dass die Bäume ihr Wasserquantum bekommen, der Esel trabt im Kreise, um es aus dem Brunnen zu pumpen.
Am Saum der Oase fünfzehn Häuser, der Hain zählt etwa dreihundert Bäume. Den günstigsten Fall vorausgesetzt, dass jedes Familienoberhaupt Besitzer von Palmen ist und jeder Baum achtzig Kilo Datteln trägt von je fünf Franken Kaufwert, so ergibt das im Durchschnitt einen Jahresverdienst von achttausend Franken (etwa tausend Reichsmark) pro Familie, wovon die Steuer abgeht, ein Franken fünfzig pro Baum. Ziemlich leicht ist die Arbeit, immerhin muss sie in flammender Glut geleistet werden und ohne Unterbrechung, die Palme bringt (wie das afrikanische Mädchen) in ihren ersten neun Lebensjahren überhaupt keine Frucht, und der artesische Brunnen, vom Tuggurter Schlossermeister Obach (aus Straßburg) hergestellt, kostet dreitausend Franken.
Verzeihung – aber zu solchen Berechnungen verführt die Oase; lang reitet man über Sand und Stein, der keinen Gedanken eingibt, und plötzlich sieht man sich einer deutlichen Vermögensaufstellung gegenüber.
Die übrigens nicht vollständig ist. Mit Dattelnüssen ernährt man das Kamel, aus Palmzweigen werden Körbe und Matten geflochten, mit den dürren Blättern der Küchenherd geheizt.
Am Rand des Seeufers rasten Nomaden. Überall, wo Wasser ist oder eine Siedlung, schlagen Bohemiens der Wüste ihre Wanderstäbe in die Erde, einen größeren in die Mitte und zwei kleinere rechts und links davon, eine zerfetzte dunkle Decke darüber – fertig ist die Laube; nicht angebunden wird das Maultier, es fühlt sich rassenzugehörig, stammesbewusst, fällt ihm gar nicht ein, in das Désert zu fliehen, zu desertieren. Das Zelt ist offen, drei Frauen glotzen, alle mit Tand behängt und schmutzig und in Lumpen. Mehr als ein Dutzend Kinder und ein Mann. Niemand bettelt – das ist das einzige, was die Arbi Sahara von den europäischen Zigeunern unterscheidet, äußerlich würde keiner auffallen unter den wandernden Kesselflickern, Wahrsagerinnen, Pferdehändlern und Jahrmarktakrobaten in Braun. Auf der einen Seite der Wüstendörfer wohnen ständig und abgesondert die Aussätzigen, auf der anderen: unbeständig und abgesondert die mit der Lepra der Freizügigkeit Behafteten.
Hinter dem See: der Schott, eine silberglänzend-trügerische Fläche. Der Weg, beiderseitig durch breite Gräben von ihr geschieden, führt festgestampft entlang, doch ist die aufregende Jugendlektüre von Verfolgungen davonjagender Wüstenräuber über Salz- und Sandgelände nicht ohne nachhaltigen Eindruck geblieben, und man muss die Gefahr verkosten. Der Hengst scheint gleichfalls seinen Karl May gelesen zu haben, er will nicht über den Graben, er bockt, ihm das Zauberwort »Rih« ins Ohr zu flüstern oder die Sure des Todes aufzusagen würde kaum etwas fruchten, selbst die wütendsten Fersenhiebe fruchten ja nichts, er bockt nur.
Erst die niederklatschende Nilpferdpeitsche zwingt ihn zum Sprung. Jetzt saust er mit dampfenden Nüstern, als befürchte er, die Geister, die da unten wohnen und ihre silbergrauen Köpfe emporstrecken, könnten ihn an den Fesseln packen und hinabziehen in den schlammigen Sand, den sandigen Schlamm. Ohnehin sinken trotz des tollen Galopps die Pferdehufe tief, tief in den Boden.
Den zweiten Satz über den Straßengraben, den auf den sicheren Weg zurück, tut der Gaul willig, es bedarf keines Fersenhiebs und nicht der Nilpferdpeitsche, noch weiterhin bebt Unruhe unter dem Sattel, sie legt sich erst, bis das Reich der Flittergespenster auch rechts und links verschwunden ist und die vertraute Wüstenebene wieder beginnt.
Nach einer Stunde sprengen von der Welle am Horizont zwei Reiter heran. Das Pferd des einen ist ein Schimmel, prachtvoll aufgezäumt, die Steigbügel sind Häuschen aus getriebenem Silber, Turban und Haïk des Reiters aus Seide und der Burnus aus goldbesticktem blauem Stoff.
Er grüßt und fragt, wohin man reite. Denn er ist der Kaid der nächsten Stadt und besorgt, man könnte ein Inspektor der Verwaltung oder ein Steuerkontrolleur sein. Man ist weder ein Inspektor der Verwaltung noch ein Steuerkontrolleur, was der Kaid erleichtert hört. Er hat beim Militärkommandanten zu tun, deshalb der rassigste Schimmelhengst und das festlichste Zaumzeug, die Offiziere werden alles neidisch mustern, dieweil sein Daira das Ross vor dem Tor am Zügel hält. Im Übrigen wünscht er gute Reise, worauf man erwidert, ihn (der sich sowieso bereichert) möge Gott bereichern, Allah jerzekek.
Rast im Negerdorf. Die Kinder haben kaum jemals einen Weißen gesehen, wie es scheint, nur selten ein Pferd. Sie schreien einander ihre Bemerkungen über den Fremdling zu, unbekümmert darum, dass man sie verstehen könne – versteht doch nicht einmal ein Araber die Sprache der Ruarha, der schwarzen Muselmanen.
Dreijährige, vierjährige Mädchen, alle an der Schläfe tätowiert, knien auf der Straße, die Ärmchen in den Staub stützend, denn auf ihrem Rücken ist eine Last festgebunden: ein Säugling. Der schläft. Fliegen kriechen ihm in die Nasenlöcher, in die Augen und in den Mund, ohne ihn zu wecken. Auch die, die wach sind, Erwachsene und Kinder, stört es nicht, wenn auf ihrem Gesicht dichte Fliegenschwärme schmausen, keine Handbewegung verscheucht sie.
Wie elend ist dieses Dorf. Die engen Gassen sind manchmal überwölbt, manchmal auch unten zusammengeschoben, wo sich die Lehmhütten zu einer Art Bank ausbuchten. Darauf hocken, damit die Fliegen etwas zu fressen haben, die Männer des Dorfes und dösen, neben sich einen Kessel, in dem Bohnen in Wasser kochen. Nur vor einer Tür arbeiten zwei Männer; sie flechten Palmenzweige, nachdem sie sie durch einen Biss längsseits gespalten haben, zu Matten.
In manchen Gässchen, heißen Röhren, können die auf Eseln reitenden Knaben ihre Beine nicht spreizen, derart nah stehen die Hütten einander gegenüber. Die Kamele muss man aus einiger Entfernung für Strauße halten, so klein sind sie, so mager ihr Hals, ihre Beine. Als Haustür dient ein Geflecht aus Palmenblättern, bestenfalls einige Kistenbretter. Selbst das Mauerwerk der Priestergräber ist nicht intakt – wie fern liegt Nordalgerien, wo man die Grüfte der Marabuts mit Opfergaben schmückt, mit bunten Seidentüchern, mit bestickten Fahnen, mit blauen Kacheln, mit goldenen Halbmonden, mit kostbaren Teppichen, mit riesigen Straußenfedern, und wo fast nirgends, als einziges von den Arabern anerkanntes Wunderwerk des Westens, eine große Empire-Standuhr fehlt, die man auf den erbeuteten Schiffen der Giaurs fand!
Zwei, drei Kaufmannsläden, je eine Dattelwaage hängt darin, ein Karton mit winzigen Fläschchen billigsten Parfüms, kanariengelbe Tücher, Ledertäschchen für Amulette, einige Streichhölzerpäckchen, Spiegel und Glasperlen.
Nicht einmal ein Kaffeehaus gibt es, der kleinste Duar der braunen Araber hat ihrer zehn. Nur süßen Pfefferminztee kann man bekommen, der Kaufmann bereitet ihn, und da er fünfzig Franken nicht zu wechseln vermag, macht er eine gleichmütige Handbewegung, schenkt dem Gast die Zeche.
Der schwingt sich wieder aufs Pferd, das die Jugend staunend umsteht, ein Knabe hält den Halfter, erhält eine Zigarette, o Sensation: eine fertige Zigarette!, man reitet weiter, um den Bordj, der zum Nachtquartier ausersehen ist, noch vor Sonnenaufgang zu erreichen, insch’ Allah, wenn Gott will.
islamischer Heiliger <<<
Seine Majestät die Nickmaschine
Keine Operette kann das Hofleben eines exotischen Monarchen läppischer darstellen, als es das Seiner Hoheit des Beys von Tunis ist.
Bekanntlich ist Tunis nicht etwa französische Kolonie, sondern ein selbstständiges Reich, das unter französischem Protektorat steht. Das heißt, der Bey hat ohne Widerspruch das anzuordnen, was der französische Generalresident von ihm verlangt, und das Volk hat ohne Widerspruch zu gehorchen, denn der Bey ist absolutistischer Regent.
Dieses System hat den Vorteil, dass die Eingeborenen für ihr Unglück nur den angestammten Monarchen verantwortlich machen könnten, und solches verbietet ihnen die Religion; ferner hat das Pariser Parlament, dessen Opposition zum Beispiel die Maßnahmen der französischen Regierung in Algerien unangenehm kritisiert, in tunesische Dinge nichts hineinzureden. Was geht’s die französische Regierung an, was der Bey von Tunis, ein Selbstherrscher, verfügt?
Die Thronfolgeordnung von Tunis kommt dieser Regierungsweise sehr zustatten. Stirbt ein Bey, so wird weder sein Sohn noch ein gewähltes Mitglied der Familie sein Nachfolger, sondern der älteste Prinz aus dem seit zweihundertzwanzig Jahren regierenden Hause der Husseniten. So ist der neue Fürst gewöhnlich fünfundsechzig Jahre alt und hat nicht Lust und Temperament, sich durch unbesonnenen Widerstand den Lebensabend zu vergällen.
Gegenwärtig schwingt Mohammed el Habib Bey das Zepter, der schon vor sechzig Jahren – damals spürte man von Frankreichs Protektorat noch kein Anzeichen, und das Beylikat war wirklich absolutistisch – als ältester Sohn des Souveräns im Schlosse an der tunesischen Kasbah wohnte. Seither hat ein halbes dutzendmal der Thron seinen Besitzer gewechselt, bevor Mohammed el Habib wieder in den Dar el Bey einzog. Im Jahre 1906, achtundvierzig Jahre alt, rückte er in den Rang eines Kronprinzen und Feldmarschalls vor, aber er hatte noch sechzehn Jahre zu warten, ehe sein Vordermann und Vetter, Mohammed el Nassr, starb.
Es war höchste Zeit, denn für ihn waren, wie für alle Prinzen, die fetten Jahre vorbei, und die mageren dauerten bereits ziemlich lange. Die fetten Jahre waren die gewesen, als man unbeschränkt herrschte, in Saus und Braus lebte und sich vom Untertanen pumpen konnte, was man wollte, ihn höchstens durch die Verleihung des Ordens Nischan Iftikhar abspeisend; zu den fetten Jahren gehörten ferner die, in denen die Wartezimmer der französischen Okkupationsbehörden voll waren von Kaufleuten und Gewerbetreibenden aus der Gegend von Bardo, des Kasbah-Platzes, von La Marsa auf den Trümmern Karthagos und anderen Orten Tunesiens, wo die Husseniten ihre Schlösser hatten; es waren Gläubiger, sie präsentierten Rechnungen und erhielten sie bezahlt. Die mageren Jahre aber begannen am 11. Juni 1902, als vor Stadt und Welt und arabisch und französisch, also urbi et orbi et arbi et rumi, kundgetan wurde das Decret sur l’administration des biens beylicaux:
»Jede Ausgabe, jede Rechnung, jeder Vertrag, welcherart sie auch immer seien, darauf abzielend, die Person oder die persönlichen Güter der Herrscherfamilie zu irgendetwas zu verpflichten, sind nicht gültig und können dem betreffenden Mitgliede des Herrscherhauses, auch wenn sie von ihm befohlen oder signiert sind, nicht als Forderung vorgelegt werden, sobald sie nicht mit Autorisation des Bey durch den besonderen Administrator unserer Zivilliste vidiert sind.«
Mit diesem schäbigen Dekret hörte jeder Kredit auf, man musste sich mit der Apanage bescheiden, und es lässt sich denken, dass unser Freund Mohammed el Habib heilfroh war, endlich den Thron seiner Onkel zu besteigen und eine Zivilliste von 280 000 Franken im Monat zu erhalten.
Damals war er nicht nur ein alter, sondern auch kränklicher Mann, und der französische Resident bemühte sich, die Krönungsfeierlichkeiten hinauszuziehen – solche Dinge kosten Geld, und man will sie deshalb nicht allzu rasch wiederholen.
Aber wie sich bekanntermaßen Päpste und Staatspräsidenten nach ihrer Wahl erstaunlich rasch verjüngen, erging es auch nach dem 10. Juli 1922 dem neuen Bey, der sich bald darauf in feierlicher Weise abermals vermählte. Die Landesmutter war nur über zweiundfünfzig Jahre jünger als ihr königlicher Gemahl, nach einigen Angaben war sie dreizehn, nach anderen fünfzehn Jahre alt (der Gothaische Hofkalender verschweigt delikat die Damen der orientalischen Herrscherhäuser), sicher jedoch ist, dass sie die Tochter eines Grünzeug- und Milchhändlers war und die Unklugheit oder Klugheit begangen hatte, sich unverschleiert vor dem vorbeigehenden König zu zeigen.
Dieser besitzt zwei Söhne von etwa vierzig Jahren, eine seiner Gattinnen lebt eingeschlossen in Menonba, die andere im Sommerschloss La Marsa, während die dritte und jüngste im Dar el Bey zu Tunis schläft, immer zur Seite ihres Gatten sitzt und ihm, eine liebende Bey-Sitzerin, bereits eine kleine Prinzessin geschenkt hat.
Sonst hat der Bey von Tunis wenig zu tun. Er unterschreibt und siegelt die von der französischen Residentur verfassten Erlässe, natürlich nicht er selbst, es gibt einen Minister der Feder und einen Großsiegelbewahrer. Dreimal im Jahr hat er die marmorne Löwentreppe des Palastes Bardo hinanzusteigen, am Aid el Kebir, dem Tage des Opferlamms, am Morgen des Mulud, dem Geburtstage des Propheten, worauf er mit seinem Gefolge die beleuchteten und bekränzten Geschäfte in den Suks abschreitet, und am Aid es Seghir, am Ende des Ramadan-Monats. Dort in Bardo, wo die Wände mit Alabaster aus Karthago, mit tunesischen Fayencen aus Nabeul, mit maurischen Stuckarabesken und mit riesigen Porträts europäischer Kaiser geschmückt sind und der Thronsessel mit einem riesigen Brillanten, reicht er den Würdenträgern seines Reiches die Hand zum Kusse und nickt den Ehrengästen gnädig zu, so wie er die von den Franzosen vorgelegten Gesetze mit einem Kopfnicken zu empfangen und zu unterfertigen hat, wofür er das Salär von dreieinhalb Millionen Franken per Anno bezieht. Ebenerdig ist ein Saal, in dem er jedem zum Tode verurteilten und nicht begnadigten Untertan ins Gesicht sagen muss, dass er ihn nicht begnadigt habe.
Dem Herrscher bleibt also ausgiebig viel Zeit, sich seinen Privatpassionen zu widmen. Mohammed el Habib übt drei Sporte aus: erstens das Dominospiel, zweitens das italienische »Scopa«, ein Spiel mit vierzig Karten, und drittens den Fischfang; man kann in La Marsa während des ganzen Sommers den Bey von Tunis stundenlang an der Bai von Tunis mit der Angelrute sitzen sehen. Mit Vorliebe näht er Anzüge und kocht, was nur für die Beteiligten unangenehm ist.
Außerdem bildet er sich auch ein, ein Maler zu sein. Das überlebensgroße Selbstbildnis im Audienzsaal ist von Fachleuten derart korrigiert worden, dass es inmitten der anderen Porträtkitsche nicht auffällt, jedoch bei den Arrangeuren der Kunstausstellung von Tunis erregte es vor zwei Jahren peinliches Aufsehen, als plötzlich ein Ölgemälde des Präsidenten Millerand, gemalt von Seiner Hoheit, ankam, um ausgestellt zu werden. Das ging nicht – bei aller loyalen Gesinnung ging das nicht. Man musste im »Palast der französischen Gesellschaften«, wo der Salon veranstaltet wurde, ein Zimmer als »Exposition orientalischer Möbel« einrichten, und dorthin hing man nun den Präsidenten der französischen Republik.
Von den dreieinhalb Millionen Franken, die dem Bey jährlich bewilligt sind, werden vor allem seine Hofhaltung, seine Palastbeamten und sein Heer bezahlt, das allerdings nur siebenhundert Mann zählt, aber eingeteilt ist wie eine richtige Armee und aus einem Feldmarschall, zwei Divisionsgeneralen, einem Brigadegeneral, einem Bataillon Infanterie, einer Eskadron1 Kavallerie, drei Artilleriebatterien mit zusammen zwei Kanonen von 90 mm Kaliber und einer Musikkapelle besteht; zur Sicherheit ist dieses Heer dem Chef der französischen Militärmission unterstellt, der allein eine Ausrückung befehlen darf.
Bargeld bekommt der Bey sehr wenig in die Hand, und da er von Schmarotzern umgeben ist und gleich am Monatsersten alles verschleudert und da seine Erlässe, vermittels welcher er verschiedene Lieferanten mit dem Nischan Iftikhar auszuzeichnen die Gnade hat, von der Residentur ad acta gelegt werden, borgt ihm kein Mensch einen Sou. Der Glaser, der geholt wird, der Fleischer, der täglich kommt, die Ärzte, die eine unheilbare Krankheit des Bey seit Jahren behandeln, wollen vorher bezahlt sein.
Was Wunder, dass Seine Hoheit ewig Geld verlangt, ungehalten wird, wenn man keines gibt, und eines schönen Tages seinen Ministerpräsidenten Mustapha Dugezli windelweich prügelte, weil eine solche Forderung abgelehnt wurde. Schnurstracks lief der misshandelte Premier zu seinem eigentlichen Vorgesetzten, dem französischen Generalresidenten, und beschwerte sich, worauf Monsieur Saint mit Dugezli und einem Angst-einflößen-sollenden Reiterfähnlein beim Bey vorfuhr. Kaum sah dieser die böse Miene des Monsieur Saint, so fiel er dem Dugezli um den Hals und tat, als weine er vor Schmerz. »Über mich gehst du dich beschweren, über mich, deinen Vater, der dich liebt und züchtigt wie seinen eigenen Sohn …« Kein Auge blieb tränenleer ob solcher Vaterliebe.
Französisch versteht Seine Hoheit, der französische Protegé, überhaupt nicht, er spricht nur ein wenig Italienisch, und da er auch arabisch kein politisches Wort sagen darf und der Dolmetsch selbst das, was er sagt, nicht übersetzt, kann man sich vorstellen, wie die Audienz eines Europäers bei Seiner Hoheit verläuft. Spielt nun der fremde Gast nicht »Scopa«, kann ihn nur seine Kenntnis des Dominospiels vor sofortiger stummer Verabschiedung retten.
Präsumtiver Nachfolger Mohammed el Habibs ist der Prinz Ismail Bey, ein sehr dicker, lebenslustiger und mitteilsamer Herr, der aus seinem zukünftigen Herrscherprogramm kein Hehl macht und immer wiederholt, er werde sich bei der Thronbesteigung einen ordentlichen Rausch antrinken. Der Verwirklichung dieses Entschlusses sieht man in politischen Kreisen mit Besorgnis entgegen, denn auch die jetzigen Räusche des starken Prinzen können von normalen Menschen nicht gerade als unordentlich qualifiziert werden.
Man hofft also, Mohammed el Habib werde noch lange keinem Nachfolger Platz machen, und die Araber, unterdrückt und ausgepowert, verehren in der von Religion und Gesetz vorgeschriebenen Weise ihren Herrscher, der malen und lieben und kochen und schneidern kann, nur das Beste seines Landes will und seinen Ersten Minister verprügelt hat, »weil dieser dem Volke wieder eine Steuer aufbürden wollte«.
Schwadron <<<
Die Fahrt der Flößer
Schon hinter der Palackýbrücke, unter welcher der Mauteinnehmer zu uns gerudert kam, um die Zahl der aus je zwölf Balken zusammengesetzten dreizehn Tafeln zu kontrollieren, nahmen wir eine schmälere Formation an. Es hieß »einzeln abfallen«, denn das Schittkauer Wehr war in der Nähe, sein Durchlass ist eng. Während wir bisher mit zwei nebeneinander befestigten Holztafeln gefahren waren, musste jetzt die linke Floßhälfte losgelöst und hinten angebracht werden.
Führer und Gehilfen hatten hart zu arbeiten. Durch einen mächtigen Überlegbaum wurde der Vorderteil des Floßes mit der nächstfolgenden Tafel verbunden, damit der Bug von der Gewalt der Schleuse nicht zu tief gerissen werde. Die Durchschlagstämme, die das Balkendutzend zusammenhalten, wurden sehr genau angesehen, ob sie nicht schadhaft geworden seien. Hierauf kamen die Weidenbänder daran – sie knüpfen die dreizehn Tafeln zu einer Einheit: dem Floß. Man besprengte sie, um ihnen ihre Sprödigkeit zu nehmen, die Wucht des Schleusenwassers würde sie sonst zerfetzen.
Mit Energie und Schwung stachen wir die harpunenartigen Staken in den Moldaugrund und schritten, uns mit dem ganzen Körper gegen die eingebohrte Stange stemmend, rüstig vorwärts, wobei wir immer an derselben Stelle blieben, da sich das Floß mit gleicher Schnelligkeit in entgegengesetzter Richtung bewegte.
An den Rudern waren wir beschäftigt, genau in die Verlängerung der Schleuse zu kommen, was nicht leicht war, denn das Wehr liegt schief im Stromstrich, teilt sich gegen das linke Ufer zu in zwei Arme, und das Floß, das mit Mühe richtig in die erste Schleuse eingefahren ist, muss wenige Meter hinterher, noch ganz in der Gewalt des Gefälles, schon in die zweite dirigiert werden.
Krachend schlugen die Stämme an den Schleusenrand, aber unversehrt sauste unser Gebälk durch Strömung und Gischt. Den Schweiß von der Stirne trocknend, aufatmend, lenkten wir zum Altstädter Wehr ein.
Beim Frantischek erhielten wir Vorspann. Der Remorqueur1 schleppte uns bis zum Neumühl-Wehr unterhalb der Karlsbrücke. Bislang waren die einzelnen Tafeln nur lose aneinandergeknüpft, und man konnte daher unmittelbar nach Passieren einer Schleuse die Vorderseite schon gegen die Flussmitte steuern, ohne dass die vor oder innerhalb des Durchlasses befindlichen Teile aus ihrer Richtung geraten. Nachdem das Neumühl-Wehr durchfahren war, wurde dem Floß durch Anspannen der Bindwieden2 eine steife Formation gegeben, denn das neue Nadelwehr bei der Hetzinsel ist lang, und der Schwanz des Floßes muss die gleiche Richtung haben wie die ersten Tafeln.
In Holleschowitz stellen wir die Schregge, den um eine horizontale Achse drehbaren Riesenbalken am Bug, senkrecht ins Wasser, die Spitze bohrt sich tief in den Moldaugrund. Ächzend bleibt unser Fahrzeug stehen.
Nun springen, balancieren wir über die in breiter Front hier verankerten anderen Flöße ans Land, in das Wirtshaus »Baštecký«. Das ist mit Flößern dicht gefüllt. Gesprächsthema: In der Hetzinselschleuse seien zwei Prahmen auseinandergegangen, und die Bemannung, die selbst in Gefahr schwebte, müsse nun den ganzen Tag arbeiten, die Stämme wiederzufinden und zu binden. Die Schleuse ist schlecht, darüber sind sich alle einig. Auch gegen die Ansicht, dass die deshalb an die Statthalterei gerichtete Eingabe ohne Erfolg bleiben würde, erhebt sich kein Widerspruch. Aber über die Art der Abwehrmaßregeln entspinnt sich eine Debatte.
»Wir sollten einfach erklären, dass wir nicht durchfahren!«
Ein etwa vierzigjähriger Mann, der einzige von den Älteren, der keinen Schnurrbart trägt, der einzige, der das Haar nicht gescheitelt hat, sondern aufwärts gekämmt, ruft es laut durch die Stube.
»Dann fahren eben andere durch!« erwidert ihm ein Dicker vom Steuermanntisch und wendet sich beifallheischend zu seinen Nachbarn. Sie nicken, und mit sich zufrieden, tut der Dicke einen Schluck aus seinem Bierglas.
»Da müssen wir’s anders machen: passive Resistenz – solange die Schleuse nicht ausgebessert wird«, wirft da ein junger Bursch ein, den eine über die linke Gesichtshälfte, Kinn, Mundwinkel und Ohr verlaufende Schramme entstellt, »wir sollten die Flöße ausmessen. Und wenn eines länger ist als hundertdreißig Meter, sollten wir nicht darauf fahren – so wie es das Gesetz vorschreibt.«
»Das ist unmöglich«, behauptet einer vom Rat der Alten. »Man kann doch die Stämme nicht abschneiden, wenn sie um einen Meter länger sind!«
»So müsste eben eine Tafel weniger angekoppelt werden«, meint der Floßführer mit der Schramme.