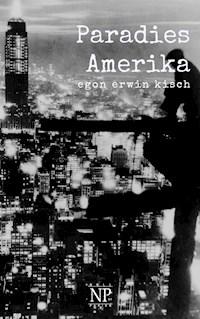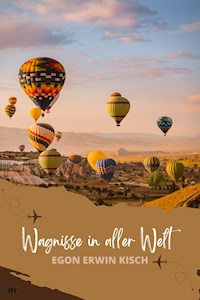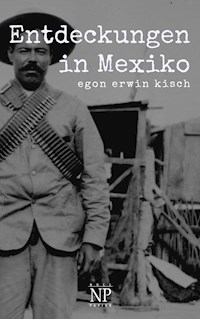Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kisch bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Fassung in aktueller Rechtschreibung Kisch, wieder unübertroffen in seinen Schilderungen von Menschen und Situationen – diesmal aber konzentriert auf Erlebnisse und Geschichten in jüdischen Ghettos. Auch hier kümmert sich die Feder Kischs' um die Außenseiter unter den Verstoßenen: Die Hochstapler, die Tore, die merkwürdigen Gestalten, wie sie besonders in schwierigen Zeiten gedeihen. Und die Zeiten waren die Schwierigsten und die Orte nicht selten die Menschenunwürdigsten. Mit 179 Fußnoten Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Egon Erwin Kisch
Geschichten aus sieben Ghettos
Egon Erwin Kisch
Geschichten aus sieben Ghettos
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Allert de Lange, Amsterdam, 1934 (216 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962816-82-7
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Auswanderer, derzeit Amsterdam
Schime Kosiner (Unhoscht) verkauft ein Grundstück
Lobing, pensionierter Redakteur
Romanze von den Bagdad-Juden
Ex odio fidei …
Die Messe des Jack Oplatka
Dantons Tod und Poppers Neffe
Des Parchkopfs Zähmung
Der Kabbalistische Erzschelm
Der Tote Hund und der lebende Jude
Notizen aus dem Pariser Ghetto
Den Golem wiederzuerwecken
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Kisch bei Null Papier
Paradies Amerika
Der Mädchenhirt
Schreib das auf, Kisch!
Geschichten aus sieben Ghettos
Der rasende Reporter
Entdeckungen in Mexiko
Marktplatz der Sensationen
Hetzjagd durch die Zeit
Wagnisse in aller Welt
Auswanderer, derzeit Amsterdam
Vom Giebel der Antoniuskerk1 streckt Christus die Arme dem Volk auf dem Waterloo-Plein2 entgegen. Meine Herrschaften, ruft er, kommen Sie doch zu mir. Ich führe die gleiche Ware, die Sie bisher von Moses & Aaron bezogen haben, nur ist mein Haus eleganter als das Ihres jetzigen Lieferanten.
Die beiden Schwurzeugen an seiner Seite sind überlebensgroße, vollbärtige, jüdisch aussehende Priestergestalten und können durchaus als Moses und Aaron gelten, wenn sie vielleicht auch Petrus und Paulus sind. Jedenfalls stehen sie da, linker Hand, rechter Hand, und protestieren durch keine Geste gegen die in goldener Antiqua behauptete Identität der beiden Religionen: »Qua fuit a saeclis sub Signo Moysis et Aaronis, stat salvatori renovata illustrior aedes.«3 Zu Füßen dieser Werbung marktet der Adressat, das Amsterdamer Ghetto, jedoch niemand hat Ohren, zu hören, was der Mann in steinerner Geduld redet, niemand Augen, zu sehen, was auf der Kirche angeschrieben ist.
Noch beschwörender als der Christ strecken die jüdischen Budenbesitzer ihre Arme aus, noch lobpreisender, noch beteuernder, und der Passant ist vollauf mit der Prüfung der feilgehaltenen Ware beschäftigt; Missbilligung markierend, fragt er nach dem Preis des von ihm ausgewählten Stücks, feilscht, geht, kommt wieder.
Ein Händler, der Heringe ausweidet und Pfeffergurken schneidet, tut so, als wäre er von einer kauflüsternen Menge umlagert, die bewundernd auf ihn weist, scheu seinen Namen flüstert und derer er sich nun erwehren muss. »Ja«, ruft er mit Stentorstimme,4 »ja, ich bin der Heimann, das weiß doch jeder! Heimann ist bekennt! Ich bin ja so bekennt.«
Nähen wirklich Käufer, und es gilt für Heimann zu handeln, so übernimmt es die Gattin, seinen Ruhm zu verkünden. Sie trägt einen »Scheitel« – Euphemismus für Perücke –, legt die Hände an den Mund und teilt der Welt mit, dass Heimann ja so bekennt ist. »Alles om een Dubbeltje«,5 dröhnt ein Nachbar-Stentor; er faltet mit weit ausladenden, spitzfingrigen Bewegungen ein Paket Briefpapier und fügt einen Crayon, eine golden scheinende Uhrkette und einen Bonbon zu jenem alles, das für ein Dubbeltje zu haben ist. – »Nuttige Kadoches« hörst du anpreisen, und das soll weder berlinerisch noch jiddisch, sondern holländisch und französisch sein und bedeuten: nützliche Cadeaux.6
Um Gemüse und Eier und Obst, um »Koscher Planten-Margarine«, um Fisch und Geflügel und Fleisch, alles »Onder Rabbinaal Toezicht«,7 kreisen Handel und Wandel auf dem rechtwinklig geknickten Waterloo-Plein; rostige Eisenbestandteile, fadenscheinige Kleider, zerbrochene Möbel, verbeultes Geschirr, Verkoop van 2e Handsch Gereedschappen en bruikbaare Materiaalen8 – der Abfall der Niederlande ist durchaus marktbares Gut.
So geht es von Morgendämmerung zu Abenddämmerung, wochentags auf dem Waterloo-Plein, sonntags kirmesartig auf der Oude Schans und in der Uilenburgstraat. Nur der Sabbat gibt Ruhe. Am Freitagnachmittag bricht Israel seine Zelte ab, die Pfosten, Plachen,9 Kisten und die unverkauft gebliebene Ware werden entweder auf Handkarren fortgeschafft, wobei schwarzlockige, magere Knaben die Wagenhunde sind, oder fahren auf dem Wasserweg von dannen. Zwanenburgwal, Wall der Schwanenburg, so poetisch heißt der Kai, an dem Frachtkähne voll mit alten Kleidern und alter Wäsche vertäut liegen und Gondeln mit Fahrradteilen (Amsterdam ist die Stadt der Juden und der Radfahrer und beteiligte sich dennoch nicht am Weltkrieg). Eine schaukelnde Zille voll splitternackter, defekter Schaufensterpuppen erweckt wegen der unzüchtigen Konstellationen der Figuren das Hallo der Gaffer an den Grachten.
Wenn ein Händler nur ein kleines Warenlager hat, eines, dessen Rest schnell eingepackt und in einem Koffer wegtransportiert werden kann, harrt er noch aus auf Waterloo. Jetzt, da die Konkurrenz abrollt oder abschwimmt, hofft er sein Geschäft zu machen, Nachbörse, Schleuderpreise, Ausverkauf, Sonderangebote, Restanten, Koopjes,10 Mezijes.11 Heimann ist noch immer da, die Menge ist noch immer nicht da, deren Ansturm er schreiend zurückweist: »Ja, ja, Heimann ist bekennt.«
Die drahtumfriedete Mitte von Waterloo-Plein ist ein Jugendspielplatz, zur Marktzeit und nach Marktschluss spielen hier Kinder, während ihre ärmeren Altersgenossen Karren abschieben oder die weggeworfenen Warenreste, alles, was auf dem Pflaster blieb, durchwühlen. Die zum Finale anschwellenden Rufe Heimanns, »Ich bin ja so bekennt«, tönen herüber, aber es kann unmöglich sein Eigenlob allein sein, was diesen ins Marktgetriebe eingebetteten, typischen Großstadtspielplatz mit Wellen von Gestank erfüllt.
Für die kleinsten Kinder sind Sandhügel zum Buddeln da, für die größeren Schaukeln, für die noch größeren Turngeräte. Die größten kämpfen ein Wettspiel aus, in je einen Korb auf hoher Stange ist der Ball zu landen; in beiden Mannschaften spielen Burschen und Mädchen, kurzberockte Mädchen, das Tempo ist flugs, die Geschicklichkeit beträchtlich, und die Marktgänger, bepackt mit Einkäufen, bleiben am Drahtnetz stehen, vom Sportfieber ergriffen.
Selbst wenn die Turmuhr schlägt, blickt niemand auf, geschweige denn zum Christus, der unermüdlich die Arme nach solchen ausstreckt, die willens wären, anzuerkennen, dass seine Kirche nichts anderes ist als das, was jahrhundertlang unter dem Zeichen von Moses und Aaron stand und nun zu einem herrlichen Bau schöpferisch erneuert ward.
Du lieber Gott, Bekehrungsversuche hat man bei den Amsterdamer Juden schon unternommen, als sie noch keine Amsterdamer Juden waren. In Polen und Russland kam man ihnen mit ganz anderen Missionsmethoden, mit Plünderungen, Schändungen und Pogromen, in Spanien und Portugal mit Kerkerverlies und Folterbank und Flammentod, und hat nichts, gar nichts ausgerichtet.
Die Kathedrale von Toledo, wahrlich ein gewaltiger lockendes, ein gewaltiger verwirrendes und gewaltiger einschüchterndes Bauwerk als diese Antoniuskerk, steht seither in einer judenleeren Straße; das hat sie nicht davor geschützt, heute »Calle Carlos Marx«12 zu heißen, und die Straßentafel mit diesem Namen ist just auf dem Palast des Torquemada13 und seiner erzbischöflichen Nachfolger befestigt. Die alabastergefütterten Synagogen von Toledo wurden zu katholischen Kirchen, die vertriebenen Inhaber der Stammsitze aber bauten sich auf der anderen Seite der europäischen Landkarte neue Synagogen. Nicht weit vom Waterloo-Plein liegen einander zwei gegenüber. Die »Hochdeutsche Synagoge«, gegründet von denen, die vor den Landsknechten und Marodeuren des Dreißigjährigen Krieges und vor der Soldateska Chmelnitzkis14 flüchteten, und die Portugiesische. Die Portugiesische Synagoge gleicht nicht etwa der Prager Altneuschul, sie ist keineswegs ein verhutzeltes, sich verstecken wollendes Versammlungshaus von Illegalen, sie ist ein Prunkbau, eine Kathedrale auf jüdisch. Aufgerichtet ist sie mitten im Fluss, sie steht auf Pfählen oder gar, wie die Sage geht, auf Fässern mit schierem Gold. Das Kirchenschiff reckt sich auf Säulen aus rundbehauenem Granit himmelwärts, wie jenes der iberischen Kirchen, in die man die Juden zur Bekehrungspredigt oder zur Zwangstaufe schleppte.
Aus brasilianischem Palisander ist die Estrade mit dem Altar gezimmert. Sie, die »Tuba«, erhebt sich in der Mitte des Hauses, ihr und einander sind die konzentrischen Bankreihen zugewendet, nicht allesamt gegen Osten wie in den Tempeln des Abendlands, wo die Beter nur den Rücken des Vorbeters sehen. Hier kehrt man sich der Ostwand erst dann zu, wenn aus der Bundeslade eine Thorarolle gehoben wird. Eine stammt aus dem ehemaligen Heimatland, die Flüchtlinge trugen sie über die Pyrenäen wie ein Fahnentuch nach verlorener Schlacht.
Sechshundertdreizehn Kerzen leuchten dem Gottesdienst, eine teure und unmoderne Beleuchtungsart, gewiss, aber da lässt sich nichts ändern, so war es in Granada, so war es in Lissabon, so muss es bleiben. Weil es in Granada und Lissabon so war, geht der Rabbi auch hier in Escarpins, seidenen Strümpfen und Schnallenschuhen, die Gemeindefunktionäre tragen den flachen harten Jesuitenhut mit geschweifter Krempe und die Tempeldiener einen fulminanten Dreispitz wie damals in Spanien die Guardia Reale15 und heute die Guardia Civile.16 Der Chorregens, den Gesang der Waisenknaben dirigierend, hat ein Samtbarett aufgesetzt, als wäre er Scholar zu Saragossa.
In portugiesischer Sprache stehen auf einer Marmortafel die Namen der Gemeinde-Ältesten, unter deren Regierung die Synagoge erbaut wurde: »Parnassimos Senhores Yshac Levy Ximenes, Mosseh Curiel, Abraham Jessurun d’Epinoza, Daniel de Pinto, Ysrael Pareira, Joseph de Azveldo, Zagachi Gabay Aboab de Fonzara, Semuel Vaz, Osorio da Veiga und Henriquez Costino se estron est esnoga construida …«17 Die Beter begrüßen einander mit »boa entrada do Sabbat«,18 welche Formel drüben bei den Hochdeutschen »Gut Schabbes« lautet, und anstatt »boa semana«19 wünscht man auf der anderen Seite der Straße nur eine »Gut Woch«. Das Gebet für die Königin der Niederlande wird portugiesisch gesprochen, und streng hält man darauf, bestimmte Formeln der Gemeindedokumente in der Sprache derer abzufassen, von denen die Ahnen gemartert und davongejagt wurden, man wahrt Tracht und Gehaben und Gebräuche derer, die die Juden zunächst zu Spanien und dann in der ersten Emigration, in Portugal, steinigen ließen.
Dort im Süden waren sie, weil sie vor der Inquisition dem Glauben öffentlich abschworen und ihm insgeheim weiter anhingen, als Maranen, das heißt Schweinekerle, beschimpft worden. In der neuen Heimat wollten sie nun dartun, dass kein Caballero sie an Vornehmheit übertreffe, kein Grande grandioser und mit mehr Grandezza auftrete als sie.
Die niederländischen Provinzen der spanischen Krone, die protestantischen Holländer kämpften den Kampf der Auflehnung gegen die katholischen Usurpatoren, und die Opfer von Inquisition und Unduldsamkeit konnten bei den Feinden ihrer Peiniger auf umso gastlichere Aufnahme rechnen, als sie aus dem Stiefmutterlande nicht mit leeren Händen kamen, sondern außer der mitgebrachten Thorarolle auch den mitgebrachten Handel mit der Levante und Südamerika entfalteten. In der Kaufmannsfeste an der Amstel gab es keine »Juderia«, kein mit Mauern oder Ketten abgeschlossenes Judenviertel; jeder kreditwürdige Mann durfte das gleiche Bürgerrecht ausüben und seiner Religion obliegen – sofern es nicht die katholische war. Nur ein einziges Mal, es geschah zu Anfang ihres Aufenthalts, wurden die, denen man in Iberien vorgeworfen hatte, unter dem Anschein katholischer Gebetstunden jüdische Gottesdienste abzuhalten, in Amsterdam bei einer Glaubensübung überfallen: man hielt sie für eine katholische.
Die jüdischen Caballeros stolzierten in Amsterdam einher, sie hatten Reichtum und Titel, auf ihren Grabsteinen und sogar auf den Etuis für ihre Gebetmäntel prangten Wappen. In den Museumsräumen der Alten Stadtwaage sieht man Beschneidungsmesser aus Achat mit Scheiden aus Robbenleder, Gewürzbüchsen aus Elfenbein, Brabanter Spitzenhauben für die Madrinis, die Mutter der Braut, und für die Padrinis, die Mutter des Bräutigams, Perlenstickereien, edelsteinbesetzte Tempelgeräte und goldenes Ostergeschirr. Als wichtige, wohlhabende und edle Geschlechter wollten die Emigranten gelten, und kein Geringerer als Goethe hat ihnen bestätigt, dass sie das seien, obgleich er die portugiesische Judengemeinde nie gesehen, vielleicht nie von ihr gehört hatte und nicht wusste, wem er das Gutachten ausstellte. In seinem Essay »Jacob van Ruysdael als Dichter« beschreibt Goethe ein Landschaftsbild; es stellt den Friedhof der Amsterdamer portugiesischen Juden zu Oudekerk dar, was Goethe unbekannt war. »Bedeutende, wundersame Gräber aller Art, durch ihre Formen teils an Särge erinnernd, teils durch große aufgerichtete Steinplatten bezeichnet, geben Beweis von der Wichtigkeit des Kirchsprengels und was für edele und wohlhabende Geschlechter an diesem Orte ruhen mögen.«
Dieser Friedhof ist noch da, und obwohl Straßenbahn Nr. 8 direkt hinführt, ist er immer noch wildromantisch, man kann wirklich sein getreues Abbild für dichterische Fantasie halten. Unter den ältesten Katafalken liegen Granden: Samuel Palache, Gesandter des Sultans Mulay Sidan von Marokko, Mozes Jehuda Beori, embaixador20 Mohammeds IV. am Hofe Karls IX. von Schweden, Manuel Teixera, Resident der Königin Christine von Schweden bei der Hansa, die Gründer der Diamantschleiferei und berühmte Juweliere wie Manuel Baron Belmonte, Curiel und Duarte del Piaz, Kaufleute, die zwischen Brasilien und den Niederlanden segelten, Bringer von Kaffee, Tabak, Olivenöl. Auf den Grabsteinen liest man Namen und Insignien von Ärzten, Schüler der maurischen Heilkundigen, Joseph Bueno, der ans Sterbebett des Prinzen Maurits gerufen worden war, sein Sohn, der Arzt Ephraim, genannt Bonus, Gómez de Sossa, Leibarzt des Kardinal-Infanten Ferdinand, Statthalters in den Niederlanden; Verfasser von Reisebeschreibungen, Übersetzer von Lope de Vega und Cervantes, Theologen und Philosophen liegen hier bestattet, darunter Doctor Semuel da Silna, der mit seinem »Tratado da Immortalidade da alma«,21 erschienen anno criaçao do mundo 5383 (1623),22 die Exkommunikation23 Uriel da Costas24 ideologisch vorbereitete. Uriel da Costa ertrug nicht die Schmach des Bannfluchs, er widerrief, und sich dieser Schwäche schämend, entleibte er sich. Spuren davon, wie es die Emigranten den Mönchen Spaniens an Gottesgelahrtheit,25 Unduldsamkeit und Mystik gleichtun wollten, finden wir in den alten Drucken der Gemeindebibliothek, der Livraria Montezinos, eines der niedrigen Häuser, die die Synagoge wie ein Burgwall umgeben. Der Bibliothekar Don Silva Roza zeigt seine Schätze nicht gern her, am wenigsten gern die vom Ende des siebzehnten und vom Beginn des achtzehnten Jahrhunderts, der Zeit des Sabbatai Zewi,26 der sich den Messias nannte. Keine Gemeinde der Judenheit schloss sich ihm mit solch bedingungsloser Inbrunst an wie die spaniolische zu Amsterdam. Sie hoffte, dieser Gott werde sie nun in das Gelobte Land zurückführen, auf dem gleichen Weg, den sie gekommen war: zunächst auf die Pyrenäenhalbinsel und dann – aber darauf legte sie ersichtlich keinen besonderen Wert – nach Jerusalem. Auf jener ersten Etappe, in Kastilien, Aragonien oder Portugal, würden die Heimkehrer vollberechtigte Granden sein mit dem Degen an der Seite und dem Orden vom Goldenen Vlies an der Brust, halleluja!
Als unstet, als unbodenständig, als ein Nomadenvolk gelten die Juden. Und dennoch zog es sie jahrhundertelang nach einer sie nicht liebenden Heimat, nach dem mächtigen Königreich, dem goldbetreßten Adel und dem prächtigen Zeremoniell, auch als dort von königlicher Macht und Adelsherren und Pracht längst nichts mehr übriggeblieben war.
Die Ostjuden auf der anderen Straßenseite haben solche Sehnsüchte freilich nie gehegt, die Rückkehr zum Zaren bot keine Lockung, sie blieben misstrauisch gegen den hergelaufenen Messias, leugneten seine Berufung, schmähten ihn. Über solche Gotteslästerung zeterten die Sepharden, gaben sich noch fanatischer an Sabbatai Zewi hin; die Männer aus Priestergeschlechtern mussten zum Zeichen, dass das Himmelreich auf Erden gekommen sei, an jedem Sonnabend die Gemeinde segnen (geschieht heute noch), und die alten Gebetbücher, die uns Don Silva Roza unwillig vorlegt, sind mit seltsamen, kupfergestochenen Titelblättern geschmückt: Sabbatai Zewi thront über den Wolken, eine Krone trägt er auf dem Haupt, Strahlen gehen von ihm aus, und Posaunenengel verkünden: »Du bist der Ewige, unser Gott, Sabbatai Zewi.«
»Ein Schwindler ist er«, schallte es von der gegenüberliegenden Seite des Jonas-Daniel-Meijer-Platzes zurück, »ein gemeiner Betrüger«; welch Bürgerkrieg des Glaubens durchwütete das Ghetto von Amsterdam.
Beweist die Bibliothek Montezinos das Interesse der Sepharden an Literatur, Wissenschaft und Theologie, beweist der Bau der Synagoge ihren architektonischen Ehrgeiz, der Inhalt der Vitrinen in der Alten Stadtwaage ihren Sinn für Kunstgewerbe und die Grabmonumente von Oudekerk ihr Verhältnis für Skulptur, so müssen wir, um ihre Beziehung zu Malerei und Zeichenkunst kennenzulernen, eine fünfte Örtlichkeit aufsuchen, ein Ghettohaus mitten auf Jodenbreestraat. Das hat Rembrandt van Rijn bewohnt, von Anfang 1639 bis Ende 1657, beinahe als einziger germanischer Bürger unter einer Anrainerschaft von Mittelmeerjuden und Ostjuden. (Genauso wie er hat sich lange vor ihm und fern von ihm Greco27 im Kern der Juderia von Toledo angesiedelt, um den bewegten Typen des Alten Testaments nahe zu sein, wenngleich sich diese hinter dem Neuen Testament zu verschanzen begannen.)
In dem Haus Rembrandts wimmelte es von Juden, und noch heute wimmelt es von ihnen, der große Hausherr ist tot, aber seine Modelle leben. Die Regeln der mosaischen Religion untersagen es ihren Anhängern, sich ein Bildnis zu machen von dem, was in dem Himmel oben und auf der Erde unten ist, und natürlich auch, sich ein solches Bildnis machen zu lassen. Aber die Seele der Emigranten war von der schmachvollen Vertreibung und von dem Wunsch erfüllt, das Beispiel ihrer hochgeborenen Peiniger nachzuahmen. Von Velázquez und Greco hatten sich die spanischen Notabeln28 porträtieren lassen, die Davongejagten ließen sich von Rembrandt malen, sie kamen freilich selten als Auftraggeber, sie gaben nur gern seinem Wunsche statt, ihm Modell zu stehen.
So entstanden die Bildnisse des Arztes Ephraim Bonus, des Philosophen Menasse ben Israel,29 die Rabbinerporträts, und viele hundert Typen aus Rembrandts Nachbarschaft füllen seine biblischen Stiche und Gemälde. Frauengestalten sind darunter, auch sie erhaschte Porträts von Jodenbreestraat und von Houtgracht, wie der Waterloo-Plein vor der Schlacht bei Waterloo hieß. Nur die »Judenbraut« ist keine Judenbraut, sondern Rembrandts reinrassisch arische Nichte, und der Bräutigam neben ihr ist kein jüdischer Bräutigam, sondern des Meisters Sohn Titus. Umso authentischer jüdisch ist auf dem berühmten Stich »Synagoge« das handelsbewegte Treiben der hochbemützten und langbebärteten Gestalten vor den Tempelstufen. Rembrandts sephardische und aschkenasische Zeitgenossen leben auf seinen Gemälden als König Saul und dessen Harfenist David, als segnender Jaakob, als Haman und Esther, als der erblindete Belisar, als Abraham, der zur Opferung seines Sohnes ansetzt.
Unter Glas und Rahmen liegen im verwaisten Atelier Rembrandts die einzigen Buchillustrationen, die er gemacht hat, Blätter zu einer Prosadichtung seines Freundes Menasse ben Israel, betitelt »Pedro Precioso«. Titelheld ist ein Stein, auf dem Nebukadnezar stand und der identisch ist mit dem Stein, den David auf Goliath schleuderte, und mit dem Stein, auf dem Daniel ruhte, als er seine Vision hatte, und auch mit dem Stein, auf den sich die Himmelsleiter Jaakobs stützte. Auf den Körper Nebukadnezars ist eine Landkarte mit vier persischen Provinzen gezeichnet, die nicht auf Rembrandts Kupferplatte entstanden war. Aus irgendwelchen närrisch-kabbalistischen Gründen hat der Autor und Drucker Menasse sie eingefügt, worauf Rembrandt wütend geworden sein und alle Beziehungen mit ihm abgebrochen haben soll.
Achtzehn Jahre wohnte Rembrandt in der Judengasse. An dem Tag, an dem seine Gläubiger das Haus zum Zweck der Zwangsversteigerung amtlich inventarisieren ließen, am 27. Juni 1657, wurde auch ein jüdischer Bewohner des Ghettos aus der Gemeinschaft vertrieben. Diesen aber vertrieben seine Glaubensgenossen selbst.
Schwarzumflorte Kerzen staken in den ziselierten Silberleuchtern, in denen sich heute noch die Sabbatlichter in vielfachen Reflexen spiegeln, und das gleiche Widderhorn, das noch immer Beginn und Ende der hohen Festtage verkündet, dröhnte die Begleitmusik zu jenem von Verbannten ausgesprochenen Urteil der Verbannung: »Verflucht sei er zu allen Stunden des Tages, und er sei verflucht zu allen Stunden der Nacht. Verflucht sei er, wenn er sich niederlegt zur Rast, und er sei verflucht, wenn er aufsteht zur Arbeit. Verflucht sei er, wenn er ausgeht, und er sei verflucht, wenn er zurückkehrt. Der Zorn und der Grimm des Herrn Zebaoth werden entbrennen gegen ihn, der Herr Zebaoth wird seinen Namen auslöschen unter dem Himmel für ewig und immerdar.«
Der solcherart Vermaledeite war Baruch Spinoza, sein Name ist nicht ausgelöscht, wenn man auch sein Konterfei im Mosaik der mosaischen Gestalten nicht zu entdecken vermag, die Rembrandt aus seiner Umwelt ausgewählt und für ewig und immerdar festgehalten hat. Rembrandt und Spinoza besaßen gemeinsame Bekannte. Spinozas Lehrer war jener Menasse ben Israel, den Rembrandt porträtiert und dessen Buch er illustriert hatte. Die Protektoren Rembrandts und Spinozas waren Vater und Sohn Huygens.30 Constantin Huygens entdeckte Rembrandts Genie auf dem Schüttboden einer Mühle am Rhein und verschaffte dem Müllerssohn Aufträge vom Prinzen Maurits von Oranien;31 der Sohn dieses Constantin Huygens, Christian, gab Spinoza Arbeit, er ließ bei ihm Linsen für die Mikroskope schleifen, durch die die Forscher jener Zeit die Natur zu beäugen begannen, um die Übereinstimmung mit ihren Theorien festzustellen.
Nur wenige Schritte voneinander entfernt wohnten Rembrandt und Spinoza. Sind die beiden einander je begegnet? Nichts ist davon überliefert, nicht Rembrandt hat ihn verewigt, erst Goethe, Marx und Lessing künden die Glorie von Spinozas Geist.
Die aber, die ihn ausstießen, sind so stolz auf ihn, wie sie stolz sind auf die, von denen sie ausgestoßen wurden. Stolz wie die Spanier heiraten sie nur untereinander und schauen hochmütig auf die misera plebs32 hinab. Wohl würden sie niemals der Einladung Christi von der Antoniuskerk Folge leisten, aber noch weniger sich mit den Ostjuden auf der anderen Seite des Jonas-Daniel-Meijer-Platzes gemein machen.
Sie sind in ihrer Urväter Zeiten als Vertreter des heraufkommenden Handelskapitals vom eifersüchtigen Feudaladel Spaniens abgeschafft worden, wie andernorts die verschuldete Schlachta Polens auf ihre Gläubiger den Zorn des ausgebeuteten Volks lenkte. Ob südländische Sephardim oder nordländische Aschkenasim, sie sind gleichermaßen Opfer ihres Merkantilismus, Opfer des Konkurrenzneids. Dennoch verhehlen die Spaniolen ihre großbürgerliche Verachtung für den Kleinbürger nicht, selbst wenn der ihr Glaubensgenosse, ihr Leidensgenosse, ihr Exilgenosse ist. Flüchtlinge der spanischen Inquisition zu sein, dünkt ihnen etwas Vornehmes, wogegen sie in den Flüchtlingen der Pogrome, noch nach dreihundert Jahren, einen Armeleutegeruch spüren.
So viele von ihnen längst verarmt sind, sosehr die Gemeinde in Vermögensschichten zerfallen ist, die miteinander gar nicht verkehren, sie leben allesamt in der Einbildung weiter, »edelen und wohlhabenden Geschlechtern« anzugehören. Diamantenschleifer, auch arbeitslose, sitzen unter den Tempelleuchtern und sind darauf bedacht, es den anderen »parnassimos senhores« und den Ahnen an Würde gleichzutun; wer ihnen sagte, dass sie Arbeiter sind, würde sie beleidigen, wer ihnen von proletarischer Organisation zu sprechen wagte, gegen den würden sie ihren nicht vorhandenen Degen zücken. Sie und die stellungslos gewordenen Angestellten des Kaffee-Exports und des Tabakversands, die älteren wenigstens, warten lieber auf einen neuen Sabbatai Zewi, der sie via Kaffeebörse und Tabakbörse in die schönen Tage von Aranjuez führen wird.
Kein Sepharde von Amsterdam, und wäre er noch so bettelarm, würde auf dem Wochenmarkt von Waterloo-Plein oder am Sonntagsmarkt von Oude Schans als Verkäufer schaustehen oder gar seinen Namen preisgeben, wie es der Aschkenase tut, indem er ausschreit: »Heimann ist bekennt.«
kerk: (niederl.) Kirche. <<<
Plein: (niederl.) Platz. <<<
(lat.) Wo seit Jahrhunderten unter dem Zeichen von Moses und Aaron ein Tempel gestanden hat, steht jetzt ein prächtigeres, für den Erlöser wiederhergestelltes Gotteshaus. <<<
Die Göttin Hera tritt während des Kampfes zwischen Griechen und Trojanern in Gestalt des Stentor vor die Griechen und fordert sie mit lauter Stimme zum Kampf auf. <<<
Dubbeltje: (niederl.) Zehncentstück. <<<
Cadeaux: (franz.) Geschenke. <<<
(niederl.) Unter Aufsicht des Rabbiners. <<<
(niederl.) Verkauf von Geräten und brauchbaren Materialien aus zweiter Hand. <<<
grobes Leinentuch <<<
Koopjes: (niederl.) Gelegenheitskäufe. <<<
Mezijes: (jidd.) preiswürdige, preisgünstige Ware. <<<
Calle: (span.) Straße. <<<
Tomas de Torquemada (1420-1498), ab 1483 Großinquisitor, Begründer und Oberhaupt der spanischen Inquisition, veranlasste 1492 die Vertreibung der Juden. <<<
Bogdan Chmelnitzki (1595-1657), ukrainischer Kosakenhauptmann. <<<
guardia real: (span.) königliche Garde. <<<
guardia civil: (span.) Wache, Gendarmerie. <<<
(port.) Unter den ehrenwerten Herren … ist der Tempel errichtet worden. <<<
(port.) Einen guten Sabbatbeginn. <<<
(port.) Eine gute Woche. <<<
(port.) Botschafter, Gesandter. <<<
(port.) Traktat von der Unsterblichkeit der Seele. <<<
(port.) im Jahre 5383 nach Erschaffung der Welt. <<<
Exkommunikation ist der zeitlich begrenzte oder auch permanente Ausschluss aus einer religiösen Gemeinschaft oder von bestimmten Aktivitäten in einer religiösen Gemeinschaft. <<<
Uriel Acosta, auch Gabriel da Costa (1590 bis 1640), jüdischer Religionsphilosoph. <<<
Theologie <<<
Sabbatai Zewi (1626-1676), jüdischer Kabbalist und messianischer Schwärmer, Begründer der religiösen Bewegung des Sabbataismus. <<<
EI Greco, eigentlich Domenico Theotocopuli (1541 bis 1614), griechisch-spanischer Maler, lebte ab 1577 in Toledo. <<<
Angehörigen der sozialen Oberschicht <<<
Menasse ben Israel (1604-1657), jüdischer Schriftsteller und Philosoph. <<<
Constantijn Huygens (1596-1687), niederländischer Dichter. <<<
Maurits (1567-1625), Prinz von Oranien, ab 1585 Statthalter der Niederlande. <<<
(lat) das arme Volk. <<<
Schime Kosiner (Unhoscht) verkauft ein Grundstück
Von der Dummheit des Kaufmanns Schime Kosiner in Unhoscht sind noch heute viele Geschichten in Umlauf, die alle mit der Phrase beginnen: »Wenn ein Jud blöd ist …«
Zu seinen Lebzeiten war im weiten Umkreis seine Dummheit noch populärer, und Herr Gustav Dub, der rote Dub, rieb sich schon im Voraus die Hände, als er erfuhr, dass das Geleise der projektierten Prag-Buschtiehrader Eisenbahn auch über das Grundstück Schime Kosiners in Unhoscht gehen werde.
Ja, wer die glänzenden Beziehungen des Herrn Gustav Dub, des roten Dub, kannte – und wer kannte sie nicht! –, konnte vermuten, er selbst habe die Eisenbahningenieure bewogen, die Strecke dorthin zu leiten. Eine solche Kombination wäre jedoch falsch, denn hätte Herr Gustav Dub, der rote Dub, seine eben geriebenen Hände im Spiel gehabt, hätte er sicherlich genau an der Stelle, wo jetzt »Simon Kosiner, Gemischte Warenhandlung« stand, das Bahnhofsgebäude hinbauen lassen. So aber hatte Herr Gustav Dub, der rote Dub, bloß aus dem (streng geheimen) Projekt ersehen, dass der zukünftige Schienenstrang eine Ecke des Kosinerschen Hauses streifen werde, nein, nicht einmal des Hauses, nur des Hofes.
Kaum zehn Meter im Geviert brauchte die künftige Eisenbahnlinie vom Kosinerschen Hof. Aber Herr Gustav Dub, der rote Dub, wusste, dass ihm die Prag-Buschtiehrader Eisenbahngesellschaft für dieses Stückchen Boden fünfhundert Gulden österreichischer Währung bezahlen werde, während er es dem dummen Schime Kosiner für höchstens zweihundert abzuknöpfen hoffte. Den Gewinn von dreihundert Gulden eskomptierte Herr Gustav Dub, der rote Dub, indem er sich die Hände rieb.