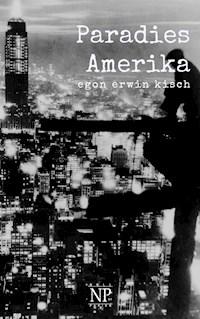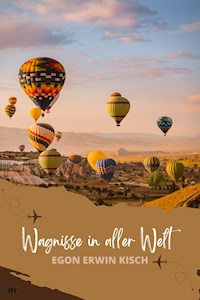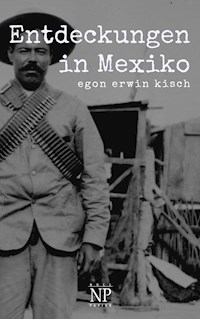
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kisch bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Fassung in aktueller Rechtschreibung Lesen Sie hier 48 seiner gelungensten Reportagen und Essays aus Mexiko. Kisch, der 1939 nach Mexiko ins Exil floh, berichtet anschaulich und unterhaltsam, wie nur er es konnte, über Land und Leute. Seiner Zeit und seinen persönlichen Erfahrungen geschuldet, hat er dabei immer ein Auge auf die Ausgebeuteten und Verlorenen, derer es auch in Mexiko nicht mangelt. Er schreibt über Entwicklungen im Gesundheitswesen genauso wie über Reformen in der Landwirtschaft, aber auch über Vulkane, Kakteen und Erdbeben. Kurz: Der "rasende Reporter" ist wieder einmal in seinem Element. "Reportage ist eine sehr ernste, sehr schwierige, ungemein anstrengende Arbeit, die einen ganzen Kerl erfordert. Kisch ist so einer." [Kurt Tucholsky] Mit 107 Fußnoten Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Egon Erwin Kisch
Entdeckungen in Mexiko
Egon Erwin Kisch
Entdeckungen in Mexiko
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Aufbau Verlag, Berlin, 1947, 1974 3. Auflage, ISBN 978-3-962817-05-3
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Geschichten mit dem Mais
Ein Vulkan bricht aus
Kolleg: Kulturgeschichte des Kaktus
I. Heraldik
II. Bildende Kunst
III. Literatur
IV. Geschichte
V. Manufakturwesen
VI. Revolutionsgeschichte
VII. Industrie
VIII. Pharmakologie
IX. Ethnografie
X. Gastronomie
XI. Hydrologie
XII. Dialektik
Der Nibelungenhort von Mexiko
I. Wie man den Schatz fand
II. Das Gold flüchtet
III. Das große Suchen
Interview mit den Pyramiden
I
II
III
IV
V
VI
VII
»Nicht jedem Volke ward solches getan …«
Das verteilte Baumwolland
Maximilian von Habsburg und Karl Marx
Landschaft, geschaffen um des Silbers willen
Liebe und Lepra
Mineral der motorisierten Menschheit
Agavenhain in der Kaschemme
I
II
Fragen, nichts als Fragen auf dem Monte Albán
An der Kräuterbude
Der Mensch im Kampf der Hähne
Geschäftsreise
Indiodorf unter dem Davidstern
Mexikoforschung bei den Nazis
Verwirrung einer Kaiserin
Zum Geburtstag des feuerspeienden Bergs
Bonanza oder die Prinzen der glücklichen Strähne
Wirtschaftliches Feuilleton über Torreón
Was immer der Peyote sei …
Der Hafen der Seeräuber
Der Kaugummi, erzählt vom Ende bis zum Anfang
Die fetten und die mageren Jahre der Stricke
Die Vanille-Indianer
Die Petroleumleitung
I
II
Der Kaspar Hauser unter den Nationen
Versuch einer Beschreibung von Chichen Itza
Sportbetrieb bei den alten Mayas
Teoberto Maler, ein Mann in verzauberter Stadt
Marktnotierungen
Erlebnisse beim Erdbeben
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Kisch bei Null Papier
Paradies Amerika
Der Mädchenhirt
Schreib das auf, Kisch!
Geschichten aus sieben Ghettos
Der rasende Reporter
Entdeckungen in Mexiko
Marktplatz der Sensationen
Hetzjagd durch die Zeit
Wagnisse in aller Welt
Geschichten mit dem Mais
Der mexikanischen Erde verdankt die Welt den Mais, ihren großen Ernährer. (Nur der Reis ist ein noch größerer.)
Der Mais ist eines der Kroninsignien von Mexiko; Krone ist die Agave, Zepter ist der Orgelkaktus, und der golden erstrahlende Reichsapfel ist der Maiskolben.
Nirgends tritt eine Ackerfrucht in Städten so sichtbarlich in Erscheinung wie der Mais in Mexiko. Das erste, was auffällt, sind die Tortillerías, Bäckereien und Bäckerläden zugleich und doch auch keines von beiden. Schaufenster und Türen fehlen, so zwar, dass das Lokal zu einer offenen Nische der Straße wird. Ein Teil der Arbeit vollzieht sich sogar auf dem Bürgersteig: das Scheuern der steinernen Reibe »Metate«, die Reinigung des eisernen Herds und am Abend das Kneten der ausgebrannten Holzkohle zu einer Art Briketts.
Das Innere aber, wenn man bei einem so weit geöffneten Raum von einem Innern sprechen kann, ist keine Bäckerwerkstatt mit Backofenglut und schwitzenden Gesellen und schürenden Lehrlingen, mit langen Feuerzangen, sargähnlichen Trögen und vielstöckigen Brotregalen.
In den Tortillerías sind nur Frauen am Werk. Vorerst kneten sie den aus Kalk und gemahlenem Mais bestehenden Teig, die Masa. Es ist der Kalk, der die Schmackhaftigkeit und die beliebte Helle der Tortilla ausmacht und den Esser vor Rachitis schützt; auf Schritt und Tritt sieht man, dass die Tortilla den Zähnen gut tut, – selbst die ältesten Mexikaner fletschen ein lückenloses weißes Gebiss mitsamt rosarotem Zahnfleisch, wie es bei Brotfressern nur dann erstrahlt, wenn es vom Dentisten stammt.
Ist der Teig durchgeknetet und geschmeidig, dann nimmt die Tortillera … Ehe wir weiterschreiben, müssen wir den Leser warnen, das Wort Tortillera etwa in Spanien so ohne weiteres anzuwenden. In Spanien macht und isst man keine Tortillas, aber es gibt Tortilleras. So heißen nämlich dort die lesbischen Frauen. (Als ein Schiff mit spanischen Flüchtlingen in Veracruz landete und mexikanische Zeitungen an Bord kamen, starrten die Passagiere verblüfft auf die Überschrift »Streik der Tortilleras«. Welch seltsames Land, sagten die Neuankömmlinge, wo solche Frauen streiken. Verlangen sie kürzere Arbeitszeit, höhere Löhne, Kollektivvertrag?)
Aber wir sind bei den normalen mexikanischen Tortilleras, während sie von der Teigmasse einen kleinen Klumpen zwischen die Handflächen nehmen. Nun beginnt ein weithin hörbarer Arbeitsgang. Der Klumpen wird zu einer runden und dünnen Platte gepatscht, die, um noch kreisrunder und noch dünner zu werden, unzählige Male und in hohem Bogen blitzschnell aus der einen Handfläche in die andere fliegt. Die Tschinellenschläger der seligen Wiener Burgmusik werden von den Tortilleras geradezu an die Wand geklatscht, – was Wunder, jonglieren doch die Mexikanerinnen schon seit Urzeiten ihr tägliches Brot auf diese Art und Weise, wie sollten sie’s da nicht besser können als ein Soldat mit beschränkter Dienstzeit!
Kundinnen füllen den Laden, begleiten das Klatschen mit ihrem Klatsch, dieweil die Disken die Luft durchfliegen. Von Zeit zu Zeit taucht die Tortillera ihre Hände in warmes Wasser, um haftengebliebene Teigstückchen abzuspülen. Schließlich hat der Fladen eine fast arithmetische Kreisrundheit erreicht. Auf den Comal, die heiße Herdplatte, kommt nun ein wenig Fett, damit die Tortilla nicht kleben bleibe, wenn sie daraufgelegt wird, und sie wird daraufgelegt. Leicht angebacken, mit einem schwarzen Fleck auf gelbem Fond, frisch und warm, ist sie ein Eierkuchen ohne Ei, ohne Salz und ohne Zucker. Die Tortilla ist das Brot von Millionen, und dient auch als Gabel, Löffel und Teller für jene, die zu diesem Brot noch etwas anderes zu essen haben.
Der tägliche Marktbesuch wird mit dem Einkauf der Tortillas beschlossen, und aus der Tortillería läuft die Käuferin geradenwegs nach Hause, um die Tortillas noch warm auf den Tisch zu bringen. Dort, wo das Backen im Haus geschieht, geschieht es während der Tischzeit, und ununterbrochen werden aus der Küche neue Tortillas herangetragen, auf dass sie so heiß gegessen werden, wie sie gekocht sind.
In den Dörfern regiert nicht die Tortillería das Straßenbild, sondern der Molino de Nixtamal, die Maismühle. Kein Dorf, das nicht mindestens einen Laden mit dieser Aufschrift und einer kleinen Mühle mit Gasolinmotor hat. »Nixtamal« ist ein indianisches Wort, das sich in die heutige Zeit Mexikos hinübergerettet hat. (Auch das Wort »Tlapalería« stammt von einem aztekischen Substantiv, aber da es in der Aztekenzeit kaum Farbwarengeschäfte gab, muss es erst später in Geschäftsgebrauch gekommen sein. Nixtamal wurde jedoch schon in der prähispanischen Zeit zermahlen.)
Die Frauen der Provinz bringen ihren eigenen Mais in den Molino de Nixtamal. Etwas Mais hat auf dem Lande jedermann, zumindest ein paar Stauden, die rings um die Hütte aufschießen. In den Höfen steht – Wahrzeichen des mexikanischen Dorfes – ein viereckiges, schlankes Türmchen, aus Maisstroh geflochten: der Cincolote, Speicher für Maiskolben. Ein Dach schützt ihn gegen Regen, und er steht hoch auf hölzernen Füßen, damit die Ratten nicht hinaufkriechen können.
Dem Cincolote entstammen die Körner, welche die Hausfrau im Molino de Nixtamal mit Kalk zur Masa vermahlen lässt. Zu Hause – jeder Küchenherd eine Tortillería – bäckt sie die Tortillas für ihre Familie. Oder auch für den Verkauf. Die Tortillas auf den Markt zu tragen ist Altenteil der Urahne. Barfüßig, auf den Zehenspitzen, mit gebeugten Knien und schnellen kurzen Schritten, den Korb auf dem Kopf balancierend, trabt sie seit tausend Jahren ihren Marktweg, oft meilenweit. Ein mitleidiges Auto will sie mitnehmen. Antwortlos, verständnislos trabt sie weiter, dem Markte zu. Dort hockt sie seit dem ersten jener tausend Jahre unbeweglich mitten im stoßenden Gewühl vor dem gleichen Korb mit den gleichen Tortillas an der gleichen Stelle. Wenn das letzte Stück seinen Käufer gefunden hat, trabt sie nach Hause, wie sie gekommen.
Die Molinos de Nixtamal in den großen Städten sind Fabriken, elektrisch betrieben, Aktien- oder Kommanditgesellschaften gehörig. Gegen sie und gegen ihre Maislieferanten richten sich die Vorwürfe der Bevölkerung, wenn der Preis der Tortilla steigt. Denn der Preis der Tortilla bestimmt das Leben der Massen.
Bei der Demonstration am Ersten Mai in Mexiko-Stadt fällt einem, der die vorige Maifeier in New York erlebt hat, zweierlei auf: die agrarische Grundhaltung der mexikanischen Industriearbeiter und die geringe Betonung des Interesses am Geldwert. Auf dem Weg zum Union Square hatten die New Yorker Kolonnen gegen die Erhöhung des Untergrundbahntarifs protestiert. »Five cents is fair enough«,1 sie zeigten Tabellen mit unzulänglichen Löhnen, und den gemalten Lohntüten standen gemalte Säcke mit den Millionenprofiten der Verwaltungsräte gegenüber. Der mexikanische Arbeiter, weit schlechter bezahlt, erwähnt an seinem Feiertag dergleichen nicht. Er lebt in einem Lande, wo die Revolution noch nichts Verjährtes, nichts mythisch Verfälschtes ist, sondern eine Gegenwart, der alles Ersprießliche oder halbwegs Ersprießliche entstammt. In Mexiko rühmen sich selbst Reaktionäre in rasselnden Reden mit rollendem R der riesigen Rolle, die sie in der ruhmreichen Revolution gespielt haben wollen.
An der Seite der Landarbeiter haben die Stadtarbeiter für Landaufteilung und gegen Leibeigenschaft gekämpft, und sie tragen noch immer diese agrarischen Ideale vor sich her. Das Porträt des Bauernführers Emiliano Zapata reitet über den Beamten der Pfandleihanstalt, »Land und Freiheit«, verlangen die Metallarbeiter. Und alle, ob sie Belegschaften der Petroleumzentrale oder des Elektrizitätswerks, ob sie Autobusschaffner, Lehrer, Eisenbahner, Buchdrucker, Rohrleger, Textilarbeiter, Angestellte der Stierkampfarena oder Kinooperateure sind, alle vereinigen sich in Banner und Ruf zum Protest gegen den gemeinsamen Feind: »Contra los acaparadores del maíz«, gegen die Maisspekulanten.
Übrigens bewegt sich die Maidemonstration mitten in einem ambulanten Markt von Nahrungsmitteln, und auch auf dem dominiert der Mais. In allen Formen bieten ihn die Straßenhändler an.
»Elote« heißt in Mexiko der pure Maiskolben. Gesotten oder geröstet wird er von des Straßenkochs glimmenden Holzkohlen weggekauft und auf dem Marsch geknabbert. Auch die vier Nationalspeisen, Tamales, Enchiladas, Tacos oder Quesadillas, kauft und isst man unterwegs. Die Unterschiede zwischen diesen vier Gerichten muss man lernen, wenn man Mexiko durchwandert und unter dem wählen will, was Garküche und Markt feilhalten.
1. Tamales: außen Mais, innen Mais. Eingeschlagen in ein Maisblatt liegt die mitsamt der Schale geschrotete Maismasse; sie ist in Dampf gekocht, oft mit etwas Fleisch, und wenn man will – und man will immer – mit Chilepfeffer darin.
2. Enchiladas: eine gerollte Tortilla, gefüllt mit etwas Truthahn- oder sonstigem Fleisch, Gemüse oder weißem Käse, gedünstet in Tomatensoße, gespickt mit Zwiebeln. Und wenn man will – und man will immer – mit Chilepfeffer.
3. Tacos: sie sind die mexikanischen Sandwichs, knusprige Tortillas mit Frijoles (Bohnen) darin, Gemüse oder Fleisch und wenn man will – und man will immer – mit Chilepfeffer.
4. Quesadillas: eine Tortilla mit Fleisch, Wurst, Käse oder Flor de Calabaza (Kürbisblüte) gefüllt, in heißem Fett gesotten. Und, ob man will oder nicht, immer mit Chilepfeffer.
Jedoch nicht nur gegessen wird der Mais, sondern auch getrunken. Der Atole ist ein Getränk, wiewohl er mehr an verdünnten Brei oder Grießsuppe erinnert; erzeugt wird er aus gequirltem Maismehl und manchmal mit Fruchtsaft vermischt. Oder Pozole, eine Suppe aus getrocknetem Mais, über einem Schweinskopf gekocht, mit rohen Zwiebeln und jenen Garbanzos2 reich versehen, gegen die Heines Atta Troll so heftig loszieht.
Auch zur Alkoholisierung des Volkes trägt der Mais das Seine bei, in Mexiko durch den Pulque de Maíz, der dem gewöhnlichen Pulque in nichts nachsteht, und in Bolivien durch die Chicha, deren absonderliche Technologie ihrer Beliebtheit keinen Abbruch tut. Den ganzen Tag lang, während aller ihrer Beschäftigungen, kauen die bolivianischen Frauen frische Maiskörner und spucken sie von Zeit zu Zeit in einen Bottich. Kraft des Speichels löst sich der Zuckergehalt und geht in Gärung über, und am Abend können sich die Ehemänner das hinter die Binde gießen, was die Ehefrauen im Laufe des Tages fürsorglich zubereitet haben. So viel und noch mehr lässt sich aus dem Mais machen, so mannigfaltig lässt er sich genießen.
Der toltekischen Religion zufolge war Mais der Stoff, aus dem der Mensch besteht. Aus der Höhle Cincalli, dem Haus des Mais, wurden die ungeborenen Kinder auf die Mutterleiber verteilt und konnten bloß durch Genuss von Mais leben und wachsen. Aber nur Zufall oder eine Gnade der Götter war es, wenn die Indios in ihrer Nomadenzeit einer Staude von wildem Mais begegneten. Meist mussten sie hungern, und auf ihre bange Frage: Wo liegt die Höhle Cincalli? gab es nur die Antwort: Das wissen die Götter.
Jedoch nicht einmal die Götter wussten das, und gerade die hätten es besonders gern gewusst. Denn auf Erden wurde der Mais »Gras der Götter« genannt, und wenn die Menschen erfahren würden, dass die Allwissenden nicht wissen, wo ihr eigenes Gras wachse, so wäre es mit religiösem Respekt und Opferwilligkeit vorbei.
Deshalb betrauten die Götter einen der Ihren mit der Investigation. Dieser brachte verhältnismäßig rasch heraus, dass die scharlachrote Ameise im Haus des Mais verkehre, und zwar nur in der sogenannten Zwinkernden Nacht. Die Adresse dieses Hauses konnte der Götterdetektiv lange nicht eruieren. Erst nach zweiundfünfzig Jahren der Beobachtung gelang es ihm, in der Zwinkernden Nacht die scharlachrote Ameise zu ertappen, als sie aus einem Bergspalt kam mit einem ganzen Maiskorn auf der Schulter. Genau so wie es die irdischen Detektive in solchen Fällen tun, verkleidete sich der göttliche, er verkleidete sich als scharlachrote Ameise und schlüpfte durch die Spalte in die Höhle Cincalli, die von unten bis oben gefüllt war mit goldenen Körnern. So brachten die Götter den Mais zu den Menschen und bewiesen, dass sie wussten, wo er zu holen sei.
Der Mensch wurde nun ein ganzer Mensch. Er brauchte nicht mehr umherzuirren, um sein Essen zu finden, er vergrub die Körner in die Erde und wartete, bis sie auferstanden und ihm eine Mahlzeit auftischten. Solcherart seßhaft geworden, baute er sein Dach, und aus Hütte und Hütte wurde die Gemeinschaft.
Allerdings, allzu üppig ließen die Götter den Menschen nicht werden, er sollte abhängig bleiben von den Göttern. Deshalb verknappten sie den Mais, es gab Missernten und Hunger. Die Menschen, nicht gewillt, Hungersnöte gottergeben hinzunehmen, wehrten sich. Sie legten in den fetten Jahren Kornkammern an für allfällige magere Jahre.
Nachdem die Spanier ins Land gedrungen waren, drangen sie auch in diese Speicher ein, und bekamen Erektionen von Habgier angesichts des bis zum Dachboden aufgeschichteten Goldes. Umso heftiger war die Enttäuschung, als sie erkannten, dass es nur Körner einer Ackerfrucht waren. Wohl sandten sie einige Proben davon nach Spanien, aber der Hof kannte das Korn bereits, denn Columbus hatte es mitgebracht, ohne Interesse dafür zu wecken. Einige spanische Granden, die es als ein kurioses Kraut in ihren Garten pflanzten, ernteten nur das Naserümpfen ihrer Damen.
Zwanzig Jahre nach der Cortezschen Sendung schenkten die Gründer der Stadt Valladolid in Yucatán ihrer Patenstadt in Spanien einen Sack mit Mais. Die Stadtväter des spanischen Valladolid wussten die Gabe besser einzuschätzen. Sie bauten den Mais an, verbreiteten ihn über ganz Europa und gründeten eine Produktenbörse, die jahrhundertelang dem Maishandel der Welt die Kurse diktierte.
In manchen Ländern nannte man den Mais »Kukuruz«, in manchen »Corn«. Zumeist aber hieß er »türkischer Weizen«, und zwar aus dem gleichen Grunde, aus dem man in England den Truthahn »Turkey« nennt. Jene Turkey, der wir beides verdanken, liegt in Mexiko. Europa vermochte damals nicht über den Kontinent hinauszudenken und identifizierte sich selbst mit dem Weltall. Ferne, exotische Landschaften konnten nicht anderswo gelegen sein als in dem Grenzwinkel Europas: der Türkei.
Auch nach der Vertreibung der Maisgötter und der Einsetzung von Kalenderheiligen kam es in Mexiko zu Maisverknappung und Teuerung, ja es kam zu Aufständen gegen die »Acaparadores del maíz«. Von einer Maisrevolte im Juni 1692 erfährt man, wenn man sich für einen Reporter jener Zeit interessiert, für Carlos de Sigüenza y Góngora, der sich und seine Zeitschrift »Mercurio Volante« nannte.
Günstlinge des Vizekönigs hatten zu Spekulationszwecken Mais gehamstert. Vergeblich stand die Bevölkerung Schlange vor den Molinos de Nixtamal und vor den Tortillerías. Es setzte Zusammenstöße mit der Stadtwache, und dabei wurde eine Frau von Hellebarden durchbohrt. Erbittert wälzte sich die Menge zum Schloss, steckte es in Brand, und Kollege Carlos de Sigüenza y Góngora, der rasende Merkur, lässt durchblicken, dass viele Tote und sonstiges Unheil zu beklagen waren.
Spekulierende Günstlinge des Vizekönigs gibt es nicht mehr, seit es das Amt des Vizekönigs nicht mehr gibt, aber der Mais hat nicht aufgehört, Objekt der Spekulation zu sein. Keine Regierung, die nicht versucht hätte, diesem Kardinalproblem der Innenpolitik beizukommen. Maximalpreise für Mais und Tortillas wurden festgesetzt, Anbaugesetze erlassen, Zoll- und Transporttarife reguliert; Vorschüsse auf Ernten gewährt und ein Notstandsspeicher für den Distrito Federal, das hauptstädtische Gebiet, eingerichtet, worin mindestens 12 000 und höchstens 25 000 Tonnen lagern für eine dreißigtägige Versorgung.
Außerdem wird nach Mexiko, das früher Mais exportierte, Mais eingeführt. Wegen der frachtgünstigen Nähe der nordamerikanischen Maishäfen am Golf von Mexiko (Corpus Christi, Houston-Galveston und New Orleans) verschwand schon vor Kriegsausbruch der gelbe, an Vitamin B reiche Plata-Mais Argentiniens fast ganz vom mexikanischen Markt. – Statt seiner wird Whitecorn 2, ein weißer, flachkörniger Mais aus den Vereinigten Staaten, gehandelt, und das Wort »Whitecorn Number Two« kehrt in Erlässen und Protokollen immer wieder, ohne dass die Tortillera oder gar der Tortilla-Esser eine Ahnung hat, was das bedeutet.
Umso besser weiß man in der Calle Mesones, was Whitecorn Number Two bedeutet. Calle Mesones ist die Straße der Pfeffersäcke, bildlich und konkret. Säcke mit Chilepfeffer kommen hierher, liegen hier und gehen von hier ab, und Säcke mit anderen Gewürzen, mit Nahrungs- und Futtermitteln, vor allem mit Mais. Hinter Schaltern und an Telefonen spekulieren die Pfeffersäcke in Menschengestalt.
Unbefahrbar ist tagsüber die Fahrbahn der Straße, weil Frachtautos und Personenautos sie verstopfen; über kein Auto, ja nicht einmal über Schuhwerk verfügen die vom Lande herangewanderten Lastträger, die hier löschen und laden.
Was in dieser Straße nicht direkt dem Großhandel mit Nahrungsmitteln dient, dient ihm indirekt. Geschäfte mit Säcken und Seilen aus Henequén, der Faser von Yucatán, Reparaturwerkstätten mit riesigen Reifen für riesige Lastautos, Tischlereien für Kisten und – eine Spezialität, die der sonst ähnliche Straßenzug an den Pariser Markthallen nicht kennt – Waffenhandlungen mit Revolvern für Einkäufer von Mais.
Die Calle Mesones ist eine Börse, aber ihre Mitglieder sind immerhin der Ware nah. Anders als auf dem Chicagoer Board of Trade. Dort hört man zwar die Pfeife der Börsianer, sieht jedoch keinen Maiskolben. Noch weniger sieht man, wie die Maiskolben nach dieser Pfeife tanzen. (Filmoperateur: Überblenden Sie von den Bewegungen der Chicagoer Kurstafel auf die von Hand zu Hand springenden Tortillas in der Tortillería!)
Zu viele Regisseure und Choreografen sind am Arrangement dieses Balletts beteiligt, und der, für den der Mais kein Divertissement, sondern Nahrung bedeutet, kommt um den Genuss. Aber die Börsenspekulation trägt nicht die Alleinschuld daran, dass der Vater Unser das Gebet um das tägliche Maisbrot nicht erhören kann. Zu den vielen Schwierigkeiten ist eine neue getreten.
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika kaufen die mexikanischen Arbeitskräfte auf. Sie bieten Tageslöhne bis zu acht Dollar und Verträge bis zu neun Monaten, also Verdienstmöglichkeiten, wie sie keinem Landarbeiter in Mexiko lächeln. Eine Massenübersiedlung über die Grenze hat eingesetzt, eine wahre Völkerwanderung. Ganze Distrikte Mexikos stehen entvölkert da, weil ihre Bewohner auf den Tomaten-, Spinat-, Broccoli- und Obstplantagen und bei Reparaturen von Eisenbahngleisen in Kalifornien und Texas beschäftigt sind.
Dem Bauern bleiben keine Arbeitskräfte. So geht er entweder als »Bracero«3 nach USA, oder er baut statt Mais, der ihm nur 325 Pesos per Tonne brächte, zum Beispiel Sesam an mit einem Ertragspreis von 1100 Pesos. Alle Nutzpflanzen stehen weit höher im Kurs als der Mais, ohne den das Volk verhungern müsste.
(engl.) Fünf Cent ist (mehr als) genug. <<<
Kichererbsen <<<
(span.) Tagelöhner. <<<
Ein Vulkan bricht aus
Ich sitze auf dem Trittbrett eines Autos, um zu skizzieren, was sich vor mir begibt. Mit grellem Hohn beleuchtet das Modell mein Papier. Für dieses Modell gibt es keinen Begriff. Es ist kein Lebewesen und lebt dennoch in unausgesetzter Bewegung. Es ist ein geologisches oder ein mineralogisches Ding, jedenfalls anorganisch, und dennoch tobt es und faucht es und grölt es und wirft Steine und Spott auf mein Papier.
Heute Nachmittag kam ich zu diesem Wesen, das sich vor zwei Wochen aus dem Bauch von Mutter Erde zu gebären begonnen hat und sich mit dem losgelösten Teil des Körpers hochreckte und immer höher, hundert Meter, zweihundert Meter. Das Neugeborene schrie zum Himmel, sein Nabel war entzündet, es spritzte Blut und Galle, es fauchte die Atmosphäre voll und schüttete eine Riesenmenge Unrat aus sich.
Dieser Unrat liegt um den entstehenden Berg wie ein Mühlstein oder wie die Krempe eines Sombreros. Das Material ist Schlacke. Ihre großen, scharfzackigen Stücke drücken sich aneinander, als wären sie gewebt und geplättet zu einem überdimensionalen Sombrero, als wären sie gemeißelt zum Mühlstein für Gottes Mühlen. Dick ist der Stoff der Krempe, dick der Mühlstein, zwölf Meter dick.
Ich trat an diese zwölf Meter hohe Lavawand, aber ich konnte sie nicht berühren, sie ergriff mich mit ihrer Glut. So ging ich denn die Glut ab, Kilometer im Kreise. Es klirrte im Gemäuer, rasselte wie Eisenketten, einer oder der andere der Mauersteine löste sich und fiel herab. Nur als Ganzes und nur allmählich erweitert sich der Kreis der Lava, wie ein Wellenring, zehn Meter per Tag rückt der Rand vor, immer senkrecht bleibend. Was im Wege steht, wird mitgenommen, hohe Bäume verschwinden ohne Spur.
Ich hatte mir Lava als etwas Dickflüssiges, Glasiges vorgestellt, einen Strom. Das hier jedoch war plumpes, zackiges, dunkelgraues Geröll. Nicht einmal entfernt verwandt ist es dem Obsidian, der wie ein düsterer Halbedelstein dem Durchwanderer mexikanischer Zonen oft entgegenfunkelt; aus der zu Obsidian erkalteten Lava erzeugten die Indios Waffen und Werkzeuge, Idolos1 und Schmuck – aus den Bestandteilen dieser Mauer ließe sich gar nichts machen. Sie sind Steine, aus dem ewigen Dunkel des Erdenschoßes dem ewigen Hell der Sonne zugeworfen. Steil fielen sie nieder, hart neben dem Krater, aus dem sie kamen. Aber schon nach einigen Sekunden, mit dem nächsten Ausbruch, langten neue Emigranten an, wollten der Heimat möglichst nahe bleiben und drängten die Erstankömmlinge zur Seite. Die rückten ab in konzentrischem Kreis, Schritt für Schritt, zehn Meter in vierundzwanzig Stunden.
Das Vorfeld des Vulkans und seines Lavakreises ist flaches Land, Maisfeld und Kuhweide, hier und da ein mit Nadelwald bestandener Hügel, dessen Fuß jetzt auf der dem Vulkan zugekehrten Seite zwölf Meter hoch mit Lavablöcken bedeckt ist.
Auf der anderen Seite eines solchen Hügels versuchte ich emporzuklettern. Die Steigung war nicht groß, aber staubige Asche bedeckte den Hang, sodass ich bis zu den Knien einsank. Leicht buddelte ich mich wieder heraus und kroch bäuchlings weiter, wobei mir Äste halbverschütteter Bäume hilfsbereit die Hand reichten.
Von der Höhe konnte ich das Lavafeld übersehen. Block neben Block, grau und rauchend, bewegte sich mit unheimlicher Langsamkeit, ein Ozean aus geschmolzenem Basalt, eine Sahara aus halberstarrten Schlacken. Nichts, nichts, nichts Menschliches, keine Verbindung zu irgendeinem Lebewesen. Jene anderen Wüsten, jene anderen Meere, die bislang diesem Geröll Heimat waren, niemals wurden sie von einer Karawane durchquert oder von einem Schiff befahren, von jener Welt unter der Erdkruste berichten nur Theorien und Hypothesen.
Hier auf meines Hügels Zinnen stand ich in der Höhe des Kraters, dem Krater gegenüber. Er erglänzte in überirdischer (oder soll ich sagen: unterirdischer?) Beleuchtung. Viel ging darin vor, jedoch es war, als blickte ich statt in den mich blendenden Schein in eine schwarze Nacht, so wenig konnte ich erkennen. Selbst wenn ich nur aussage, dass der Krater als Mulde oben auf dem Berg eingebettet liegt, ist diese Aussage falsch. Die Öffnung der Erde ist tiefer unten, auf dem verschütteten Maisfeld eines Mannes aus der nahen Ortschaft Paricutín.
Dieser Mann, der Indio Dionisio Pulido, kam vor vierzehn Tagen, am Nachmittag des 20. Februar 1943, hierher und sah plötzlich, wie seine Ackerfläche auseinanderklaffte, sich hochhob, zu qualmen und zu donnern begann, und er nahm die Beine in die Hände.
Von Dionisios Maisfeld blieb nichts übrig, nie wieder in aller Ewigkeit wird es ein Maisfeld sein. Denn der Krater hat es vollgespien und speit weiter, sodass ein Berg entstand, der ununterbrochen wächst, und auf dessen Plateau nun der Krater eingebettet scheint gleich einer Mulde.
Aus dieser Mulde schießt alle vier oder sechs Sekunden die Rauch- und Feuersäule ins Firmament. Neunmal nacheinander sind die Explosionen verhältnismäßig schwach, dann kommen vier von mittlerem Grad, dann zwei starke und schließlich die stärkste, eine unheimliche, fulminante Eruption. Diese Reihenfolge wird eingehalten, wenn auch nicht die Intervalle. Manchmal platzt eine starke Detonation rücksichtslos in eine schwache hinein.
Schon heute Morgen und aus einer Ferne von Meilen hatte ich, als ich durch den Staat Michoacán hierherfuhr, die Rauch- und Feuersäule gesehen. Da war sie freilich nur eine Rauchsäule schlechthin gewesen. Auch am Nachmittag, als ich bei ihr ankam, schien sie aus Qualm und Dampf zu bestehen, ein enormer Blumenkohl aus Rauch, in dessen Mitte ein rötlicher Strunk schimmerte. Mit Anbruch der Dunkelheit wurde es anders.
Mit Anbruch der Dunkelheit wurde alles hell. Vor allem die Rauchsäule. Die ist jetzt zur Feuersäule geworden. Rot springt sie auf, rot ragt sie hoch, rot verschwindet sie. Die Flamme, die nachmittags kaum eine Unterströmung des wallenden Rauches war, dominiert absolut, und der graue Dampf darf nur mehr wie ein Schatten in ihrem Innern umherhuschen.
In heißen Farben vollzieht sich ihr Aufsprung, aufregend und in wechselvollen Formen. Einmal ist es ein Ross, das aus dem Berg heraussprengt, sich aufbäumt, schnaubt und zusammenbricht. Einmal erscheint eine allegorische Statue mit einer Fackel in der erhobenen Hand – Symbol, das im kosmischen Nu zu einem spurlosen Nichts vergeht. Einmal wächst aus dem Zauberberg eine Palme auf mit breitem goldenem Stamm, goldenem Astwerk und goldenen Früchten; ach, der Stamm zersplittert, die Zweige zerbrechen, und die Kokosnüsse fallen zu Boden, bevor ich mich dessen versehe. Einmal scheint die Feuersäule eine wirkliche Säule zu sein, eine barocke Säule mit üppigen Ausbuchtungen und Windungen, die wie Brüste, Hüften und Becken sind, lockend reckt sie sich bis zum Himmel, um zu bersten, wenn sie ihr Ziel erreicht. Einmal ist sie ein Feuerwerk mit steil aufzischenden Raketen und platzenden Sprühregenkörperchen, ein Feuerwerk, wie es der erste Schlossherr von Versailles nicht erträumte.
Ununterbrochen keucht es aus dem Krater stoßartig wie eine Lokomotive, ununterbrochen schießt eine Batterie, auch während die Eruption hochgeht, absackt und erlischt. Wenn eine Seeschlacht tobt, wenn Chemikalien explodieren, wenn eine bombardierte Stadt zum Flammenmeer wird, wenn Hochöfen lodern – ich weiß den Grund. Aber hier? Weshalb faucht es und donnert es, warum werden Fels und Brand und Asche zuerst himmelan und dann erdwärts geschleudert, wer und was schafft da in diesem Schlund, wie lange wird das dauern, noch einen Tag oder ein Jahrtausend?
Wäre es für die gärende Unterwelt nicht bequemer gewesen, durch die unergründlich tiefen Schluchten der Gegend, die »Barrancas«, oder durch die Kanäle und Trichter der schon vorhandenen Vulkane aufzustoßen als durch dieses Tal? Warum ward gerade das stille Paricutín auserkoren, und darin der Acker des Indios Dionisio Pulido?
Am Nachmittag sah ich Steine aus dem Krater fliegen, die sich unterwegs aus der Rauchsäule lösten und in alle Himmelsrichtungen absprangen. Vom Abenddämmer an aber sind es Feuerblöcke. Sie fahren dem Sternbild des Orion zu, und einen Augenblick lang scheinen sie ihm anzugehören. Ist dieser Augenblick vergangen, dann blitzen sie sternschnuppenartig auf den Berg hernieder, den vor ihnen andere Feuerblöcke geschaffen haben. Viele der Sternsteine fallen in den Krater zurück, andere auf den Gipfel des Bergkegels und kullern und purzeln von dort herab. Als wäre die Basis des Bergkegels in 360 Grad eingeteilt, rollt zu jedem Grad von der Spitze eine goldene Strähne, dreihundertsechzig Lawinen aus flüssigem Gold. Der Berg wird durchsichtig.
Ich höre die Kanonade nicht mehr, ich spüre den Brandgeruch nicht mehr, ich fühle die Hitze nicht mehr. Ich schaue nur und bin in Visionen verstrickt.
Tagsüber war der Lavarand eine Mauer aus dunkelgrauen, blaugrauen Basaltschlacken. Nachtsüber aber stehen die Blöcke in Brand. Ich könnte beeiden, dass ich die Grande Corniche2 vor mir habe: Hellbeleuchtet schiebt sich das Casino de la Jetée3 ins Meer, es brennen in waagrechter, regelmäßiger Kette die Straßenlampen der Promenade des Anglais, dann schwingt sich die Lichterkette hügelan und hügelab und mündet in der illuminierten Kuppel der Spielerkathedrale von Monte Carlo. Dazwischen, von Lichtreklamen überwölbt, Bars, Pavillons und Geschäfte mit Juwelen und allen erdenklichen Arten von Glanz. Der Glanz beleuchtet das Papier, auf dem ich schreibe.
Vor vierzehn Tagen gab es auf dem Podium dieser Gaukelspiele noch wirkliches Leben. Das ist weg für immerdar, weg ist das Gras mit Käfer und Wurm, weg das Maisfeld mit Feldmaus und Maulwurf, weg der Baum mit Vogel und Schmetterling, weg die Weide mit Kuh und Esel. Im Umkreis aber, hart am Rand des Ausbruchs, setzt sich das Leben fort.
Vögel schwirren umher, für die es doch eine Kleinigkeit wäre, sich in eine kühle, von Gedröhn und Geblitz nicht gestörte Sphäre zu erheben. Ganz tief fliegen diese farbenreichen Vögel, nahe dem aschenbedeckten Erdboden, an meinen Knien vorbei, wahrscheinlich suchen sie ihr Nest und ihre Familie und finden sich nicht zurecht in der total veränderten Gegend.
Schütter steht der Wald da. Den Bäumen ist in Mannshöhe ein Stück Rinde ausgeschnitten, das nackte Holz schaut heraus, und wenn vom Vulkan her Reflexe auf dieses gelbe Gesicht fallen, schneidet es Grimassen. Unheimlich ist es, den zuckenden Fratzen ausgesetzt zu sein, obwohl man weiß, dass sie nur Schnitte im Baumstamm sind, aus denen das Harz in ein darunter angebrachtes Gefäß fließt.
Ich kenne die Psychologie von Vulkanen nicht. Ist der eben erstandene enttäuscht, weil er ein Objekt der Neugierde, des Geldverdienens und der Sensation geworden ist? Seit Vulkangedenken ist es noch keinem ergangen wie ihm. Man hängt ihm ein Mikrophon vor die Nase, und er muss hineinkeuchen, hineinhusten oder hineindonnern für die Rundfunkhörer der Kontinente. Man stellt ihm einen fotografischen Apparat vor die Nase, und jeden Anblick, den er profil oder en face4 bietet, bietet er den Abonnenten der illustrierten Weltpresse dar. Man streckt ihm eine Filmkamera vor die Nase, und wie er sich räuspert und wie er spuckt, wie er sich bewegt, er räuspert und spuckt und bewegt sich für das gesamte Kinopublikum oberhalb der von ihm mutwillig durchbrochenen Erdrinde.
Außerdem sitzt ihm die Wissenschaft auf der Pelle, beäugt ihn, behorcht ihn, fühlt ihm den Puls und misst ihm die Temperatur. Wie oft er vomiert, wie oft er Stuhlgang hat, kaum getan, ist es schon in Skalen und Tabellen eingetragen – wie ungestört hatte sich das alles im Schoß der Erde vollzogen!
Auf dem Hügel, den ich, bis zu den Knien einsinkend, erklomm, haben die Gelehrten ihre Zelte aufgeschlagen. Zwei der Studenten kenne ich, »vom Harz bis Hellas nichts als Vettern«, wie Vetter Mephistopheles konstatiert.
Sie erzählen mir von dem vulkanischen Baby. Sogar die Tiefe, der es entstammt, sei festgestellt, festgestellt ohne Lot: zweiunddreißig Kilometer. Das wisse man, weil alles emporkommende Material dem Pliozän angehört, der jüngsten in jener Tiefe gelegenen Tertiärschicht. Das Klima dort unten sei mit 1100 Grad Hitze errechnet, denn bei dieser Temperatur schmelze der Basalt zu jenen Schlacken, die vor uns liegen. Die Lavatrümmer am Bergesfuß bedecken zwei Quadratkilometer Boden und bewegen sich pro Tag zehn Meter zur Seite und neunzig Zentimeter in die Höhe. In den Blöcken seien vier bis fünf Prozent Eisen enthalten.
Was den Bergkegelstumpf anbelangt, so entwickle er sich seit seiner Geburtsstunde geradezu prächtig. Seit gestern wuchs er um viereinhalb Meter, jetzt messe er schon zweihundertzwanzig Meter. Seine Basis sei ein fast geometrisch genauer Kreis von fünfhundert Metern Durchmesser, und der Durchmesser des Gipfelplateaus betrage einhundertfünfzig Meter. Die Hänge neigen sich im Winkel von fünfunddreißig Grad.
»Und die Fahne, Kameraden?«
»Die Fumarole? Sie ist nicht immer gleich hoch, aber durchschnittlich tausend Meter. Bis höchstens sechshundert Meter reißt sie Eruptionsgestein mit sich und Asche. Der größte der Blöcke hatte vier Kubikmeter.«
Dann erzählen sie mir noch, dass es sich um einen wirklichen Vulkan handelt, woran ich eigentlich nie gezweifelt hatte. Ich möge nicht etwa glauben, es sei eine bloße Extorsion, eine Aufbäumung des Bodens, wie sie oft von tektonischen Beben verursacht wird und in vulkanischen Gegenden auch Feuer und Rauch und Stein hochschlagen kann. Das sei der erste Vulkan, der seit dem Jorullo in Mexiko geboren wurde …
Der Jorullo liegt kaum zwei Autostunden von seinem neuen Brüderchen entfernt. Am 28. September 1759 wurde der Jorullo geboren, und einer der Gründe von Humboldts Mexikoreise war die Sehnsucht gewesen, diesen jüngsten aller Berge von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Er sah ihn, als der Vulkan vierundvierzig Jahre alt war. In der Zwischenzeit war der Jorullo nicht müßig gewesen, die Lava war noch so heiß, dass Humboldt seine Zigarre an einem der vulkanischen Erdkegelchen, den Hornitos, anzünden konnte. In der Gegend lebten noch Augenzeugen, die ihm Material für seine Beschreibung der Vulkangeburt lieferten. Gern wäre er selbst dabeigewesen, wie Plinius beim Ausbruch des Vesuvs, beim Untergang von Pompeji.
Heute hier zu stehen, böte Humboldt die Genugtuung, seine Theorie vom Vorhandensein einer Vulkanreihe bestätigt zu finden. Dieser Theorie zufolge klafft »sehr tief im Innern der Erde, zwischen 18 Grad 59’ und 19 Grad 12’ nördlicher Breite, ein Riss, der sich neunhundert Kilometer lang vom Osten nach Westen hinzieht, und durch welchen sich das vulkanische Feuer zu verschiedenen Zeiten von der Küste des mexikanischen Golfs bis an die Südsee Luft gemacht hat«. Ganz nahe von Humboldts Grenzlinie, nämlich 19 Grad 21’ nördlicher Breite (und 102 Grad 19’ westlicher Länge), ersteht zur Stunde der Vulkan von Paricutín.
Als solcher, als der »Vulkan von Paricutín« wird die Neuschöpfung in die Geografie und in die Vulkanologie eingehen, denn Paricutín heißt das Dorf, das er sich als Geburtsstätte und ständigen Aufenthalt ausgesucht hat. Einhundertfünfundachtzig Bewohner zählt es, durchwegs Indios aus dem Stamm der Tarascos. Einer von ihnen ist jener Dionisio Pulido, der sein altes, geduldiges Feld so unvermutet sich aufbäumen sah und dennoch überzeugt ist, dass es gefallen ist, gefallen auf den Nullpunkt des Werts.
»Zwei Fanegas Mais sind verloren«, klagt er und erzählt mir, wie sich der Anfang vom Ende vor seinen Augen vollzog. Er selbst vermochte sich zu retten, und seine beiden Maulesel rannten hinter ihm her, aber was er mit Mühe angebaut hatte und eben ernten wollte, die beiden Fanegas, also hundertelf Liter Mais, liegen unwiderruflich im Bergesinnern.
»Seit jener Stunde habe ich keinen Bissen gegessen«, schwört er, und, so unwahrscheinlich das klingt, ich muss es ihm glauben. Schwört er doch beim Wundertätigen Bild von Parangaricútiro, und er weiß dieses Bild so nahe, dass es ihn hören und gleich da sein könnte, um ihn für die Lüge zu strafen. Aber wenn Dionisio Pulido auch zehnmal schwören würde, dass er seit jener vulkanischen Stunde nichts getrunken habe, so würde ich ihm nicht glauben; sein Atem riecht deutlich nach dem ortsüblichen Zuckerrohrschnaps.
»Zwei Fanegas Mais verloren, und mein Feld für immer vernichtet.«
»Dafür sind Sie Besitzer eines Vulkans.«
»Ach, Señor, wem nützt schon ein Vulkan?«
Ich könnte Dionisio antworten, dass ein Vulkan nicht ganz ohne Wert sei. Vor Jahrzehnten hat die mexikanische Republik einem General den Popocatépetl zum Geschenk gemacht, einen Vulkan als Orden! Nach dem Tode des Generals wurde der Popocatépetl mit dem Ausrufpreis von fünfundzwanzig Millionen Pesos zum öffentlichen Verkauf angeboten. Rockefeller beabsichtigte, ihn zur Ausbeutung der Schwefelwände zu kaufen, bekam ihn aber nicht.
Dionisio Pulido könnte seinen Vulkan an Rockefellers Erben losschlagen, falls die ihn haben wollten. Aber dass er auch dann kein Geld davon hätte, sondern höchstens ein paar Flaschen Zuckerrohrschnaps, ist anzunehmen. Er hat doch auch nichts davon, dass sein Feld ein Objekt der Fremdenindustrie zu werden anfängt.
In Uruapan, der nächsten großen Stadt, herrscht Konjunktur in Mietsautos. Jeder, der einen Lieferwagen hat, lässt alle Lieferungen liegen und vermietet sich an Touristen zur Fahrt an den Vulkan; der Fahrpreis steigt schneller als der Vulkan. Etwa sechsundzwanzig Kilometer ist die Entfernung von Uruapan nach Paricutín, der Weg führt durch den weglosen Terpentinwald, man fährt sechseinhalb Stunden und kommt zerrüttet an.
Auf dem Vorfeld des Vulkans erstanden Marktbuden aus Latten und Reisig, wo Coca Cola ausgeschenkt wird, Tacos verkauft werden und das Fruchtbrot Ate, eine Spezialität des Staates Michoacán. Verkäufer sind die Bewohner des Fleckens San Juan de Parangaricútiro. Nicht unvorbereitet kommen sie in den Handelsbetrieb. Parangaricútiro ist ein Wallfahrtsziel, alljährlich, am 19. September, pilgern Hunderte von Gläubigen zum Fest des Christo Milagro.5 Demgemäß sind alle Ortsbewohner gläubige Katholiken; in politischer Beziehung gehören sie den Sinarquistas an, den Faschisten, die vor allem in den rückständigen Gegenden eine kostspielige Agitation entfalten. Übrigens hindert das die Bevölkerung nicht, auch begeisterte Anhänger eines Demokraten zu sein, des vorigen Präsidenten Lázaro Cárdenas. Cárdenas hat ihnen Land gegeben, und die Faschisten versprechen ihnen noch mehr.
»Wir sind arm«, sagen sie, »wir leben von dem, was wir selbst anbauen. Bares Geld verdienen wir nur im September bei der Wallfahrt.« Sie sind fromm und halten den Vulkanausbruch für eine Strafe Gottes. Eine liederliche Frau habe mit verheirateten Männern des Ortes Sünden begangen. Als die Eruption begann, entflohen die Bewohner, und nur ein Schock Freiwilliger blieb zurück, um den Cristo Milagro zu bewachen. Nach drei Tagen kehrten die Flüchtlinge heim in ihre Häuser und errichteten hier oben ihre Stände. Die Frauen besorgen den Verkauf, die Männer begleiten die Touristen auf die Hügel rings um den Vulkan und bekommen dafür Führerlohn. Mit Stangen heben sie Lavasteine aus dem Wall, urinieren darauf, um die Glut auszulöschen, und verkaufen dann die solcherart abgekühlten Steine den Besuchern. Das Geschäft geht weit besser als das am Wallfahrtstag.
»Nicht schlecht, so eine Strafe Gottes«, sage ich.
Sie lachen verlegen, was offenkundig eine Zustimmung bedeutet, aber als solche nicht beweisbar ist.
(span.) Götzenbilder. <<<
(franz.) allgemeine Bezeichnung für eine Küsten-, Ufer- oder Klippenstraße <<<
(franz.) Spielkasino. <<<
in gerader Ansicht <<<
(span.) Wundertätiger Christus. <<<
Kolleg: Kulturgeschichte des Kaktus
Goethe – Cortez – Spitzweg Stifter – Napoleon – Humboldt Karl May – Hebbel – Henri Rousseau
I. Heraldik
Nicht deshalb, meine Herren, nicht deshalb, weil der Kaktus in Mexiko zu Hause ist, hat ihn Mexiko auf sein Wappenschild gehoben. Das Emblem war schon da, bevor die Azteken ihr Land gesehen. Vom Norden her, sozusagen aus den hyperboreischen1 Wäldern Amerikas, kamen sie gezogen, um die Heimat zu suchen, die Heimat, die ein Orakel ihnen verheißen hatte. Lange wanderten sie kämpfend kreuz und quer, bis sie im Jahre 1325 das ihnen gelobte Land fanden. Kein Zweifel konnte sich regen, das Ziel war genau so markiert, wie in der Prophezeiung angegeben, eine dreigliedrige Opuntie, von zwei entfalteten Blüten gekrönt, entspross dem von Wasser umspülten Felsen, und darauf horstete ein Königsadler mit einer Schlange in den Fängen.
Hier am See, auf Lagunen, Landzungen, Ufern und Inseln, ließen sich die Wandermüden nieder und nannten den Standplatz, wie sie ihn schon in den Träumen ihrer Wanderung genannt hatten: »Tenochtitlán«, Kaktus auf einem Stein. Heute heißt die Stadt »Mexiko«. Adler und Schlange sind aus der Bannmeile geschwunden, aber der Kaktus beherrscht nach wie vor das Landschaftsbild.
Mexiko trug den Kaktus auf Fahnen, auf Siegeln und auf Münzen, und manche indianische Familie ließ, um vor dem Vizekönig den Adelsanspruch zu begründen, ihren Stammbaum malen, aber nicht als Baum, sondern als Opuntie. Wenn Sie das Nationalmuseum besuchen, werden Sie im Saal der Kodizes sehen, dass die Glieder der Opuntie, von Natur aus wie Veduten oder Schilder geformt, sich weit logischer zur Aufnahme von Namen und Jahreszahlen eignen, als die auf europäischen Stammbäumen wachsenden Linden- oder Eichenblätter.
Boreisch (von Boréas, der Personifikation des winterlichen Nordwinds in der griechischen Mythologie) ist ein veralteter Begriff für nördlich. Hyperboreisch bedeutet demnach: über/jenseits/nördlich des Nordens/des Polarkreises, rund um den Nordpol. <<<
II. Bildende Kunst
Angesichts dieser Tatsachen berührt es fast komisch, dass die Maler der Neuen Sachlichkeit, einer Kunstrichtung von 1920, das Neue ihrer Sachlichkeit durch einen Kaktus ausdrückten, der in jedem ihrer Interieurs und Exterieurs vorkommt. Fast hundert Jahre vor der Neuen Sachlichkeit hielt Spitzweg, der altmodisch Verschrullte, den Kakteenliebhaber für das altmodisch Verschrullteste seiner Sujets. Deshalb wohl wagte der Kunsthistoriker Wilhelm Uhde die Hypothese, Spitzweg habe, eben von seiner Pariser Reise zurück, in seinen beiden Kaktusbildern Deutschland konterfeien wollen: draußen leuchtet die Sonne, grünt das Blattwerk und zwitschern die Vögel, während sich der alte Magistratsaktuarius dem staubigen Kaktus entgegenneigt, der sich seinerseits symmetrisch vor ihm verbeugt.
»Tu te rapelles, Rousseau, du paysage aztèque …?«1 ruft ein Gedicht von Guillaume Apollinaire seinem Malerfreunde zu. Dieser Satz Apollinaires wurde als Beweis dafür verwendet, dass des Zöllners Rousseau fantastische und erfundene Landschaften weder fantastisch noch erfunden seien, sondern Modellmalerei aus dem paysage aztèque. Wahr ist, dass Henri Rousseau als junger Militärmusiker mit der Interventionsarmee des Marschalls Bazaine nach Mexiko gekommen war, und dort mag er die Aztekenlandschaft mit ihren achthundertfünfzig Kakteensorten so gesehen haben, wie ein zukünftiger Maler sie sieht. Was der närrische Douanier jedoch später malte, hat damit nicht mehr zu tun, als etwa sein Fußballbild mit einem Fußballspiel. Die Pariser Botaniker, von den ratlosen Kunsthistorikern zu Hilfe gerufen, konnten nur feststellen, dass außer den Agaven keine der Rousseauschen Pflanzen in Mexiko wachsen.
(franz.) Erinnerst du dich an die aztekische Landschaft, Rousseau? <<<
III. Literatur
Für Adalbert Stifter ist »der Kaktus nicht das letzte gewesen, dem ich meine Aufmerksamkeit geschenkt habe«. Er findet zwar die Blüten »verwunderlich wie Märchen«, aber nicht bizarr, formensprengend oder gar ungestaltig. Im Gegenteil: Sein Gärtner Simon im Kaktushaus schließt das Loblied auf den Kaktus und seine Blüten mit dem polemischen Akkord:
»Es könne nur Unverstand oder Oberflächlichkeit oder Kurzsichtigkeit diese Pflanzengattung ungestaltig nennen, da doch nichts regelmäßiger und mannigfaltiger und dabei reizender sei als eben sie.«
In Mexiko bedürfen die Kakteen keines Stifterschen Gärtners, keines Spitzwegschen Aktuarius, keiner Gewächshäuser und keiner zierlichen Blumentöpfe. Allerorten im Land wächst der Kaktus und treibt Blüten, die oftmals verwelken, ohne ein menschliches Auge entzückt zu haben. Dass und in welchen Gestalten er das mittlere und südliche Amerika bewächst, hat schon Goethe verzeichnet. Seine Kenntnis stammt aus Humboldts »Ideen zu einer Physiognomik1 der Gewächse«, dessen Formulierungen Goethe nur stilistisch verändert:
»Dem neuen Kontinent ist eigentümlich die Kaktusform, bald kugelförmig, bald gegliedert, bald in hohen vieleckigen Säulen wie Orgelpfeifen aufrecht stehend. Diese Gruppen bilden den höchsten (bei Humboldt: »den auffallendsten«) Kontrast mit der Gestalt der Liliengewächse und der Bananenbäume.« (Bei Humboldt nur: »Bananen«.)
Nicht nur Goethe, sondern auch Karl May und sogar sein Pferd haben Humboldts »Ansichten der Natur« gelesen und darin die komplizierte Methode, mit der durstige Huftiere in den Wüstengegenden Amerikas sich »bedächtig und verschlagen« das wasserreiche Mark des Melokaktus zunutze machen:
»Mit dem Vorderfuß schlägt das Maultier die Stacheln der Melokakteen seitwärts und wagt es dann erst, den kühlen Distelsaft zu trinken. Aber das Schöpfen aus dieser Quelle ist nicht immer gefahrlos; oft sieht man Tiere, welche von Kaktusstacheln am Hufe gelähmt sind.«
Wen kann es wundernehmen, dass Karl Mays ungebärdiger Hengst den Trick besser beherrscht als alle bedächtigen und verschlagenen Maultiere, und ihn gleich am Anfang des Romans »Old Surehand« dem Leser vorführt?
»Hierauf sattelte ich ab und ließ den Hengst frei. Gras gab es hier freilich nicht; dafür aber standen zwischen den Riesenkakteen Melokakteen genug, die Futter und Saft in Fülle lieferten. Mein Rappe verstand es, diese Pflanzen zu entstacheln, ohne sich zu verletzen …«
Die »Kunst«, aus dem unveränderlichen physiologischen Äußeren des Körpers, besonders des Gesichts, auf die seelischen Eigenschaften eines Menschen – also insbesondere dessen Charakterzüge und/oder Temperament – zu schließen. <<<
IV. Geschichte
Die Pflanze, die Sie hier sehen, meine Herren, eine Opuntia cochinellifera, habe ich an der Schlangenpyramide am Nordwestrand von Mexiko-Stadt ausgegraben. Ein Indioknabe, der dort Idolos anbot, griff diesem Kaktus in die Achselhöhle und streckte mir etwas Winziges, Rötliches, wie mit Mehl Bestäubtes entgegen und sagte: »Cochenilla.« Als er es über der Pflanze zerquetschte, floss Blut, so viel, dass dieses eine Opuntienglied aussieht wie rohes Fleisch. Von dem Tierchen, dem das Rot entstammt, blieb nichts übrig.
Um der Cochenille willen hat man einst das Gewächs gepflegt, das ihre Wohnung war. In der Aztekenzeit musste alles Blut dieser Läuse gesammelt und an die kaiserliche Hausverwaltung abgeliefert werden; Stammesfürsten und Kriegshelden wurden mit Töpfen dieses Karmins belohnt. Jedoch die edelste Sorte, jene, die von jungfräulichen oder wenigstens ungeschwängerten Lausweibchen stammte, durfte keines anderen Mantel färben als den des Herrschers selbst und die kurze Jacke des höchsten Hohenpriesters. Wie im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation trugen im damals noch unentdeckten Mexiko der Kaiser und der Henker ein Gewand vom gleichen Rot. In der Tat, in Mexiko war der höchste Priester zugleich der höchste Henker und thronte auf dem Schafott, wie in Heines »Vitzliputzli« zu lesen:
Auf des Altars Marmorstufen Hockt ein hundertjährig Männlein Ohne Haar an Kinn und Schädel, Trägt ein scharlach Kamisölchen. Dieser ist der Hohepriester Und er wetzet seine Messer …
Vergeblich war das Messerwetzen, vergeblich die Menschenopfer. Der weiße Feind marschierte heran, um dem Kaiser den Purpurmantel vom Leib zu reißen und dem Henkerpriester das scharlach Kamisölchen. Und die Götter verhinderten es nicht.
Aber ein schlichter Kaktus, ein Nopal1 aus der Gegend von Cholula, hätte es beinahe verhindert. In Cholula hatte Cortez die Bewohnerschaft massakrieren lassen, sechstausend Tote binnen drei Stunden – ein Gemetzel, wie es bis dahin die Neue Welt niemals erlitten. Nach vollbrachter Tat wandten sich die Spanier der Hauptstadt zu, voran das Reiterfähnlein. Es war ein sengender Tag, gierig schlürften die Kavalleristen die rötlichen Früchte des Nopals von Cholula.
Unterwegs wird Halt befohlen: »Absitzen! Austreten!« Aber, Herr des Himmels, was ist das? Es ist Blut, das die Reiter urinieren! Tiefrotes Blut! Kein Zweifel, ihre Venen sind gerissen – Gottes Strafgericht für die am Indiovolk begangenen Gräuel und Scheuel.2 Alle sind blass und zittern vor Todesangst. Sie rotten sich zusammen, knien gemeinsam nieder, beten zu San Jago de Compostella, leisten ein Gelübde, weigern sich, weiter Dienst zu tun.
Da kommt zu Fuß der indianische Hilfstrupp heran und lässt gleichfalls, jedoch ohne sich darüber zu beunruhigen, rotes Wasser. Nun erfahren die reuigen Sünder, solches sei die Wirkung der Tuna von Cholula, der Frucht, die sie gegessen. Keine Strafe Gottes also! Kein Grund zur Reue! Erlöst von Skrupeln, setzen die Gottesstreiter ihre grausen Kriegstaten fort.
Feigenkaktus <<<
Ekel <<<
V. Manufakturwesen
Und nehmen das Land mit allem, was da kreucht und fleucht. Unter dem, was da kreucht, kreucht die Cochenille bald zu hoher Bedeutung hinan. Cortez hatte sie übers Meer nach der heimatlichen Halbinsel geschickt, »nur um der Wissenschaft willen«, wie er zur Entschuldigung betonte. Aber während man in Spanien die Körner von Mais und Kakao, die Tomate und die Vanille und die Stücke edelster Jade als wertlos abgetan hatte, erfasste man sogleich den potentiellen Wert dieses Farbstoffs für die Wollweberei von Barcelona und die Seidenweberei von Valencia.
Eilends pflanzte man die vermeintlichen Samen in den Boden und wunderte sich, dass ihnen kein Gewächs entspross. Nun heischte man aus Neu-Spanien Sprößlinge. Fruchtknollen oder Wurzeln, und solche der Opuntia cochinellifera trafen ein. Aus denen wuchsen in den heißeren Territorien der spanischen Krone, in Algier und auf den Kanarischen Inseln, die Kakteen, und auf den Blättern fanden sich die winzigen Tuben, prall gefüllt mit dem ersehnten Farbstoff.
Große Plantagen wurden angelegt, sie brachten reichen Nutzen, aber immer noch begriff man nicht, dass die Pflanzensamen keineswegs Pflanzensamen seien. Als 1703 Mijnheer Ruysch unter dem gerade erfundenen Mikroskop Leeuwenhoeks die Cochenille leben und sich bewegen sah, geschah allgemeines Schütteln des Kopfes. Eine Laus? Wie kann eine Laus so edlen Farbstoff liefern?
Als ich zu Hause meine heutige Vorlesung vorbereitete, ließ mir ein in Schweinsleder gebundener Riesenfoliant kaum ein Eckchen meines Tisches zum Schreiben frei. Auf irdische Maße reduziert, lautet der Titel des Buchs »Museum Museorum oder Schaubühne aller Materialien und Specereyen … Unter Augen geleget von Doctor Michael B. Valentini, Franckfurt am Mayn, im Jahre Christi MDCCXIV.« (Dieses deutsche Werk, das neben vielem anderen eine komplette Technologie der Manufakturzeit darstellt, habe ich in Europa jahrelang gesucht und fand es – o Witze, die die Emigration mit uns macht – in Mexiko.) Noch 1714 ließ sich der Verfasser des gelehrten Wälzers nicht ganz durch das Mikroskop überzeugen:
»Ob nun die Kutzenellen vor einen Saamen oder sonsten etwas zu halten seyen? davon sind biss auff den heutigen Tag noch verschiedene Meynungen. Einige halten es vor einen Saamen, daher es auch die meisten Apothecker unter die anderen Saamen stecken und in ihren Catalogis als ein Sem. Coccinillae setzen; – teils weilen Coccionella von Cocco herkäme und bey den Spaniern ein kleines Korn heiße, teils weilen Wilhelmus Piso in seiner ›Historie der Brasilianischen Gewächsen‹ eine Art indianischer Feigen weitläuffig beschreibet, an welchen die Coccionellen wachsen sollen …«
Valentini zählt die vielen Verwendungsmöglichkeiten dieser fragwürdigen Miniaturkörper auf, besonders die Tatsache, dass Italien den neuspanischen Kutzenellen die Rotfärbung des Glases verdankt.
VI. Revolutionsgeschichte
Zweieinhalb Jahrhunderte wahrte Spanien sein Cochenille-Monopol und überwachte jedes Schiff, das von den mexikanischen Küsten auslief. Auf den bloßen Versuch, die rötenden Läuse auszuführen, stand Todesstrafe. Ein Franzose, Thierry de Menonville, wollte es dennoch wagen, um seinem eben zur Republik gewordenen Vaterland das kostbare Färbemittel zu verschaffen. Im Staate Oaxaca (er schreibt »Juaxaca«) grub er nächtlicherweile etliche der besten Zuchtpflanzen aus und verschaffte sich einige Paare der Läuse. Diese Beute brachte er glücklich nach Santo Domingo, wo sie gedieh und sich vermehrte, sodass er bald ein Fass Cochenille nach Paris senden konnte.
Und nun erlebte er den Höhepunkt seines Lebens. Die Gabe wurde dazu verwendet, der Fahne der französischen Republik, der Trikolore, die dem Nationalkonvent 1793 überreicht wurde, das Rot der Freiheit zu geben. Seine Tierchen waren es, die das neue Banner salbten!
Aber ach, auch der Vernichter der Republik schmückte sich mit dem Blut der Cochenille: Es musste dazu dienen, den roten Frack des Ersten Konsuls zu färben. Später verknüpfte sich, wenngleich nur anekdotisch, ein mexikanischer Kaktus noch einmal mit dem Namen Napoleons.
Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts verpflanzte ein britischer Kapitän, Sidney Longwood, die großen Kandelaberkakteen aus Mexiko auf die damals geschichtslose Insel Sankt Helena. Ihn hinderte kein spanisches Gesetz an diesem Export, denn Zierpflanzen waren für Industrie und Handel wertlos. Auf Sankt Helena schossen sie hoch, verzweigten sich von den lotrechten Säulen des Stammes in vielarmige Leuchter, ganz so, wie sie sich daheim in Mexiko verzweigt hätten, nur mit dem Unterschied, dass sie auf Sankt Helena nicht blühten. Erst an dem Maienabend, an dem Napoleon starb, entzündeten sich Hunderte von Trauerleuchtern, und ihre Flammen waren gelbgrüne Blüten mit roten Spitzen. Es war, als hätten Beleuchter, hinter den Felsen versteckt, auf diese Stunde gewartet. Angesichts der unvermutet brennenden Ampeln flüsterten die vorbeifahrenden Schiffe: »Er ist tot.«
VII. Industrie
Die Manufakturzeit endete, die industrielle Revolution brach aus, das Maschinenzeitalter und die Massenproduktion setzten ein und mit ihr stieg der Preis der mexikanischen Cochenille. Und gleichzeitig stiegen Ausbeutung, Spekulation und Konkurrenzkampf. Alexander von Humboldt berichtet darüber:
»Auf der Halbinsel Yucatán wurden allein in einer Nacht alle Nopale, auf denen die Cochenillen leben, abgeschnitten. Die Indianer behaupten, dass die Regierung diese gewaltsame Maßregel darum ergriffen habe, um den Preis einer Ware hinaufzutreiben, deren Eigentum man den Bewohnern der Mixteca ausschließlich zuwenden wollte; die Weißen hingegen versichern, dass die Eingeborenen aus Unzufriedenheit mit dem Preis, den die Kaufleute für die Cochenille festsetzten, einmütig das Insekt und die Opuntien zerstört haben.«
Mit solchen Mitteln der Produktionsbeschränkung begann das neunzehnte Jahrhundert. Ehe es zu Ende ging, waren diese Mittel, wenigstens soweit sie die Cochenille betrafen, nicht mehr nötig. Denn das Alizarin – aber das ist eine eigene Geschichte, und diese eigene Geschichte erzählte mir eine Dame, die einen urspanischen Taufnamen sowie einen urspanischen Familiennamen trägt und dahinter einen urdeutschen Vatersnamen. Dadurch geriet das Gespräch auf ihren Großvater.
Der kam als junger Mann mit Maximilian von Habsburg nach Mexiko und schickte seinem daheim gebliebenen Freund, dem Berliner Fabrikchemiker Karl Liebermann, eine kleine Schachtel mit Cochenille-Läusen, damit er sie analysiere. Er konnte sie per Post als Muster ohne Wert senden, zehn Centavos Porto, die Zeiten, da Thierry de Menonville beim Schmuggel Kopf und Hals riskiert hatte, waren längst vorüber. Drüben verfasste Liebermann eine Abhandlung über die Cochenille und schickte sie dem Freund in Mexiko mit einer Widmung, dem Dank für das Paketchen, das den Anlass zu der Arbeit gegeben. Bald darauf vernahm man, ein Karl Liebermann in Berlin habe die künstliche Cochenille erfunden, die synthetische Herstellung des Alizarins.
Bei diesem Punkt äußerte ich zu der Erzählerin, ihr Großvater müsse wohl sehr stolz darauf gewesen sein, eine solche Erfindung angeregt zu haben.
Stolz? Sein Leben lang wurde er die Angst nicht los, jemand könnte erfahren, dass durch seine Schuld Mexiko eine Wirtschaftskatastrophe von unvorstellbarem Ausmaß erlitt.
Der bedeutendste Ausfuhrartikel war plötzlich außer Kurs gesetzt. Während Deutschland mit dem Alizarin Millionen und aber Millionen erntete und die unbeschränkte Herrschaft auf dem Farbenweltmarkt errang, verfielen in Mexiko die Nopalerias; die Cochenille-Flotte, die den Transport nach Europa besorgt hatte, wurde abgewrackt; angesehene Exporthäuser bankrottierten. Wie hätte ein Mexikaner – und das war der Großvater der Erzählerin inzwischen geworden – wie hätte ein Mexikaner nicht entsetzt sein sollen, dieses nationale Unglück herbeigeführt oder zumindest beschleunigt zu haben! Noch seine Enkelin bat mich, seinen Namen nicht zu nennen.
Einen von den Erben jenes Krachs, einen Nachkommen des größten Exporthauses für Cochenille, habe ich in der Stadt Oaxaca als Beamten des Fremdenverkehrsbüros getroffen. Im Verlauf unserer Bekanntschaft erzählte mir Señor Corres von seinem Vater, der in England studierte, dort seine eigenen Pferde ritt und als Sohn des Cochenille-Königs von Mexiko Ansehen genoss. Bis er eines Tages nach Hause fahren musste – im Zwischendeck.
Señor Corres, durch Herkunft und Amt dazu berufen, informiert zu sein, konnte meine Frage, ob sich irgendwo der Rest einer Cochenille-Plantage finden ließe, nicht beantworten. Dadurch nicht abgeschreckt, suchte ich das Dorf Cuilapan de Díaz auf, das einst ein Zentrum der Cochenille-Zucht war und heute ein Weberort ist, dessen Sarapes1 man nachsagt, sie seien noch immer mit Cochenille gefärbt. Aber ich fand in den Werkstätten nur die Originaltiegel einer nordamerikanischen Farbenfabrik.
(span.) Mexikanischer Kittel. <<<
VIII. Pharmakologie
Für immer ist die Cochenille aus dem Exportgeschäft ausgeschieden, selbst als Heilmittel gegen Fleckfieber und Beulenpest kam sie aus der Mode.
Auf dem internationalen Medikamentenmarkt wird nur noch der Peyote-Kaktus gehandelt, die »Mezcal Buttons«, der Zauberkaktus, über den ich Ihnen ein eigenes Kolleg lesen will. Eine überirdische Funktion wird auch manchen anderen Kakteen zugeschrieben, auf welche Sie bei unserer Exkursion in den Botanischen Garten von Chapultepec der Floricultur Sánchez de la Vega aufmerksam machte.
Die »Cardon«, das heißt Distel, genannte Opuntie hängt man in den Dörfern über Tür und Fenster auf, um zu verhindern, dass die Dämonen eindringen und den Kindern das Blut aussaugen. In den Handtaschen städtischer Jungfrauen finden Sie oft die leichtgewölbte Spitze des Kaktus Lemaire cereus – ein unfehlbares Amulett gegen das Kinderkriegen. Das Totem des Jagdgottes Mixcoatl war ein topfförmiger, riesiger Igelkaktus, auf den, wie die Kodizes zeigen, die Menschenopfer gelegt wurden, damit sich ihr verströmendes Blut in die Gottheit ergieße; heute legt man in den Küstengegenden diesen Kaktus auf Wunden, die, so klaffend sie auch sein mögen, im Nu vernarben.
Auch in Europa glaubte man an die Heilwirkung der Kakteen. Zum Beweis sei eine Stelle aus Friedrich Hebbel hier angeführt, obwohl ich sie vielleicht hätte dort erwähnen sollen, wo ich von den literaturgeschichtlichen Beziehungen des Kaktus sprach. In seinen Tagebüchern erzählt Hebbel:
»In Hamburg auf dem Stadtdeich kommt eines Morgens zu meinen Wirtsleuten, den alten Zieses, ein Bauernweib mit Gemüse. Sie erblickt auf dem Fenstersims eine Pflanze, eine Art Kaktus, setzt ihren Korb beiseite und kniet nieder. Dann sagt sie: ›Das tu’ ich jedes Mal, sobald ich diesen Baum sehe, denn ihm verdank’ ich’s, dass ich wieder gehen und stehen kann; ich war gichtbrüchig wie Lazarus, da riet man mir, den Saft seiner Blätter auszupressen und zu trinken, und davon wurde ich wieder gesund.‹«
IX. Ethnografie
Längst leben die Kakteen in der Diaspora, fast alle auf allen Kontinenten, jedoch keineswegs allüberall zu der Menschen Freude. In Australien zum Beispiel, wo man die Wälder verbrennt, um den Schafen Weideland zu schaffen, hat sich ein Kaktus eingenistet, der auf deutsch »Feigendistel« und auf englisch »prickly pear« heißt, obzwar er weder mit einer Feige noch mit einer Birne nennenswerte Ähnlichkeit hat. Kaum einen Schafzüchter habe ich dort gesprochen, der diese Pflanze nicht mit australischen Flüchen bedacht hätte, weil sie dem Boden das Gras entzieht und mit ihren Dornen die Herden verletzt. »Aber, nur Geduld! Schon haben wir einem englischen Entomologen den Auftrag gegeben, einen Wurm zu züchten, der den bloody Kaktus auffressen wird mit bloody Stumpf und Stiel, mit bloody Haut und Haar.«
In Mexiko hat der Kaktus keine solchen meuchelmörderischen Feinde, wenngleich er auch hier nur ein Unkraut ist, insofern ihn niemand anbaut, und er auch hier den Tieren Harm tut, die ihm zu Leibe rücken. Neben Orchidee und Bougainvillea und Rose steht er als Zierpflanze in Ehren und ist als Nutzpflanze unentbehrlich.
Wie sehr sich des Kaktus und des Menschen Leben wechselseitig bedingen, können Sie auf dem Land beobachten. Sie stehen vor einer Hütte, einer wie Hunderttausende, armselig mit armseligem Hof. Der Zaun aber ist prächtiger und sichernder als das Gitterwerk einer Villa. Grün gerippte, meterhohe Orgelkakteen sind aneinandergeschlossen zu einer Phalanx, durch die kein feindlicher Mensch und kein feindliches Tier zu dringen vermag, selbst eine Schlange nicht. Wollte jemand hinüberklimmen, flugs bekäme er Stacheldrähte zu spüren, die aus der Pflanze wachsenden Widerhaken.
Die Hütte hinter dem Zaun ist ebenfalls dem Kaktus entboren, wenn auch nicht dem gleichen, der den Hof umschließt. Als Ziegelsteine und als Schindeln sind die flachen ovalen Glieder der Opuntia robusta verwendet, die auch alles »hölzerne« Material für den Haushalt beisteuert, denn sie wird so hart und unverweslich wie Mahagoni.
Bei isolierten Indiostämmen tut der Kaktus alle Arten von Diensten. Im östlichen Chiapas stricken die Frauen mit Hilfe langer weißer Kaktusstacheln, und auf den Berghängen bei Guaymas dient ein Kaktusglied als Kamm und Bürste zugleich. Weil wir gerade von Haarpflege sprechen, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass auf allen Märkten Opuntien als Haarwaschmittel verkauft werden. Sie schützen gegen das Ergrauen, und mag das Gesicht der Indiogreisin noch so fahl sein, ihr glattes und in Zöpfe geflochtenes Haar glänzt schwarz wie in ihrem ersten Lebensjahr.
Lieblingsspiel mexikanischer Kinder ist der Stierkampf. Über Bürgersteig, Fahrbahn oder Spielplatz tobt ein hölzernes Gestell auf Rädern, der Stier. Zwei echte Hörner sind seine Waffe, aber zwischen ihnen und an den Flanken des Steckenstiers sind Kaktusglieder befestigt, in die der kleine Picador die hölzernen Lanzen stößt und schließlich der kleine Torero sein hölzernes Schwert.
X. Gastronomie
Alle Gänge eines Mittagessens können aus Kaktus bereitet werden. Sogar das Fleisch wird von einer saftigen Scheibe der Opuntie täuschend vertreten, einer gleichen, wie man sie als Salat anrichtet. Dieses Menü aus Kaktus wird auf einem Herd gekocht, der mit Kaktus geheizt ist.
Kaktusfrüchte wie Pitaya und Tuna sind das billigste Obst, man kann es auf allen Wegen pflücken. An Ständen auf der Straße und in Konfitürengeschäften kauft man es kandiert, als Gefrorenes, als Kompott, als Fruchtsaft, als Dulce de Bisnaga.
In diesem Zusammenhang muss ich wohl oder übel einer Sache Erwähnung tun, die nicht eben ins Gebiet der Gastronomie gehört, jedoch die Unverwüstlichkeit der Kakteen deutlicher dartut als alles andere. Auf der Tiburón-Insel im Kalifornischen Meerbusen (zum Staat Sonora gehörig) nähren sich die wilden, starken Seri-Indianer fast ausschließlich vom Feigenkaktus, Opuntia ficus indica, dessen Früchte sie in der Reifezeit heißhungrig in Unmengen verschlingen. Mit dieser Hemmungslosigkeit kontrastiert die fürsorgliche Maßnahme, die Resultate ihrer Verdauung gut aufzuheben. Das rettet sie, wenn die Saison des Mangels heranbricht, vor dem Hungertod. Denn dann suchen sie aus den inzwischen hart gewordenen Faeces die unverdauten Teile heraus, essen, verdauen und bewahren sie von Neuem, um sie in der nächsten Hungerzeit wieder herauszuholen, zu essen und so ad infinitum.
XI. Hydrologie
Sie wissen, meine Herren, dass ich gegenwärtig ein Lehrbuch über Mexiko schreibe, und ich habe es mit einer Abhandlung über den Mais begonnen. Denn so wie die Kultur Europas mit dem Anbau von Korn und wie die Kultur Asiens mit dem Anbau von Reis zur Welt kam, fängt diejenige Amerikas mit dem Zeitpunkt an, da der indianische Mensch Mais züchtet und zu diesem Behufe seßhaft wird.
Vorher muss jedoch dieser Mensch dagewesen sein, wenn auch nur als Nomade.
Wie war er ins Land eingedrungen, ohne zu verdursten; wer wies ihm die Richtung durch die Wüstenei zum wilden Mais, zum künftigen Bauplatz für Hütte und Dorf? Niemand anderer als der Kaktus. Er war’s, der den Menschen hereinführte und eine brache Unendlichkeit zum blühenden Lande machte, und ich frage mich, ob ich ihn nicht doch dem Mais voranstellen sollte.