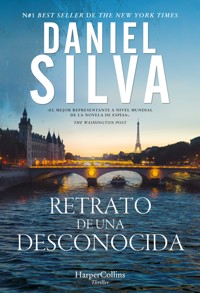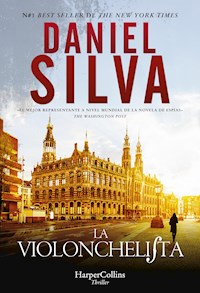Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gabriel Allon
- Sprache: Deutsch
"Elegant, niveauvoll und unterhaltsam. The Heist ist ein rasanter und fesselnder Thriller um internationale Intrigen, der einmal mehr deutlich macht, warum Daniel Silva zur Weltelite der Spionage-Romanautoren gehört."
Washington Post
"Großartig! Dieses Buch enthält all das, was die Leser an Daniel Silva lieben - eine einzigartige Story, unvergleichliche Charaktere und eine große Spanne an packenden Emotionen."
Huffington Post
Mord, Kunstraub, ein internationales Komplott: Daniel Silvas neuer Thriller-Bestseller mit Restaurator und Top-Spion Gabriel Allon garantiert spannende Unterhaltung auf höchstem Niveau. Nr. 1 auf der Bestsellerliste der New York Times!
Für den Restaurator war Frieden nur die Zeit zwischen dem letzten Krieg und dem nächsten. Frieden war eine Täuschung, ein flüchtiges Trugbild …
Der israelische Geheimagent und Restaurator Gabriel Allon bessert gerade ein Altarbild in Venedig aus, als die italienische Polizei seine Hilfe verlangt: Ein krimineller Kunstsammler wurde brutal in dessen Villa am Comer See ermordet. Ausgerechnet Gabriels langjähriger Weggefährte Julian Isherwood gilt als Hauptverdächtiger. Um die Unschuld des Kunsthändlers zu beweisen, muss Allon den wahren Täter aufspüren. Seine Ermittlungen führen ihn quer durch Europa bis in den Nahen Osten. Dabei stößt er auf ein mörderisches Komplott von gigantischem Ausmaß - und kommt dem berühmtesten gestohlenen Gemälde der Welt auf die Spur …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Handlung und Figuren dieses Romans sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen
sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig.
Daniel Silva
Der Raub
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Wulf Bergner
HarperCollins
HarperCollins
HarperCollins © Bücher
erscheinen in der HarperCollins GermanyGmbH,
Valentinskamp 24, 20354 Hamburg
Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright dieses eBooks © 2015 HarperCollins
in der HarperCollins Germany GmbH
Titel der nordamerikanischen Originalausgabe:
The Heist
Copyright © 2014 by Two Joeys Productions
erschienen bei Harper Collins, New York
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner gmbh, Köln
Covergestaltung: pecher und soiron, Köln
Redaktion: Thorben Buttke
Titelabbildung: Thinkstock
eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN eBook 978-3-95967-979-4
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheberinnen und Urheber und des Verlags bleiben davon unberührt.
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder
auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle handelnden Personen in dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Wie immer für meine Frau Jamieund meine Kinder Nicholas und Lily
Die meisten gestohlenen Kunstwerke
bleiben auf ewig verschwunden …
Der einzige kleine Trost ist, dass die Chancen,
dass ein Gemälde eines Tages wieder beigebracht wird,
umso größer sind, je besser es ist.
EDWARD DOLNICK, THE RESCUE ARTIST
Aber wer eine Grube macht, der wird selbst hineinfallen;
und wer den Zaun zerreißt, den wird eine Schlange stechen.
PREDIGER 10,8
VORWORT
Am 18. Oktober 1969 verschwand Caravaggios Christi Geburt mit den Heiligen Laurentius und Franziskus aus dem Oratorio di San Lorenzo des Franziskanerordens in Palermo. Christi Geburt, wie das Bild allgemein heißt, ist eines der letzten großen Meisterwerke Caravaggios, das 1609 entstand, als er auf der Flucht war, weil die päpstliche Gerichtsbarkeit ihm den Prozess machen wollte, nachdem er in Rom an einem Totschlag beteiligt gewesen war. Aber obwohl dieses Altarbild seit über vier Jahrzehnten das am intensivsten gesuchte gestohlene Gemälde der Welt ist, ist sein Verbleib, sogar sein Schicksal bisher ein Geheimnis geblieben. Jedenfalls bisher …
TEIL EINSCHIAROSCURO
1ST. JAMES’S, LONDON
Es begann mit einem Unfall, aber das war bei Dingen, die mit Julian Isherwood zusammenhingen, unvermeidbar. Tatsächlich war sein Ruf für Torheit und Missgeschicke so fest etabliert, dass die Londoner Kunstszene nichts anders erwartet hätte, wenn sie von dieser Angelegenheit gewusst hätte, was sie nicht tat. Isherwood, erklärte ein Spötter aus dem Department Alte Meister bei Sotheby’s, sei der Schutzheilige hoffnungsloser Fälle, ein Hochseilartist mit einer Vorliebe für sorgfältig geplante Unternehmen, die im Ruin endeten – oft allerdings ohne sein Verschulden. Als Folge daraus wurde er bewundert und bemitleidet zugleich, was für einen Mann in seiner Position selten war. Julian Isherwood machte den Alltag etwas weniger langweilig. Und dafür himmelte ihn die Hautevolee Londons an.
Seine Galerie lag in der entferntesten Ecke eines als Mason’s Yard bekannten gepflasterten Platzes und nahm drei Stockwerke eines leicht heruntergekommenen viktorianischen Lagerhauses ein, das einst Fortnum & Mason gehört hatte. Direkt benachbart waren die Londoner Vertretung einer kleinen griechischen Reederei und ein Pub, in dem hübsche Sekretärinnen verkehrten, die Motorroller fuhren. Vor vielen Jahren, bevor erst arabisches und dann russisches Geld den Londoner Immobilienmarkt überflutet hatte, hatte die Galerie in der eleganten New Bond Street – oder New Bondstraße, wie sie in der Branche hieß – gelegen. Dann waren Hermès, Burberry, Chanel, Cartier und Konsorten gekommen und hatten Isherwood und anderen wie ihm – selbstständige Kunsthändler, die auf Altmeister in Museumsqualität spezialisiert waren – keine andere Wahl gelassen, als in St. James’s Zuflucht zu suchen.
Dies war nicht das erste Mal, dass Isherwood ins Exil flüchten musste. Er war kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs als einziges Kind des bekannten Pariser Kunsthändlers Samuel Isakowitz geboren, nach dem Einmarsch der Deutschen über die Pyrenäen getragen und nach England geschmuggelt worden. Seine Pariser Kindheit und seine jüdische Abstammung waren zwei Dinge aus seiner bewegten Vergangenheit, die Isherwood vor der notorisch verleumderischen Londoner Kunstwelt geheim hielt. Nach allgemeiner Überzeugung war er urbritisch: der einzigartige Julian Isherwood, Julie für seine Freunde, Juicy Julian für seine gelegentlichen Trinkkumpane und Seine Heiligkeit für die Kunstwissenschaftler und Kuratoren, die gewohnheitsmäßig auf seinen unfehlbaren Blick vertrauten. Er war unfehlbar loyal, an Dummheit grenzend vertrauensselig und hatte tadellose Manieren und keinen wirklichen Feind, was eine einzigartige Leistung war, wenn man bedachte, wie lange er nun schon die tückischen Gewässer der Kunstwelt befuhr. Isherwood war vor allem anständig, und Anständigkeit war in diesen Zeiten in London und anderswo rar.
Isherwood Fine Arts war übereinander angeordnet: überquellende Lagerräume im Erdgeschoss, Büros im ersten Stock und ein eleganter Ausstellungsraum im zweiten. Dieser Raum, den viele für den schönsten Ausstellungsraum Londons hielten, war eine genaue Kopie von Paul Rosenbergs berühmter Galerie in Paris, in der Isherwood als Kind viele glückliche Stunden verbracht hatte, oft in Gesellschaft von Picasso. Der Bürotrakt war ein Labyrinth voller vergilbter Kataloge und Monografien wie aus einem Roman von Dickens. Um ihn zu erreichen, mussten Besucher zwei Türen aus Sicherheitsglas im Erdgeschoss und oben an der mit einem fleckigen braunen Läufer belegten Treppe passieren. Dort trafen sie auf Maggie, eine Blondine mit Schlafzimmerblick, die einen Tizian nicht von Toilettenpapier unterscheiden konnte. Isherwood hatte sich einst völlig zum Narren gemacht, indem er versucht hatte, sie zu verführen, bis ihm zuletzt nichts anderes übrig geblieben war, als sie als seine Empfangsdame einzustellen. Im Augenblick polierte sie ihre Fingernägel, während das Telefon auf ihrem Schreibtisch vergebens klingelte.
„Willst du nicht rangehen, Mags?“, schlug Isherwood freundlich vor.
„Wozu?“, fragte sie ohne die geringste Ironie in der Stimme.
„Könnte wichtig sein.“
Sie verdrehte die Augen, bevor sie widerstrebend den Hörer ans Ohr hob und „Isherwood Fine Arts“ säuselte. Einige Sekunden später legte sie wortlos auf und wandte sich wieder ihren Nägeln zu.
„Nun?“, fragte Isherwood.
„Keiner am Apparat.“
„Sei so lieb, Schätzchen, und sieh nach der angezeigten Nummer.“
„Er ruft wieder an.“
Isherwood setzte stirnrunzelnd seine stumme Begutachtung des Gemäldes fort, das mitten im Raum auf einer mit grünem Wollstoff verhängten Staffelei stand: Christus erscheint Maria Magdalena, vermutlich von einem Schüler Francesco Albanis, das er vor Kurzem in einem Herrenhaus in Berkshire für ein Trinkgeld gekauft hatte. Wie Isherwood selbst musste das Gemälde dringend restauriert werden. Er hatte das Alter erreicht, das Vermögensberater blumig als „den Herbst des Lebens“ bezeichneten. Aber es war kein goldener Herbst, dachte er trübselig. Eher ein Spätherbst mit schneidend kaltem Wind und ersten Weihnachtsdekorationen in der Oxford Street. Trotzdem machte er mit seinem Maßanzug aus der Savile Row und seinem ergrauten Lockenhaupt weiterhin eine gute, wenn auch heikle Figur. Er selbst bezeichnete diesen Look als würdevolle Verderbtheit. Nach mehr konnte man in seinem Alter nicht streben.
„Ich dachte, irgendein grässlicher Russe wollte um vier vorbeikommen, um ein Gemälde zu besichtigen“, sagte Isherwood plötzlich, während er weiter das an vielen Stellen beschädigte Gemälde begutachtete.
„Der grässliche Russe hat abgesagt.“
„Wann?“
„Heute Morgen.“
„Warum?“
„Hat er nicht gesagt.“
„Wieso hast du mir das nicht erzählt?“
„Hab ich doch.“
„Unsinn.“
„Das musst du vergessen haben, Julian. Passiert in letzter Zeit häufig.“
Isherwood durchbohrte Maggie mit einem vernichtenden Blick, während er sich fragte, wieso er sich jemals zu einem so widerwärtigen Wesen hingezogen gefühlt hatte. Weil sein Terminkalender ansonsten leer war und er eindeutig nichts Besseres zu tun hatte, schlüpfte er in seinen Mantel und ging zu Green’s Restaurant and Oyster Bar hinüber, wodurch er eine Abfolge von Ereignissen in Gang setzte, die ihn in weitere Kalamitäten führen würden, an denen er schuldlos war. Es war zwanzig vor vier – noch etwas zu früh für die Stammgäste, und die Bar war leer bis auf Simon Mendenhall, den permanent sonnengebräunten Chefversteigerer von Christie’s. Mendenhall hatte einst ohne sein Wissen eine Rolle in einem israelischamerikanischen Geheimdienstunternehmen mit dem Zweck gespielt, ein dschihadistisches Terrornetzwerk zu unterwandern, das in ganz Westeuropa Bombenanschläge verübte. Das wusste Isherwood, weil er selbst eine kleine Rolle bei diesem Unternehmen gespielt hatte. Isherwood war kein Spion. Er half Spionen, vor allem einem bestimmten Spion.
„Julie!“, rief Mendenhall aus. Dann fügte er mit der Schlafzimmerstimme hinzu, die er sonst für zögerliche Bieter reservierte: „Du siehst echt klasse aus. Hast du abgenommen? Ein teures Wellness-Wochenende gebucht? Eine neue Freundin? Was ist dein Geheimnis?“
„Sancerre“, antwortete Isherwood, bevor er sich an seinen gewohnten Fenstertisch mit Blick auf die Duke Street setzte. Und dort bestellte er eine Flasche von dem Zeug, brutal kalt, weil ein Glas ihm nicht reichen würde. Mendenhall verabschiedete sich bald in seiner überschwänglichen Art, und Isherwood blieb mit seinen Gedanken und seiner Flasche allein zurück – eine gefährliche Kombination für einen Mann fortgeschrittenen Alters, mit dessen Karriere es unübersehbar bergab ging.
Wenig später ging jedoch die Tür auf, und aus der nassen Abenddämmerung kamen zwei Kuratoren der National Gallery herein. Als Nächster kam ein wichtiger Mann der Tate, dann folgte eine Delegation von Bonhams unter Führung von Jeremy Crabbe, dem eleganten Direktor der Abteilung Altmeistergemälde des Auktionshauses. Ihnen dicht auf den Fersen war Roddy Hutchinson, weithin als der skrupelloseste Kunsthändler in ganz London bekannt. Seine Ankunft war ein schlechtes Omen, denn wo Roddy aufkreuzte, war meistens auch der dicke Oliver Dimbleby nicht weit. Erwartungsgemäß kam er einige Minuten später mit der Diskretion einer Dampflokpfeife um Mitternacht hereingewatschelt. Isherwood hob sein Handy ans Ohr und gab vor, ein wichtiges Gespräch zu führen, aber Oliver ließ sich nicht aufhalten. Er kam geradewegs auf den Tisch zu – wie ein Jagdhund, der einen Fuchs stellt, würde Isherwood sich später erinnern – und pflanzte seinen breiten Hintern auf den leeren Stuhl. „Domaine Daniel Chotard“, las er anerkennend vor, als er die Flasche aus dem Eiskübel zog. „Da trinke ich gern ein Glas mit.“
Er trug einen blauen Geschäftsanzug, der seinen stämmigen Körper wie eine Wurstpelle umschloss, und protzige goldene Manschettenknöpfe. Seine Wangen waren rund und rosig; seine blassblauen Augen strahlten lebhaft und vermittelten den Eindruck, er schlafe gut. Oliver Dimbleby war ein Sünder höchsten Grades, aber sein Gewissen belästigte ihn nicht.
„Nimm’s mir nicht übel, Julie“, sagte er, während er sich großzügig von Isherwoods Wein einschenkte, „aber du siehst wie ein Häufchen Schmutzwäsche aus.“
„Simon Mendenhall hat genau das Gegenteil gesagt.“
„Simon lebt davon, dass er Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Ich dagegen spreche unverfälschte Wahrheiten aus, auch wenn sie schmerzhaft sind.“ Dimbleby musterte Isherwood mit einem Blick, aus dem aufrichtige Besorgnis sprach.
„Oh, sieh mich nicht so an, Oliver.“
„Wie denn?“
„Als versuchtest du, dir noch etwas Freundliches einfallen zu lassen, bevor der Arzt den Stecker zieht.“
„Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel gesehen?“
„Derzeit versuche ich Spiegel zu meiden.“
„Kann mir denken, weshalb.“ Dimbleby schenkte sich einen Fingerbreit Wein nach.
„Kann ich dir sonst noch was bestellen, Oliver? Etwas Kaviar?“
„Revanchiere ich mich nicht immer?“
„Nein, Oliver, das tust du nicht. Hätte ich mitgerechnet, was ich nicht tue, wärst du ein paar tausend Pfund im Minus.“
Dimbleby ignorierte diese Bemerkung. „Was hast du, Julian? Was setzt dir diesmal zu?“
„Im Augenblick nur du, Oliver.“
„Schuld ist diese Frau, stimmt’s, Julian? Ihretwegen bist du so trübselig. Wie heißt sie gleich wieder?“
„Cassandra.“
„Hat dir das Herz gebrochen, was?“
„Das tun sie alle.“
Dimbleby lächelte. „Deine Fähigkeit, dich immer neu zu verlieben, erstaunt mich. Was würde ich nicht dafür geben, mich einmal verlieben zu können!“
„Du bist der größte Schürzenjäger, den ich kenne.“
„Ein Schürzenjäger zu sein, hat verdammt wenig mit Verliebtheit zu tun. Ich liebe Frauen, alle Frauen. Und darin liegt das Problem.“
Isherwood starrte auf die Straße hinaus. Draußen setzte wieder Regen ein, genau zu Beginn des abendlichen Berufsverkehrs.
„Hast du in letzter Zeit irgendein Gemälde verkauft?“, fragte Dimbleby.
„Sogar mehrere.“
„Aber keines, von dem ich gehört habe.“
„Weil die Verkäufe privat waren.“
„Bockmist“, sagte Dimbleby. „Du hast seit Monaten nichts mehr verkauft. Aber das hat dich nicht davon abgehalten, neue Ware einzukaufen, stimmt’s? Wie viele Gemälde hast du schon in deinem Lagerraum angesammelt? Genug, um ein ganzes Museum auszustatten und noch ein paar hundert übrig zu haben. Und sie sind alle verbrannt, tot, wie der bekannte Türnagel.“
Isherwoods einzige Antwort bestand darin, dass er sich das Kreuz rieb. Rückenschmerzen hatten den bellenden Husten abgelöst, der ihm bisher hauptsächlich zugesetzt hatte. In gewisser Beziehung war das wohl eine Verbesserung. Mit Kreuzschmerzen belästigte man seine Mitmenschen nicht.
„Mein Angebot steht weiter“, sagte Dimbleby eben.
„Welches Angebot meinst du?“
„Komm schon, Julie. Zwing mich nicht dazu, es laut zu wiederholen.“
Isherwood hob langsam den Kopf und starrte direkt in Dimblebys fleischiges, kindliches Gesicht. „Du redest nicht etwa schon wieder davon, meine Galerie zu kaufen, oder?“
„Ich bin bereit, mehr als großzügig zu sein. Ich zahle dir einen fairen Preis für den kleinen Teil deiner Sammlung, der verkäuflich ist, und benutze den Rest dafür, das Gebäude zu heizen.“
„Das ist sehr freundlich von dir“, antwortete Isherwood sarkastisch, „aber ich habe andere Pläne für die Galerie.“
„Realistische?“
Isherwood sagte nichts.
„Na schön“, sagte Dimbleby. „Wenn ich das brennende Wrack, das du als Galerie bezeichnest, nicht übernehmen darf, will ich wenigstens etwas anderes tun, um dich aus deiner jetzigen Blauen Periode rauszuholen.“
„Ich will keines deiner Mädchen, Oliver.“
„Ich rede von keinem Mädchen. Ich rede von einer netten kleinen Reise, die mithelfen könnte, dich von deinen Sorgen abzulenken.“
„Wohin?“
„Comer See. Alles frei. Flug erster Klasse. Zwei Nächte in einer Luxussuite in der Villa d’Este.“
„Und was muss ich dafür tun?“
„Mir einen kleinen Gefallen erweisen.“
„Wie klein?“
Dimbleby schenkte sich Wein nach und erzählte Isherwood den Rest.
Wie sich herausstellte, hatte Oliver Dimbleby vor Kurzem einen in Italien lebenden Engländer kennengelernt, der eifrig Kunst sammelte, aber keinen Kunstkenner als Berater hatte. Außerdem schienen die Finanzen des Engländers nicht mehr das zu sein, was sie einmal gewesen waren, sodass er schnellstens einen Teil seiner Sammlung abstoßen musste. Dimbleby hatte sich einverstanden erklärt, die Sammlung dezent zu besichtigen, aber als die Reise jetzt bevorstand, graute ihm vor dem Gedanken, wieder ein Flugzeug besteigen zu müssen. Zumindest behauptete er das. Isherwood vermutete, Dimblebys wahre Gründe für seinen Rückzieher lägen woanders, denn Oliver Dimbleby war die Verkörperung Fleisch gewordener Hintergedanken.
Trotzdem fand Isherwood die Vorstellung, ganz unerwartet eine kleine Reise zu machen, so attraktiv, dass er wider besseres Wissen auf der Stelle zusagte. Am selben Abend packte er leicht, und am folgenden Morgen um neun Uhr saß er bei British Airways in der ersten Klasse von Flug 576 zum Mailänder Flughafen Malpensa. Unterwegs trank er nur ein einziges Glas Wein – zur Herzstärkung, versicherte er sich –, und als er um 12.30 Uhr in einen gemieteten Mercedes stieg, war er im Vollbesitz seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Die Fahrt nach Norden, zum Comer See, bewältigte er ohne Straßenkarte oder Navi. Als hoch angesehener Kunstwissenschaftler, der auf venezianische Malerei spezialisiert war, hatte er Oberitalien mit seinen Kirchen und Museen unzählige Male bereist. Noch heute nutzte er jede Gelegenheit, um dorthin zurückzukehren – vor allem, wenn ein anderer die Kosten trug. Julian Isherwood war als Franzose geboren und als Engländer aufgewachsen, aber in seiner eingesunkenen Brust schlug das romantische, ungebärdige Herz eines Italieners.
Der ausgewanderte Engländer mit den schwindenden Ressourcen erwartete Isherwood um vierzehn Uhr. Er residierte fürstlich, in der Nähe der Kleinstadt Laglio am südwestlichen Arm des Sees, wie Dimbleby in einer hastig verfassten E-Mail mit Hintergrundinformationen geschrieben hatte. Als Isherwood einige Minuten früher eintraf, stand das imposante Tor bereits für ihn offen. Hinter dem Tor erstreckte sich eine frisch asphaltierte Einfahrt, die ihn zu einem mit Kies bestreuten Vorhof brachte. Er parkte neben dem zu der Villa gehörenden Carport und schlenderte an Marmorstatuen vorbei zur Haustür. Auf sein Klingeln reagierte niemand. Isherwood sah auf seine Armbanduhr, dann klingelte er noch mal. Das Ergebnis blieb das gleiche.
An diesem Punkt wäre Isherwood gut beraten gewesen, sich in seinen Mietwagen zu setzen und Laglio so schnell wie möglich zu verlassen. Stattdessen drückte er die Klinke herab und stellte leider fest, dass die Haustür unversperrt war. Er öffnete sie eine Handbreit, rief eine Begrüßung ins dunkle Hausinnere und trat dann zögerlich in die prachtvolle Eingangshalle. Dabei sah er sofort die große Blutlache auf dem Marmorboden, die im Raum hängenden nackten Füße und das blauschwarz angelaufene Gesicht, das ihn von oben herab anstarrte. Isherwood spürte, dass er weiche Knie bekam, und sah, wie der Fußboden ihm entgegenzukommen schien. So kniete er einen Augenblick, bis die erste Übelkeit sich gelegt hatte. Dann rappelte er sich auf und stolperte mit einer Hand vor dem Mund aus der Villa zu seinem Wagen. Und obwohl es ihm in dem Moment nicht bewusst war, verfluchte er bei jedem Schritt den dicken Oliver Dimbleby.
2VENEDIG
Früh am folgenden Morgen verlor Venedig eine weitere Schlacht in seinem uralten Krieg gegen das Meer. Die Fluten trugen alle möglichen Meerestiere in die Halle des Hotels Cipriani und setzten Harry’s Bar unter Wasser. Dänische Touristen badeten auf dem Markusplatz; Tische und Stühle des Cafés Florian wurden wie Trümmer eines gesunkenen Luxusdampfers an den Stufen des Markusdoms angetrieben. Die sonst unvermeidlichen Tauben waren ausnahmsweise nirgends zu sehen; sie schienen die überflutete Stadt verlassen zu haben, um sich auf dem Festland in Sicherheit zu bringen.
Es gab jedoch Teile von Venedig, in denen das Acqua alta eher lästig als katastrophal war. Der Restaurator schaffte es sogar, einen Archipel aus halbwegs trockenem Land zu finden, der sich von der Tür seines Apartments im Sestiere Cannaregio bis nach Dorsoduro im äußersten Süden der Stadt erstreckte. Obwohl der Restaurator kein gebürtiger Venezianer war, kannte er die Gassen und Plätze der Stadt besser als die meisten Einheimischen. Er hatte sein Handwerk in Venedig gelernt, hatte in Venedig geliebt und getrauert und war einmal, als man ihn hier unter falschem Namen kannte, von seinen Feinden aus Venedig vertrieben worden. Nach langer Abwesenheit war er nun in seine geliebte Stadt des Wassers und der Gemälde zurückgekehrt – den einzigen Ort, an dem er jemals etwas wie Zufriedenheit empfunden hatte. Aber nicht Frieden, denn für den Restaurator war Frieden nur der Zeitabschnitt zwischen dem letzten Krieg und dem nächsten. Frieden war eine Täuschung, ein flüchtiges Trugbild. Dichter und Witwen träumten von ihm, aber Männer wie der Restaurator gestatteten sich nie, der Illusion nachzuhängen, Frieden sei tatsächlich erreichbar.
Er blieb an einem Zeitungskiosk stehen, um sich zu vergewissern, dass er nicht beschattet wurde, und setzte dann seinen Weg fort. Er war nicht ganz durchschnittlich groß – schätzungsweise einen Meter zweiundsiebzig, aber nicht mehr – und hatte den sportlich schlanken Körperbau eines Radrennfahrers. Sein langes Gesicht lief in ein schmales Kinn aus; dazu gehörten weit auseinanderstehende Wangenknochen und eine wie aus Holz geschnitzte, schlanke Nase. Die Augen unter dem Schirm seiner flachen Mütze leuchteten unnatürlich grün, und sein dunkles Haar war an den Schläfen grau meliert. Er trug eine gelbe Regenjacke und Gummistiefel, verzichtete aber auf einen Schirm als Schutz vor dem stetigen Regen. Aus alter Gewohnheit belastete er sich in der Öffentlichkeit nie mit etwas, das blitzschnelle Handbewegungen hätte behindern können.
Er erreichte das Viertel Dorsoduro, den höchsten Teil der Stadt, und ging zur Kirche San Sebastiano weiter. Ihr Hauptportal war geschlossen, und eine amtlich aussehende Mitteilung informierte darüber, die Kirche sei bis zum kommenden Herbst geschlossen. Der Restaurator ging zu dem Nebeneingang auf der rechten Seite der Kirche und sperrte ihn mit einem großen altmodischen Schlüssel auf. Ein Hauch von kühler Luft aus dem Kircheninneren liebkoste sein Gesicht. Kerzenduft, Weihrauch, leichter Modergeruch: Irgendetwas an dieser Mischung erinnerte den Restaurator an den Tod. Er schloss hinter sich ab, ignorierte das Weihwasserbecken und betrat das Innere der Kirche.
Das ausgeräumte Kirchenschiff lag in geheimnisvollem Halbdunkel. Der Restaurator bewegte sich lautlos über die abgetretenen Steinplatten und trat durch die offene Balustrade in den Altarraum. Der prächtige Altar war abgebaut worden, um gereinigt zu werden; an seiner Stelle stand jetzt ein zehn Meter hohes Aluminiumgerüst. Der Restaurator erklomm es mit katzengleichen Bewegungen und schlüpfte unter Abdeckplanen hindurch, um seine Arbeitsplattform zu erreichen. Sein Material lag genau so da, wie er es am Vorabend zurückgelassen hatte: Flaschen mit Chemikalien, ein großer Wattebausch, ein Packen Holzstäbchen, eine Lupenbrille, zwei starke Halogenscheinwerfer und eine Stereoanlage mit vielen Farbklecksen. Auch das Altarbild – Thronende Muttergottes und Kind mit Heiligen von Paolo Veronese war unverändert. Es war nur eines der vielen Meisterwerke, die Veronese zwischen 1556 und 1565 für diese Kirche geschaffen hatte. Sein Grab mit der finster dreinblickenden Marmorbüste befand sich auf der linken Seite des Chorraums. In Augenblicken wie diesem, wenn die Kirche dunkel und leer war, konnte der Restaurator fast spüren, wie Veroneses Geist ihn bei der Arbeit beobachtete.
Der Restaurator schaltete seine Halogenscheinwerfer ein und blieb lange Augenblicke bewegungslos vor dem Altarbild stehen. Im oberen Drittel thronten die Muttergottes und das Jesuskind, von Glorienschein und musizierenden Engeln umgeben. Unter ihnen waren andächtig zu ihnen aufblickende Heilige versammelt, darunter auch Sebastian, der Namenspatron der Kirche, den Veronese als Märtyrer dargestellt hatte. In den vergangenen drei Wochen hatte der Restaurator den rissigen und vergilbten Firnis sorgfältig mit einer genau abgestimmten Mischung aus Azeton, Methylproxitol und Terpentin entfernt. Den Firnis eines Barockgemäldes abzunehmen, erläuterte er gern, hatte nichts mit dem Ablaugen eines Möbelstücks zu tun; es hatte mehr Ähnlichkeit damit, das Deck eines Flugzeugträgers mit einer Zahnbürste zu reinigen. Als Erstes musste er aus Watte und einem Holzstäbchen einen Tupfer herstellen, den er, mit Lösungsmittel getränkt, auf die Bildfläche setzte und sanft drehte, damit nicht noch mehr Farbe abplatzte. Mit jedem Tupfer ließ sich eine Fläche von ungefähr zwei mal zwei Zentimetern reinigen, bevor er zu schmutzig war und ersetzt werden musste. Nachts, wenn er nicht von Blut und Feuer träumte, entfernte er vergilbten Firnis von einem Gemälde von der Größe des Markusplatzes.
Noch eine Woche, glaubte er, dann würde er mit der zweiten Phase der Restaurierung beginnen können: der Ausbesserung der Stellen, an denen Paolo Veroneses ursprünglicher Farbauftrag abgeblättert war. Die Muttergottes und das Jesuskind wiesen kaum Schäden auf, aber der Restaurator hatte am Ober- und Unterrand des Gemäldes großflächige Schäden freigelegt. Klappte alles nach Plan, würde er diese Restaurierung abschließen, wenn für seine Frau die letzten Wochen der Schwangerschaft begannen. Wenn alles plangemäß klappt, sagte er sich erneut.
Er schob eine CD mit La Bohème in die Stereoanlage, und im nächsten Augenblick erfüllten die vertrauten Klänge von „Non sono in vena“ die Sakristei. Während Rodolfo und Mimi sich in einem winzigen Pariser Dachatelier verliebten, stand der Restaurator allein vor dem Veronese und entfernte sorgfältig alten Schmutz und vergilbten Firnis. Er arbeitete gleichmäßig und mühelos rhythmisch – eintauchen, drehen, wegwerfen … eintauchen, drehen, wegwerfen –, bis die Arbeitsplattform mit schmutzigen Wattebäuschen übersät war. Veronese hatte Formeln für Farben entwickelt, die im Alter nicht verblassten; als der Restaurator Stück für Stück von dem tabakbraunen Firnis entfernte, leuchteten die Farben darunter intensiv. Man hätte glauben können, der Meister habe sie nicht vor viereinhalb Jahrhunderten, sondern erst gestern aufgetragen.
Der Restaurator hatte die Kirche noch zwei Stunden für sich allein. Gegen zehn Uhr hörte er das Klappern von Stiefelabsätzen auf dem Steinboden des Kirchenschiffs. Die Stiefel gehörten Adrianna Zinetti, Reinigerin von Altären, Verführerin von Männern. Nach ihr kam Lorenzo Vasari, ein begnadeter Freskenrestaurator, der Leonardo da Vincis Letztes Abendmahl fast im Alleingang gerettet hatte. Zuletzt kam mit lautlosem Verschwörerschritt Antonio Politi, der zu seinem Ärger nicht das Altarbild, sondern nur die Deckengemälde restaurieren durfte. So verbrachte er seine Tage wie ein wiedergeborener Michelangelo, indem er auf dem Rücken liegend arbeitete, wobei er ab und zu böse Blicke zu der verhängten Arbeitsplattform des Restaurators hoch im Altarraum hinüberwarf.
Dies war nicht das erste Mal, dass der Restaurator und die anderen als Team zusammenarbeiteten. Vor einigen Jahren hatten sie in der Kirche San Giovanni Cristosomo in Cannaregio und zuvor in der Kirche San Zaccaria in Castello umfangreiche Restaurierungen vorgenommen. Damals hatten sie den Restaurator als den brillanten, aber privat sehr zugeknöpften Mario Delvecchio gekannt. Später hatten sie wie die übrige Welt erfahren, dass er der legendäre israelische Geheimdienstoffizier und Berufskiller Gabriel Allon war. Adrianna Zinetti und Lorenzo Vasari waren großmütig genug gewesen, Gabriel diese Täuschung zu verzeihen, aber Antonio Politi hatte sich nicht dazu bereitfinden können. In seiner Jugend hatte er Mario Delvecchio einmal vorgeworfen, ein Terrorist zu sein, und er betrachtete Gabriel Allon ebenfalls als Terroristen. Insgeheim hegte er den Verdacht, Gabriel sei daran schuld, dass er seine Tage von allen Menschen isoliert unter der Decke des Kirchenschiffs verbringen musste: verkrampft auf dem Rücken liegend, während Farben und Lösungsmittel auf ihn herabtropften. Die Gemälde stellten das Leben von Königin Ester dar. Das sei bestimmt kein Zufall, versicherte Politi jedem, der es hören wollte.
Tatsächlich hatte Gabriel nichts mit der Entscheidung zu tun gehabt; getroffen hatte sie Francesco Tiepolo, Inhaber des angesehensten Restaurierungsbetriebs im Veneto und Direktor des Projekts San Sebastiano. Tiepolo, ein Bär von einem Mann mit grau-schwarzem Vollbart, war zu großem Zorn und noch größerer Liebe imstande. Als er jetzt das Kirchenschiff entlangschritt, trug er wie üblich einen wallenden Malerkittel und dazu einen Seidenschal. In dieser Aufmachung erweckte er den Eindruck, den Bau der Kirche statt nur ihre Renovierung zu beaufsichtigen.
Tiepolo blieb kurz stehen, um Adrianna Zinetti, mit der er einmal eine Affäre gehabt hatte, die zu den am schlechtesten gehüteten Geheimnissen Venedigs gehört hatte, einen bewundernden Blick zuzuwerfen. Dann erstieg er Gabriels Gerüst und zwängte sich durch den Spalt zwischen den Planen. Die hölzerne Plattform schien sich unter seinem gewaltigen Gewicht zu biegen.
„Vorsicht, Francesco“, sagte Gabriel stirnrunzelnd. „Der Boden ist aus Marmor, und wir sind hoch darüber.“
„Was willst du damit sagen?“
„Damit will ich sagen, dass du gut daran tätest, ein paar Kilo abzunehmen. Du fängst langsam an, ein eigenes Gravitationsfeld zu entwickeln.“
„Was würde Abnehmen nützen? Ich könnte zwanzig Kilo verlieren und wäre noch immer fett.“ Der Italiener trat einen Schritt vor und begutachtete das Altarbild über Gabriels Schulter hinweg. „Ausgezeichnet“, sagte er mit gespielter Bewunderung. „Wenn du in diesem Tempo weitermachst, wirst du am ersten Geburtstag deiner Kinder fertig.“
„Ich kann es schnell machen“, antwortete Gabriel, „oder ich kann es sorgfältig machen.“
„Das muss sich nicht ausschließen, weißt du. Hier in Italien arbeiten unsere Restauratoren schnell. Aber nicht du“, fügte Tiepolo hinzu. „Auch als du dich als Italiener ausgegeben hast, warst du immer sehr langsam.“
Gabriel machte einen neuen Tupfer, tränkte ihn mit Lösungsmittel und drehte ihn auf Sebastians von Pfeilen durchbohrtem Leib. Tiepolo beobachtete ihn genau, dann stellte er selbst einen Tupfer her und versuchte ihn an der Schulter des Heiligen. Der vergilbte Firnis verschwand sofort und ließ Veroneses leuchtende Farben sehen.
„Dein Lösungsmittel ist perfekt“, sagte Tiepolo.
„Das ist’s immer“, sagte Gabriel.
„Woraus besteht es?“
„Das ist ein Geheimnis.“
„Muss bei dir immer alles geheim sein?“
Als Gabriel keine Antwort gab, betrachtete Tiepolo die aufgereihten Chemikalien.
„Wie viel Methylproxitol verwendest du?“
„Genau die richtige Menge.“
Tiepolo runzelte die Stirn. „Hab ich dir nicht Arbeit verschafft, als deine Frau beschlossen hat, ihre Schwangerschaft in Venedig zu verbringen?“
„Das hast du, Francesco.“
„Und zahle ich dir nicht mehr als den anderen“, flüsterte er, „obwohl du immer alles stehen und liegen lässt, wenn deine Meister wieder mal deine Dienste benötigen?“
„Du warst immer sehr großzügig.“
„Warum sagst du mir dann nicht die Formel für dein Lösungsmittel?“
„Weil Veronese seine geheime Formel hatte und ich meine habe.“
Tiepolo machte eine wegwerfende Handbewegung mit seiner gewaltigen Pranke. Dann ließ er seinen schmutzigen Tupfer fallen und stellte den nächsten her.
„Gestern Abend hat mich die Korrespondentin der New York Times aus Rom angerufen“, sagte er beiläufig. „Sie will für die Kunstbeilage am Sonntag über die Restaurierung schreiben. Sie will am Freitag kommen und sich hier ein bisschen umsehen.“
„Ich möchte mir den Freitag freinehmen, Francesco, wenn’s recht ist.“
„Hab mir gedacht, dass du das sagen würdest.“ Tiepolo musterte Gabriel prüfend. „Bist du nicht mal versucht?“
„Was zu tun?“
„Der Welt den wahren Gabriel Allon zu zeigen? Den Gabriel Allon, der die Werke großer Meister restauriert: den Gabriel Allon, der genial malen kann.“
„Mit Journalisten rede ich nur, wenn’s gar nicht anders geht. Und ich käme nicht im Traum auf die Idee, mit einem über mich zu reden.“
„Du hast ein interessantes Leben geführt.“
„Das ist bescheiden ausgedrückt.“
„Vielleicht solltest du an ein Coming-out denken.“
„Und was dann?“
„Du kannst den Rest deines Lebens hier bei uns in Venedig verbringen. Im Herzen warst du schon immer ein Venezianer, Gabriel.“
„Klingt verlockend.“
„Aber?“
Gabriel ließ durch seine Miene erkennen, dass er keine Lust hatte, diese Diskussion fortzuführen. Indem er sich wieder der Leinwand zuwandte, fragte er: „Hast du sonst irgendwelche Anrufe bekommen, von denen ich wissen sollte?“
„Nur einen“, antwortete Tiepolo. „General Ferrari von den Carabinieri trifft am späten Vormittag in Venedig ein. Er will dich unter vier Augen sprechen.“
Gabriel drehte sich ruckartig um und betrachtete Tiepolo forschend. „In welcher Sache?“
„Das hat er nicht gesagt. Der General kann weit besser Fragen stellen als Antworten geben.“ Tiepolo musterte Gabriel sekundenlang. „Ich wusste nicht, dass der General und du befreundet seid.“
„Sind wir nicht.“
„Woher kennst du ihn?“
„Er hat mich mal um einen Gefallen gebeten, den ich ihm nicht abschlagen konnte.“
Tiepolo tat so, als denke er angestrengt nach. „Das muss die Sache vor ein paar Jahren im Vatikan gewesen sein, als eine junge Frau im Petersdom in den Tod gestürzt ist. Wenn ich mich recht erinnere, hast du damals den dortigen Caravaggio restauriert.“
„Wirklich?“
„So hat’s gerüchteweise geheißen.“
„Auf Gerüchte solltest du nichts geben, Francesco. Die sind fast immer falsch.“
„Außer sie betreffen dich“, wandte Tiepolo mit einem Lächeln ein.
Gabriel ließ diese Bemerkung unbeantwortet in den Höhen des Altarraums verhallen. Dann arbeitete er weiter. Vorhin hatte er dazu die rechte Hand benutzt. Jetzt arbeitete er ebenso geschickt mit der Linken.
„Du bist wie Tizian“, sagte Tiepolo, der ihn beobachtete. „Du bist eine Sonne unter kleinen Sternen.“
„Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, wird die Sonne nie mit diesem Gemälde fertig.“
Tiepolo machte keine Bewegung. „Weißt du bestimmt, dass du nicht er bist?“, fragte er nach kurzer Pause.
„Wer?“
„Mario Delvecchio.“
„Mario ist tot, Francesco. Mario hat nie existiert.“
3VENEDIG
Das regionale Hauptquartier der Carabinieri, der italienischen Gendarmerie, die zugleich Militärpolizei war, lag im Sestiere Castello unweit des Campo San Zaccaria. General Cesare Ferrari trat um Punkt dreizehn Uhr aus dem Gebäude. Seine dunkelblaue Uniform mit den vielen Orden und Ehrenzeichen hatte er diesmal mit einem eleganten Geschäftsanzug vertauscht. In einer Hand trug er einen Aktenkoffer aus Edelstahl; die andere, an der zwei Finger fehlten, steckte in der Tasche seines gut geschnittenen Mantels. Er zog sie nur lange genug heraus, um Gabriel die Hand zu schütteln. Sein Lächeln war kurz und förmlich. Wie immer hatte es keinen Einfluss auf sein rechtes Auge, das Glasauge. Selbst Gabriel fand seinen leblos starren Blick schwer zu ertragen. Man kam sich vor, als studiere einen das allsehende Auge eines unbarmherzigen Gottes.
„Sie sehen gut aus“, sagte General Ferrari. „Wieder in Venedig zu sein, bekommt Ihnen offenbar.“
„Woher wussten Sie, dass ich hier bin?“
Das zweite Lächeln des Generals war länger als sein erstes. „In Italien ereignet sich nicht viel ohne mein Wissen – vor allem nicht, wenn es um Sie geht.“
„Woher haben Sie’s gewusst?“, fragte Gabriel noch mal.
„Als Sie bei unserem Inlandsgeheimdienst beantragt haben, nach Venedig zurückkehren zu dürfen, sind diese Informationen an alle betroffenen Dienste und Ministerien gegangen. Unter anderem auch an den Palazzo.“
Der Palazzo, von dem der General sprach, stand im alten Zentrum Roms an der Piazza di Sant’Ignazio. Dort residierte das Dezernat für die Verteidigung des Kulturerbes, besser als Kunstdezernat bekannt. General Ferrari leitete es. Und in einem Punkt hat er recht, dachte Gabriel. In Italien passierte nicht viel, von dem der General nicht wusste.
Ferrari, der Sohn eines Lehrerehepaars aus der ärmlichen Campania, galt seit Langem als einer der kompetentesten und erfolgreichsten Polizeibeamten Italiens. Als in den siebziger Jahren Terroranschläge das Land erschütterten, hatte er mitgeholfen, die kommunistischen Roten Brigaden auszuschalten. Und in den Mafiakriegen der achtziger Jahre war er Kommandeur der von der Camorra unterwanderten Außenstelle Neapel gewesen. Diese Position war so gefährlich gewesen, dass Ferraris Frau und seine drei Töchter unter ständigem Polizeischutz hatten leben müssen. Der General selbst war das Ziel zahlreicher Anschläge gewesen, bei denen ihn eine Briefbombe zwei Finger einer Hand und das rechte Auge gekostet hatte.
Der Posten im Kunstdezernat hatte eine Belohnung für lange treue Dienste sein sollen. Allgemein wurde erwartet, Ferrari würde lediglich in die Fußstapfen seines glanzlosen Vorgängers treten, viel Zeit aufs Aktenstudium und lange römische Mittagessen verwenden und gelegentlich ein oder zwei der zahllosen Meisterwerke in Museumsqualität aufspüren, die jährlich in Italien gestohlen wurden. Stattdessen hatte er sich sofort darangemacht, eine ehemals effektive Truppe, die durch Überalterung und Vernachlässigung atrophiert war, zu modernisieren. Schon wenige Tage nach seinem Amtsantritt setzte er die Hälfte des Personals seiner Dienststelle vor die Tür und füllte seine Reihen rasch mit aggressiven jungen Beamten auf, die tatsächlich etwas von Kunst verstanden. Sie erhielten einen einfachen Auftrag. Ihn interessierten weniger die Kleinkriminellen, die sich gelegentlich als Kunstdiebe versuchten; er hatte es auf die großen Fische, die Bosse, abgesehen, die das Diebesgut auf den Markt brachten. Der Erfolg von Ferraris neuen Methoden ließ nicht lange auf sich warten. Über ein Dutzend großer Diebe wanderte hinter Gitter, und die Zahl der Kunstdiebstähle ging zurück, auch wenn sie weiter erstaunlich hoch blieb.
„Was führt Sie also nach Venedig?“, fragte Gabriel, während er den General durch die Seenlandschaft auf dem Campo Zaccaria begleitete.
„Ich hatte dienstlich im Norden zu tun – genauer gesagt am Comer See.“
„Ist dort was gestohlen worden?“
„Nein“, antwortete der General. „Jemand ist ermordet worden.“
„Seit wann ist das Kunstdezernat auch für Leichen zuständig?“
„Wenn das Opfer Verbindungen zur Kunstszene hatte.“
Gabriel blieb stehen und drehte sich nach dem General um. „Sie haben meine Frage noch immer nicht beantwortet“, sagte er. „Was führt Sie nach Venedig?“
„Ich bin natürlich Ihretwegen hier.“
„Was hat eine am Comer See aufgefundene Leiche mit mir zu tun?“
„Der Mann, der sie aufgefunden hat.“
Ferrari lächelte wieder, aber sein Glasauge blickte starr in mittlere Entfernung. Das Auge eines Mannes, der alles weiß, dachte Gabriel. Ein Mann, der sich nicht mit einem Nein abspeisen lässt.
Sie betraten die Kirche durch den Haupteingang vom Campo aus und gingen nach vorn zu dem berühmten Altarbild, das Bellini für San Zaccaria gemalt hatte. Eine Reisegruppe stand davor, und ein Fremdenführer dozierte laut über die erst vor Kurzem abgeschlossene Restaurierung des Meisterwerks, ohne zu ahnen, dass der Restaurator zu seinem Publikum gehörte. Selbst General Ferrari schien das amüsant zu finden, obwohl sein einäugiger Blick bald zu wandern begann. Der Bellini war San Zaccarias wichtigstes Werk, aber in der Kirche hingen auch weitere bedeutende Gemälde von Tintoretto, Palma dem Älteren, van Dyck und anderen. Sie war nur eines der Beispiele dafür, weshalb die Carabinieri eine schlagkräftige Truppe von Kunstdetektiven unterhielten. Italien besaß zwei Dinge im Übermaß: Kunstwerke und Berufsverbrecher. Viele dieser Kunstwerke, vor allem in Kirchen, waren schlecht gesichert. Und viele dieser Kriminellen waren entschlossen, sie alle zu stehlen.
Vom Kirchenschiff zweigte eine kleine Kapelle mit der Krypta des Namenspatrons und einem Gemälde eines hiesigen Kleinmeisters ab, das seit hundert Jahren nicht mehr gereinigt worden war. General Ferrari setzte sich auf eine der Bänke, klappte seinen stählernen Aktenkoffer auf und nahm eine Akte heraus. Aus der Akte zog er ein Foto im Format 18 x 24 cm, das er Gabriel übergab. Es zeigte einen Mann, der an den Handgelenken an einem Kronleuchter aufgeknüpft war. Die Todesursache war nicht zu erkennen, aber klar war, dass der Mann schlimm misshandelt worden war. Sein Gesicht war eine geschwollene blutige Masse, und der Oberkörper wies mehrere blutige Fleischwunden auf.
„Wer war das?“, fragte Gabriel.
„Ein gewisser James Bradshaw, besser als Jack bekannt. Ein Engländer, der wie mehrere tausend seiner Landsleute überwiegend am Comer See gelebt hat.“ Der General machte eine nachdenkliche Pause.
„Den Briten scheint das Leben in ihrem eigenen Land heutzutage nicht sehr zu gefallen, was?“
„Allerdings nicht.“
„Woher kommt das?“
„Das müssen Sie sie selbst fragen.“ Gabriel betrachtete das Foto und fuhr leicht zusammen. „War er verheiratet?“
„Nein.“
„Geschieden?“
„Nein.“
„Sonst wie liiert?“
„Anscheinend nicht.“
Gabriel gab das Foto zurück und fragte, wovon Jack Bradshaw gelebt habe.
„Er hat sich Berater genannt.“
„Auf welchem Gebiet?“
„Er war mehrere Jahre als Diplomat im Nahen Osten tätig. Dann ist er ausgeschieden und hat sich selbstständig gemacht. Offenbar als Berater britischer Firmen, die in der arabischen Welt Geschäfte machen wollten. Anscheinend sehr erfolgreich“, fügte der General hinzu, „denn seine Villa steht in der teuersten Gegend am See. Und er hat eine recht eindrucksvolle Sammlung italienischer Altmeister und Antiquitäten zusammengetragen.“
„Was das Interesse des Kunstdezernats an seiner Ermordung erklärt.“
„Teilweise“, sagte der General. „Schließlich ist’s kein Verbrechen, eine nette Sammlung zu haben.“
„Es sei denn, sie wäre mit nicht ganz sauberen Methoden zusammengetragen worden.“
„Sie sind allen immer einen Schritt voraus, nicht wahr, Allon?“ Der General sah zu dem dunklen Ölgemälde an der Wand der Kapelle auf. „Wieso ist das bei der letzten Restaurierung ausgelassen worden?“
„Das Geld hat nicht gereicht.“
„Der Firnis ist fast undurchsichtig.“ Nach einer Pause fügte Ferrari hinzu: „Genau wie Jack Bradshaw.“
„Er ruhe in Frieden.“
„Das ist unwahrscheinlich, nachdem er so geendet hat.“
Der General musterte Gabriel, dann fragte er: „Hatten Sie jemals den eigenen Tod vor Augen?“
„Leider schon mehrmals. Aber wenn’s Ihnen recht ist, würde ich lieber über Jack Bradshaws Sammlertätigkeit reden.“
„Der verstorbene Mr Bradshaw stand in dem Ruf, Bilder anzukaufen, die nicht wirklich zum Verkauf standen.“
„Gestohlene Bilder?“
„Das haben Sie gesagt, mein Freund. Nicht ich.“
„Haben Sie ihn überwacht?“
„Das Kunstdezernat hat seine Aktivitäten so gut wie möglich überwacht.“
„Wie?“
„Mit den üblichen Mitteln“, antwortete der General ausweichend.
„Ich nehme an, dass Ihre Leute seine Sammlung gründlich und vollständig inventarisieren.“
„Das tun sie in diesem Augenblick.“
„Und?“
„Bisher haben sie nichts aus unserer Datenbank verschwundener oder gestohlener Werke gefunden.“
„Dann werden Sie all die hässlichen Dinge, die Sie über Jack Bradshaw gesagt haben, wohl zurücknehmen müssen.“
„Dass es keine Beweise gibt, bedeutet noch längst nicht, dass es nicht so ist.“
„So spricht ein wahrer italienischer Polizeibeamter.“
General Ferraris Gesichtsausdruck zeigte, dass er Gabriels Bemerkung als Kompliment auffasste. Nach kurzer Pause sagte er: „Über den verstorbenen Jack Bradshaw war alles Mögliche zu hören.“
„Zum Beispiel?“
„Er sei nicht nur ein Privatsammler, sondern an der illegalen Ausfuhr von Gemälden und anderen Kunstwerken beteiligt gewesen.“ Der General senkte die Stimme, als er fortfuhr: „Was erklärt, weshalb Ihr Freund Julian Isherwood wirklich in der Patsche sitzt.“
„Julian Isherwood handelt nicht mit Schmuggelware.“
Darauf gab Ferrari keine Antwort. In seinen Augen waren alle Kunsthändler in irgendeiner Weise schuldig.
„Wo ist er?“, fragte Gabriel.
„In meinem Gewahrsam.“
„Ist Anklage gegen ihn erhoben worden?“
„Noch nicht.“
„Nach italienischem Gesetz dürfen Sie ihn nicht länger als achtundvierzig Stunden festhalten, ohne ihn einem Richter vorzuführen.“
„Er ist vor einem Mordopfer stehend angetroffen worden. Mir fällt schon etwas ein.“
„Sie wissen, dass Julian nichts mit dem Mord an Bradshaw zu tun hatte.“
„Keine Sorge“, antwortete der General, „ich habe nicht vor, zu empfehlen, Anklage gegen ihn zu erheben. Aber wenn bekannt würde, dass Ihr Freund sich mit einem polizeibekannten Schmuggler getroffen hat, wäre sein Ruf ruiniert. Sie wissen recht gut, Allon, dass in der Kunstwelt Wahrnehmung Realität ist.“
„Was muss ich tun, um Julians Namen aus den Zeitungen herauszuhalten?“
Ferrari antwortete nicht gleich; er betrachtete angelegentlich das Foto von Bradshaws Leichnam.
„Warum haben sie ihn wohl gefoltert, bevor sie ihn ermordet haben?“, fragte er schließlich.
„Vielleicht war er ihnen Geld schuldig.“
„Vielleicht“, stimmte der General zu. „Oder vielleicht wollten die Mörder etwas anderes, das noch wertvoller war.“
„Sie wollten mir gerade sagen, was ich tun muss, um meinen Freund freizubekommen.“
„Ermitteln Sie, wer Jack Bradshaw ermordet hat. Und stellen Sie fest, worauf seine Mörder es abgesehen hatten.“
„Und wenn ich mich weigere?“
„Dann machen in der Londoner Kunstszene hässliche Gerüchte die Runde.“
„Sie sind ein billiger Erpresser, General Ferrari, wissen Sie das?“
„Erpressung ist ein hässliches Wort.“
„Ja“, sagte Gabriel. „Aber in der Kunstwelt ist Wahrnehmung Realität.“
4VENEDIG
Gabriel kannte ein gutes Restaurant, das nicht weit von der Kirche entfernt in einem ruhigen Winkel von Castello lag, der von Touristen weitgehend verschont blieb. General Ferrari bestellte üppig; Gabriel schob sein Essen auf dem Teller herum und nippte Mineralwasser mit Limone.
„Sie haben keinen Hunger?“, fragte der General.
„Ich hatte gehofft, heute Nachmittag ein paar Stunden an dem Veronese arbeiten zu können.“
„Dann sollten Sie etwas essen, damit Sie Kraft haben.“
„So funktioniert das nicht.“
„Sie essen nichts, wenn Sie restaurieren?“
„Kaffee und trockenes Brot.“
„Was für eine Art Diät soll das sein?“
„Die Art, die mir erlaubt, mich zu konzentrieren.“
„Kein Wunder, dass Sie so dünn sind.“
General Ferrari ging an den Servierwagen mit den Antipasti und lud sich zum zweiten Mal auf. In dem Restaurant waren außer ihnen nur der Besitzer und seine Tochter, ein hübsches schwarzhaariges Mädchen von zwölf oder dreizehn Jahren. Die Kleine sah der Tochter Abu Dschihads, des zweiten Mannes der PLO, den Gabriel an einem warmen Frühlingsabend des Jahres 1968 in seiner Villa in Tunis erschossen hatte, geradezu unheimlich ähnlich. Die Tat war in Abu Dschihads Arbeitszimmer im ersten Stock geschehen, wo er sich Videos der palästinensischen Intifada angesehen hatte. Das Mädchen hatte alles gesehen: zwei Schüsse in die Brust, damit er nicht fliehen konnte, zwei tödliche Schüsse in den Kopf, alle zu arabischer Revolutionsmusik. An Abu Dschihads Totenmaske konnte Gabriel sich nicht mehr erinnern, aber das von kindlicher Wut verzerrte Porträt des jungen Mädchens hatte einen prominenten Platz in den Ausstellungsräumen seiner Erinnerung. Als der General wieder Platz nahm, verbarg Gabriel ihr Gesicht unter einer deckenden Farbschicht. Dann beugte er sich über den Tisch und fragte: „Wieso ich?“
„Wieso nicht Sie?“
„Soll ich mit den auf der Hand liegenden Gründen anfangen?“
„Wenn Ihnen dann wohler ist.“
„Ich bin kein italienischer Polizeibeamter, sondern geradezu das Gegenteil.“
„Sie haben hier in Italien schon viele Erfahrungen gesammelt.“
„Nicht nur erfreuliche.“
„Ganz recht“, bestätigte Ferrari, „aber dabei haben Sie wichtige Verbindungen geknüpft. Sie haben einflussreiche Freunde – zum Beispiel im Vatikan. Noch wichtiger ist vielleicht, dass Sie auch Freunde unter einfachen Leuten haben. Sie kennen das Land von Nord nach Süd, beherrschen unsere Sprache wie ein Einheimischer und sind mit einer Italienerin verheiratet. Sie sind praktisch einer von uns.“
„Meine Frau ist keine Italienerin mehr.“
„Welche Sprache sprechen Sie zu Hause?“
„Italienisch“, gestand Gabriel ein.
„Auch in Israel?“
Gabriel nickte.
„Keine weiteren Fragen, Euer Ehren.“ Der General verfiel in nachdenkliches Schweigen. „Das wird Sie vielleicht überraschen“, sagte er zuletzt, „aber wenn ein Kunstwerk gestohlen wird oder jemand zu Schaden kommt, weiß ich meistens ziemlich sicher, wer dahintersteckt. Wir haben über hundert Informanten und überwachen mehr Telefone und E-Mail-Accounts als die NSA. Jedes Ereignis im kriminellen Sektor der Kunstwelt löst viel Tratsch aus. Die Netzknoten leuchten auf, wie die Terroristenjäger sagen.“
„Und diesmal?“
„Die Stille ist ohrenbetäubend.“
„Was bedeutet das Ihrer Meinung nach?“
„Dass Jack Bradshaws Mörder sehr wahrscheinlich keine Italiener waren.“
„Irgendeine Idee, woher sie stammen könnten?“
„Nein“, sagte der General und schüttelte langsam den Kopf, „aber die Brutalität, mit der sie vorgegangen sind, macht mir Sorgen. Ich habe in meiner Dienstzeit schon viele Leichen gesehen, aber seine war anders. Was sie Jack Bradshaw angetan haben …“ Er brachte den Satz nicht zu Ende, sondern murmelte nur: „Mittelalterlich.“
„Und jetzt soll ich mich mit diesen Leuten abgeben?“
„Sie kommen mir wie ein Mann vor, der sich zu behaupten weiß.“
Gabriel ignorierte Ferraris Kommentar. „Meine Frau ist schwanger. Ich kann sie nicht allein lassen.“
„Keine Angst, wir behalten sie im Auge.“ Etwas leiser fügte er hinzu. „Das tun wir bereits.“
„Gut zu wissen, dass der italienische Staat uns nachspioniert.“
„Sie haben doch wohl nichts anderes erwartet?“
„Natürlich nicht.“
„Das habe ich mir gedacht. Außerdem, Allon, ist das zu Ihrem Besten. Sie haben viele Feinde.“
„Und jetzt soll ich mir weitere machen.“
Der General legte die Gabel weg und blickte nachdenklich aus dem Fenster, wobei er Gabriel an Bellinis Dogen Leonardo Loredan erinnerte. „Eigentlich merkwürdig“, sagte er nach längerer Pause.
„Was ist merkwürdig?“
„Dass ein Mann wie Sie es vorziehen sollte, in einem Ghetto zu leben.“
„Ich wohne nicht im Ghetto.“
„Aber nahe dran“, sagte Ferrari.
„Mir gefällt dieses Viertel – der beste Sestiere Venedigs, wenn Sie mich fragen.“
„Er ist voller Geister.“
Gabriel sah zu dem Mädchen hinüber. „Ich glaube nicht an Geister.“
Der General lächelte skeptisch und tupfte sich mit der Serviette einen Mundwinkel ab.
„Wie könnte das funktionieren?“, fragte Gabriel.
„Betrachten Sie sich als einen meiner Informanten.“
„Was bedeutet das praktisch?“
„Sie steigen in die Niederungen der Kunstwelt hinab und ermitteln, wer Jack Bradshaw ermordet hat. Den Rest erledige ich.“
„Und wenn ich zuletzt mit leeren Händen dastehe?“
„Ich bin zuversichtlich, dass das nicht passiert.“
„Das klingt wie eine Drohung.“
„Wirklich?“
Der General sagte nichts mehr. Gabriel atmete geräuschvoll aus.
„Ich werde ein paar Sachen brauchen.“
„Zum Beispiel?“
„Das Übliche“, antwortete Gabriel. „Protokolle der Telefonüberwachung, Kreditkartenabrechnungen, E-Mails, Browserchroniken und eine Kopie seiner PC-Festplatte.“
Der General nickte zu seinem Aktenkoffer hinunter. „Alles drin“, sagte er. „Und alle hässlichen Gerüchte, die wir jemals über ihn gehört haben.“
„Außerdem muss ich mir seine Villa und die Sammlung ansehen.“
„Sie bekommen ein Exemplar der Inventurliste, sobald sie fertig ist.“
„Ich will keine Liste. Ich will die Gemälde sehen.“
„Abgemacht“, sagte der General. „Sonst noch was?“
„Ich denke, irgendjemand sollte Francesco Tiepolo mitteilen, dass ich Venedig für ein paar Tage verlassen werde.“
„Und Ihrer Frau auch.“
„ Ja“, sagte Gabriel distanziert.
„Vielleicht sollten wir uns die Arbeit teilen. Ich nehme Francesco; Sie erzählen es Ihrer Frau.“
„Können wir nicht lieber tauschen?“
„Leider nicht.“ General Ferrari hob eine Hand, die mit den fehlenden Fingern. „Ich habe schon genug gelitten.“
Blieb noch Julian Isherwood. Wie sich herausstellte, saß er in der Zentrale der hiesigen Carabinieri in einem fensterlosen Raum, der nicht ganz eine Zelle für Untersuchungshäftlinge, aber auch kein Wartezimmer war. Die Übergabe fand am Pont della Paglia in Sichtweite der Seufzerbrücke statt. Dem General schien es ganz recht zu sein, seinen Gefangenen wieder loszuwerden. Mit seiner verkrüppelten Hand in der Manteltasche blieb er auf der Brücke stehen, und sein Glasauge beobachtete ohne zu blinzeln, wie Gabriel und Isherwood die Markusmole entlang zu Harry’s Bar gingen. Isherwood kippte rasch zwei Bellinis, während Gabriel sich um seine Rückreise kümmerte. Eine Maschine der British Airways startete um achtzehn Uhr und war wenige Minuten nach neunzehn Uhr in Heathrow. „Reichlich Zeit“, murmelte Isherwood, „um Oliver Dimbleby zu ermorden und noch vor den News at Ten im Bett zu sein.“
„Als dein inoffizieller Vertreter in dieser Angelegenheit“, sagte Gabriel, „würde ich dir davon abraten.“
„Du meinst, ich soll Oliver lieber erst morgen liquidieren?“
Gabriel lächelte unwillkürlich. „Der General ist großzügigerweise bereit, deinen Namen aus dieser Sache rauszuhalten“, sagte er. „An deiner Stelle würde ich in London deinen kurzen Zusammenstoß mit der italienischen Polizei gar nicht erwähnen.“
„Er war nicht kurz genug“, sagte Isherwood. „Ich bin nicht wie du, Schätzchen. Ich bin’s nicht gewohnt, hinter Gittern zu nächtigen. Und ich bin’s erst recht nicht gewohnt, über Leichen zu stolpern. Mein Gott, du hättest ihn sehen sollen! Er war regelrecht filetiert.“
„Umso mehr Grund, nach deiner Heimkehr kein Wort zu erzählen“, sagte Gabriel. „Du willst bestimmt nicht, dass Jack Bradshaws Mörder deinen Namen in der Zeitung lesen.“
Isherwood kaute auf seiner Unterlippe, dann nickte er langsam. „Der General glaubt anscheinend, dass Bradshaw mit gestohlenen Gemälden gehandelt hat“, sagte er dann. „Und er scheint mich für seinen Geschäftspartner zu halten. Er hat mich echt in die Mangel genommen.“
„Warst du’s, Julian?“
„Sein Geschäftspartner?“
Gabriel nickte.
„Diese Frage würdige ich gar keiner Antwort.“
„Ich musste sie aber stellen.“
„Ich habe in meinem Berufsleben viele fragwürdige Dinge getan, meistens auf deine Veranlassung. Aber ich habe niemals ein Gemälde verkauft, von dem ich wusste, dass es gestohlen war.“
„Was ist mit geschmuggelten Gemälden?“
„Definiere geschmuggelt“, sagte Isherwood verschmitzt lächelnd.
„Was ist mit Oliver?“
„Fragst du mich, ob Oliver Dimbleby mit gestohlenen Gemälden handelt?“
„Das tue ich wohl.“
Isherwood musste einen Augenblick nachdenken, bevor er antwortete. „Es gibt nicht viel, was ich Oliver Dimbleby nicht zutraue“, sagte er dann. „Aber nein, ich glaube nicht, dass er mit gestohlener Ware handelt. Das war alles nur Pech und der falsche Zeitpunkt.“
Isherwood winkte den Kellner heran und bestellte einen weiteren Bellini. Er wirkte endlich etwas entspannter. „Ich muss zugeben“, sagte er, „dass du der absolut letzte Mensch warst, den ich heute zu sehen erwartet habe.“
„Danke, gleichfalls, Julian.“
„Vermute ich richtig, dass du General Ferrari schon länger kennst?“
„Wir haben unsere Geschäftskarten ausgetauscht.“
„Er ist eine der widerlichsten Kreaturen, denen ich jemals begegnet bin.“
„Bei näherer Bekanntschaft ist er gar nicht so übel.“
„Wie viel weiß er über unsere Beziehung?“
„Er weiß, dass wir Freunde sind und ich schon mehrere Gemälde für dich gereinigt habe. Und wenn du mich fragst“, fügte Gabriel hinzu, „weiß er vermutlich von deinen Verbindungen zum King Saul Boulevard.“
Der King Saul Boulevard war die Adresse des israelischen Auslandsgeheimdienstes, dessen langer, bewusst irreführender Name nur wenig mit seiner tatsächlichen Arbeit zu tun hatte. Für seine Mitarbeiter war er „der Dienst“, und auch Isherwood nannte ihn so. Er war kein Angestellter des Dienstes, sondern gehörte zu den Sajanim, einem globalen Netzwerk freiwilliger Helfer. Dazu gehörten Banker, die Agenten des Dienstes in Notfällen mit Geld versorgten; Ärzte, die sie behandelten, wenn sie verwundet waren; Hoteliers, die ihnen Zimmer gaben, ohne sie einzutragen; und Autovermieter, von denen sie Fahrzeuge bekamen, die nicht nachzuweisen waren. Isherwood war Mitte der siebziger Jahre während einer Welle palästinensischer Anschläge auf israelische Ziele in Europa angeworben worden. Er hatte nur eine einzige Aufgabe gehabt: mitzuhelfen, einen jungen Restaurator und Berufskiller namens Gabriel Allon mit einer glaubhaften Legende auszustatten und sie aufrechtzuerhalten.
„Ich vermute, dass meine Freilassung nicht kostenlos war“, sagte Isherwood.
„Nein“, antwortete Gabriel. „Sie war sogar ziemlich kostspielig.“
„Wie kostspielig?“
Gabriel erzählte es ihm.
„So viel zu deiner Auszeit in Venedig“, sagte Isherwood. „Ich habe anscheinend alles ruiniert.“
„Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann, Julian. Ich schulde dir sehr viel.“
Isherwood lächelte wehmütig. „Wie lange ist’s jetzt schon her?“, fragte er.
„Hundert Jahre.“
„Und jetzt wirst du wieder Vater, sogar im Doppelpack. Ich hätte nie gedacht, dass ich das erleben würde.“
„Ich auch nicht.“
Isherwood musterte Gabriel prüfend. „Die Aussicht, Kinder zu haben, scheint dich nicht zu begeistern.“
„Red keinen Unsinn.“
„Aber?“
„Ich bin alt, Julian.“ Gabriel machte eine Pause, dann fügte er hinzu: „Vielleicht zu alt, um noch mal eine Familie zu gründen.“
„Das Leben hat dir ein miserables Blatt gegeben, mein Junge. Du hast Anspruch auf etwas Glück im Alter. Du bist mit einer schönen Frau verheiratet, die dir zwei schöne Kinder schenken wird. Ich wollte, ich wäre an deiner Stelle.“
„Sei vorsichtig mit deinen Wünschen.“
Isherwood trank einen kleinen Schluck Bellini, äußerte sich aber nicht dazu.
„Es ist noch nicht zu spät, weißt du.“
„Um Kinder zu haben?“, fragte er ungläubig.
„Um jemanden zu finden, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen willst.“
„Mein Verfallsdatum ist überschritten, fürchte ich“, antwortete Isherwood. „Ich bin jetzt mit meiner Galerie verheiratet.“
„Verkauf die Galerie“, schlug Gabriel vor. „Setz dich in einer Villa in Südfrankreich zur Ruhe.“
„Ich würde binnen einer Woche durchdrehen.“
Sie verließen die Bar und gingen die wenigen Schritte zum Canal Grande. Am Ende eines Stegs dümpelte das von Gabriel bestellte Wassertaxi, ein elegantes Mahagoniboot. Isherwood schien es zu widerstreben, an Bord zu gehen.
„An deiner Stelle“, sagte Gabriel, „würde ich aus Venedig verschwinden, bevor der General sich die Sache anders überlegt.“
„Guter Rat“, bestätigte Isherwood. „Darf ich dir auch einen geben?“
Gabriel äußerte sich nicht dazu.
„Sag dem General, dass er sich einen anderen suchen soll.“
„Dafür ist’s zu spät, fürchte ich.“
„Dann sieh dich dort draußen vor. Und spiel nicht wieder den Helden. Du hast viel, wofür es sich zu leben lohnt.“
„Wenn du so weitermachst, verpasst du deine Maschine, Julian.“
Isherwood ging leicht schwankend an Bord des Wassertaxis. Als es mit ihm ablegte, wandte er sich Gabriel zu und rief: „Was soll ich zu Oliver sagen?“
„Dir fällt schon was ein!“
„Klar“, murmelte Isherwood vor sich hin. „Mir fällt immer was ein.“
Dann schlüpfte er mit gesenktem Kopf in die Kabine und war verschwunden.
5VENEDIG
Gabriel arbeitete an dem Veronese, bis die hohen Kirchenfenster in der Abenddämmerung dunkel wurden. Dann rief er Francesco Tiepolo auf seinem telefonino an und teilte ihm mit, er müsse einen vertraulichen Auftrag für General Ferrari von den Carabinieri übernehmen. Einzelheiten nannte er keine.
„Wie lange bist du weg?“, fragte Tiepolo.
„Ein paar Tage“, antwortete Gabriel.
„Vielleicht einen Monat.“
„Was soll ich den anderen sagen?“
„Erzähl ihnen, dass ich tot bin. Das wird Antonio aufheitern.“
Gabriel räumte seine Arbeitsplattform sorgfältiger auf als sonst, bevor er in den kalten Abend hinaustrat. Er folgte seiner gewohnten Route durch San Polo und Cannaregio nach Norden bis zu einer eisernen Brücke, der einzigen Eisenbrücke Venedigs. Im Mittelalter hatte es in der Brückenmitte ein Tor gegeben, das nachts von einem christlichen Posten bewacht wurde, damit die auf der anderen Seite Eingesperrten nicht entkommen konnten. Jetzt war die Brücke leer bis auf eine einzelne Möwe, die Gabriel übelwollend anstarrte, als er langsam vorbeiging.
Nachdem er eine schlecht beleuchtete Unterführung passiert hatte, trat er auf den Campo de Gheto Novo genannten weiten Platz hinaus, das Herzstück des alten Ghettos in Venedig. Er überquerte den Platz und machte vor der Tür der Nummer 2899 halt. Auf einem kleinen Messingschild stand COMUNITÀ EBRAICA DI VENEZIA: JÜDISCHE GEMEINDE VENEDIGS. Er klingelte und wandte dann instinktiv das Gesicht von der Überwachungskamera ab.
„Ja, bitte?“, fragte eine vertraute Frauenstimme auf Italienisch.
„Ich bin’s.“
„Wer ist ich?
„Mach auf, Chiara.“
Der Türöffner summte, ein Bolzen schnappte zurück. Gabriel betrat einen engen Flur und folgte ihm zu einer weiteren Tür, die sich automatisch entriegelte, als er darauf zuging. Sie führte in ein kleines Büro, in dem Chiara adrett hinter einem ordentlich aufgeräumten Schreibtisch saß. Zu einem cremeweißen Pullover trug sie rehbraune Leggings und halbhohe Lederstiefel. Ihr kastanienbraunes Haar fiel ihr bis auf die Schultern und den Seidenschal, den Gabriel ihr auf Korsika gekauft hatte. Er widerstand der Versuchung, ihre vollen Lippen zu küssen. Es erschien ihm unangebracht, die Empfangsdame des Oberrabbiners von Venedig zu küssen, auch wenn sie seine Frau und zugleich die Tochter des Rabbis war.
Bevor Chiara ihn begrüßen konnte, klingelte ihr Telefon. Gabriel setzte sich auf die Schreibtischkante und hörte zu, wie sie eine kleine Krise bewältigte, die eine schwindende Gemeinschaft von Gläubigen betraf. Erstaunlicherweise sah sie noch immer wie die schöne junge Frau aus, die er hier kennengelernt hatte, als er vor zehn Jahren zu Rabbi Jacob Zolli gekommen war, um Informationen über das Schicksal der italienischen Juden im Zweiten Weltkrieg zu erhalten. Damals hatte Gabriel nicht gewusst, dass Chiara eine Agentin des israelischen Geheimdienstes war, die der King Saul Boulevard zu seinem Schutz abgestellt hatte, während er das Altarbild der Kirche San Zaccaria restaurierte. Wenig später hatte sie sich ihm in Rom offenbart, als sie nach einer Schießerei vor der italienischen Polizei hatten flüchten müssen. In der sicheren Wohnung, in der sie festgesessen hatten, hatte Gabriel sich nach Chiara verzehrt, aber er hatte gewartet, bis der Fall gelöst und sie wieder in Venedig waren. Dort hatten sie sich in einem Kanalhaus in Cannaregio in einem frisch bezogenen Bett erstmals geliebt. Gabriel war das vorgekommen, als liebe er eine von Veronese gemalte Schönheit.
Bei ihrer ersten Begegnung hatte Chiara ihm einen Kaffee angeboten. Jetzt trank sie keinen Kaffee mehr, nur noch Wasser oder Fruchtsaft aus einer Plastikflasche, die sie ständig bei sich hatte. Das war vorerst das einzige äußerliche Anzeichen dafür, dass sie nach langem Kampf gegen Unfruchtbarkeit endlich Zwillinge erwartete. Sie hatte sich geschworen, die unvermeidliche Gewichtszunahme nicht durch Fasten oder Sport zu bekämpfen, weil sie darin eine weitere Verrücktheit sah, die die Amerikaner der Welt aufgedrückt hatten. Chiara war im Grunde ihres Herzens eine Venezianerin, und Venezianerinnen kurbelten nicht an Ergometern oder übten mit Hanteln, um Muskeln zu bekommen. Sie aßen und tranken gut, sie hatten Sex, und wenn sie das Bedürfnis nach Auslauf hatten, gingen sie am Lido im Sand spazieren oder zum Zattere hinüber, um ein Eis zu essen.
Chiara legte auf und musterte ihn mit scherzhaftem Blick. Ihre karamellbraunen Augen waren grün gefleckt: eine Kombination, die Gabriel noch nie richtig hatte malen können. Jetzt strahlten sie förmlich. Sie war glücklich, dachte er, glücklicher, als er sie je erlebt hatte. Plötzlich hatte er nicht den Mut, ihr zu erzählen, dass General Ferrari wie die Flut hereingebrochen war und alles verdorben hatte.
„Wie fühlst du dich?“, fragte er.
Sie verdrehte die Augen, nahm einen Schluck aus ihrer Trinkflasche.
„Habe ich etwas Falsches gesagt?“
„Du brauchst nicht dauernd zu fragen, wie’s mir geht.“
„Du sollst wissen, dass ich um dich besorgt bin.“
„Ich weiß, dass du um mich besorgt bist. Aber ich bin nicht sterbenskrank. Ich bin nur schwanger.“
„Was sollte ich dich fragen?“
„Du solltest fragen, was ich zum Abendessen möchte.“
„Ich bin ausgehungert“, sagte er.
„Ich habe ständig Heißhunger.“
„Sollen wir zum Essen ausgehen?“
„Eigentlich habe ich Lust, selbst zu kochen.“
„Ist das nicht zu anstrengend?“
„Gabriel!“
Sie fing an, den schon ordentlichen Schreibtisch noch mehr aufzuräumen. Das war kein gutes Zeichen. Chiara räumte immer auf, wenn sie verärgert war.
„Wie war’s bei der Arbeit?“, fragte sie.
„Nicht sehr spannend.“
„Erzähl mir bloß nicht, dass der Veronese anfängt, dich zu langweilen.“
„Schmutzigen Firnis abzutragen, ist sicher nicht der lohnendste Teil einer Restaurierung.“
„Keine Überraschungen?“
„Bei dem Gemälde?“
„Ganz allgemein“, antwortete sie.
Das war eine seltsame Frage. „Adrianna Zinetti ist als Groucho Marx verkleidet zur Arbeit gekommen“, erzählte Gabriel, „aber ansonsten war’s ein normaler Tag in der Kirche San Sebastiano.“
Chiara betrachtete ihn stirnrunzelnd. Dann zog sie mit der Stiefelspitze die unterste Schreibtischschublade auf und stopfte geistesabwesend ein paar Papiere in einen Ordner. Gabriel wäre nicht überrascht gewesen, wenn sie nichts mit seinem sonstigen Inhalt zu tun gehabt hätten.
„Hast du irgendwas?“, fragte er.
„Du willst mich nicht schon wieder fragen, wie’s mir geht, nicht wahr?“
„Das würde mir nicht im Traum einfallen.“
Sie schloss die Schublade nachdrücklicher als nötig. „Heute Mittag war ich in der Kirche, um dich zu überraschen“, sagte sie dann, „aber du warst nicht da. Francesco hat gesagt, du hättest Besuch bekommen. Er hat behauptet, ihn nicht zu kennen.“
„Und du wusstest natürlich, dass Francesco lügt.“
„Um das zu erkennen, brauchte man kein ausgebildeter Geheimagent zu sein.“
„Bitte weiter“, sagte Gabriel.
„Ich habe die Einsatzzentrale angerufen, um zu fragen, ob jemand vom King Saul Boulevard hier ist, aber die Auskunft bekommen, niemand sei auf der Suche nach dir.“
„Ausnahmsweise nicht.“
„Wer hat dich heute aufgesucht, Gabriel?“
„Dies klingt allmählich nach einem Verhör.“
„Wer war’s?“, fragte sie noch mal.
Gabriel hielt die rechte Hand hoch und legte Ring- und Mittelfinger an.
„General Ferrari?“
Gabriel nickte. Chiara starrte auf ihren Schreibtisch, als suche sie etwas, das nicht an seinem Platz war.
„Wie fühlst du dich?“, fragte Gabriel ruhig.
„Mir geht’s gut“, antwortete sie, ohne aufzusehen. „Aber wenn du mich das noch ein einziges Mal fragst …“
Tatsächlich wohnten Gabriel und Chiara nicht in dem historischen Ghetto Venedigs. Ihre Mietwohnung lag im ersten Stock eines verblassten alten Palazzos in einem stillen Winkel von Cannaregio, zu dem Juden stets Zutritt gehabt hatten. Auf einer Seite lag ein ruhiger Platz, auf der anderen Seite ein Kanal, auf dem ein kleines, schnelles Motorboot für den Fall bereitlag, dass Gabriel zum zweiten Mal in seiner Laufbahn aus Venedig flüchten musste. Tel Aviv hatte allen Grund, um seine Sicherheit besorgt zu sein: Gabriel hatte nach jahrelangem Sträuben zugestimmt, der nächste Direktor des Dienstes zu werden. Bis er das Amt übernahm, würde noch ein Jahr vergehen. Ab dann würde er jeden wachen Augenblick damit verbringen, Israel vor seinen Feinden zu schützen, die es vernichten wollten. Es würde keine Restaurierungen oder längere Venedig-Aufenthalte mit seiner schönen jungen Frau mehr geben – jedenfalls nicht ohne ein Heer von Leibwächtern.
Das Apartment war mit einer hochmodernen Alarmanlage gesichert, die freundlich piepste, als Gabriel die Wohnungstür aufstieß. Er ging in die Küche, entkorkte eine Flasche Bardolino, saß an der Esstheke und hörte die BBC-Nachrichten, während Chiara einen Teller Bruschette vorbereitete. Ein UN-Ausschuss hatte katastrophale Folgen der Erderwärmung vorausgesagt, eine Autobombe hatte in einem Schiitenviertel von Bagdad vierzig Todesopfer gefordert, und der syrische Präsident, der Schlächter von Damaskus, hatte wieder Chemiewaffen gegen das eigene Volk eingesetzt. Chiara runzelte die Stirn und schaltete das Radio aus. Sie betrachtete die offene Weinflasche fast wehmütig. Das tat Gabriel leid, denn er wusste, wie gern sie jungen Bardolino trank.
„Ein winziger Schluck schadet ihnen bestimmt nicht“, sagte er.

![Die Fälschung (Gabriel Allon 22) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a3c78f56d830648941e8541a912ece8c/w200_u90.jpg)
![Der Geheimbund (Gabriel Allon 20) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/b3f0442bd1f64b2b41e586c80150b3c0/w200_u90.jpg)
![Die Cellistin (Gabriel Allon 21) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5bdaaa9cd283b671c252c1b0a29ef6f0/w200_u90.jpg)


![Das Vermächtnis (Gabriel Allon 19) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2dc3fc2736d865447dbf9f082ac49b4/w200_u90.jpg)