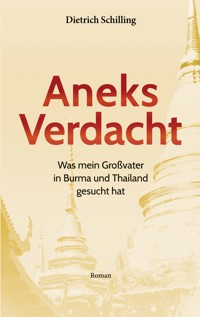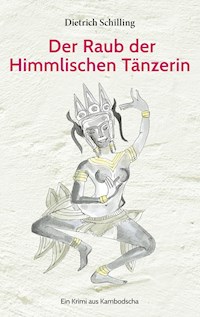
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der windige Antiquitätenhändler Prungnie aus Bangkok hat ein Objekt in Kambodscha "bestellt": eine Apsara, eine der berühmten, in Stein gehauenen Tänzerinnen. Die kleine, auf dem illegalen Markt äußerst wertvolle Figur ist erst kürzlich entdeckt worden. Doch obwohl der Kunstraub raffiniert eingefädelt ist, geht einiges schief. Gemeinsam mit seiner innig geliebten Frau Kunthea gelingt es dem Hobby-Detektiv Nhean den Hintermännern des Verbrechens auf die Spur zu kommen. Die frei erfundene Geschichte ist geprägt von der großen Liebe des Autors zum Weltkulturerbe Angkor sowie den Menschen und ihren Lebensumständen in Kambodscha.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietrich Schilling, Jahrgang 1945, hat nach seinem Germanistik-Studium fast 40 Jahre lang als Hörfunk-Redakteur beim NDR gearbeitet. Er ist verheiratet und lebt als freier Autor in Hamburg.
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Hunderttausend Dollar
Fleisch und Bier
Ein vertrautes Gespräch
Wie wunderbar sie tanzt
Eine private Einladung
Motorengeräusche
Trautes Heim
Die Ärmsten der Armen
Viele Probleme
„Dem geht‘s dreckig!“
Hah Taew
Eine Drohung
Verhandlungen
Ärger für Channary
„Mach es selbst!“
Nheans Verdacht
Besuch beim Mönch
Ein paar Scheinchen
Zwei Zeugen
Kunthea klärt etwas
Ein Zettel
Weicher Sand
Dünne Wände
Das Objekt ist verschwunden
Luft holen und schweigen
Eine riskante Idee
Die Falle
Ein Zufall
Amok
Drei Hälften
Personenverzeichnis
Vorbemerkung
Geschichte und Personen dieses Romans sind frei erfunden. Doch der Ort, an dem er spielt, ist real: Es ist die Stadt Siem Reap in Kambodscha, nahe den weltberühmten Tempeln von Angkor.
Real ist auch das Phänomen des Kunstraubs bzw. der Antikenhehlerei, das dem Roman als Motiv zugrunde liegt. Schätzungen über den weltweiten Umfang dieses äußerst lukrativen kriminellen Deliktes gehen weit in die Milliarden Dollar. Man geht davon aus, dass - nach dem Handel mit Drogen und Waffen - die Antikenhehlerei das international einträglichste illegale Geschäftsfeld ist.
1
Hunderttausend Dollar
„Habt ihr sie?“
Den Telefonhörer dicht ans Ohr gepresst, geht Prungnie ans Fenster und schaut aufs Wasser. Woher kommen die Stimmen und Schreie?
Nicht weit entfernt, am Pin Klao Pier, ist ein Flusstaxi über den Bootsanleger hinausgeschossen. Nur wenige Meter, doch weit genug, dass niemand von Bord kann. Die Fahrgäste, die hier aussteigen wollen, gestikulieren aufgeregt in Richtung Bootsführer, der von seinem Sitz aufgesprungen ist, während sein Assistent sich weit über die Bordwand hinaushängt und hektisch versucht, ihn mit schrillen Tönen aus der Trillerpfeife in die richtige Position zu dirigieren.
Prungnie sieht das, aber er nimmt es nicht wirklich wahr. In Gedanken ist er ganz woanders. Seine Finger krampfen sich um den Telefonhörer. Am liebsten würde er seinem Gesprächspartner sofort an die Gurgel gehen. Denn was der gesagt hat, bringt ihn völlig aus der Fassung. Wütend bläst er eine Qualmwolke gegen das Moskitogitter vor dem Fenster und drückt seine Zigarette aus.
„Ich muss sie aber haben!“, blafft er in den Hörer, „der Kunde wartet.“ Dann bemerkt er, dass der Zigarettenstummel noch glimmt, und bei dem Versuch, ihn endgültig auszudrücken, gerät er mit der Kuppe seines Daumens in die Glut.
„Scheiße!“
Wütend über seine Ungeschicklichkeit, den Finger im Mund, irrt er durchs Zimmer, den Telefonhörer weiterhin am Ohr.
„Bitte?“, fragt der Gesprächspartner am anderen Ende.
Prungnie nimmt den Daumen aus dem Mund.
„Nichts, hab‘ mich nur verbrannt.“
Die Dächer des Wat Phra Kaew, des Königspalastes auf der anderen Seite des Flusses, haben ihren goldenen Glanz bereits eingebüßt. Um diese Tageszeit schimmern sie nur noch matt. Und in wenigen Augenblicken, wenn die Sonne endgültig untergeht, wird es auch damit vorbei sein. Die Hitze, die sich den ganzen Tag über Bangkok ausgetobt hat, lässt schon spürbar nach. Ein versöhnlicher, ein sanfter Abend kündigt sich an. Bis wie aus dem Nichts ein Speedboot auftaucht und die Idylle zerreißt. Mit ohrenbetäubendem Lärm schießt es dicht am Haus vorbei, den schlanken Bug weit aus dem Wasser. Einen Moment später sieht man nur noch die Wolke aus Gischt, die es hinter sich herzieht.
„Und wann?“, schreit Prungnie ins Telefon und lutscht an seinem Daumen. „Ich warte seit einer Woche! Eine ganze, komplette, Scheißwoche!“
Seine Stirn glänzt, er schwitzt. Auf der Rückseite des Hemdes, das er vor kaum einer Stunde frisch angezogen hat, zeichnen sich unansehnliche Flecken ab. Es ist ein teures Hemd von Jim Thompson, aber gegen die Hektik, den Schweiß und die Fettpolster von Prungnie hat es wenig Chancen, seine Eleganz zu bewahren.
„Was heißt ‚so schnell wie möglich‘?
Während er auf die Antwort hört - und das kann er nicht, ohne seinen Gesprächspartner immer wieder zu unterbrechen -, bewegt Prungnie sich langsam zurück zu seinem Schreibtisch. Schwerfällig lässt er sich auf seinen Hocker fallen und zündet sich eine neue Zigarette an. Den ersten Zug inhaliert er tief, als erhoffe er sich davon etwas Entspannung. Dann pustet er den Qualm sofort und in die Länge gezogen wieder aus. Was er hört, scheint ihn ein wenig zu beruhigen. Er streckt die Beine von sich und spielt mit dem Feuerzeug.
„Wenn sie innerhalb einer Woche hier ist: hunderttausend Dollar. Mindestens!“, antwortet er schließlich in einem herablassenden Ton, so kaltblütig und so nebenbei, als kenne er keine Nervosität. „Kommt drauf an, wie sie dann aussieht. Also passt auf!“
Im Gefühl zurückgewonnener Überlegenheit streckt er seine Beine noch ein Stück weiter unter den Tisch, so dass er beinahe das Gleichgewicht verliert und sich nur noch mit Mühe auf dem Hocker halten kann.
„Scheiße!“
„Bitte?“
„Nichts.“
Prungie richtet sich auf und versucht mit der rechten Hand an seinen Rücken zu gelangen. Dorthin, wo es ihn so heftig erwischt hat. „Und wo ist die Übergabe? Wie immer? In Poipet?“ Er kennt den Schmerz, der seine unbeherrschten Bewegungen erbarmungslos abstraft.
„Ja, wie immer. 5000 Baht, und sie ist in Thailand.“
Die Sonne ist inzwischen untergegangen, doch es wird noch einige Minuten dauern, bis die Dunkelheit wirklich einsetzt.
„Nochmal: ihr dürft sie auf keinen Fall beschädigen!“
Prungnie hat sich erneut aufgerappelt und spricht jedes Wort so langsam und eindringlich ins Telefon, als wolle er eine Schlange beschwören. „Der Kunde ist scharf auf sie, und er zahlt sofort. Aber er lässt sich nicht hinhalten. Ihr müsst euch beeilen. Sonst ist er weg.“
Und als wolle er ein dickes Siegel auf seine Worte pressen, drückt er die Zigarette, kaum begonnen, wieder aus. Der Aschenbecher, ein massives Monstrum aus schwarzem Porzellan, ist schon lange nicht mehr geleert worden. Unzählige mehr oder weniger zu Ende gerauchte Kippen bilden ein ekliges Gemenge aus Asche und gelb-bräunlichen Filtern und sorgen für einen üblen Gestank. Kunden, die das Haus und Prungnie kennen, haben gelernt darüber hinwegzusehen. Wer allerdings zum ersten Mal hierher kommt, schüttelt verständnislos den Kopf. Denn das Haus am Fluss, nicht weit von der Brücke, die nach Banglamphoo hinüberführt, macht sonst einen überaus gepflegten Eindruck. Groß ist es nicht. Doch die wenigen, sehr sparsam möblierten Räume sind von einem Architekten gestaltet, der offenbar wusste, was er wollte. Und das war nicht billig. Jeder, der dieses Haus betritt, ist beeindruckt von seiner unaufdringlichen Eleganz. Die Wände überzogen von zartgrauem Maulbeerpapier, und das wiederum durchwirkt von hauchdünnen, kaum sichtbaren Goldfäden; der Fußboden matt glänzendes, sorgsam verfugtes Teak, und vor den Fenstern seidene Vorhänge in Pastell-Tönen, die farblich auf Wand und Hölzer abgestimmt sind. Dazu auf filigranbeinigen, gläsernen Tischchen und in Vitrinen das, womit Prungie sein Geld verdient: Buddhafiguren, Skulpturen, Schmuck und andere Kostbarkeiten aus den verschiedensten Materialien. Aus Holz, Bronze, Porzellan, Stein. Dazu Stoffe und edle Töpferware. Es kommt nicht selten vor, dass die Blicke der Kunden ein wenig ratlos hin und her wandern zwischen dem bulligen, stets schwitzenden, oft groben Prungnie und dem, was er in seinem Laden zum Verkauf anbietet: feine, geschmackvolle Kostbarkeiten, die ein Tourist auf der schnellen Suche nach Souvenirs niemals entdecken würde und schon gar nicht bezahlen könnte. Alle aus längst vergangener Zeit. „Antiquities“ steht neben der Tür auf der Straßenseite des Hauses.
Prungnie zündet sich eine weitere Zigarette an. Er ist ruhiger geworden. Mit dem kleinen Finger der rechten Hand, die die Zigarette hält, zieht er einen Notizblock zu sich heran, reißt, den Telefonhörer zwischen Schulter und Ohr geklemmt, einen Zettel ab und notiert etwas darauf. Ein Datum. Das Datum von morgen. Und während er weiter zuhört, erhebt er sich erneut von seinem Hocker und bewegt sich ein weiteres Mal in Richtung Fenster. Der Fluss ist inzwischen grau geworden, die hunderttausende durcheinander tanzenden Wellen auf seiner Oberfläche haben ihr scheinbar unentwegtes Glitzern eingebüßt. Umso deutlicher zeichnen sich die Plastikabfälle ab, die im Wasser dümpeln und mit der geringen Strömung flussab treiben, Richtung Golf. Unterhalb des Fensters hat sich ein leerer Kanister verfangen und stößt immer wieder gegen die Hauswand. Prungnie sieht und hört das alles nicht. Er starrt hinaus in Richtung Osten. Über den Fluss und über die Stadt hinweg. Dorthin, wo Kambodscha liegt.
„Okay!“, sagt er schließlich und legt den Hörer auf. Dann nimmt er einen tiefen Zug aus der Zigarette und stößt den Rauch Wölkchen für Wölkchen aus. Wie nach dem vorentscheidenden Zug bei einem Spiel, das er nun so gut wie gewonnen glaubt.
2
Fleisch und Bier
Etwa 400 km östlich von Prungnies „Antiquities“-Laden, in einem winzigen Dörfchen namens Paleah, geschieht zur selben Zeit etwas Außergewöhnliches.
Paleah ist ein Dorf wie tausende andere in Kambodscha. Es liegt einige Kilometer nördlich der berühmten Tempel von Angkor, aber noch südlich der von den Koreanern gebauten neuen Umgehungsstraße. Die wenigen Hütten sind ausnahmslos aus Brettern, Ästen und großflächigen Blättern errichtet. Und wie in all diesen Dörfern sind sie halb zerfallen. Kaum eine, die noch ausreichend Schutz bietet vor Sonne oder Regen oder allzu neugierigen Blicken von außen. Und zwischen ihnen, auf der kümmerlichen Grasnarbe, auf dem staubigen Sandboden und sogar in den Zweigen der Büsche: Müll. Wohin man sieht: Müll. Aufgerissene und zerfetzte Plastiktüten, verrottende Papp- und Papierfetzen, rostende Metallreste, zerknüllte Dosen. Kulisse für ein Leben ohne Zukunft. Der einzige Reichtum der Familien, die hier leben, sind ihre Kinder. Halb oder gänzlich nackt laufen die kleineren zwischen den Hütten umher und suchen nach Spielmöglichkeiten.
In der Regenzeit steht das Wasser manchmal knöcheltief zwischen den Behausungen; nach wochenlangen, nicht enden wollenden Niederschlägen ist der Boden vollkommen gesättigt und nimmt keinen einzigen Tropfen mehr auf. Jetzt, in der Trockenzeit, in der kein Wölkchen am Himmel zu sehen ist, kann man sich das nicht vorstellen. Jetzt ist alles knochenhart; die kleineren Äste, die herumliegen, sind so ausgetrocknet, dass sie unter den Füßen zu nichts zerbröseln.
Und genauso ist es mit den Hütten. Auch sie sind dem ständigen Wechsel von Sonne und Regen ausgesetzt. Mal saugen sich die Schilfdächer mit Wasser voll, mal ducken sie sich unter der brutalen Sonnenstrahlung. Die Bäume, die um die Hütten herumstehen, geben nicht mehr viel Schutz. Es sind zu wenige. Sie sind alt, ihre Kronen durchlässig. Alle paar Jahre müssen die Hütten neu gedeckt werden. Dazu muss brauchbares Material herangeschafft werden, das nichts kostet. Und das bedeutet oft weite Wege zu Fuß. Nur zwei Familien in Paleah besitzen ein Motorrad.
In dieser Nacht jedoch ist das Dorf nicht wiederzuerkennen. Es ist Vollmond, die Nacht vor Mahga Puja, in der die Buddhisten alljährlich an die Lehre ihres verehrten Lehrers erinnern. Und in diesem Jahr feiern die Männer von Paleah besonders ausgelassen. Sie lassen es sich ungewöhnlich gut gehen. Niemand kann sich daran erinnern, jemals vorher auch nur ein einziges Mal so üppig gegessen und getrunken zu haben. Denn zum Feiern braucht man Fleisch. Man braucht viel Bier. Das kostet Geld, und davon gibt es so gut wie keines in Paleah. Die Familien, die in den erbärmlichen Hütten mehr überleben als leben, preisen den Tag, an dem sie einen Fisch angeln oder im Wald ein Vögelchen erlegen. Das bisschen Reis, das sie anbauen, reicht nicht mal für sie selbst. Und die paar ausgemergelten Hühner, die herumlaufen, haben kaum Fleisch auf den Knochen. Wenn die älteren Kinder nicht wären, die den Touristen vor den Tempeln billige Halstücher und Bücher, zumeist Reiseführer und Raubdrucke, verkaufen, sähe es übel aus. Die Kinder verdienen, wenn sie Glück haben, wenigstens ein paar Dollar, mit denen man hin und wieder sogar ein Stückchen Fleisch kaufen kann.
Diese Nacht vor Magha Puja ist aber eine ganz besondere in Paleah. In dieser Nacht werden fette, saftige Fleischstücke gegrillt. Auf einem Rost, der ursprünglich als Zaungitter gedient hat. Die Frauen, die sie würzen und mit Öl bestreichen, legen immer neue auf den Grill. Sie scheinen endlose Vorräte zu besitzen. Und dazu fließt das Bier in solchen Mengen, wie es in Paleah noch nie jemand erlebt hat.
Zwei oder drei Männer haben sich breitbeinig auf stark ramponierten Plastikstühlen niedergelassen, doch die meisten sitzen auf schäbigen, ausgefransten Bastmatten oder direkt auf dem Sandboden. Alle schwelgen in dem Gefühl, das sie bisher nur vom Hörensagen kannten: Die Bäuche voll, die Köpfe auf herrliche Weise befreit von Sorgen und Ängsten.
„Wenn der Regen kommt, gehe ich auf den Büffelmarkt und kaufe mir eine Kuh!“
Phirin! Er räuspert sich vernehmlich, um die Bedeutung seiner Worte zu unterstreichen. Dann nimmt er seine Bierdose, trinkt sie demonstrativ und in einem entschlossenen Zug fast ganz leer und kippt den Rest mit Schwung ins Unterholz. Die Männer, die mit ihm am Feuer sitzen, schweigen. Die Köpfe halb gesenkt, suchen sie vorsichtig Blickkontakt mit den anderen, als wollten sie herausbekommen, was die denn von Phirins gewichtigem Satz halten. Und nach und nach erscheint, wie verabredet, ein Grinsen auf den Gesichtern.
„Du, eine Kuh? Wovon denn?“, fragt schließlich einer. Auch er bestätigt die Bedeutung des Gesagten mit einem tiefen Schluck und kippt den Rest vor sich in den Sand. Dann wischt er sich mit dem Ärmel den Mund ab und ist stolz darauf, etwas so Zutreffendes entgegnet zu haben.
Phirin schweigt. Er hat noch nicht so viel getrunken, dass er nicht begreifen könnte, zu welch dummer Bemerkung er sich hat hinreißen lassen; hoffentlich hat seine Frau nichts gehört. Er weiß ja, dass die anderen recht haben. Wovon sollte er, der kaum das Nötige für seine Familie heranschaffen kann, eine Kuh kaufen? Von den paar Riel, die unter seiner Schlafmatte liegen? Erst einmal muss er seine Hütte neu decken. Die letzte Regenzeit hat seinem Dach so übel mitgespielt, dass es eine weitere nicht mehr überstehen würde. Gut, dass Athit, sein ältester Sohn, seit kurzem eine Arbeit als Gärtner hat. Aber wenn er sich vorstellt, wie er auf dem Markt erscheinen und um eine Kuh handeln würde ... nein! Alle würden ihn auslachen.
„Geh nach Hause und pass auf, dass deine dürren Hühner nicht auch noch weglaufen!“, würden sie rufen und sich köstlich amüsieren.
Also schweigt er und greift nach einem neuen Bier. Die anderen können ja nicht wissen, dass diese Nacht manches verändern wird. Und sie dürfen es auch nicht wissen. Beinahe hätte er sich verplappert.
Vor jeder Hütte züngeln die Feuer. Niemand hat sich auf seinen Schlafplatz zurückgezogen. Selbst die kleinsten Kinder tappen noch unsicher im Halbdunkel herum; die Aufregung hält sie wach, auch wenn sie nicht begreifen können, was passiert. Auf ihren nackten Körperchen spielen Licht und Schatten. Rauchsäulen kräuseln sich empor in den Himmel, wo sie allmählich dünner werden. Aber immer noch garen üppige Fleischfetzen auf dem Grill, vom Huhn, vom Schwein, vom Rind, und die dürren Hunde wundern sich über die abgelutschten Knochen, an denen sie schnuppern dürfen, ohne einen einzigen Tritt zu bekommen. Buddha, der sich vor zweieinhalbtausend Jahren für den Mittleren Weg entschieden hat, muss in dieser Nacht großzügig die Augen schließen. Denn kaum jemand im Dorf hält sich an seine Lehre, dem Körper nur das zu geben, was er braucht, und ihm vorzuenthalten, was er nicht braucht.
Den Alltag haben die Männer längst vergessen. Knapp ein Dutzend sind es, die ihr bestes Hemd angezogen haben, sofern sie mehr als eines haben. Geflickt sind sie ohnehin alle. Viel wichtiger ist aber, dass in der Mitte des Kreises, den die Männer gebildet haben, eine Plastikwanne steht. Und darin, eingetaucht in Eiswasser, drängen sich die Bierdosen, so viele, dass man sie kaum zählen kann. Was für ein Leben! Endlich! Keine Minute vergeht, in der nicht einer von ihnen den anderen zuprostet.
„Ein langes Leben für den König!“, ruft Meas. Seine Stimme ist lauter als üblich, wenn auch nicht mehr so zuverlässig.
„Ein langes Leben für den König!“, wiederholen Chankrisna und die anderen im Chor. Phirins Kuh ist längst vergessen. Beim Zuprosten stoßen die Bierdosen jetzt weit ungestümer aneinander als zu Beginn des Abends. Und die Köpfe neigen sich immer tiefer in den Nacken. Man trinkt und trinkt und greift nach den duftenden Fleischhappen, die die Frauen vom Grill genommen und, hübsch angeordnet auf Bananenblättern, für ihre Männer bereitgestellt haben. Die Frauen wissen, was sie zu tun haben.
„Ein langes Leben für euch alle!“, ruft Phirin. „Hundert Jahre für jeden!“ Er hält den anderen auffordernd seine Dose entgegen und bemerkt, dass sie fast leer ist. „Bier!“, verlangt er und schleudert sie weit weg von sich ins Unterholz. Seine Frau fischt missmutig eine neue aus dem Eiswasser, reißt den Verschluss auf und reicht sie ihm.
„Im Trinken bist du gut!“, bemerkt sie.
Es dauert eine Weile, bis Phirin diese Äußerung so versteht, wie sie gemeint ist; er hat Wichtigeres im Kopf.
„Heute ist heute“, antwortet er schließlich, „und ein andermal ist ein andermal.“
Er merkt, dass er seine Stimme nicht mehr ganz sicher unter Kontrolle hat.
„Wenn du mehr verdienen würdest, wäre es weniger ein andermal und öfter heute“, muss er sich daraufhin anhören. Ja, er weiß! Doch wo oder wie soll er mehr verdienen? Er ist froh, dass auf seinem kleinen Feld ein bisschen mehr Gemüse wächst als seine Familie braucht, und dass er davon ab und zu etwas auf dem Markt verkaufen kann. Viel ist es natürlich nicht, was er da verdient. Aber seine Frau wird sich wundern! Ist es denn seine Schuld, dass er nur drei Jahre in die Schule gegangen ist? Nein. Es war ihm so vorherbestimmt. Seine Frau hat keine Ahnung, wenn sie ihn so piesackt. Er wirft den abgenagten Knochen weit von sich in die Büsche, der Bierdose hinterher, und sofort jagen die Hunde los und balgen sich darum.
„Möge diese Nacht nie zu Ende gehen!“, beschwört einer der Männer den Augenblick. Er muss sich schon große Mühe geben, diesen einfachen Satz verständlich über die Lippen zu bringen. Doch alle äußern auf die eine oder andere Weise ihre Zustimmung, erheben ihre Bierdosen und schauen glücksduselig in den Kreis. Was für ein Gefühl! Was für ein Wunder, dass man heute Nacht endlich einmal alles vergessen kann! Wie gut diese kleine Dorfgemeinschaft doch ist! Bier? Bier ist noch genug da! Aber während sie zu Beginn des Abends noch lauthals durcheinander geredet und sich gegenseitig unüberhörbar ihre Taten unterbreitet und sich ihrer Fähigkeiten versichert haben, werden sie allmählich müde und wortkarger in ihrem Glück. Nur noch ab und zu meldet sich jemand zu Wort.
„Wir danken Meas und Chankrisna! Danke für dieses Fest!“
Phirin prostet den beiden zu, und die anderen tun es ihm gleich, soweit sie dazu noch in der Lage sind. Niemand hatte übrigens ernsthaft wissen wollen, woher die beiden das Geld hatten, um so viel Bier und Fleisch zu kaufen. Zuerst war die Überraschung zwar groß, sicher, aber als die beiden sich hinter geheimnisvollem Schweigen verschanzten und nicht zu bewegen waren, auch nur die geringste Andeutung zu machen, gaben sich alle damit zufrieden. Wozu sollte es auch gut sein, mehr zu wissen? Hauptsache, es gab Fleisch und Bier!
„Ein langes Leben für Meas und Chankrisna!“
In immer kürzeren Abständen fordert Phirin zum Trinken auf. Doch nach jedem Zuprosten, unbemerkt von den anderen, legt er seine Dose absichtlich so auf den Erdboden, dass ein großer Teil des Bieres ausläuft und im Sand versickert.
„Bier!“, ruft er dann aufs Neue, „Bier!“
Und während die Frauen ihre Männer ein weiteres Mal bedienen, schaut er zu Chankrisna und Meas hinüber. Als auch sie jeder ein frisches Bier in der Hand haben, prostet er ihnen ein weiteres Mal zu.
„Auf den Grund!“, verlangt er und beobachtet zu seiner Genugtuung, dass, wie alle anderen, auch diese beiden das Bier in einem Zug in sich hineinschütten, bis die Dosen geleert sind. Sein eigenes Bier versickert, unbemerkt von den anderen, erneut im Erdboden. „Eine Schande!“, denkt er. Aber er muss jetzt aufpassen. Er darf nichts mehr trinken, auch wenn es eine Sünde ist. Denn es wird nicht mehr lange dauern, bis die beiden sich auf ihre Matten legen. Und mit den anderen wird es genauso sein.
Vielleicht ..., denkt Phirin, aber er wagt es nicht den Gedanken zu Ende zu führen. Immer öfter schaut er hinüber zu Vanna, seiner Frau. Ohne es sich wirklich einzugestehen, ahnt er, dass er das ohne sie alles nicht schaffen würde. Gut, dass er ein Mann ist und Rechte hat!
Aber wann gibt sie ihm das Zeichen, das sie verabredet haben? Er greift nach einem gegrillten Hühnerbein und beißt hinein. Zu viel Chili, zu wenig Knoblauch! Egal. Gut geröstet ist es jedenfalls. Und saftig. Wie lange hat er nicht in solches Fleisch hineingebissen? Der Knochen, unvollständig abgenagt, landet vor zwei dösenden Hunden im Sand. Sie erschrecken, springen auf und gehen sofort in Verteidigungsstellung. Kaum haben sie begriffen, was da in ihrer Nähe zu Boden gefallen ist, geraten sie in einen wütenden Streit über die seltene Beute.
Die halbe Nacht ist fast vorbei. Die Feuer heruntergebrannt. Die Hölzer glimmen nur noch. Einige der Zecher sind schon in ihren Hütten verschwunden. Dafür haben die Frauen gesorgt, die wissen, wann ihre Männer genug haben. Zwei der jüngeren sind dort eingeschlafen, wo sie gegessen und getrunken haben; die anderen halten sich nur noch mit Mühe wach; sie stieren mit glasigen Augen vor sich hin. Kaum, dass sie noch einen Schluck nehmen. Reden tut keiner mehr.
Phirin aber schläft nicht. Je tiefer die Nacht ist, desto wacher, desto unruhiger wird er. Immer wieder schaut er sich im Halbdunkel nach seiner Frau um. Mal hockt sie hier, mal da. Er weiß, dass er sich auf sie verlassen kann. So eine wie sie hat kein anderer im Dorf. Wenn es ihm nur besser gelänge, sich gegen sie durchzusetzen.
Jetzt steht sie neben dem Brunnen, den eine unbedeutende amerikanische Kirche vor ein paar Jahren gesponsert hat, und der schon lange kein Wasser mehr zutage fördert. ‚Joy of Jesus‘, steht auf dem Schild am Brunnen.
Da! Da ist es! Er hat sich nicht getäuscht. Das Zeichen, das sie verabredet haben! Noch einmal nickt Vanna ihrem Mann zu und verschwindet dann schnell in ihrer Hütte.
3
Ein vertrautes Gespräch
Um dieselbe Zeit gellt ein schriller, hysterischer Schrei durch eine vornehme Villa. Das Haus steht 15 km südlich von Paleah, in dem Städtchen Siem Reap. Auf den Schrei folgt das Geräusch von zersplitterndem Glas, gleichzeitig der scheppernde Aufprall eines metallenen Tabletts auf steinernem Fußboden. Danach ist es still. Mucksmäuschenstill. Mehrere Sekunden lang.
„Pardon!“, sagt schließlich eine Stimme in das Schweigen hinein. Der Mann, dem sie gehört, wischt sich unwillig die Ärmel seines Jacketts ab; der Champagner, der bei dem Zusammenprall aus den Gläsern geschwappt war und sich über seinen Anzug ergossen hat, tropft auf den Fußboden. Dort liegt, vollkommen verstört und zutiefst unglücklich, eine der sehr jungen Hausangestellten. Sie trägt ein kurzes, schwarzes Kleid mit den deutlich erkennbaren Buchstaben „Ch“ am Saum. Um sie herum Glasscherben und Wein-Pfützen. Einige Sekunden ist sie vollkommen benommen von ihrem Sturz. Dann richtet sie sich mühsam halb auf, stützt sich mit der linken Hand auf den Fußboden und reibt sich, dem Weinen nahe, mit der rechten die Augen.
Die zahlreichen Gäste, die sich im Saal und auf der Terrasse zum Garten hin aufhalten, nehmen nur kurz Notiz von dem kleinen Unglück. Als sie sich vergewissert haben, dass nichts Ernsthaftes passiert ist, setzen sie ihre kaum unterbrochenen Gespräche fort. Sie stehen in kleinen Grüppchen zusammen; die meisten halten ein Glas in der Hand, einige eine Zigarette. Der Mann, der das Hausmädchen so unachtsam angestoßen und aus dem Gleichgewicht gebracht hat, überprüft seine Kleidung auf Schäden und mischt sich dann mit einem verunglückten Lächeln wieder unter die Gäste. Das gestürzte, unglückliche Mädchen würdigt er keines Blickes.
„Kannst du nicht aufpassen!“, herrscht Channary das Häufchen Elend auf dem Boden mit unterdrückter Stimme an.
„Steh auf!“
Er streckt ihr eine Hand entgegen. Sie rappelt sich mit seiner Hilfe auf, streicht sich das Kleid glatt und schaut verlegen und schuldbewusst an sich herab. Verletzt hat sie sich nicht bei dem Sturz. Doch als sie sich bei ihrem Helfer bedanken will und ihn anschaut, erkennt sie plötzlich, dass es der Hausherr höchstpersönlich war, der ihr aufgeholfen hat. Im selben Augenblick läuft ihr Gesicht über und über rot an. Channary bemerkt das sofort, nicht ohne tiefe Genugtuung. Er ermuntert sie mit einem für seine Verhältnisse ungewöhnlich freundlichen, gönnerhaften Blick. Dann versetzt er ihr einen leichten Klaps in die Taille.
„Ab in die Küche!“
Das lässt sich das Mädchen nicht zweimal sagen.
„Bring neuen Champagner!“
Kaum ist sie verschwunden, gibt Channary Anweisung, die Scherben zu beseitigen und den Boden trocken zu wischen. Er beherrscht seine Rolle. Lächelt jovial in alle Richtungen und freut sich diebisch darüber, dass so viele Gäste erschienen sind. Und dass er selbst ein weiteres Mal als Gastgeber glänzen kann. Er ist stolz auf die Villa, die man ihm als Residenz zugewiesen hat, und er genießt es jedes Mal ungemein, wenn sie so festlich geschmückt ist wie heute.
Gerade, als er darüber nachdenkt, welcher von den anwesenden wichtigen Persönlichkeiten er sich als nächster zuwenden soll, steuert seine Frau auf ihn zu. Ausgerechnet jetzt, wo er das kleine Malheur so souverän unter Kontrolle gebracht hat.
„Das musste nicht sein!“, zischelt sie. Er schaut sie überrascht an, sich keiner Schuld bewusst.
„Was musste nicht sein?“, fragt er.
„Das mit Botum. Ich hab‘s genau gesehen.“
In Channarys Gedächtnis blitzt sofort die Erinnerung an die Szene auf, die seine Frau meint. Es ist der Moment, als er dem Hausmädchen vom Fußboden aufgeholfen und sich anschließend die tiefe Röte in ihrem Gesicht ausgebreitet hat. Und in dem er ihr, hocherfreut darüber und wunderbar angeregt von ihrer unschuldigen Reaktion, einen ganz besonderen Blick geschenkt hat. Wie herrlich es doch ist, so einem jungen Ding seine Anerkennung zu vermitteln, denkt er.
„Was hast du gesehen?“
Channary schaut Songim, seine Frau, amüsiert an. Er hat es allzu gern, wenn sie ihre Eifersucht so deutlich zeigt, und er lässt sie mit Vergnügen ein bisschen zappeln.
„Du weißt nicht einmal, was Du getan hast?“, faucht sie ihn an und beherrscht nur mühsam ihre Stimme; die Gäste dürfen ihren Auftritt nicht bemerken.
„Ja, was denn? Ich hab sie freundlich angelächelt, sonst nichts“, sagt er, kann es aber nicht lassen im Ton größter Unschuld hinterherzuschicken, dass er sie zugleich ein kleines bisschen trösten wollte. ‚Trösten‘ ist natürlich nicht das richtige Wort. Selbst Channary muss sich eingestehen, dass er es mit dieser Provokation übertrieben hat.
„Lass uns später darüber sprechen!“, sagt er.
Nein, nicht später, sie will sich nicht so einfach abspeisen lassen. Doch als sie ihren Mund zu einer empörten Entgegnung öffnet, denn was fällt ihm ein, sie erst so abzukanzeln und sich dann jeder weiteren Diskussion zu verweigern, nähert sich einer der Gäste, dem Channary unbedingt seine Aufmerksamkeit schenken will. Das muss sogar seine Frau respektieren. Zähneknirschend, wie Channary weiß. Ohne ein weiteres Wort dreht sie sich um und geht und zerbricht sich den Kopf darüber, ob er Botum, der jungen, fraglos hübschen Angestellten, tatsächlich nur freundlich zugelächelt hat. Oder ob mehr dahinter steckt.
Channary hingegen hat den kleinen Vorfall in Sekundenschnelle vergessen. Er hat Besseres zu tun. Geübt kontrolliert er den Sitz seiner silbernen Fliege, setzt sein zuvorkommendstes Lächeln auf, streckt nach westlicher Angewohnheit die Hand aus und begrüßt sein Gegenüber. Es ist Dr. Müller oder der Deutsche, wie er von fast allen Khmer genannt wird, die ihn kennen, ein leitender Mitarbeiter der Angkor Society.
„Wie schön, dass Sie mir die Ehre geben!“, begrüßt ihn der Hausherr nicht besonders einfallsreich. Doch seine Stimme drückt Zufriedenheit aus, denn dieser Gast ist wichtig, seine Anwesenheit schmückt den Gastgeber.
„Aber das ist doch selbstverständlich“, entgegnet der Angesprochene. „Was könnte ich mehr genießen als an diesem Abend in Ihrem Haus zu sein.“ Er lächelt auf eine Art, die nicht erkennen lässt, ob er wirklich meint, was er sagt, oder ob sich hinter seinem Gruß noch etwas anderes versteckt.
Müller, ein junger Archäologe, den die Universität der Stadt Köln zu Forschungszwecken und Ausgrabungen nach Angkor entsandt hat, schmückt sein Kompliment mit einer kaum angedeuteten Verbeugung. Und als Channary den Arm um seine Schultern legt und ihn hinausführt auf die Terrasse - „Darf ich Ihnen etwas zeigen, verehrter Doktor?“ -, folgt er ohne zu zögern. Es kann ihm nur nützen, wenn er auf die Vorschläge des Gastgebers eingeht. Und dafür nimmt er manches in Kauf. So hat er es sich angewöhnt, dessen gelegentlich etwas übersteigertes Selbstbewusstsein entweder zu überhören oder ihm, wenn es gar zu aufdringlich ist, mit vorsichtigem Spott zu begegnen. Manchmal macht es ihm allerdings auch Spaß, seine Eitelkeit ein bisschen zu kitzeln; es amüsiert ihn, wenn Channary darauf reagiert wie eine hungrige Ziege auf ein saftiges Blatt, das man ihr unverhofft vor die Nase hält. Zeigen würde Dr. Müller das jedoch nie. Denn ihm ist wohl bewusst, dass er und Channary dieselben Interessen haben. Er weiß auch, wie gerne Channary ins Nationalmuseum oder gar ins Kultusministerium nach Phnom Penh wechseln würde, und dass er dafür ein paar Erfolge vorweisen muss; die Freuden des Lebens sind in der Hauptstadt noch attraktiver als in Siem Reap. Aber auch er selbst braucht Erfolge. Und in Channary hat er einen Partner auf kambodschanischer Seite, der es ihm nicht allzu schwer macht. Im Übrigen ist es durchaus angenehm, regelmäßig in diesem Haus zu Gast zu sein und die Annehmlichkeiten zu genießen, die ihm hier geboten werden.
Channary führt Dr. Müller hinaus in den äußersten Winkel des Gartens. Dorthin, wo das Grundstück an den Fluss grenzt, der die Stadt von Nord nach Süd in zwei Hälften teilt. Mit der Hand deutet er hinüber auf die andere Seite.
„Das Haus mit der Galerie da drüben, sehen Sie das?“
Müller schaut angestrengt in die vorgegebene Richtung.
„Das mit dem schwarzen Dach?“
„Es ist blau. Aber sie haben recht: im Dunkeln ist es tatsächlich schwer zu erkennen.“
Müller wartet auf weitere Erklärungen, die aber nicht kommen.
„Was ist mit dem Haus?“, fragt er endlich.
Channary schaut ihm ins Gesicht. „Ich könnte es kaufen.“
„Nicht schlecht!“
„Gefällt es Ihnen?“