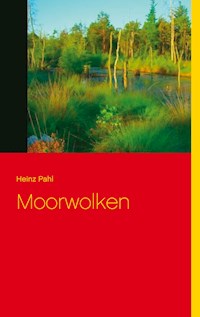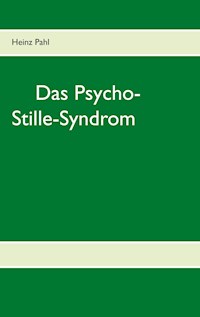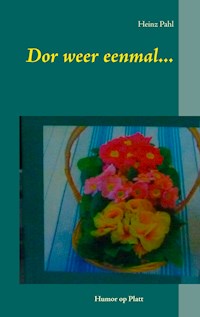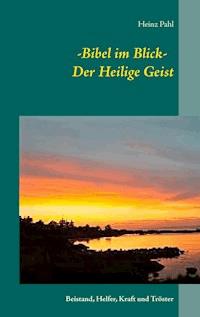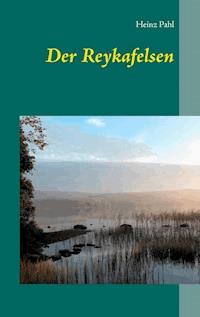
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Thema Antisemitismus und Rechtsradikalität kann man in Deutschland noch nicht von der Tagesordnung streichen. In der Lektüre Der Reykafelsen werden die Schatten der Vergangenheit im Leben des Juden Samuel Schneider zu einer bedrohlichen Realität. Als Überlebender des Holocaust wird ihm der Ort Reepenstein durch die Liebe zu seiner deutschen Frau Amalie zur neuen Heimat. Der Antisemitismus der Väter aus nationalsozialistischer Zeit scheint aber immer noch in vielen Kindern weiterzuleben. Durch eine rechtsradikale Zelle kommt es zu einem terroristischen Anschlag gegen Samuel Schneider und seine Familie. Am Ende bleibt eine Lücke, die nicht mehr ausgefüllt werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Punkt 4 im 25 Punkte umfassenden Programm der NSDAP vom 24 Februar 1920:
„Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfessionen. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.“
Adolf Hitler schrieb in „Mein Kampf“:
„Mit dem Juden gibt es kein Paktieren, sondern nur das harte Entweder – Oder.“
Dieser Roman spielt zum größten Teil in der Elbe-Weser-Region Deutschlands. Über die Einbindung von konkreten geschichtlichen Ereignissen und Personen hinaus, habe ich mir bei dem Handlungsablauf gewisse Freiheiten erlaubt. Die Hauptperson sowie alle anderen Personen und Geschehnisse sind fiktiv. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen oder mit lebenden, beziehungsweise verstorbenen Personen ist rein zufällig.
INHALT
Nichts Neues unter der Sonne
Das Opfer
Familie Schneider
Sachsenhausen
Reepenstein, 9. November 1938
Nachruf
Lieneckes Marschbefehl
Sandbostel
Kapitulation
Minstedt
Hochzeit
21. Juni 1946
Besenmartin
Lienecke kehrt zurück
Der nächste Tag
Strom der Hoffnung
Predigt
Überlandhandel
Maria Cordes
Jeschua hinter den Wolken
Vater und Mutter
Reepenstein ist Zukunft
Joschko David Schneider
Hass
Das Gespräch
13. August 1969
Gerhard Eckepreg
Noch in diesem Jahr in Jerusalem
Schweden
Gösta Stern
Spurensuche
Begegnung
Sarah Schneider
Der Auftrag
Ende April
Gösta und Sarah
Am Ziel
Epilog
Autorenvita
NICHTS NEUES UNTER DER SONNE
Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Jede Wirkung hat ihre Ursache. Jedes aktuelle Ereignis hat seinen historischen Hintergrund. Als Kain seinen Bruder Abel erschlug, waren die Auslöser für diese Tat Neid, Missgunst und Zorn. Die Sünde konnte über ihn herrschen. Wie viel besser wäre es ausgegangen, wenn er über die Sünde geherrscht hätte. So schreit das Blut von unzählig vielen Menschen durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch von der Erde zu Gott. Opfer, die ohne Sinn waren. Immer nur ein Haschen nach dem Wind und am Ende blieben Trauer, Schmerz und Verzweiflung. Unendliches Leid, das keinen Trost fand.
Wie oft versuchen die Menschen dem mächtigen Unsichtbaren zu gefallen. Ihre Opfer sollen ihn gnädig stimmen und ihr Weg soll der Weg zum Allerhöchsten sein. Doch sie laufen nur in die Irre, und ihre Opfer bringen nicht zum Ziel, sondern sind am Ende ohne Hoffnung.
DAS OPFER
Reepenstein, damals noch Reepensteen, war ein Sachsen-Go, eine Ansiedlung gewesen, zu dem etwa einhundertzwanzig Bauernhöfe gehörten. Sie verteilten sich weit über die heutige Ortsgrenze. Der Sachsen-Go Reepensteen gehörte zum Mosidi-Gau, dessen Mittelpunkt etwa bei Hollenstedt lag und dessen südliche Grenze die obere Wümme bildete.
Die Besitzer dieser großen Höfe waren stolze, freie Sachsen gewesen, die sich keinem unterwerfen wollten. Weder Karl dem Großen, noch irgendeinem anderen Menschen, der ihnen das Christentum bringen wollte. Ihre wichtigsten Götter hießen Thor, der Donnergott, und Sachsnot, der Schwertgott. Manch ein weißer Hengst wurde für Thor geopfert und manch ein Mensch aus den Reihen der Gefangenen und Sklaven. Wenn es sein musste, kamen selbst die eigenen Leute dran.
Viel Blut muss vom Reykafelsen in die Reyka geflossen sein, um Thor, dem Donnergott, die Ehre zu geben. Er war ihr Hauptgott. Die Legende berichtet, als das Frankenheer im Anmarsch war, und alle freien Männer mit ihren Waffen am Reykafelsen versammelt waren, verlangte der Sachsenedling Legumind ein Opfer. Stolz und aufrecht stand er vor seinen fast dreihundert schwer bewaffneten Männern. Mit lauter Stimme, über die Köpfe seiner Krieger hinweg, forderte er das Opfer für Thor.
„Es muss ein reines Opfer sein, damit Thor uns mit seinem wütenden Donner wie einen feurigen Gewittersturm über die Franken kommen lässt. Nur er kann unser Schicksal wenden. Ohne ihn gehen wir verloren. Ohne ihn werden wir keinen Sieg haben!“
Kraftvoll bewegte er sich auf dem Reykafelsen, drehte sich einmal um die eigene Achse und schritt die Fläche des Opfersteines ab, fast genau fünf mal fünf Meter im Quadrat. Am äußersten Rand nach Westen blieb er stehen und hob sein Schwert in die Richtung, aus der der Feind heranmarschierte. Ein vielstimmiges Gejohle erhob sich, das sich schließlich zu einem einzigen Namen ausformte:
„Aase! Aase! Aase!“, klang es aus den Kehlen der Männer.
Legumind erstarrte und seine Gesichtszüge wurden so hart wie der Stein, auf dem er stand. Nein, nicht Aase! Sein Herz krampfte sich zusammen. Sein Gesicht wurde bleich wie die Mondsichel hinter dem Morgennebel. Seine Schultern sackten herunter und sein Blick, der auf die johlenden Krieger fiel, schien zu ermüden. Als er Aase vor knapp zwei Jahren hoch im Norden aus der Nähe von Hedeby raubte, war sie für ihn nur eine Sklavin. Arbeiten sollte sie auf seinem Hof, wie die anderen Sklaven. Doch dann verliebte er sich in ihre hellen Haare, die wie goldene Wellen über ihre Schultern fielen.
Er verliebte sich in ihre makellose Haut, die wie weiße Seide in der Sonne schimmerte. Er liebte ihren sanften Gang und das unergründliche Blau ihrer Augen.
Sie wich seinem Blick niemals aus. Als sie endlich in seinen Armen lag, wusste er, dass diese Frau für ihn bestimmt war, dass er sie gesucht und gefunden hatte, und dass niemand mehr sie eine Sklavin nennen durfte.
Jetzt forderten seine Männer ihren Tod, oder war er es gar selbst, der ihren Tod gefordert hatte, als er ein makelloses Kriegsopfer für Thor verlangte? Eisige Stille hatte sich auf die erwartungsvolle Schar kriegserprobter Sachsen gelegt. Mit unnachgiebigem Blick musterten sie ihren Anführer. Legumind sah es ihnen an. Nicht einer würde von seiner Forderung zurücktreten.
Schließlich brach es aus ihm hervor: „Holt Aase! Holt sie endlich!“ Es klang nicht wie ein Befehl, sondern eher wie der Aufschrei einer gequälten Seele.
Ein paar Männer stürzten eilfertig davon. Legumind blieb stumm und unbeweglich auf dem Reykafelsen stehen. Das einschneidige Schwert, der kurze Sax, lag ihm schwer in der rechten Hand. Nach einiger Zeit sah man die Gruppe Krieger zurückkommen. Aase schritt in ihrer Mitte. Das Haupt erhoben, und schon von ferne blickte sie unverwandt auf Legumind, den Mann, dem sie gehörte, im Leben wie im Tod.
Ihre Hände hatte man mit Lederriemen auf den Rücken gefesselt. Am Opferstein angekommen, hob man sie mit einem schnellen Griff hinauf zu Legumind, der seinen Blick nicht von ihren Augen abwenden konnte. Er versuchte Worte zu formen. Es gelang ihm nicht.
Ohnehin sah er ihr an, dass sie alles wusste, und dass sie keine Sekunde zögern würde, sich in seinen Willen zu begeben. Legumind schnitt ihr die Fesseln durch. Ganz sanft, so wie immer, legte er seinen linken Arm um ihre Schultern. Unmerklich nickte sie ihm zu. Er spürte, dass ihr Atem ganz ruhig ging. Die Männer waren in gespanntem Schweigen verstummt. Er richtete seine Augen zum Himmel.
„Allmächtiger Thor!“, rief er mit lauter Stimme. „Nimm dieses Opfer an und gebe uns den Sieg über die verhassten Franken, die unser Land rauben und unser Volk töten. Erweise deine Macht als der Starke und Siegreiche!“
Bei den letzten Worten stieß er Aase, seiner geliebten Aase, das kurze Schwert mitten ins Herz. Als er die junge Frau auf dem Opferfelsen ablegte, war ihm, als hätte er sich selbst getötet.
„Aase, meine einzige Liebe, was habe ich getan?“ Er wollte seine Tat selbst nicht fassen. Doch seine Worte gingen unter in dem Kriegsgeschrei seiner Männer. Schnell wurde Holz herbeigeschafft, um das frisch getötete Opfer als Brandopfer zum Himmel zu schicken.
Inzwischen hatte sich der Himmel mit dunklen Wolken überzogen. Ein Blitz zuckte hernieder, dem Sekunden später ein Furcht erregender Donner folgte. Die Krieger schauten verstört zum Himmel. War ihrem Gott das Opfer nicht angenehm?
Ein Sachse zündete den Holzstoß an. Innerhalb kurzer Zeit schlugen mächtige Flammen zum Himmel, die den Körper der toten Frau zu fressen versuchten.
Der Leib des Opfers sackte in sich zusammen. Doch ehe er völlig von den Flammen aufgezehrt werden konnte, platzte ein gewaltiger Regenschauer über den Reykafelsen und die umstehenden Sachsenkrieger. Die Flammen verlöschten, und zwischen den verkohlten Holzscheiten lag eigenartig verkrümmt, die schwarz verbrannte Leiche der Nordländerin. Der rechte Arm ragte wie in einer beschwörenden Geste gen Himmel.
Die Männer hatten sich noch nicht ganz aus ihrer Erstarrung gelöst, als um sie herum die Franken aus der Deckung des Kiefern- und Tannenwaldes hervorbrachen. Die Übermacht war erdrückend. Trotz des heldenmutigen Kampfes der Sachsen lichteten sich ihre Reihen wie ein Kornfeld, in das die Sichel hineinfährt. Zum Schluss waren es siebenunddreißig Sachsenkrieger, die übrig blieben. Unter ihnen Legumind. Nach einem Marsch von zwei Stunden wurden sie in das Heerlager der Franken gebracht. Man nahm ihnen die Fesseln ab und gab ihnen zu trinken.
Legumind konnte nicht verstehen, dass man sie nicht schon längst niedergemacht hatte. Spät am Abend ließen seine Bewacher einen Mann in einer braunen Kutte durch. Er beherrschte ihre Sprache und begann ihm von dem Gott der Franken zu erzählen. Legumind überlegte immerzu, wo dieser Mann seine Waffe tragen könnte. Er brauchte eine Waffe. Ein Schwert oder wenigstens ein Messer. Das würde ausreichen für seinen eigenen Tod; denn einen Sinn sah er nicht mehr in seinem Leben. Wozu auch?
Den Menschen, für den es sich zu leben gelohnt hätte, gab es nicht mehr, und der Name Aase brannte immer wieder wie ein feuriger Pfeil in seinen Gedanken. Wie würde er ihn jemals anders auslöschen können als durch das Gericht, das er selbst an sich vollzog. Die Götter hatten es ihm nicht vergönnt, in der Schlacht den Tod zu finden. Bis auf wenige Krieger hatten alle Männer im Kampf gegen die Franken den Tod gefunden. Im Sachsen-Go Reepensteen fehlten nun die Männer, die Verantwortung für ihre Höfe getragen und den Schutz für ihre Sippen garantiert hatten. Wird man die Frauen, die Kinder und die alten Leute jetzt auch töten oder sie als Sklaven verschleppen. Es schien keine Zukunft mehr zu geben. Schuld und Versagen hatte ihr Anführer über sie alle gebracht.
Bruder Ortfrid, der Benediktinermönch, trat etwas näher heran. Der Sachse krümmte sich zusammen, so, als wollte er sich vor dem Mann in der braunen Kutte klein und unsichtbar machen. Der Mönch stand ganz ruhig vor dem Sachsenführer.
„Gott liebt dich“, sagte er mit einer Stimme, die keinen Hass in sich trug, „und er möchte deine Seele heilen und retten“, fuhr er fort.
Legumind hob leicht den Kopf und sah in die graugrünen Augen eines Mannes, dessen Gesicht wie ein frisches Lächeln auf ihn wirkte. Bruder Ortfrid erwiderte seinen Blick. Legumind schüttelte den Kopf.
Wie ein Stöhnen brach es aus ihm heraus: „Es gibt keinen Gott, der mir noch helfen kann. Der Tod ist schon in mir!“
Dann wendete er sich zur Seite und schwieg. Die Lippen zusammengepresst, so, als bereute er die Worte, die er ausgesprochen hatte. Der Mönch ließ sich nicht abweisen. Er trat noch einen Schritt auf Legumind zu und legte ihm ganz sanft seine rechte Hand auf den Kopf. Der Sachse zuckte leicht zusammen. Doch er ließ es geschehen. Seine Mutter war die letzte gewesen, die ihm mit dieser Geste Trost und Mut zugesprochen hatte. Vierzehn war er damals. Einen Tag und eine Nacht lang hatte er die Wälder durchstreift und kam dann am frühen Morgen ohne Beute, erschöpft, müde und zerrissen auf dem Hof an. Er bemerkte wohl das verständnisvolle Grinsen der Knechte, die den Misserfolg des Jungen seinem Alter und seiner mangelnden Erfahrung zuschrieben. Das tat weh. Jetzt fühlte er die Hand des Franken auf seinem Kopf, und der Gedanke an seine Mutter, dieser stolzen, aber auch warmherzigen Frau, wurde schmerzhaft lebendig in ihm. Plötzlich hörte er den Mann über sich sprechen, und die Worte flossen wie Öl in sein Inneres und salbten seine Seele.
Er konnte sich hinterher nicht an jedes einzelne Wort erinnern, doch der warme Strom, der von den Haarspitzen bis zu den Fußspitzen lief, den wird er niemals vergessen können. Es war, als wollte dieser Strom nie enden. Er hörte den Namen „Vater“ und „Jesus“ und „Heiliger Geist“ und das „Blut von Golgatha für alle Schuld“, und er merkte, wie seine Seele aufweichte und ein Strom lautloser Tränen über sein Gesicht lief. Und jede Träne trug den Namen Aase. Nie zuvor hatte er geweint.
Der Tapfere, der Krieger, der Anführer. Er vermochte es selbst nicht zu erfassen, warum gerade ihm Tränen aus den Augen liefen, die er nicht aufhalten konnte. Doch danach konnte er wieder atmen. Tief durchatmen und seine Seele schien ihm frei, als wäre ein großer Stein herabgerollt und mit ihm alle Schuld, die sein Leben belastet hatte.
Durch den Benediktinermönch Ortfrid war ihm Gott begegnet. Fast gierig atmete er den frischen Abendwind in sich hinein wie ein Verdurstender, der viel nachzuholen hatte, und als er sein Gesicht dem Franken wieder zuwenden wollte, war dieser schon gegangen. Auch in den nächsten Tagen blieb dieses Gefühl von Freiheit und Hoffnung in ihm, und als er anfing zu zweifeln, hatte er in der darauf folgenden Nacht einen deutlichen Traum, an dessen kleinste Einzelheit er sich am nächsten Morgen noch erinnerte, und es schien ihm, als liefe dieser Traum noch einmal vor seinem geistigen Auge ab.
Wilde Wolken rasten im Halbdunkel am Himmel entlang. Der Sturm peitschte sie wie feurige Rosse, die nicht wussten, wohin sie hätten fliehen können. Er kniete auf einem Hügel nahe der Reyka. Wie durch einen inneren Drang hob er seine Augen zum Himmel empor.
Eine Vision zeichnete sich vor seinen Augen ab. Da war vor ihm das Kreuz, an dem Jesus Christus hing. Am Fuße dieses Kreuzes kniete er und umklammerte den Stamm. Er sah die Nägel, die sie dem Gottessohn durch die Füße und Hände geschlagen hatten. Dann sah er das Haupt Jesu. Die Dornenkrone, die sie ihm auf den Kopf und über die Stirn gepresst hatten.
Das Blut, das herunterfloss und sich am Kreuzesstamm seinen Weg zur Erde suchte. Doch bevor es im Boden versickerte, wurde er ganz davon eingehüllt und sein schmutziger, schuldbeladener Körper verwandelte sich in ein Weiß ohne Flecken, völlig makellos. Schließlich blickte er in die Augen seines Erlösers. Es war Liebe, die reine Liebe, die sich mit seinem Blick verband. Kein Hass, kein Zorn und keine Gewalt waren darin zu erkennen. Eine Liebe, die ihm alles vergab und keine Schuld mehr an ihm fand.
„Jesus! Jesus! Jesus!“, musste er immerzu ausrufen. Ein Name, der tief in sein Herz drang und für ihn zum Namen über alle Namen wurde.
Er schämte sich zutiefst und wusste zugleich, dass der Gott der Christen ihm alle seine Schuld bezahlt hatte durch den eigenen Sohn, Jesus Christus. Der trug jetzt seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft als eine lebendige, ewige Hoffnung.
Er konnte es plötzlich fassen, begreifen und verstehen. Der Heilige Geist hatte ihn in alle Wahrheit geführt. Bruder Ortfrid war noch viele Tage mit ihm zusammen und lehrte ihn die Schrift, das Wort Gottes, und all das, was ein Benediktinermönch wissen muss. Mit unendlich viel Geduld ging er immer wieder auf seine Fragen ein und es verging kein Tag, an dem sie nicht miteinander beteten. Eines Tages, nach dem Morgenmahl, kam Bruder Ortfried, ausgerüstet mit seiner grob gewebten Umhängetasche und einem mannsgroßen Wanderstab zu Legumind. Der Sachse ahnte schon, was kommen würde und Traurigkeit wollte sich seiner bemächtigen.
Doch Ortfrid schüttelte den Kopf.
„Lass es gut sein, Bruder Legumind. Es ist die Zeit, dass ich gehen muss. Der Herr wird mit dir sein alle Tage, und du wirst in seinem Namen das Werk des Glaubens vollbringen.“
Der Benediktinermönch legte ihm noch einmal die Hände auf und segnete ihn. Dann umarmte er ihn als seinen Bruder in Christus und ging ohne ein weiteres Wort. Legumind schaute ihm nach, bis ihn der Eichenwald verschluckt hatte. Sieben Jahre später war unter der Leitung des Benediktinermönches Legumind auf dem Hügel an der Reyka eine wuchtige Kirche mit einem prachtvollen Innenleben entstanden. Es war genau der Platz, an dem sich der Sachse in seiner Vision verzweifelt an den Kreuzesstamm geklammert hatte.
Vom Kirchengebäude aus blickte man auf die Reyka, die sich mit ihren Wassermassen in einem fast rechtwinkligen Bogen nach Norden wälzte. An der Krümmungsspitze des Flusses krallte sich, nicht weit vom Ufer entfernt, der wuchtige Opferfelsen in die Erde. Ein geschichtlicher Zeuge, über dessen Kanten so viel unschuldiges Blut geflossen und in der Erde versickert war. Für Legumind blieb dieser Opferstein Zeit seines Lebens eine Warnung, dem Christengott als dem Gott der Liebe und des Friedens zu folgen und keinem anderen Gott sonst.
Bis zu seinem Lebensende diente er in der Kirche an der Reyka und führte jahraus, jahrein unzählige Menschen zu einem persönlichen Glauben an Jesus Christus. Diese Menschen zu begleiten, und sie zu ermutigen, im Glauben an dem lebendigen Gott festzuhalten.
Dies wurde zu seiner vornehmsten Aufgabe, die er immer wieder durch sein Leben in Wort und Tat zu unterstreichen wusste. Über sein Sterben und seinen Tod weiß die Chronik nichts zu berichten. Doch zurück blieb sein Werk, das den Ort Reepenstein über viele Jahrhunderte geprägt hat. Bis heute.
Die Legumindkirche steht noch auf dem Hügel an der Reyka. Über die Jahrhunderte hinweg hat sie ihr Gesicht immer wieder verändert. Etwas Romanik. Etwas Gotik. Geschichte hinterlässt ihre Spuren. Um die Jahrhundertwende 1900 fiel der Holzturm der Legumindkirche einem Feuer zum Opfer.
Die Chronik spricht von Blitzeinschlag oder gar Brandstiftung während eines heftigen Gewitters. Manch einer munkelte, dass der Oelkers-Bauer etwas damit zu tun gehabt haben könnte. Seine schöne Wiese hatte man für einen Spottpreis zum Gottesacker gemacht. Doch bewiesen wurde es nie. Nun liegt er selbst schon sehr lange begraben in seiner eigenen Wiese. Das Jüngste Gericht wird wohl erst die ganze Wahrheit ans Licht bringen.
Als man den Turm dann wieder aufbaute, diesmal aus soliden Backsteinen mit einem Kupferdach, erhielt er durch den Jugendstil der Jahrhundertwende seine unverkennbare Prägung. Bei aller Veränderung. Eines war über die Jahrhunderte geblieben. Der Name. Legumind, der Begründer der Kirche. Sie war weithin bekannt, die Legumindkirche. Ein Lehrstück architektonischer Bauepochen. Eine Kirche mit Geschichte und Tradition.
Immer häufiger kamen Reisegruppen in Bussen, um einen Nachmittag in dieser reizvollen Kleinstadt zu verbringen.
Eine geschichtsträchtige Ortschaft am Rande der Lüneburger Heid. Und vor dem Kaffeetrinken in der Marktkonditorei gehörten die Kirche, der Reykafelsen und die alte Wassermühle zum festen Besichtigungsprogramm. Besonders die älteren Menschen genossen die gut ausgebauten Wanderwege an der Reyka entlang, um die Kirche herum, von wo man über eine abwärts führende Treppe aus festen Granitstufen ans Ufer der Reyka zum Opferfelsen gelangte, der grau und majestätisch an der Reyka lagerte.
Aus wie viel Jahrtausenden vermochte er seine Geschichte mit den Menschen zu berichten. Wie viel Blut war von diesem Stein heruntergeflossen. Meist standen die Besucher stumm erschauert vor dem Koloss, wenn sie von dem Leiter des örtlichen Heimatvereins hörten, wie eng die Geschichte dieses Opfersteins mit der Geschichte der Reepensteiner Kirche und mit dem Sachsenedling Legumind verknüpft war.
Wenn auch vieles immer wieder in diesem Ort dem zeitlichen Wandel unterlag, der Reykafelsen blieb unverrückbar an seinem Platz. Gleich einem Symbol für das Unabänderliche der Geschichte in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, füllte er die Niederung der Reykakrümmung aus, nicht weit vom Stauwehr, das stets genügend Wasser staute, um das riesige Mühlenrad der alten Wassermühle anzutreiben.
Ganz nahe an den Reykafelsen heran ragte die südliche Begrenzungskante des Mühlenseeplatzes, auf dem im Herbst Würstchenbuden und Karussells aufgebaut wurden.
Besonders wenn Herbstmarkt war, kletterten allzu gern übermütige Jugendliche auf den Reykafelsen und vollführten ihre tollkühnen Tänze.
Einmal im Monat fand auf dem Mühlenseeplatz und in den angrenzenden Straßen ein großer Verkaufsmarkt statt. Händler aus den umliegenden Orten, ja selbst aus Hamburg und Bremen, rollten schon frühmorgens mit ihren Verkaufswagen an, um einen guten Stellplatz zu bekommen.
Die Geschäfte am Ort hatten es gut. Ihr Weg war nicht weit, um die Verkaufsstände aufzubauen. Mittwoch war Markttag. Immer der letzte Mittwoch im Monat. Gegen neun Uhr wimmelte es schon von Menschen zwischen den zahlreichen Buden und Verkaufsständen. Manch einer kam nur, um zu schauen oder hier und da ein paar Worte zu wechseln, um dann endlich nach etwa zwei Stunden den Markt mit einem Kilo Äpfel aus dem Alten Land wieder zu verlassen.
So entwickelte sich der Mühlenseemarkt auch zu einer Börse allerneuester Informationen. Diese wurden meist am Reykafelsen ausgetauscht, nachdem man, wie in alten Zeiten, ein größeres Geschäft mit Handschlag besiegelt hatte. Keiner wusste so recht, warum man für diesen Handschlag an den Reykafelsen ging. Es war einfach so.
FAMILIE SCHNEIDER
Samuel Schneiders Geschichte beginnt in einer besonderen Weise am 9. November 1938 in Berlin. Genau an dem Tag war sein Geburtstag. Er wurde vierzehn Jahre alt. Er erlebte diesen Tag als einen Tag des Hasses und der Angst. Es gab so viel zerbrochenes Glas an diesem Tag, und Scherben auf den Straßen und Gehwegen, und man konnte das Schreien der Menschen hören. Auch das Schreien kleiner Kinder. Grauhaarige Männer und Frauen eilten verstört an den Häuserfronten entlang. Immer wieder hörte man das hämische Brüllen und Fluchen der SA-Männer, die Menschen durch die Straßen schleppten, sie vor sich hertrieben und auf sie einschlugen. Jüdische Kinder, Frauen und Männer jeden Alters. Es wurde kein Unterschied mehr gemacht.
Schaufensterscheiben klirrten immer wieder und Verkaufsartikel und andere Gegenstände flogen aus den Geschäften der Juden auf die Straße. Die Synagogen wurden angezündet. Der Feuerschein flackerte gespenstisch durch dicke Qualmwolken in den dunklen Abendhimmel hinein. Die Synagoge in der Fasanenstraße in Berlin brannte völlig aus. Die Synagoge in der Oranienburger Straße stand in Flammen. Am Ende meldete der Chef des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich: Es sind im Ganzen 191 Synagogen durch Brand zerstört, 76 Synagogen demoliert, 7500 zerstörte Geschäfte im Reich. Es gab keine Zurückhaltung mehr. Nun konnte die Judenhatz so richtig beginnen.
„Kommt, so kommt doch, wir dürfen nicht stehen bleiben!“, drängte Dr. Josua Schneider, Arzt für Allgemeinmedizin, immer wieder, als sie durch die dunklen Nebenstraßen von Berlin-Niederschönhausen eilten.
In der Ferne sahen sie den Feuerschein am nachtschwarzen Himmel zucken. Die Macht des Bösen hatte sich über Berlin gelagert und schlug unerbittlich zu. Endlich hatte der Arzt mit seiner Frau Lea und seinem Sohn Samuel die Körnerstraße erreicht. Die Körnerstraße, nicht weit vom Straßenbahndepot Niederschönhausen entfernt, war eine ruhige Straße. Eine Sackgasse, an deren Ende man durch eine unverschlossene Pforte in eine Schrebergartenkolonie entweichen könnte. Doch das war nicht die Absicht.
„Hier ist es“, flüsterte Josua Schneider. Sie standen vor einem ruhig wirkenden, dreistöckigen Gebäude mit Jugendstilfassade. An der Haustür versuchten sie die Namen zu lesen.
„Halt mal!“ Schneider gab seiner Frau die Aktentasche mit den Papieren.
Sie setzte sich mit Samuel auf den Koffer, in den sie ein paar notwendige Sachen eingepackt hatten. Auf der anderen Straßenseite gingen ein Mann und eine Frau vorbei. Sie drückten sich eng aneinander in den vorgebauten Hauseingang. Nachdem das Paar außer Sichtweite war, nahm Dr. Schneider eine Schachtel Streichhölzer aus der Hosentasche. Mit der hohlen Hand versuchte er den Lichtschein einzugrenzen.
„Hier steht es“, flüsterte er hastig. „Franz Jeschke! Das muss es sein!“
Dem Franz Jeschke hatte Dr. Schneider einmal das Leben gerettet mit einem gewagten Luftröhrenschnitt. Sonst wäre er erstickt an einer zu hart gekochten Kartoffel, die der Franz Jeschke zu hastig und unzerkaut hinuntergeschluckt hatte. Neunzehnhundertdreiunddreißig, das war nun schon einige Jahre her.
Doch damals hatte die Olga Jeschke versichert: „Wenn ihr wirklich mal in Not seid und Hilfe braucht, dann kommt zu mir. Ich werd’ euch dann ganz gewisslich helfen. Gott sei mein Zeuge!“
Ja, das hatte sie damals gesagt, die Olga Jeschke. Jetzt standen sie spät am Abend vor ihrer Tür. Es ging schon auf zwölf zu. Josua Schneider drückte den Klingelknopf.
„Wir haben keine andere Wahl. Heute kommen wir nicht mehr ungesehen heraus aus Berlin!“
Als Olga Jeschke nach einiger Zeit endlich herunterkam und die Tür öffnete, erkannte sie die Schneiders sofort. Erschrecken wollte sich für einen kurzen Moment auf ihrem Gesicht ausbreiten. Doch dann fing sie sich und besann sich schnell. Bevor der Arzt das Warum und Weshalb erklären konnte, forderte sie die drei auf, hereinzukommen. Sie schaute noch kurz die Straße entlang. Es fiel ihr jedoch nichts Verdächtiges auf. Dann schloss sie die Eingangstür. In dem muffigen Hausflur schaute sie dem Ehepaar in die Augen. „Ick hab et vasprochen, wa?“ Josua und Lea Schneider nickten vorsichtig. „Ja, ick, Olga Jeschke, hab et vasprochen, und wat Olga Jeschke eenmal vasprochen hat, det hält se ooch. So is det mit’m Versprechen!“ Sie lachte ein wenig hilflos.
„Warten Se hier, ick hol nur noch den Kellerschlüssel.“
Olga Jeschke eilte die Holztreppe so leise wie möglich hinauf. Ihre Wohnung lag im ersten Stock. Die Familie Schneider stand still und wartete. Das dämmerige Flurlicht verzerrte ihre Schatten an den Wänden zu bedrohlichen Gestalten. Was war eigentlich passiert?
Am Abend des 9. November 1938 erhielt Dr. Josua Schneider gegen neunzehn Uhr einen anonymen Anruf in seiner Praxis Unter den Linden.