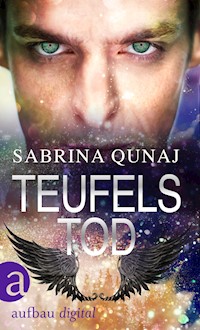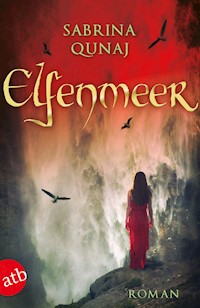9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Geraldines-Roman
- Sprache: Deutsch
Könige fordern seine bedingungslose Treue, doch er dient allein der Gerechtigkeit.
Wales im 12. Jahrhundert: Der junge Maurice de Prendergast wird im Haushalt des Constable of Pembroke, Haupt der einflussreichen Geraldine-Sippe, zum Ritter ausgebildet. Nicht nur seine Verlobung mit einer Tochter der Familie, sondern auch die enge Freundschaft zu Richard de Clare, dem Sohn des mächtigen Earl of Pembroke, verschafft ihm bald erbitterte Feinde. Maurice geht aber als Ritter seinen Weg, macht sich an Richards Seite im englischen Bürgerkrieg verdient und spielt eine entscheidende Rolle bei der Eroberung Irlands. Doch als man eine junge Frau aus seiner Vergangenheit in den Krieg hineinzieht, wird seine Loyalität auf eine harte Probe gestellt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1001
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Wales im 12. Jahrhundert: Der junge Maurice de Prendergast wird im Haushalt des Constable of Pembroke, Haupt der einflussreichen Geraldine-Sippe, zum Ritter ausgebildet. Nicht nur seine Verlobung mit einer Tochter der Familie, sondern auch die enge Freundschaft zu Richard de Clare, dem Sohn des mächtigen Earl of Pembroke, verschafft ihm bald eiserne Feinde. Maurice geht aber als Ritter seinen Weg und macht sich an Richards Seite im englischen Bürgerkrieg verdient. Doch als de Clare und Maurice bewusst wird, dass sie in Wales keine Zukunft haben, beschließen sie, zu neuen Ufern aufzubrechen – nach Irland. Der Fürst Dermot McMurrough, von seinen eigenen Leuten verbannt, verspricht den Normannen Land und Reichtum, wenn sie ihm sein Fürstentum zurückerobern. Die Grausamkeit Dermots nagt aber schon bald an Maurice’ Gewissen – er muss sich schließlich fragen, welchem König er wirklich die Treue schuldet. Und als man eine junge Frau aus seiner Vergangenheit in den Krieg hineinzieht, wird seine Loyalität einmal mehr auf eine harte Probe gestellt …
Weitere Informationen zu Sabrina Qunaj
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
SABRINA QUNAJ
Der Ritter
der Könige
Historischer Roman
Für meinen »kleinen« Bruder Alexander,
der noch ganz Großes vollbringt
Dramatis Personae
Historische Persönlichkeiten sind mit einem * gekennzeichnet
Die Normannen, Flamen und Bretonen in Wales
Maurice de Prendergast*, ein Flame, der für seine Ritterlichkeit bekannt wurde
Philip de Prendergast*, sein Vater
Robert Smith*, ein Ritter von Prendergast
Godebert, ein weiterer Ritter von Prendergast
Goedele, die Frau des Gerbers in Prendergast
Eyck, ein Fischer in Prendergast
Anneka, seine Frau und Heilerin
Vater Nicolas, der Pfarrer von Prendergast
Gilbert de Clare*, der Earl of Pembroke, ein mächtiger Marcher Lord
Isabel de Beaumont*, seine Frau, ehemalige Mätresse König Henrys I
Richard de Clare*, der Sohn und Erbe
Roger de Clare*, der Earl of Hertford (meist als Earl of Clare angesprochen)
Hervey de Montmorency*, der landlose Halbbruder von Gilbert de Clare
Robert de Quincy*, ein Ritter in Richard de Clares Dienst und sein Standartenträger
Walter Bloet*, ein Ritter in Richard de Clares Dienst
Geoffrey Arthur of Monmouth*, ein bretonischer Gelehrter und Kleriker, der für seine Geschichten über König Arthur berühmt wurde
Bruder Albert, ein Mönch in Geoffreys Dienst
Die Geraldines
Die Nachfahren der walisischen Fürstentochter Nesta ferch Rhys und ihres normannischen Gemahls Gerald de Windsor nannten sich »Geraldines« – meist werden aber auch Nestas Söhne von anderen Männern in diese Bezeichnung miteingeschlossen.
William FitzGerald*, Lord von Carew und Emlyn, Constable of Pembroke
Maria de Montgomery*, seine Frau
Odo FitzWilliam*, ältester Sohn und Erbe, Fechtmeister in Pembroke
Griffin FitzWilliam*, ein jüngerer Sohn
Raymond FitzWilliam (le Gros)*, der jüngste Sohn
Maurice FitzGerald*, Lord von Llansteffan und Maurice’ Vorbild
Alice de Montgomery*, seine Frau
Elizabeth FitzMaurice, seine Tochter, sie wird bei ihrer Geburt mit Maurice verlobt
David FitzGerald*, ein bedeutender Kirchenmann in Wales
Milo FitzBishop*, sein illegitimer Sohn
Henry FitzRoy*, Lord von Narberth und Pebidiog, Nestas illegitimer Sohn von König Henry I
Meilyr FitzHenry*, sein Sohn und Erbe, Maurice’ enger Freund
Robert FitzStephen*, Nestas jüngster Sohn von ihrem zweiten Ehemann, Constable von Cardigan
Robert de Barry*, ein jüngerer Sohn von Nestas Tochter Angharad aus Manorbier
Milo de Cogan*, de Barrys Halbbruder aus zweiter Ehe Angharads
Die Waliser
Um Ihnen das Lesen der walisischen Namen zu erleichtern, finden Sie die Aussprache phonetisch geschrieben in Klammern. Dabei ist zu beachten, dass es im deutschen Alphabet oftmalig keinen Buchstaben gibt, um einen Laut des Walisischen korrekt auszudrücken. So soll dies nur eine Annäherung sein. Auch gibt es deutliche sprachliche Unterschiede zwischen Nord und Süd.
Deheubarth, Südwales (De-hay-barth)
Cadell ap Gruffydd* (Ka-dell ap Gri-ffith), der Fürst von Südwales, der um sein Land kämpft
Anarawd ap Gruffydd* (An-ah-raud), sein verstorbener älterer Bruder, der durch Verräter aus Nordwales getötet wurde
Maredudd ap Gruffydd* (Ma-reh-dith), Cadells und Anarawds jüngerer Halbbruder, ein Sohn der berühmten Kriegerprinzessin Gwenllian
Rhys ap Gruffydd* (Rh-ies), Maredudds jüngerer Bruder, der normannische Strategien annimmt
Gwynedd, Nordwales (Gwin-ef)
Owain Gwynedd* (O-wein), der Fürst von Nordwales
Cadwaladr ap Gruffudd* (Cad-wa-la-der), sein Bruder und zeitweiliger Verbündeter der Normannen
Gwent
Elen ferch Davydd, eine Magd in Striguil
Marared ferch Davydd, ihre Schwester von fragwürdiger Moral
Siwan, Marareds Tochter von einem Unbekannten
Davydd, Elens und Marareds Vater, der Pfeilmacher
England
Kaiserin Matilda*, die Tochter des verstorbenen Königs Henry I, die um ihre Krone kämpft
Stephen de Blois*, ihr Vetter, der sich selbst zum König krönte und gegen Matilda kämpft
Eustace de Boulogne*, sein Sohn und Erbe
Henry Plantagenet*, Matildas Sohn, später König Henry II
Eleonor of Aquitaine*, Ehefrau von König Louis VII, später Henrys Ehefrau
William Boterel*, der Constable von Wallingford, der Stephens Belagerung standhält
Roger Fitzmiles*, der Earl of Hereford, der in Wallingford festsitzt
Robert de Beaumont*, Earl of Leicester, Unterstützer Stephens, der zu Henry Plantagenet überläuft
Henry de Blois*, Bischof von Winchester und Stephens Bruder
William d’Aubigny*, Earl of Arundel, Unterstützer Stephens, der um den Frieden verhandelt
Theobald von Bec*, Erzbischof von Canterbury
Thomas Becket*, Theobalds Nachfolger als Erzbischof von Canterbury, der im ständigen Clinch mit König Henry II steht
Robert FitzHarding*, Lord von Berkeley, Kaufmann in Bristol, Unterstützer von Dermot McMurrough
Humphrey de Bohun*, Lord High Constable unter König Henry II
Irland
Um Ihnen das Lesen zu erleichtern, habe ich mich in diesem Buch großteils für die englische Schreibweise der irischen Namen entschieden, obwohl diese erst nach der Eroberung Irlands entstanden ist. Die gälischen Namen sind hier zu Ihrer Information in Klammern angeführt, wobei es auch hier unterschiedliche Schreibweisen gibt.
Leinster
Dermot McMurrough* (Diarmait Mac Murchada), verbannter Fürst, der in England Hilfe sucht
Enna Kinselagh* (Eanna Cinnsealaigh), sein Sohn und Erbe
Donnell Kavanagh* (Domhnall Caemhanach), Dermots ältester und illegitimer Sohn
Aoife McMurrough* (Aoife Ní Diarmait), Dermots unverheiratete Tochter
Morice Regan*, Dermots Sekretär
Ossory
Donnell Mac Gillapatrick* (Domhnall Mac Giolla Phádraig), Fürst von Ossory, der um die Freiheit seines Landes kämpft
Donough Mac Gillapatrick* (Donnchadh Mac Giolla Phádraig), sein verstorbener Vater, der Enna Kinselagh aus Leinster blenden ließ
Triscatal, Champion des Fürsten
Weitere Fürsten und Clanführer
Rory O’Connor* (Ruaidrí Ua Conchobair), Fürst von Connacht, Hochkönig Irlands
Tiernan O’Rourke* (Tighearnán Mór Ua Ruairc), der »Einäugige«, Fürst von Breifne, dem seine Frau von Dermot McMurrough aus Leinster gestohlen wurde
Dermot O’Melaghlin* (Diarmait mac Domnaill Ua Mael Sechlainn), Fürst von Meath und O’Rourkes Schwiegervater
Donnell O’Brien* (Domhnall Ua Briain), Fürst von Thomond, Dermot McMurroughs Schwiegersohn
Faelan Mac Fhaelain*, Clanführer von Offelan
O’More*, Clanführer von Leix
Melaghlin O’Phelan*, Clanführer von Decies
Brian Boru*, erster Hochkönig Irlands und irischer Held
Ostmänner (Dänen und Norweger, einstige Wikinger)
Raghnall*, Stadtführer Waterfords
Sitric*, Stadtführer Waterfords
Hasculf*, Stadtführer Dublins
Der treue Normanne
Gelobt sei der tapfere und treue Feind!
Gib uns noble Feinde, nicht Freunde, die lügen.
Wir fürchten den vergifteten Kelch, nicht den offenen Schlag.
Wir fürchten den alten Hass in neuer Verkleidung.
An Ossorys König gaben sie ihr Wort. Doch als er in ihrem Lager stand, brachen sie ihr Versprechen.
Da erhob Maurice, der Normanne, sein Schwert. Das Kreuz am Heft küsste er und sprach: »So lange, wie dieses Schwert oder dieser Arm Kraft haben, schwöre ich bei dem Kreuz, das Herr über alles ist, bei der Treue und Ehre von Noblen und Rittern, wer Euch berührt, Fürst, durch diese Hand soll er fallen!«
So passierten sie Seite an Seite das Gedränge, und Irland pries den Gerechten und Wahren.
Tapferer Feind! Zuletzt heilt die Wahrheit das Vergangene.
Im großen Herzen Irlands ist Platz für Euch!
Aubrey De Vere
»Inisfail – a lyrical chronicle of Ireland«, 1863
Pembrokeshire, Südwestwales, März 1145
Sein Tod war gewiss. Der Gedanke ärgerte ihn mehr, als dass er ihm Angst einjagte. Aber er konnte ihn auch nicht vertreiben, als der Windhauch eines vorbeizischenden Pfeils ihn an der Wange streifte. Die Geschosse kamen von überallher, brachen aus dem Nebel, der zwischen den dichtstehenden Nadelhölzern waberte und das Unterholz in einen milchigen Schleier hüllte. Die Angreifer verhielten sich ruhig, da war einzig das Surren der Pfeile, immer und immer wieder aus dem Nichts.
»Holt mir diese dreckigen Waliser aus dem Gebüsch!«, rief der Constable of Pembroke über das Geschrei der Männer. Der Constable war Maurice’ Herr, und für gewöhnlich gehorchte er ihm ohne zu zögern, aber dieser Befehl war Selbstmord.
Ein Geschoss nach dem anderen schwirrte an ihm vorbei; das Geräusch wirkte unwirklich laut und schien jedes andere zu verschlucken. Es hüllte Maurice ein, und der Ursprung war einfach nicht auszumachen.
Nach Deckung suchend drehte er sich in der baumumstanden Senke im Kreis. Seine Hand umklammerte das Heft seines Kurzschwertes, das er noch nicht lange besaß und auch noch nie benutzt hatte. Am liebsten hätte er sich den viel zu großen Helm vom Kopf gerissen. Der Nasenkolben tanzte in seinem Blickfeld und gaukelte ihm eine feindliche Bewegung vor, aber er war sein einziger Schutz vor den Walisern. Außer dem gepolsterten Wams, das seinen Oberkörper kleidete, trug er nichts, das Hiebe oder Stiche dämpfen könnte.
Vierzehn Winter hatte er bereits überlebt, und er hatte nicht vor zu akzeptieren, dass dieser Tag sein letzter war. Sie hatten die Rebellen, die unweit von St. Issels gesichtet worden waren, stellen wollen, aber jetzt fanden sie sich in einem Hinterhalt wieder.
»Komm schon, Mann!«
Maurice fuhr herum und entdeckte seinen besten Freund Meilyr, der einem Ritter folgte, Kurzschwert in der Hand, bereit zum Kampf. Meilyr war ebenfalls ein Knappe im Dienst des Constable und nur wenig jünger als Maurice. Dafür aber sehr viel unüberlegter.
Mit einem Fluch auf den Lippen rannte Maurice los, seinem Freund hinterher. Seine Stiefel pflügten durch knöcheltiefes Laub, Zweige knackten unter ihm und verfingen sich zwischen seinen Beinen, doch in all dem Nebel konnte er nicht erkennen, wohin er trat. Er sah nur den Ritter, der einen Schritt vor Meilyr niederbrach.
»Meilyr, komm zurück!«
Aber Meilyr blieb nicht stehen, er eilte Ruhm oder Tod entgegen, und Maurice beschleunigte seine Schritte, streckte die Hand aus. »Beim Gekreuzigten, willst du dich umbringen?« Mit eisernem Griff packte er Meilyrs Schulter und zerrte ihn fort, ungeachtet der Gegenwehr. »Der Constable hat sich auch schon zurückgezogen, komm endlich, hier gehen wir drauf!«
»Lass los, den krieg ich!«
Maurice warf einen gehetzten Blick zum Gestrüpp aus knorrigen Sträuchern und hatte das Gefühl, die hasserfüllten Augen des Feindes zu sehen und eine Pfeilspitze auf sich gerichtet zu spüren. Er konnte nicht länger warten, verstärkte den Griff um Meilyrs Arm und rannte, ohne loszulassen.
Den Blick auf die schwarzen Schemen der Baumgerippe gerichtet torkelte er vorwärts, setzte einen Schritt vor den anderen, stets das Gefühl im Nacken, jeden Moment getroffen zu werden. Er blickte zurück, sah eine huschende Bewegung im Nebel und schob Meilyr aus einem Impuls heraus vor sich. Nicht mehr weit, sagte er sich, gleich haben wir es geschafft. Er sah den Constable, der seine Männer sammelte, und wähnte sich bereits in Sicherheit, als ein brennender Schmerz seinen linken Arm durchzuckte. Es war, als traf ihn ein Feuerstrahl, der sich tief ins Fleisch brannte, und ein schmerzvolles Stöhnen entkam ihm. Beinahe stürzte er, doch er biss die Zähne zusammen und taumelte weiter. Noch war er in der Lage, seine Glieder zu bewegen und Schmerz zu fühlen. Das bedeutete, er war noch am Leben.
Ein unsanfter Stoß in den Rücken warf ihn gegen den Stamm einer Ulme, sein Helm prallte dagegen, und einen Moment lang tanzten Sterne vor seinen Augen. Als er aber über sich das Knurren des Constable hörte, wusste er, wer ihn empfangen hatte.
»Verfluchte Narren, was lauft ihr hier wie die Hühner in der Gegend herum, als wäre Markttag?«
»Ihr habt befohlen, die Waliser aus dem Gebüsch zu holen, Onkel!«, begehrte Meilyr an seiner Seite auf, während Maurice noch zu sich kam und versuchte, aus dem See des Schmerzes aufzutauchen.
Der Constable schnaubte. »Aber nicht kopflos und ohne organisiertes Vorgehen. Außerdem ist das keine Aufgabe für Kinder, ihr haltet euch zurück, habt ihr mich verstanden?«
Maurice blinzelte. Er warf einen Blick auf seinen Arm und atmete erleichtert auf. Er hatte erwartet, das gefiederte Ende eines Pfeils daraus hervorragen zu sehen, doch er war nur gestreift worden.
»Es sind nicht mehr als zehn«, riss ihn die Stimme seines Herrn vom Anblick des Blutes auf seinem Ärmel. »Eher acht. Und da drüben noch einmal so viele.«
»Zwei hinter den verdammten Haselnusssträuchern dort drüben«, fügte einer der Männer des Constable hinzu, was Maurice mit Staunen erfüllte. Es hätte ihn nicht gewundert, wären sie von hundert Angreifern umzingelt gewesen, aber er vertraute auf die Einschätzung seines Herrn. Zwar konnte er kaum verstehen, wie es dem Constable gelang, die Zahl der im Nebel verborgenen Schützen zu erfassen, aber der bejahrte Ritter wusste sicherlich, wovon er sprach. Schließlich war er im Kampf gegen Rebellen aufgewachsen.
Maurice wagte einen kurzen Blick am Stamm vorbei und meinte, eine Silhouette auf der gegenüberliegenden Seite der Senke auszumachen. Oben am Hang bewegte sich etwas Dunkles.
Ein weiterer Pfeil zischte knapp an ihm vorbei, nur dieses Mal kam er aus der anderen Richtung. Maurice fuhr zurück, sah sich um und atmete auf, als er bemerkte, dass das Geschoss aus den eigenen Reihen stammte. Der Feind saß nicht in seinem Rücken. Zwar befanden sich in ihrer Begleitung nur eine Handvoll Schützen, zwei mit einer nur langsam ladbaren Armbrust, aber sie stellten die vor ihnen aufragende Hangseite unermüdlich unter Beschuss. Der Rest ihrer Truppe wartete in nervenzerreißender Anspannung. Sie waren nicht mehr als zwei Dutzend Mann, und wenn den Walisern nicht bald die Pfeile ausgingen, bliebe niemand übrig. Zwei lagen schon mitten in der Senke, mit Pfeilen gespickt. Die anderen drückten sich genauso wie Maurice gegen die Stämme der jahrhundertealten Bäume dieses Waldes, die mit Efeu überwuchert waren.
»Warte nur, bis ihre Köcher leer sind.« Meilyr stieß ihn an, was Maurice mit einem zischenden Laut des Schmerzes beantwortete.
»Was ist? Haben sie dich etwa getroffen? Ist es schlimm?«
Maurice winkte ab, er konnte nichts sagen, doch Meilyr schien zufrieden, denn er fuhr sogleich aufgeregt fort: »Heute werde ich einem von ihnen die Kehle durchschneiden.« Er klopfte mit seinem geweihten Kurzschwert auf die Erde und grinste. Augenscheinlich konnte er es nicht erwarten, die Waffe zum Einsatz zu bringen, die er genauso wie Maurice vor zwei Wochen zur Erhebung zum Knappen erhalten hatte. Maurice hingegen konnte darauf verzichten, den Rebellen von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Zwar war er ebenso stolz auf seinen Fortschritt in der Ausbildung zum Ritter und auch darauf, dass sein Vater ihm ein Kurzschwert geschenkt hatte, doch dies schien kein kluger Moment, um Gottes Segen zu testen. Pater Simon hatte das Schwert geweiht, so wie bei allen Knappen, aber Maurice fragte sich, inwiefern ihn diese Gnade gegen die tödlichen Pfeile der kampferprobten Waliser schützen konnte.
»Was ist mit dir, Mann? Keine Lust auf eine Schlägerei? Lass uns zu denen hinüberlaufen und ihnen zeigen …«
»Hör zu, Meilyr, ich erwarte keine Dankbarkeit dafür, dass ich dich gerade davor bewahrt habe, wie ein Wildschwein abgeschossen zu werden, aber wenigstens etwas Verstand! Mach einen Schritt hinter diesem Baum hervor, und ich hätte dich gleich ins Verderben laufen lassen können. Hätte mir ein Hemd erspart.«
Meilyr hob die Schultern. »Dann sterbe ich wenigstens mit Ruhm und Ehre.«
»Mit Ruhm und Ehre? Was soll daran ruhmreich sein, in den sicheren Tod zu laufen?«
»Besser, als sich hier zu verstecken. Wenn du Angst hast …«
»Maul halten!« Der Constable warf ihnen von seinem Stamm aus einen vernichtenden Blick zu, und Maurice drückte sich noch ein wenig fester gegen den Baum in seinem Rücken. Meilyr mochte ihn für ängstlich halten, aber für Maurice gab es einfach einen Unterschied zwischen Mut und unbedachter Waghalsigkeit, den Meilyr nicht verstand. Irgendwann würde sein Freund noch in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Maurice kannte die Konsequenzen eines kopflosen Vorsturms. Von einem Waliser niedergestreckt zu werden, war wohl das kleinere Übel, wenn man die Wutausbrüche des Constable bedachte. Meilyr hingegen kümmerten die Folgen seiner Taten selten, Maurice hatte schon viel zu oft als Stimme der Vernunft gedient. In den sieben Jahren Freundschaft hatte er gelernt, den hitzköpfigen Kameraden zu bändigen, ohne ihn zu verlieren. Dies war anscheinend wieder ein solcher Moment, und so ließ er den Jüngeren nicht aus den Augen.
»Pfeile«, knurrte plötzlich einer der Bogenschützen und erinnerte ihn an seine Pflichten. Die Pferde waren beim ersten Geschoss aus dem Dickicht durchgegangen und mit Bündeln voller Pfeile und Proviant verschwunden, doch die Bogenschützen hatten ein paar Beutel, die jetzt direkt neben ihnen lagen. Im Moment konnten sie nicht danach greifen, und so atmete Maurice tief durch und schob sich ein Stück vom Stamm weg. Er warf Meilyr neben sich einen Blick zu, der ein verwegenes Grinsen im Gesicht trug, das nichts Gutes bedeuten konnte. Zu seiner Erleichterung schob sich der Knappe aber nur durch das nass verfaulte Laub zum nächsten Baum, und Maurice tat es ihm gleich. Der Geruch feuchter Erde stieg ihm in die Nase, und er presste sich so fest gegen den Boden, dass er selbst bald völlig durchnässt war. Seine Finger bohrten sich in den kalten Untergrund, als er plötzlich ein Vibrieren unter sich wahrnahm.
Verwirrt hielt er inne und horchte. Ein dumpfes Geräusch, ferner Donner.
Vorsichtig hob er den Kopf, dabei bemerkte er, dass auch die anderen einen Blick aus ihren Verstecken wagten. Es kamen keine Pfeile mehr. Es war nichts zu sehen, alles war ruhig, bis plötzlich Schreie von der feindlichen Seite der Senke her erschollen. Die Rufe in der fremden Sprache der Waliser klangen nach einer Warnung, und im nächsten Moment zerrissen die Nebelschleier und gaben Rebellen frei, die den Hang herabliefen – geradewegs auf sie zu.
»Holt euch die Bastarde!« Der Constable sprang auf die Füße und stürmte gemeinsam mit seinen Männern hinter den Bäumen hervor.
Maurice blieb keine Zeit, um nachzudenken. Wie an Fäden gezogen schoss er hoch, rannte zu den am Boden verstreuten Pfeilen, die bei der Flucht aus dem Köcher gefallen waren, sammelte sie auf und eilte zu den Schützen. Beim ersten Stamm, den einer der Männer als Deckung benutzte, ließ er sich wieder fallen und wagte einen Blick nach vorne. Der Schweiß floss ihm trotz winterlicher Kälte unter dem Helm hervor in die Augen, und verschwommen erkannte er den näher kommenden Feind, der auf den Constable und seine Männer traf. Hinter den Rebellen, am Kamm des flachen Hangs, drang der Ursprung des Donners aus dem Nebel. Eine Reihe schwerer normannischer Schlachtrösser galoppierte übers modrige Laub herab, brach durch Gebüsch und Farn und gab den Blick auf eine Gruppe bewaffneter Krieger frei, die zu Fuß folgten. Manche der Waliser stürzten im Lauf, von Pfeilen niedergerissen, andere trafen auf den Constable oder wurden von hinten von den Neuankömmlingen mit ihren Lanzen niedergemacht. Als wehe ein Sturm durch den Wald, fielen die Feinde, die Nebelschleier färbten sich rot, einer nach dem anderen ging zu Boden, bis jeder einzelne Rebell besiegt war und nur noch Maurice’ Gruppe aufrecht stand. Die Schützen neben Maurice jubelten und hoben ihre Bögen über die Köpfe, und Meilyr, der sich auf halbem Weg die Senke hinab befand, führte einen Freudentanz auf. Er war nur wenige Schritte von den dahingestreckten Walisern entfernt.
Ein Fluch entrang sich Maurice, als er erkannte, was sein Freund getan hatte. Anstatt die Bogenschützen zu unterstützen, hatte er sich tatsächlich ins Getümmel geworfen. Gut, dass er nicht weit genug gekommen war und die Reiter diesen Platz schneller als ein Orkan von Feinden leer gefegt hatten. Im Moment konnte Maurice sich nicht länger auf ihn konzentrieren, denn sein Blick fiel auf das Wappen der Neuankömmlinge, das hier in Südwales jedes Kind kannte.
»Strongbow!«
Alle liefen aufgeregt den Hang hinab, und auch Maurice beeilte sich hinterherzukommen, um den Earl of Pembroke aus der Nähe zu sehen. Es kam selten vor, dass Vertreter solch hohen Adels sich in dieser hart umkämpften Ecke des barbarischen Wales blicken ließen.
Gilbert de Clare kam in diesem Landstrich einem König gleich, er war der nobelste Lord, den die meisten Menschen hier je zu Gesicht bekommen hatten. Über ihm stand nur noch der König im entfernten England selbst. Majestätisch saßen seine Ritter auf ihren schweren Schlachtrössern, die unruhig tänzelten und mit großen Hufen auf den Boden stampften. Trotz des muskulösen Baus und dem hohen Wuchs verströmten die Pferde mit den edlen Köpfen und dem dampfenden Fell eine eigene Eleganz. Anders als die zottigen Ponys der Waliser.
Die gelben und roten Farben der im Wind wehenden Standarte und der Waffenröcke der Männer leuchteten im tristen Grau des Winterwaldes. Die Knappen und Bogenschützen, die sich daranmachten, die Gefallenen zu durchsuchen, und verschossene Pfeile einsammelten, trübten das prächtige Bild nicht.
Mit seinen vierzehn Jahren hatte Maurice genügend Tote gesehen, dass ihn diese nicht schreckten. Schließlich war sein Leben hauptsächlich von Krieg geprägt gewesen. Der Anblick der besiegten Waliser erfüllte ihn eher mit Erleichterung, da er diesen Tag überlebt hatte. Zwei Männer seines Herrn waren nicht so glücklich gewesen.
»Ich will verdammt sein.« Der Earl of Pembroke schwang sich schwerfällig in seinem Kettenhemd aus dem Sattel und reichte den Helm einem abgemagerten Jungen in Maurice’ Alter. Dieser blickte scheu drein und presste das Stück Metall an die hagere Brust, während der Earl mit einem befreiten Schnauben den Kopf schüttelte. Sandfarbenes Haar, mit einer Spur ins Rötliche, flog um das von grauen Bartstoppeln gezeichnete Gesicht. Zwar wirkte es strähnig und an den Schläfen ergraut, aber der Earl schien immer noch kräftig und kampflustig. Sein Ausdruck hatte etwas Flegelhaftes an sich, das sich verstärkte, als er auf den Constable zuging.
»Da will ich meine Burg besuchen«, donnerte er in gespielter Entrüstung und warf seine muskulösen Arme in die Luft, »mit meinem Kastellan trinken, und wo finde ich ihn?« Er klopfte dem Constable auf die Schulter und zeigte ein verblüffend jungenhaftes Grinsen. »In Pembroke sagte man mir, du wärst auf Rebellenjagd, mein Freund. Ich dachte, du kannst ein paar zusätzliche Schwerter gebrauchen.«
Der Constable zuckte mit den Achseln, in seinem Gesicht offenbarte sich wie üblich keine Spur von einem Lächeln. »Unnötig, aber willkommen, Mylord. Es waren nur Gesetzlose, die sich hier herumtrieben, keine von Cadells Schwurmännern. Wir waren gerade dabei, sie zum Teufel zu schicken.«
»Du kannst nicht leben, ohne dich mit den Lauchfressern anzulegen, was?«
»Es liegt mir im Blut. Familienzwistigkeiten konnten mich noch nie schrecken.«
Diese Worte entlockten dem Earl ein schallendes Lachen. »Jaja, ihr und eure Familienzwistigkeiten. Ich kann mich wohl glücklich schätzen, dass du auf der richtigen Seite geboren wurdest und mit deinem kräftigen Arm mich, anstatt die Rebellen unterstützt.«
»Meine Vettern werden auch noch lernen, wer über dieses Land herrscht. Alles nur eine Frage der Zeit.« Die beiden klopften sich noch einmal auf die Schultern und traten schließlich über ein paar Tote hinweg. Dabei befahl der Earl, die Körper der Gefallenen aus der Truppe des Constable auf Pferde zu heben, damit sie mitgenommen und bestattet werden konnten. Die Waliser sollten bleiben, wo sie waren. Sogleich machten sich alle an die Arbeit, während der Earl und der Constable an den Rand der Senke schritten und leise miteinander sprachen.
Maurice warf seinem Freund Meilyr einen Blick zu. Der Knappe schob gerade sein Schwert zurück in die Scheide und hätte nicht fröhlicher aussehen können. Der Constable hatte von Familienzwistigkeiten gesprochen, und wieder einmal fragte Maurice sich, warum es seinem Herrn so leichtfiel, gegen Rebellen zu kämpfen. Noch nicht einmal Meilyr schien Skrupel zu haben, das Schwert gegen seine Landsleute zu erheben. Dabei war Meilyr, genauso wie der Constable, mit den Rebellen verwandt. Einst war Südwales ein walisisches Fürstentum gewesen, ehe die Normannen mit ihren Schiffen den Kanal überquert und England im Sturm erobert hatten. Auch Maurice’ Vorfahren aus Flandern waren an der Invasion beteiligt gewesen, und nach der Einnahme von walisischen Gebieten hatte sein Großvater hier Land zugesprochen bekommen. Der einheimische Fürst dieser Gegend war in der Schlacht gefallen und hatte zwei Kinder hinterlassen: Die Tochter Nesta war als Gefangene nach England geschickt und an einen der Invasoren verheiratet worden, während der Sohn Gruffydd den Kampf um sein verlorenes Fürstentum eröffnet hatte. So stammten der Constable, Meilyr und viele andere der Umgebung von der walisischen Prinzessin Nesta ab, die ein Leben unter den normannischen Eroberern geführt und ihre Kinder zu Normannen erzogen hatte. Die Anführer der Rebellen waren hingegen Söhne ihres Bruders Gruffydd und führten sein Werk des Freiheitskampfes weiter. Der Älteste von Gruffydds verbliebenen Söhnen war vor zwei Jahren durch Verrat eines Verbündeten gestorben, doch es gab immer noch drei Brüder, die nicht müde wurden, normannische Burgen anzugreifen, zu plündern und zu brandschatzen. Sie waren Vettern des Constable und doch Feinde. Manchmal kam Maurice das alles absurd vor. Ihm war bewusst, dass er von den Einheimischen als Eindringling, Eroberer und Unterdrücker angesehen wurde, aber er war hier geboren und aufgewachsen, genauso wie sein Vater. Dieses Land war sein Zuhause, und er würde es verteidigen.
Das Lachen des Earls riss ihn aus seinen Gedanken, und er blickte zurück zu den beiden hohen Herrn. »Wo ist dein Pferd?«, wollte der Earl vom Constable wissen, als er sich zwischen den Bäumen umsah. »Sag nicht, die Waliser haben dich aus dem Sattel geschossen.«
»Dafür braucht es einen Schützen wie Euch«, erwiderte der Constable und strich mit der Hand über die grauen Bartstoppeln, die sein großporiges und leicht aufgeschwemmtes Gesicht zeichneten. Goldene Locken, die immer noch dicht und glänzend waren, fielen ihm in den Nacken. Wäre er dem Alkohol nicht so zugetan, hätte man ihm vielleicht angesehen, dass er der Sohn der schönsten Frau Englands und Wales’ war. »Durchgedreht sind sie, die elenden Viecher. Als hätten sie diese schreienden Bastarde nie zuvor gesehen. Drei sind auf und davon.« Er spuckte aus und deutete schließlich in Maurice’ und Meilyrs Richtung. »Ihr zwei da! Los, sucht die Pferde. Heute noch. Und traut euch nicht, ohne sie in Pembroke aufzutauchen.«
»Mylord.« Maurice unterdrückte ein Stöhnen. Er war müde. Den ganzen Tag war er marschiert, und der Rückweg lag auch noch vor ihm. Er wusste, der Constable würde nicht erlauben, dass sie in einer der benachbarten Burgen unterkamen, die alle paar Meilen auf einem Hügel thronten, um das Gebiet zu sichern. Stattdessen mussten sie sich bis Pembroke Castle zurückschlagen, und das würde ewig dauern. Noch länger, da sie in diesem verwunschenen Wald auch noch die Gäule suchen mussten, die bestimmt längst nach Hause in ihren warmen Stall gelaufen waren. Das taten sie schließlich immer. Aber keinen dieser Gedanken sprach er laut aus. Sogar Meilyr hielt den Mund, denn sie hatten früh gelernt, dass Widerworte mit unerfreulichen Konsequenzen einhergingen. So war Maurice in der Lage, die Kettenhemden der gesamten Garnison von Pembroke Castle in kürzester Zeit auf Hochglanz zu polieren. Die Stimme der Vernunft, für die ihn viele hielten, schien stets zu versagen, wenn sie für ihn selbst, anstatt für andere sprechen sollte.
Nieselregen setzte ein, und da Maurice abends keine Strafarbeiten erledigen wollte, zog er sein Kurzschwert aus der Scheide und setzte sich in Bewegung. Meilyr kam an seine Seite, und so schlurften sie durchs Laub den Hang hinauf. Es blieb nur zu hoffen, dass sie ihre Waffen nicht benutzen mussten, denn es mochten immer noch Waliser dort draußen sein. Jetzt, da die normannischen Lords damit beschäftigt waren, in England einen Bürgerkrieg um die Thronfolge auszufechten, nutzten die Waliser den Moment, um ihr Land zurückzuerobern. Noch gelang es dem Constable und den anderen aus der Gegend, die Rebellen im Zaum zu halten, doch das Erstarken der Feinde war spürbar. Der Tod des ältesten von Gruffydds Söhnen hatte die Waliser nicht nachhaltig geschwächt, und so dauerte der Kampf an. Meist hielten die Rebellenführer zwar Abstand zu ihren normannischen Vettern, aber herrenlose Banden auf Raubzügen verirrten sich immer wieder in diese Gegend.
»Jungs, wartet!« Die befehlsgewohnte Stimme des Earls ließ ihn erstarren. Maurice blickte über die Schulter zurück und sah den hohen Adligen, der den schmächtigen Jungen von vorhin nach vorne winkte.
»Richard, du gehst mit den beiden. Kann nicht schaden, wenn du mal unter Kerle kommst und dich bewegst, anstatt ständig am Rockzipfel deiner Mutter zu hängen.«
Maurice tauschte einen Blick mit Meilyr, doch sein Freund schien ebenso verblüfft. Jedermann hier wusste, dass Strongbows Sohn Richard hieß, und das feine Gewand des Jungen ließ tatsächlich auf eine hohe Geburt schließen. Doch Maurice konnte sich nicht vorstellen, dass der Earl derart abweisend mit seinem einzigen Sohn und Erben umging. Noch nicht einmal der Constable, der alles andere als zimperlich war, trug so viel Verachtung in der Stimme, wenn er mit seinen Kindern sprach. Doch als der hagere Junge aus dem Nebel trat und auf Maurice und Meilyr zuging, sah Maurice rotes Haar unter dem Helm hervorlugen. Graue Augen, die etwas Gehetztes an sich hatten, blickten ihm aus dem sommersprossigen Gesicht entgegen. Der Junge hatte immer noch die feinen Züge eines Kindes, anders als beispielsweise Meilyr, dem die Ecken und Kanten eines Mannes anzusehen waren – womit er sich natürlich bei jeder Gelegenheit brüstete, besonders, da er sich vor Mädchenherzen kaum retten konnte.
Die Ähnlichkeit zwischen dem Earl und Richard war aber zu deutlich, um noch Zweifel zu haben.
»Willkommen in Pembrokeshire«, begrüßte Maurice den Leidensgenossen und machte eine weit ausholende Geste, die das nasse und trostlose Gebiet des walisischen Waldes umfasste. »Manch einer bezeichnet diesen Ort auch als das Ende der Welt.«
»Und ich dachte, von dort komme ich.« Richard de Clare, Strongbows Sohn und damit Erbe eines der mächtigsten Barone Englands, schlug in die dargebotene Hand. »Hier liegt zumindest kein Schnee. England wird davon erdrückt.«
»Du wirst feststellen, Mann«, Meilyr setzte sein charakteristisch schiefes Lächeln auf, »der Regen hier ist auch nicht viel besser. Vor allem, wenn man entlaufene Gäule sucht.«
»Fällt mir nicht schwer, das zu glauben.«
»Also, du bist der zukünftige Earl of Pembroke, hm?« Maurice suchte immer noch nach etwas an dem Jungen, das er mit der Stärke Strongbows in Verbindung bringen konnte. Doch mehr als das karottenfarbene Haar und die Sommersprossen hatte der halbwüchsige Adlige mit seinem Vater wohl nicht gemein. Es blieb abzusehen, ob der Sohn des Barons in der Abgeschiedenheit von Wales Schwierigkeiten machte oder ein eher angenehmer Geselle war. Maurice war von Natur aus misstrauisch, und er wusste nicht, ob ihm dieses Eindringen gefiel. Mit dem Grafensohn an der Seite galt es Vorsicht walten zu lassen und zu überlegen, bevor er sprach. Zwar war Maurice ebenso der Erbe einer Burg, so auch Meilyr, aber ihre Familien konnten nicht mit den de Clares verglichen werden. Sie waren einfache Landritter, die sich ein Lehen erkämpft hatten, während der Neuling aus einem uralten normannischen Adelsgeschlecht stammte.
»Mein Name ist Richard de Clare«, sagte der Grafensohn etwas steif, nickte ihm aber freundlich zu, fast schon etwas schüchtern. Maurice erwiderte das Nicken.
»Und ihr seid …«
»Meilyr FitzHenry von Narberth.« Meilyr wies mit dem Daumen auf Maurice. »Und das ist mein griesgrämiger Freund Maurice de Prendergast. Keine Sorge, der taut noch auf. Er ist Flame, die sind anders.«
Maurice verdrehte die Augen. Sein Arm brannte, und er wollte endlich die Pferde finden, etwas essen und schlafen. »Fall nicht zurück«, sagte er an de Clare gewandt, da er sich an die Worte des Earls über Mutters Rockzipfel erinnerte. »Wir kennen die Gegend hier und marschieren schnell. Wäre ja eine Schande, wenn du dich verirrst.«
De Clare hob die roten Augenbrauen, doch ehe er etwas erwidern konnte, ertönte die Stimme des Constable aus der Senke zu ihnen hoch. »Wollt ihr ein paar Decken und etwas Ale, um es euch gemütlich zu machen, Ladys? Verschwindet endlich!«
Einer weiteren Aufforderung bedurfte es nicht, sie drehten sich schleunigst um und machten sich auf den Weg. Schließlich war der Constable nicht für seine Geduld bekannt.
Zu Maurice’ Überraschung fiel de Clare nicht zurück, sondern bewegte sich behände und zügig über Wurzeln und durch stachelige Sträucher hindurch. Eine Weile sprach niemand, stattdessen hielten sie nach den Pferden Ausschau.
Schließlich fanden sie die ersten Spuren der schweren Rösser im aufgeweichten Waldboden. Der Nebel verzog sich dank des Regens, und so war die Schneise durchs Unterholz deutlich zu sehen.
»Die sind zurück zur Burg«, brummte Meilyr, als er auf ein Knie niederging und den Hufabdruck in Augenschein nahm. Sein Blick fiel zum niedergetrampelten Farn und zu den abgeknickten Zweigen der Sträucher, und er schnaubte entrüstet. »Fressen sich im Warmen die Bäuche voll und lassen uns hinterherlaufen.«
»Wäre nicht das erste Mal«, seufzte Maurice und sah hoch zum Himmel. Zu dieser Jahreszeit wurde es früh dunkel, und sie mussten sich beeilen, um die Spur nicht zu verlieren. »Sehen wir zu, dass wir weiterkommen. Ich habe keine Lust, hier draußen zu übernachten.«
»Wäre auch nicht das erste Mal«, grinste Meilyr, wobei er sich bestimmt darüber im Klaren war, dass meist er die Verspätungen verschuldete. Der Knappe sammelte ständig herumliegendes Holz ein, um daraus mit einem Messer Figuren zu schnitzen. Eine filigrane Arbeit, über die Maurice nur den Kopf schütteln konnte. Seine Hände waren für das Führen eines Schwertes geschaffen, nicht für das Erstellen winziger Holzpferde. Genauso wenig für das Formen von Schriftzeichen, wie Pater Simon irgendwann in müder Resignation hatte feststellen müssen.
Heute schien Meilyr aber keine Augen für Holz zu haben, denn sein Blick fiel auf Maurice’ Arm. Sofort legte er seine Stirn in Falten. »Eine schöne Sauerei«, stellte er fest und schob den zerfetzten Ärmel aus mehreren Lagen übereinandergelappten Leinens hoch. Die Wolle, die dazwischen hervorquoll, hatte sich rot verfärbt. »Sieht grässlich aus. Hast du den Pfeil etwa für mich eingesteckt?«
»Nur ein Kratzer«, winkte Maurice ab, auch wenn ihn die Kraft der walisischen Bögen jedes Mal aufs Neue zugleich erschreckte und auch mit Bewunderung erfüllte. Er wollte sich nicht vorstellen, was geschehen wäre, hätte er das Wams nicht getragen.
»Du solltest den Arm verbinden«, meinte de Clare, der die Wunde jetzt ebenso betrachtete, doch Maurice winkte ab.
»Ein Kratzer«, wiederholte er und setzte seinen Weg fort. Die Situation war ihm peinlich. Schlimm genug, dass er getroffen worden war, jetzt wollte er nicht auch noch bemitleidet werden. Schon gar nicht vom Sohn des Earls, den er noch nicht wirklich einschätzen konnte. Freund oder Feind? Das war auf einer Burg, inmitten ständig aufbrandender Scharmützel, bei einem Leben unter einem ganzen Haufen ambitionierter Gleichaltriger, und einem von Wettbewerb bestimmten Alltag schwierig zu erkennen.
Doch de Clare ließ sich nicht so leicht abwimmeln. Vielleicht war er seinem Vater doch ähnlicher als anfangs angenommen. »Ich verbinde die Wunde«, beschied er und hielt ihn an der Schulter fest. »In der Burg solltest du sie dann noch gründlich auswaschen.«
Maurice fuhr zu ihm herum. »Kümmere dich um deinen eigenen Mist«, knurrte er unter Schmerzen, doch de Clare sah ihm ungerührt in die Augen.
»Die Wunde wird brandig werden«, sagte er mit seiner sanften Stimme, die im Widerspruch zum unbeugsamen Tonfall stand. »Du bekommst Fieber und verlierst deinen Arm. Aber wenn du Karriere als einarmiger Ritter machen willst …«
Ein wütendes Schnauben war alles, was Maurice darauf erwiderte. Er wollte endlich zurück. Ewig würde er dieses scheußliche Brennen nicht aushalten, und so riss er mit den Zähnen einen Streifen des Leinens ab und reichte es seinem Gegenüber. »Etwas übertrieben, aber wenn du darauf bestehst, Grafensöhnchen.«
De Clare zuckte mit den Schultern und nahm das Leinen entgegen. »Ich habe oft genug gesehen, was ein Kratzer mit einem Mann anstellen kann. Es gibt bessere Arten zu sterben.«
Maurice stutzte. »Ich dachte, du warst bis jetzt bei deiner Mutter. Wo hast du Männer an Kratzern sterben sehen?«
»Ich war in England und diente meinem Vater als Knappe.«
»Im Krieg?!« Maurice hätte nicht verblüffter sein können. Weshalb, in Gottes Namen, behauptete der Earl dann, sein Sohn würde nur an Rockzipfeln hängen?
Plötzlich neugierig beobachtete er den konzentrierten Ausdruck im Gesicht des jungen Adligen, während dieser seinen Arm verband. Im Grunde konnte Maurice froh sein, noch keinen richtigen Krieg erlebt zu haben. Die Scharmützel mit den Walisern waren bestimmt harmlos im Vergleich zu dem, was man sah, wenn ganze Heere aufeinanderprallten. Der Earl hatte seinen Sohn so dargestellt, als wäre dieser ein Schwächling, und das äußere Erscheinungsbild wirkte tatsächlich wenig angsteinflößend. Aber in den grauen Augen de Clares erkannte Maurice, dass er bereits mehr gesehen hatte als alle Knappen von Pembroke zusammen.
»Hast du Schlachten erlebt?«, fragte er, auch wenn er wusste, dass sich Knappen im Hintergrund hielten.
De Clare blickte nicht auf, sondern knotete aufmerksam das Leinen. »Keine sonderlich großen wie etwa bei Lincoln – da war ich noch zu jung. Aber ich war bei meinem Vater, als er vor knapp zwei Jahren Salisbury mit dem König einzunehmen versuchte. Er wollte Matildas Nachschublinie unterbrechen, nur kamen wir nicht weiter als zur Abtei von Wilton. Matildas Bruder war von unserem Vormarsch gewarnt worden und griff mitten in der Nacht an. Es war nicht sehr schön. Der König wurde fast gefangen genommen … schon wieder. Seitdem hat es ein paar Scharmützel gegeben, aber nichts, das ihr hier nicht auch hättet.«
Maurice senkte den Blick, er hatte den Jungen völlig falsch eingeschätzt. »Es tut mir leid.«
Verwundert sah de Clare auf, aber Maurice winkte ab und wechselte das Thema. »Dann kommst du geradewegs aus England?« Er wusste nicht, wie es in England war und was ein Bürgerkrieg anrichtete, aber er hatte eine gute Vorstellungsgabe.
»Nein, wir machten Halt in Striguil – das liegt noch in Wales, wenn auch ganz im Osten an der Grenze, direkt am Fluss Wye. Meine Mutter lebt dort, und mein Vater rekrutiert in seinen Grafschaften weitere Männer für den König.«
Maurice schnaubte ob der Sinnlosigkeit dieses Krieges. »Es heißt, der König kann nicht gewinnen. Es heißt, er ist schwach.«
Abrupt blickte de Clare auf. Einen Moment lang wirkte er erschrocken, doch ehe er etwas sagen konnte, kam Meilyr an ihre Seite. »Na los!« Der Knappe wies zum zertrampelten Unterholz. »Für Plaudereien bleibt immer noch Zeit. Lasst uns erst die Gäule finden, ehe wir hier Wurzeln schlagen.«
Brummend marschierten sie weiter, und es kam Maurice mit seiner Verletzung so vor, als stapfte er eine Ewigkeit durch die Nässe.
Die Wolken jenseits der Wiesen färbten sich blutrot und kündigten den Sonnenuntergang an. Die Wälder lagen endlich hinter ihnen, und das Gras der Weiden knirschte unter ihren Stiefeln, da es bereits deutlich kühler wurde. Immer weiter marschierten sie gen Westen, dabei hielten sie sich abseits der Straßen, um den Spuren zu folgen. Die vielen Wasserläufe des Flusstals erschwerten ihr Weiterkommen, und so verbrachten sie den Weg hauptsächlich fluchend. Ihre Stiefel versanken in eisig kaltem Schlamm, sie passierten Bäche und Felder, umgingen Sümpfe, und selbst de Clare drückte seinen Unmut aus, wenn Meilyr anhielt, um Holzstücke aufzuheben, sie zu überprüfen und dann wieder wegzuwerfen oder in seinen Gürtel zu stecken. Maurice’ Arm schmerzte deutlich mehr, er hatte das Gefühl, als fräßen sich Würmer durch sein Fleisch, was seine Laune nicht gerade besserte. Aber zumindest liefen sie keinen Rebellen über den Weg. Zumeist wagten sich diese nicht so weit in den Südwesten, und bis Pembroke Castle waren sie Jahrzehnte nicht mehr gekommen. Die Burg galt gemeinhin als uneinnehmbar und thronte auf einer felsigen Erhebung, die zu drei Seiten vom Fluss umschlossen wurde.
De Clare beobachtete das Umland sehr genau, und das lag wohl nicht nur daran, dass er nach Rebellen oder Gesetzlosen Ausschau hielt. Schließlich würde all das mal sein Land werden. Der schmächtige Junge wirkte stets wachsam und konzentriert, als erwarte er hinter jedem Baum einen feindlichen Schützen. Müdigkeit schien er überhaupt nicht zu kennen, anders als Maurice. Bereits vor Sonnenaufgang war er aus seinem Strohlager gezerrt worden, um in den Osten zu marschieren und die Rebellen zu stellen. Er hatte einen Kampf beobachtet, dem Tod ins Auge gesehen, und der beschwerliche Weg zurück raubte ihm die letzten Kräfte.
Als sie die Burg endlich erreichten, war sie nur noch als schwarzer Schemen im Dämmerlicht zu erkennen, über den leuchtende Punkte der Fackeln tanzten. Müde stapften sie zwischen den von Hecken und Erdwällen gesäumten Katen der Bauern und Handwerker hindurch und blickten sehnsüchtig zu den Rauchfahnen, die mit verheißungsvollem Duft aus den Strohdächern aufstiegen.
»Auch schon da?«, riefen die grinsenden Wachen am Tor der Palisade, als sie verdreckt und müde dort ankamen. »Wo habt ihr denn die Pferde gelassen? Der Constable hat uns aufgetragen, keinen von euch einzulassen, wenn ihr die Gäule nicht dabeihabt.«
»Lass die Scherze, Guy«, stöhnte Maurice und schob sich an dem Wachmann vorbei. »Sind die Pferde zurückgekommen oder nicht?«
Guy lachte und wuschelte ihm durchs Haar, was Maurice hasste, in seiner Erschöpfung aber ohne Kommentar hinnahm. »Keine Sorge, Junge. Wir haben sie eine Meile von hier eingefangen.«
»Danke.« Damit blieb ihnen zumindest der Zorn ihres Herrn erspart. Maurice wollte sich gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, hätten die Waliser diese wertvollen Tiere abgeschossen oder sie erwischt und behalten.
Zur Sicherheit sah er mit Meilyr und de Clare aber noch im Stall nach dem Rechten, ehe sie sich in die Halle begaben und sich gleich neben der Tür, am unteren Ende, auf die Bank fallen ließen. Dichter, beißender Rauch umwaberte Maurice, genauso wie der Gestank nach Schweiß und Nässe, aber im Moment machte ihm das nichts aus. Denn auch der Geruch von Essen stieg ihm in die Nase.
Auf dem Podest an der Stirnseite saßen die hochwohlgeborenen Herren beisammen: der Earl of Pembroke, der Constable mit seiner Gemahlin Lady Maria und ihrer Schwester Lady Alice, sowie eine Handvoll ausgesuchte Ritter, die mit dem Earl gekommen waren. An den Längsseiten standen ebenfalls lange Tafeln, an denen sich die übrigen Ritter und Angehörigen des Haushalts eingefunden hatten, genauso wie Maurice und die anderen Knappen. Alle waren in angeregte Unterhaltungen vertieft, während Maurice so müde war, dass er trotz Hunger kaum bemerkte, wie eine Schale Hafergrütze vor ihm abgestellt wurde. Der Schmerz in seinem Arm hatte endlich nachgelassen, doch nun spürte er Übelkeit in sich hochsteigen.
Nach den Erlebnissen dieses Tages fand er gerade noch die Kraft, sich darüber zu freuen, kein Page mehr zu sein. Höfisches Gehabe zu lernen erschien ihm nach den Erlebnissen mit den Rebellen zwar nicht mehr so furchtbar, doch als er die jüngeren Knaben mit den Weinkrügen in der Hand sah, war er froh, diesen Dienst nicht mehr verrichten zu müssen. Anstatt die Herren zu bedienen und beim Essen zuzusehen, durfte er jetzt selbst an der Tafel sitzen und sich den Magen vollschlagen.
Das Eintreffen des Earls bestimmte die Gespräche in der Halle, denn sein Gefolge wusste vom Bürgerkrieg in England zu berichten. Hier in Wales bekamen sie kaum etwas davon mit, sie hatten eigene Kämpfe auszutragen und eigenes Land zu verteidigen. Aber der Earl und seine Männer teilten freudig Neuigkeiten und stillten die Neugierde der Burgbewohner, die sich häufig vom Rest der Welt abgeschnitten fühlten. So lauschten auch die Knappen mit aufgeregten Mienen den Worten des jungen de Clare.
»Matilda hat sich in Wallingford verschanzt«, erzählte dieser, als wären seine Worte alte Nachrichten, denen keine Bedeutung mehr beigemessen werden musste. Für die abenteuerhungrigen Knappen aber war jede Information aus der Außenwelt ein Geschenk. »Der König belagerte sie in Oxford, das ist schon ein paar Jahre her. Matilda entwischte damals, und seitdem sitzt sie hinter uneinnehmbaren Mauern und wartet darauf, dass den König der Schlag trifft und sie ihre Krone bekommt.«
»Wie ist sie damals entkommen?«, fragte Meilyr, ohne von seiner Schüssel aufzusehen. Sein rabenschwarzes Haar hing ihm in nassen Strähnen in die Stirn, was ihn nicht sonderlich zu stören schien. »Hat sie sich rausgebuddelt?«
»Das nicht.« De Clare trank aus seinem Becher und schien gar nicht zu bemerken, dass die meisten ungeduldig hin und her rutschten. Erst als Meilyr von seinem Essen aufsah und ihm mit dunklen Augen einen Blick zuwarf, fuhr er fort. »Sie hat sich von der Burgmauer abgeseilt«, verkündete er, woraufhin sich Meilyr verschluckte und von einem so starken Hustenanfall geschüttelt wurde, dass selbst die Herren von der hohen Tafel kurz aufblickten.
»Erzähl keine Märchen«, knurrte indessen Griffin, ein etwas älterer Knappe und einer der Söhne des Constable, der dasselbe sonnige Gemüt wie sein Vater hatte. Für gewöhnlich ging Maurice ihm aus dem Weg, nur hin und wieder konnte er sich nicht beherrschen und geriet – meist durch Meilyrs Einfluss – in Schwierigkeiten. Maurice’ Vater würde wohl sagen, dass er froh sein sollte, jemanden zu haben, der ihm während einer gesunden Prügelei zur Seite stand. Doch Griffin hatte den Ehrgeiz eines jüngeren Sohnes, der sich mit Händen und Füßen gegen eine klerikale Ausbildung hatte wehren müssen. Er musste beweisen, dass er zum Ritter und nicht zum Mönch geboren war. Zudem wurde er als Sohn des Constable meist noch härter rangenommen, um bei den anderen keinen Verdacht auf Bevorzugung aufkommen zu lassen. Wäre Griffin nicht so ein hinterlistiger Widerling, hätte Maurice vielleicht Mitleid mit ihm gehabt. Doch zu seiner Schande musste er gestehen, dass es ihm Genugtuung bereitete, wenn seine Fäuste bei Griffin ein schmerzvolles Ziel fanden.
Den jungen de Clare schien der Einwurf des Älteren jedoch nicht zu kümmern. Noch nicht einmal als Neuling in der Runde musste er sich von der Stellung, die Griffins Vater auf der Burg innehielt, beeindrucken lassen. Der misstrauische Ausdruck seiner Augen blieb zwar immer noch bestehen, doch jetzt funkelte darin etwas, das Maurice nur als Streitlust bezeichnen konnte.
»Mit drei Rittern«, fuhr er fort, als hätte er Griffins Kommentar gar nicht gehört. »Es heißt, Matilda und ihre Männer ließen sich die Burgmauer hinab – komplett in Weiß gekleidet, um im Schnee nicht erkannt zu werden. Dann flohen sie über den zugefrorenen Mühlenzufluss. Niemand bemerkte etwas, bis es zu spät war.«
»Und wieder hat sie dem König ein Schnippchen geschlagen«, murmelte Maurice, der bisher nur wenig Beeindruckendes vom König gehört hatte. Viele hielten ihn für schwach, und Maurice brachte insgeheim Bewunderung für Matilda auf. Zwar sprach er seine Gedanken nicht aus, doch in seinen Augen war Matilda die rechtmäßige Königin. Sie war das einzige legitime Kind des verstorbenen Königs Henry und damit Erbin seiner Krone. Für Maurice spielte es keine Rolle, dass Matilda eine Frau war, auch wusste er nichts über ihren Gemahl Geoffrey, den Grafen von Anjou, den viele Barone verachteten. Sie sagten, eine Frau hätte auf dem Thron nichts zu suchen, und Anjou, durch dessen Adern angeblich Teufelsblut floss, wollten sie noch weniger darauf sehen. Also hatten sie Matildas Vetter Stephen darin unterstützt, sich die Krone zu ergreifen. Doch Matilda wäre nicht Henrys Tochter, ließe sie sich das gefallen. So gab es seit nunmehr zehn Jahren Krieg in England.
»Was ist mit Anjou?«, fragte er de Clare, da er sich nur schwer vorstellen konnte, dass Matilda sich seit Jahren nicht mehr aus Wallingford wagte, ohne dass ihr Ehemann etwas unternahm.
Zu seiner Überraschung winkte de Clare ab. »Der hat sich zum Herzog der Normandie gemacht und geht sicher nicht mehr von dort weg. Matilda hat wohl nach ihm geschickt, aber er riskiert den gerade erlangten Frieden in seinem eigenen Land bestimmt nicht für einen Krieg in England.«
»Besser so«, ließ sich nun wieder Griffin vernehmen. »Soll er da drüben bleiben und verrecken.«
»Soll er sein Weib nach Hause holen und einsperren«, fügte Meilyr hinzu, der rittlings auf der Bank saß und bereits wieder eines seiner Holzstücke bearbeitete.
Maurice verdrehte die Augen. »Hört, hört! Meilyr FitzHenry erneut auf Kriegsfuß mit der Familie.« Er warf ein Stück Brot nach seinem Freund. »Sag mal, Meilyr, welcher Familienzweig bereitet dir größere Bauchschmerzen? Die walisischen Rebellen oder Matilda auf dem Schlachtfeld?«
Meilyr richtete sich auf der Bank auf und legte das Holz beiseite. »Wusstest du eigentlich, de Clare«, wandte er sich an den jungen Adligen, »dass dieses Mannweib Matilda meine Tante ist?«
»Natürlich.« Bestimmt kannte er jeden Adligen dieses Landes mit Namen, Titel und dazugehörigem Lehen. »Dein Vater ist Henry FitzRoy, der Sohn des verstorbenen Königs Henry, während Matilda Henrys Tochter ist. Dein Vater ist also Matildas Bruder.«
»Halbbruder«, warf Griffin ein.
»Schrecklich kompliziert.« Plötzlich leuchteten Meilyrs Augen auf. »Leute, stellt euch mal vor, mein Vater wäre kein Bastard, sondern legitim wie Matilda, dann wäre er jetzt König und ich …« Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich denke besser nicht darüber nach.« Sein Blick fiel auf die Hafergrütze neben sich. »Hier ist es ja auch ganz schön.«
»Der König hatte noch mehr Bastarde, nicht nur deinen Vater«, beruhigte Maurice seinen Freund. »Da hätte es einige Anwärter auf die Krone gegeben, nicht zuletzt den Earl of Gloucester, der ja der älteste Sohn des verstorbenen Königs ist und jetzt Matilda treu zur Seite steht. Oder den Earl of Cornwall.«
»Meine Schwester ist ebenfalls einer dieser Bastarde«, erklärte zu aller Überraschung de Clare.
»Deine Schwester?!« Griffin ließ den Holzlöffel sinken und schien plötzlich ganz Ohr. »Dann war deine Mutter ja …«
»Eine der zahlreichen Mätressen König Henrys, ganz recht.« De Clare warf einen Blick zur hohen Tafel, und seine Züge verhärteten sich. »Isabel de Beaumont, sie war noch jung, als sie meine Schwester bekam. Später gab der König sie meinem Vater zur Frau.«
Schweigen breitete sich unter den Knappen aus. Alle starrten de Clare an. Maurice überraschte weniger die Information an sich, als die ungenierte Art, mit der de Clare diesen Makel in der Vergangenheit seiner Mutter preisgab. Der Earl hieße bestimmt nicht gut, dass die Knappen von den Abenteuern seiner Frau sprachen. Vielleicht war aber auch genau das der Grund, weshalb de Clare sie ausgeplaudert hatte. Zufriedenheit stand in seinem Gesicht, ein schmallippiges Lächeln, während er seinen Vater beobachtete. Ein kleiner Sieg.
»Warte mal.« Meilyr nahm seine Holzarbeit auf und griff nach dem Schnitzmesser. »Dann sind mein Vater und deine Halbschwester ja …«
»Ebenfalls Halbgeschwister. Ich weiß, das ist verwirrend.«
Meilyr grunzte. »Tja, hätte der König sich häufiger mit der Königin vergnügt, anstatt in fremden Betten, dann hätte er vielleicht einen männlichen Erben gehabt, anstatt zwei Dutzend Bastarde.«
»Amen.« Maurice hob seinen Holzbecher, um auf diese Worte zu trinken, und die anderen Knappen taten es ihm gleich.
Vielleicht war die walisische Art des Erbrechts ja sinnvoller und vermied Kriege wie diesen in England. Denn die Waliser unterschieden nicht zwischen legitimen und illegitimen Kindern. Das Erbe wurde unter allen anerkannten Söhnen aufgeteilt, was durchaus gerecht war. Aber wenn Maurice genauer darüber nachdachte, versprach diese Lösung genauso viele Konflikte. Schließlich teilte sich so das Land – aus einem Reich wurden viele kleine. Schade, dass sich die Rebellen-Brüder von Südwales nicht gegenseitig bekriegten, wie es die Waliser sonst so gerne taten. Doch Meilyrs walisische Verwandte hielten zusammen wie Pech und Schwefel, und das mochte noch gefährlich werden. England war weit weg, und im Moment sollten sie sich wohl eher um die Waliser kümmern.
Verstärkung sollten sie durch Richard de Clare erhalten. Kurz bevor sich die Knappen auf ihre Strohlager auf dem Heuboden zurückzogen, verkündete der Earl, dass sein Sohn auf Pembroke Castle bleiben würde. Er selbst plante, in nur wenigen Tagen in den Kampf gegen die Rebellen zu ziehen. Er wollte die Ruhepause in England nutzen, um sich um seine Grafschaft zu kümmern, und das Land seines verstorbenen Bruders weiter nördlich aus walisischer Hand zurückerobern.
Maurice wusste nicht, was er von dieser Entwicklung halten sollte, doch es war vielleicht ganz gut, einen Kampfgefährten auf dieser Burg zu gewinnen. De Clare kam ihm einsam vor, und das war ein Gefühl, das Maurice durchaus nachempfinden konnte. Natürlich war Meilyr sein Freund, und Maurice vertraute ihm wie niemandem sonst. Doch Meilyr gehörte einem gewaltigen Clan an und war mit fast ganz Wales verwandt, sowohl unter den Walisern als auch unter den Normannen. Im Grunde konnte Meilyr keinen Stein werfen, ohne Familie zu treffen, denn die Geraldines, wie sich seine Sippe nannte, waren überall. Meilyr verstand nicht, wie es war, in einem Landstrich aufzuwachsen, der von einer zusammengeschweißten Familie gehalten wurde, der man nicht angehörte. Maurice war ja noch nicht einmal Normanne, so wie fast alle hier, auch hatte er kein walisisches Blut in sich, wie Meilyr und der Constable. Als Flame war er eindeutig ein Außenseiter. Zwar waren nach Überschwemmungen in der Heimat ein paar Flamen in dieses Land gekommen, aber sie waren nur eine kleine Gruppe im Vergleich zu den Geraldines. Richard de Clare würde das verstehen. Er war ebenso allein, und die Stellung seines Vaters brachte ihm bestimmt nicht viele Freunde. Eher jene, die sich einen Vorteil erhofften. In diesen Zeiten des Bürgerkriegs, in denen Barone stets die Seiten wechselten und jeder seine Macht bis an die Grenzen und darüber hinaus trieb, war es generell nicht leicht, Freunde zu finden. De Clare hatte das wohl auch schon herausgefunden und war sicher froh, dem Hof und seinem Vater für eine Zeit lang zu entgehen. Vielleicht fand Maurice in Strongbows Sohn tatsächlich einen Leidensgenossen, vielleicht würde die Zeit als Knappe nicht so schlimm werden, wie angenommen.
Es war der schlimmste Tag seines Lebens; wieder einmal hatte er das Gefühl, bald sterben zu müssen. Die Schinderei unter dem Fechtmeister trieb ihn nach der Begegnung mit den Rebellen an seine körperlichen Grenzen. Wie es das Schicksal so wollte, gehörte sein Peiniger auch noch dem Clan der Geraldines an und war zudem ein weiterer Sohn des Constable. Ab und zu gönnte der Constable sich selbst das Vergnügen, doch seit dem Tod des vorherigen Fechtmeisters überließ er es zumeist seinem Ältesten Odo, die Knappen zu quälen.
»Bist du müde, Prinzessin? Soll ich dir Stickzeug holen? Vielleicht können deine zarten Fingerlein mit Nadel und Garn besser umgehen als mit einem Schwert. Hoch mit dem Schild!« Ein Tritt traf das Holz und prellte durch Maurice’ gesamten Arm. Fast wäre ihm ein Stöhnen entkommen, doch er konnte es gerade noch hinunterschlucken. Sie alle hatten Schwierigkeiten, den Schild zu halten, doch heute schien er Maurice so schwer, als hätte er einen Baumstamm am Arm festgebunden. Es war ihm unmöglich, ihn richtig hochzuhalten, und so steckte er weitere böse Schläge von den glatten Holzschwertern ein.
»Bist du taub? Schild hoch!« Noch ein Tritt, der ihn fast in die Knie zwang. Er hätte ahnen müssen, dass sein blutdurchtränkter Ärmel ihm keine Schonung verschaffte. Es war wohl amüsant anzusehen, wie die anderen Knappen ihn verprügelten. »Hoch damit, Maurice! Hoch!«
Die Spitze des Schilds, der fast so groß war wie er selbst, kratzte über den Boden. Maurice versuchte ihn zu heben, biss die Zähne zusammen, sein verletzter Arm zitterte, Schweiß strömte ihm unter dem Helm hervor ins Gesicht und brannte in seinen Augen. Ein Laut, der sich fast nicht menschlich anhörte, entfuhr ihm. Schmerz, Zorn, Entschlossenheit und schließlich Resignation. Der Schild sank gänzlich zu Boden, und Maurice gab auf. Mit all seinem Gewicht stützte er sich auf das schwere Holzstück und versuchte, seinen schnellen Atem unter Kontrolle zu bringen. Das Gebrüll des Fechtmeisters schwand zu einem fernen Rauschen, das er kaum noch wahrnahm. Odos Ritterschlag lag noch nicht lange zurück, er musste sich also daran erinnern, wie es war, am schwachen Ende der Befehlsordnung zu stehen. Aber vielleicht war auch genau das der Grund, weshalb er so viel Freude daran hatte, die Jüngeren im Staub kriechen zu sehen. Bislang hatte Maurice ihn nie für bösartig gehalten, nicht so wie seinen jüngeren Bruder Griffin. Die Gemeinheiten des Fechtmeisters waren offen und direkt, während Griffin stets hinterrücks angriff. Maurice sollte die Zornesausbrüche wohl der Hinterlistigkeit des Jüngeren vorziehen, zumal der Fechtmeister keinen Unterschied zwischen seinen Verwandten und Außenstehenden machte. Alle wurden mit derselben Höflichkeit bedacht, die auch den Constable auszeichnete. Verhätschelung hatte noch niemanden zum Ritter gemacht, pflegte er zu sagen, und vermutlich lag er damit gar nicht so falsch. Vor ein paar Jahren, bei der Schlacht von Lincoln, war sein Bein von einem Pfeil getroffen worden, seither hinkte er. Was jedoch nicht bedeutete, dass er sich von seinem Gebrechen aufhalten ließ. Im Gegenteil – es machte ihn nur noch verbissener. Und entschlossener, aus seinen Knappen gestählte Krieger zu machen.
Nur Maurice fühlte sich weder gestählt noch kriegerisch, während die Beschimpfungen des Ritters dumpf zu ihm durchdrangen. Er sah nur noch den Gegner, den er im Zweikampf besiegen musste, und wartete auf den neuerlichen Schlag gegen seine gepolsterte Schulter. Die Paare wurden immerzu ausgetauscht, und es spielte auch keine Rolle, wem Maurice gegenüberstand. Die Hiebe waren dieselben. Er sah auch ein ums andere Mal das Schwert kommen, doch er war zu langsam. Seine Bewegungen wurden schleppend, und sein Gewand klebte bereits an seinem Körper.
Ein neuerlicher Tritt gegen den Schild ließ ihn zur Seite taumeln. Gerade noch rechtzeitig fand er sein Gleichgewicht, um nicht hinzufallen.
»Angriff Maurice! Schild hoch! Schlag! Schlag! Schild hoch!«
Eine kalte Hand packte ihn im Nacken und riss ihn mit einer Wucht herum, die ihn zu Boden schleuderte. Der Helm flog ihm vom Kopf, und sein Gesicht versank in kaltem Gras. Aus einem Instinkt heraus hob er die Hände schützend über sich. Er wusste, der Fechtmeister schreckte nicht davor zurück nachzutreten. Es gelang ihm gerade noch, einen Schmerzenslaut zu unterdrücken, auch wenn er sich bereits erbärmlich genug fühlte. Hier lag er auf der Übungswiese, zitternd und schwächlich, wo ihn jeder sehen konnte.
In diesem Moment hasste er den Fechtmeister. Nicht für die Schmerzen und die Qualen – die mussten sie alle erdulden. Er hasste ihn für die Demütigung.
»Ein Kratzer!«, hörte er den Mann mit seiner tiefen, volltönenden Stimme über sich brüllen. Er klang wie sein Vater. »In der Schlacht wärst du tot! Tot! Willst du wegen eines Kratzers draufgehen, hm? Soll das von dir in Erinnerung bleiben? Wie willst du deinem König dienen, wenn du dich wegen einer kleinen Verletzung umbringen lässt?«
»Und wie dienst du deinem König, Krüppel?«, entfuhr es ihm, ehe er darüber nachdenken konnte. Doch seiner Schwäche und dem Gras unter seinem Gesicht verdankte er, dass diese Worte ungehört und seine Rippen heil blieben.
»Er ist verletzt, Fechtmeister«, vernahm er plötzlich Meilyrs Stimme wie aus weiter Ferne. »Die Waliser haben ihn gestern abgeschossen.«
»Weil er zu langsam ist. Ich frage mich, Maurice, wie du gestern überhaupt lebend zurückkommen konntest!«
Ein Tritt traf ihn in die Seite, jedoch kein besonders kräftiger. Es war eher einer der motivierenden Sorte, der ihm sagen sollte, dass es jetzt Zeit war aufzustehen. Doch das war leichter gesagt als getan. Wenn man einmal wie ein geprügelter Hund zu Füßen des Fechtmeisters gelegen hatte, war es schwer, die Hände vom Gesicht zu nehmen. Doch Maurice war nicht gewillt, sich länger zu demütigen. Er atmete einmal tief ein, presste die Lippen aufeinander und stützte sich schließlich auf seine Hände. Sein linker Arm zitterte immer noch, und fast knickte er beim Ellbogen ein. Doch bevor das geschehen konnte, richtete er seinen Oberkörper auf, auch wenn ihm dadurch schwarz vor den Augen wurde. Blind kam er auf die Beine, seine Knie wackelten, und sein Arm pochte, aber er musste nur noch etwas länger durchhalten. Nach ein paarmal blinzeln kehrte auch seine Sicht wieder zurück. Er stand tatsächlich aufrecht.
Mit zusammengebissenen Zähnen hob er Schild und Helm auf und griff nach dem Schwert. Dabei bemerkte er das anerkennende Nicken des Fechtmeisters und ein kurzes Zucken des Mundwinkels, als unterdrücke er ein Lächeln – ein seltener Anblick, doch er schenkte Maurice Kraft. Er wollte Odo nicht enttäuschen, und so nahm er seine Position ein.
Es war keine Überraschung zu sehen, dass Griffin ein selbstzufriedenes Grinsen im Gesicht trug, vermutlich, weil diesmal nicht er schikaniert wurde. Maurice konnte nur froh sein, dass er jetzt nicht gegen ihn kämpfen musste, denn Odo winkte seinen neuen Schützling Richard de Clare nach vorne.
Der junge Grafensohn zögerte einen Moment, doch dann gehorchte er und hob sein Schwert.
Maurice atmete tief durch, der erste Schlag kam, doch die Seite des gegnerischen Holzschwertes berührte kaum seinen Schild. Ein Blinder hätte gesehen, dass de Clare sich zurückhielt. Mitleid stand in den grauen Augen, die ihn am Nasenkolben des Helms vorbei ansahen, und Maurice verstärkte seinen Griff um das Schwert. Rücksichtnahme machte den Fechtmeister nur wütender, und wenn sein neuer Kamerad nicht bald Härte zeigte, wäre er der Nächste im Dreck.