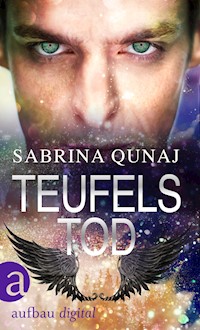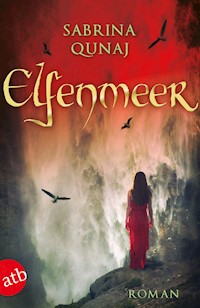12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zwei Romane von Bestsellerautorin Sabrina Qunaj in einem E-Book.
Elfenmagie.
Die magische Elfenköngin Jahrtausende nach der Teilung Elvions erreicht die Fehde der Licht- und Dunkelelfen einen Höhepunkt. Mit dem Blut der Halbelfe Vanora könnte das Reich wiedervereint werden und die Königin Alkariel ihre alte Macht zurück erhalten. Die Dunkelelfen versuchen dies zu verhindern, indem sie das Mädchen versteckt halten. Nichts ahnend wächst Vanora in der Welt der Menschen bei ihrem Vater auf, bis das Schicksal sie eines Nachts einholt und der geheimnisvolle Glendorfil erscheint ...
Elfenkrieg.
Die Jagd nach dem Drachenherz Kein Jahrhundert nach dem großen Elfenkrieg brennen wieder die Städte Elvions, doch dieses Mal sind es Drachen, die in den Krieg ziehen. Sie zerstören die Tempel und greifen die Wächter an, ehe Nebel aufzieht und graue Schemen die Priesterinnen und Orakel vernichten. Als Aurün, die Königin der Drachenelfen, bei Königin Liadan eintrifft und vom Überfall auf ihr Volk berichtet, wird das Ausmaß der Katastrophe erst wirklich klar. Die Nebelgestalten stahlen das Drachenherz und haben damit die Drachen unter Kontrolle. Einzig Aurün konnte den Angreifern entkommen. Sie sucht Hilfe bei Eamon, der sie aus der Welt der Menschen zurück nach Elvion begleitet, um den Kampf um das Drachenherz aufzunehmen ...
Die ersten beiden Bände der ELVION-Reihe sind in diesem E-Book enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2145
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Elfenmagie:
Die magische Elfenköngin
Jahrtausende nach der Teilung Elvions erreicht die Fehde der Licht- und Dunkelelfen einen Höhepunkt. Mit dem Blut der Halbelfe Vanora könnte das Reich wiedervereint werden und die Königin Alkariel ihre alte Macht zurück erhalten. Die Dunkelelfen versuchen dies zu verhindern, indem sie das Mädchen versteckt halten. Nichts ahnend wächst Vanora in der Welt der Menschen bei ihrem Vater auf, bis das Schicksal sie eines Nachts einholt und der geheimnisvolle Glendorfil erscheint.
Elfenkrieg:
Die Jagd nach dem Drachenherz
Kein Jahrhundert nach dem großen Elfenkrieg brennen wieder die Städte Elvions, doch dieses Mal sind es Drachen, die in den Krieg ziehen. Sie zerstören die Tempel und greifen die Wächter an, ehe Nebel aufzieht und graue Schemen die Priesterinnen und Orakel vernichten. Als Aurün, die Königin der Drachenelfen, bei Königin Liadan eintrifft und vom Überfall auf ihr Volk berichtet, wird das Ausmaß der Katastrophe erst wirklich klar. Die Nebelgestalten stahlen das Drachenherz und haben damit die Drachen unter Kontrolle. Einzig Aurün konnte den Angreifern entkommen. Sie sucht Hilfe bei Eamon, der sie aus der Welt der Menschen zurück nach Elvion begleitet, um den Kampf um das Drachenherz aufzunehmen.
Sabrina Qunaj
Elfenmagie & Elfenkrieg
Zwei Romane in einem E-Book
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Elfenmagie
Übersichtkarte
Prolog
Vanora
Alkariel
Eamon
Vanora
Eamon
Alkariel
Nevliin
Bienli
Nevliin
Vanora
Eamon
Bienli
Vanora
Eamon
Nevliin
Vanora
Eamon
Vanora
Nevliin
Eamon
Bienli
Alkariel
Vanora
Nevliin
Vanora
Alkariel
Eamon
Nevliin
Bienli
Eamon
Vanora
Eamon
Nevliin
Vanora
Bienli
Vanora
Nevliin
Alkariel
Eamon
Vanora
Nevliin
Eamon
Vanora
Eamon
Vanora
Eamon
Alkariel
Eamon
Vanora
Eamon
Nevliin
Bienli
Vanora
Eamon
Nevliin
Eamon
Epilog
Danksagung
Elfenkrieger
Übersichtkarte
Prolog
Ardemir
Aurün
Vinae
Eamon
Vinae
Aurün
Vinae
Eamon
Ardemir
Aurün
Der Wächter
Vinae
Eamon
Vinae
Ardemir
Aurün
Eamon
Vinae
Eamon
Vinae
Ardemir
Aurün
Vinae
Eamon
Vinae
Ardemir
Aurün
Vinae
Vanora
Die Nebelpriesterin
Vinae
Ardemir
Vinae
Aurün
Ardemir
Nevliin
Vinae
Eamon
Vinae
Ardemir
Aurün
Vinae
Eamon
Aurün
Vinae
Eamon
Danksagung
Informationen zur Autorin
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Wer von diesen Romanen von Sabrina Qunaj begeistert ist, liest auch ...
Orientierungsmarken
Cover
Inhaltsverzeichnis
Elfenmagie
Elfenkrieger
Impressum
Sabrina Qunaj
Elfenmagie
Roman
Für meinen Sonnenschein Marissa
Prolog
Wofür lohnt es sich zu sterben? Die Leben Tausender?
Ein ruhmreicher Tod. Doch was bedeutet es schon, als Held zu sterben, wenn man sich von denen, die man liebt, für immer verabschieden muss?
Die Augen können den Schmerz nicht mehr verbergen. Solch starkes Herz, noch voller Liebesmut. Die Flamme erlischt nicht, nur weil der Orkan sie zu Boden drückt. Wie viel Leid kann man ertragen, bevor man daran zerbricht? Wie groß muss der Schmerz sein, um sich nach dem Tod zu sehnen?
Das strahlende Licht nimmt überhand, die Schatten ziehen sich zurück. So leicht fühlt es sich an, eingehüllt in diese Wärme. Der Verstand so klar, die Sinne scharf. Wie leer und ruhig die Welt doch plötzlich ist.
Wofür lohnt es sich zu sterben? Um ein einziges Leben zu retten?
Ein letzter Blick in diese Augen, verschwommen im gleißenden Licht der Flammen.
Wie erklärt man, dass man sich entschieden hat zu gehen?
Schicksal.
Bestimmung.
Was ist schon ein Leben im Vergleich zu Tausenden?
Sterben.
Sterben, auch wenn das Herz vor Liebe bricht.
Vanora
Jeden Tag bei Sonnenuntergang saß sie am Fenster ihrer Kammer und wartete auf die Finsternis. Denn dann wurden sie sichtbar, die Schatten, die sie begleiteten, seit sie denken konnte. Auf dem Dach der gegenüberliegenden Kate, im Haselstrauch am Rande ihres kleinen Grundstücks, in den Baumkronen des nahen Buchenhains. Auch heute lag das Dorf wie verlassen in der Dunkelheit, aber Vanora sah sie doch – die goldfarbenen Augen, die schon so oft auf ihr geruht hatten. Sie spiegelten das Mondlicht, den Schein der Fackeln, den sanften Schein der Kerze an ihrem Fenster. Doch wenn es hell wurde – so wie jetzt, da ein Blitz sein grelles Licht über das schlafende Dorf warf –, waren die Schatten verschwunden. Sie waren schneller als das Licht und geschickt darin, sich zu verbergen, aber sie waren immer da. Zuverlässig, bei Sturm, bei Regen, bei klirrender Kälte, Nacht für Nacht. Es war nie anders gewesen. Vanora fürchtete sie nicht. Es mussten Schutzgeister sein. Ein beruhigender Gedanke. Sie lächelte. Ob sie jemals herausfinden würde, wer es war, der über sie wachte?
Das Wetterleuchten verging. Vanora schob den dicken Stoff vor dem Fenster noch etwas weiter zurück und starrte versonnen in die Dunkelheit. Die dünnen Äste der Eiche, denen es gelungen war, vom Hof bis zum Haus zu greifen, kratzten über die hölzernen Wände und streckten sich ihr entgegen wie die knochigen Fänge eines Ungeheuers. Leise prasselnd fiel der Regen auf das Strohdach, der Wind heulte durch die Ritzen, das Dorf schlief. Und so bemerkte auch niemand außer ihr die dunkle Gestalt, die sich jetzt vom Stamm der alten Eiche löste und zur Schmiede ihres Vaters hinüberhuschte. Vanora erstarrte. Niemals zuvor hatten sich ihr die Schatten genähert. Spielte ihr die Phantasie einen Streich?
Ein vielfach verzweigter Blitz zuckte von den Wolken zur Erde, ließ die Regentropfen wie glitzernde Kristalle funkeln und –
Vanora schnappte nach Luft und wich zurück. Der Stoff fiel vor das Fenster. War dort unten wirklich eine Gestalt in dunklem Umhang gewesen, deren Schritte in Pfützen und Schlamm auf dem Hof keine Spuren zu hinterlassen schienen? Das konnte nicht sein. Die Hand auf ihr wild schlagendes Herz gepresst, machte sie einen vorsichtigen Schritt nach vorn. Es war sicher nur Einbildung gewesen. Kein Mensch hatte so weiße Haut! Und doch hatte sie die Augen wiedererkannt. Sie hatten im Schein des Blitzes golden aufgeleuchtet. Hatte er sie gesehen? Wusste er, wo sie war? Sie schüttelte den Kopf – natürlich wusste er es. Er hatte es immer gewusst.
Mit zitternder Hand berührte sie den Stoff, nahm all ihren Mut zusammen, und langsam beruhigte sie sich wieder. Sicherlich war es nur Graham von der Mühle, der ihrem Vater einen Besuch abstatten wollte. Manchmal tat er das. Die beiden Männer tranken Wein und sprachen miteinander, und manchmal lachten sie. Das Lachen ihres Vaters zu hören machte Vanora glücklich und ließ sie zufrieden einschlafen. Sie atmete auf. Vielleicht war es nur der Blitz gewesen, der ihr den Müller so fremdartig hatte erscheinen lassen. Aber der Zweifel blieb, und so schloss sich ihre Hand noch etwas fester um den Stoff. Sie würde jetzt nachsehen. Schließlich war sie kein kleines Kind mehr. Es waren bereits zehn Sommer seit ihrer Geburt verstrichen. Sie war schon groß.
Mit einer heftigen Bewegung riss sie den Vorhang zur Seite, doch die Gestalt auf dem Hof war verschwunden. Stattdessen erklang ein leises Klopfen unten an der Haustür. Vanora presste die Hand an den Mund, hielt den Atem an, lauschte. Schritte, das Wegschieben eines Riegels, dann Stille. Nichts als der Regen und der Wind. Langsam ließ sie die Hand sinken und atmete vorsichtig aus. War da nicht eben ein Geräusch gewesen? Eine Stimme, die mit dem Singsang des Windes verschmolz? Aber nein, der Müller hatte eine kräftige Stimme – weich und dunkel wie ein Glockenschlag. Und ihr Vater …
»Ich sage es nicht noch einmal! Ihr seid hier nicht willkommen!«
Vanora riss erschrocken ihre Augen auf. Ihr Vater war zornig! Nur einmal hatte sie ihn dermaßen aufgebracht erlebt. Als er sie auf dem Weg zu den Steilklippen erwischt hatte. Nein, mit dem Müller hätte ihr grundgütiger Vater niemals so gesprochen. Aber wer war es dann, der mitten in der Nacht Einlass begehrte?
Auf Zehenspitzen schlich sie zur Tür ihrer Kammer, die zum Glück nur angelehnt war. Nun war sie sich sicher: Die Melodie, die mit dem Wind zu verschmelzen schien, war wirklich eine Stimme. Leise war sie, und doch schien es ihr, als dränge sie in jeden noch so kleinen Winkel des Hauses. Das schwache Licht der wenigen Kerzen, die in der Stube unten brannten, drang durch den schmalen Spalt. Mit angehaltenem Atem ergriff sie das Türblatt, zog es langsam auf und biss die Zähne zusammen, als ein leises Knarren ertönte.
Vanora hielt inne, lauschte. Die fremde Stimme war immer noch zu hören, auch wenn es ihr schwerfiel, sich auf die Worte zu konzentrieren. Der Fremde sprach mit einem ungewohnten Akzent und seine Worte klangen wie ein Lied. Ein wunderschönes Lied.
Die Stimme des Vaters brach den Zauber: »Ich will nichts mehr von Euch wissen!«
Vanora zuckte zusammen, als hätte er sie persönlich angebrüllt.
»Ich bin nicht Euer Feind«, entgegnete der Fremde ruhig.
»Das könnt Ihr sehen, wie Ihr wollt. Glaubt Ihr etwa, ich bin blind? Glaubt Ihr etwa, ich weiß nicht, dass Ihr ständig alle um sie herumschleicht? Das wird jetzt aufhören! Habt Ihr verstanden? Lasst uns in Frieden!«
Der Fremde blieb noch immer ruhig. »Die Zeit ist gekommen«, sagte er in seiner weichen, melodischen Stimme.
Einen Moment lang war es still, und Vanora hörte nur noch das Rauschen ihres Blutes in den Ohren.
»Die Zeit ist gekommen?«, japste ihr Vater schließlich, atemlos vor Zorn. »Sucht Euch jemand anders. Sie hat uns verlassen. Sie hat mir das Kind vor die Tür gelegt und uns alleinegelassen. Ich will nichts mehr von ihr wissen.«
»Eliria ist tot, Briac Larnegie. Sie starb schon vor langer Zeit.«
Stille. Ein schweres Ausatmen.
»Das ist nicht … Wieso habt Ihr mir nichts davon gesagt?«
»Dies war nicht unsere Aufgabe. Ihr solltet in Frieden leben, ohne unsere Anwesenheit zu bemerken. Sie wollte es so.«
Ihr Vater schnaubte, eine Mischung aus Wut und Schmerz. »Aber ich habe Euch bemerkt!« Etwas Schweres krachte zu Boden, und jetzt war Vanora sich sicher, dass ihr Vater weinte. »Was soll das alles noch? Wenn sie tot ist … Was wollt Ihr dann noch von uns?«
»Das Kind ist immer noch in Gefahr. Ihr könnt ihre Herkunft nicht verleugnen. Ihre Bestimmung …«
Doch ihr Vater ließ den Fremden nicht ausreden: »Sprecht nicht von Bestimmung. Unglaubwürdiges Zeug, das Ihr Euch einfallen lasst, um Eure Grausamkeit zu rechtfertigen. Wir haben sehr gut alleine gelebt. Wir haben Eliria nicht gebraucht, und wir brauchen Euch auch nicht.«
Vanora verstand jedes einzelne der Worte, die unten in der Stube gesprochen wurden, doch der Inhalt der Unterhaltung erschloss sich ihr nicht. Eliria. Ein seltsam klingender Name. Niemals zuvor hatte sie ihren Vater diesen aussprechen hören. Waren »sie« wirklich die Schatten, die sie ihr Lebtag lang beobachtet hatten? Hatte sie das richtig verstanden, dass ihr Vater die Schatten auch bemerkt hatte? Ein Kind war in Gefahr – war das etwa sie selbst? Und was hatte es mit dieser Bestimmung auf sich? Vanora ignorierte die warnende Stimme in ihrem Kopf und schlich weiter zu der steilen Treppe, die in die Stube hinabführte. Dort legte sie sich auf den Bauch und spähte hinunter.
Ihr Vater stand mit dem Rücken zu ihr, direkt neben dem Tisch in der Mitte des Raumes – und ihm gegenüber jene dunkle Gestalt, die sie auf dem Hof gesehen hatte, eingehüllt in einen schwarzen Umhang. Vanora hatte ihren Vater stets für den größten Mann der Welt gehalten, aber die schlanke Gestalt des Fremden überragte Briac um ein gutes Stück. Das Gesicht des Besuchers lag im Schatten der Kapuze verborgen, und im weichen Licht der Kerzen erschien er ihr wie ein Traumgespinst, ein Geist aus einer anderen Welt.
Mit einer geschmeidigen Bewegung, als verschmelze er mit den Schatten und dem flackernden Licht der Flammen, bewegte sich der Fremde ein Stück auf ihren Vater zu. »Ihr wisst, dass sie keine andere Wahl hatte«, sagte er ruhig. »Sie wollte ihre Tochter beschützen. Bei uns wäre sie verloren gewesen. Ich habe es Euch an ihrem ersten Geburtstag erklärt. Erinnert Ihr Euch?«
Ihr Vater nahm an dem Tisch Platz und strich sich mit der Hand über Augen und Stirn. »Ihr werdet sie mir nicht wegnehmen.«
»Nein, noch nicht«, sagte der Fremde, und ihr Vater blickte auf: »Noch nicht? Nein, so war das nicht abgemacht. Sie ist noch zu jung.«
»Der Feind kümmert sich nicht darum, wie alt sie ist. Sie muss vorbereitet werden.«
»Verschwindet.« Der Zorn war aus der Stimme ihres Vaters gewichen, doch die Müdigkeit, die nun in ihr lag, war schlimmer. Am liebsten wäre Vanora die Treppen hinuntergestürmt und hätte ihn getröstet. Wer auch immer diese Eliria gewesen war, die Nachricht ihres Todes hatte ihren Vater sichtlich getroffen.
»Es ist Eure Entscheidung, Briac Larnegie. Das Mädchen muss lernen, über ihre Fähigkeiten zu verfügen. Es kann hier …« Der Fremde hob den Kopf. Einen flüchtigen Moment lang wich der Schatten, und sie sah erneut das blasse, nahezu schneeweiße Gesicht, dessen Züge im Zwielicht scharf und feindselig wirkten. Seine goldenen Augen funkelten im Schein der Kerze, und dann – als hätte er gespürt, wo sie war – sah er zu ihr hoch.
Vanora schnappte nach Luft, brachte all ihre Willensstärke auf und rutschte etwas zurück. Dabei stieß sie mit dem Fuß gegen die offene Tür ihrer Kammer, doch das Geräusch und ihr leises Fluchen gingen in den letzten Worten des Fremden unter: »… oder woanders geschehen.«
Erleichtert atmete sie aus. Offenbar hatte er sie doch nicht bemerkt, auch wenn ihr wild schlagendes Herz das Gegenteil behauptete. Vorsichtig kroch sie wieder ein Stück näher und spähte über die Stufen hinab. Ihr Vater saß immer noch am Tisch, seine Haltung war angespannt. »Woanders, ja?« Er schnaubte verächtlich. »Ihr habt Nerven! Hier einfach aufzutauchen und zu glauben, ich gebe Euch mein Kind.«
»Solange das Mädchen hier in Sicherheit ist …«
Ihr Vater sprang auf, und der alte Holzstuhl, ein Werk des Großvaters, fiel polternd um und schlitterte ein Stück weit über den Lehmboden. »Sie wird hier immer in Sicherheit sein!« Einen Moment lang schien es, als würde sich ihr Vater auf die dunkle Gestalt stürzen, doch er blieb stehen, die Hände zu Fäusten geballt.
Auch Vanora erstarrte. Die Worte des Fremden hallten immer und immer wieder durch ihren Kopf, und die Erkenntnis traf sie wie eine Ohrfeige. Das Kind, über das der Fremde mit ihrem Vater sprach, das war sie selbst, denn ein anderes Kind gab es hier ja nicht! Ihr wurde schwindlig. Plötzlich ergaben die scheinbar zusammenhanglosen Worte einen Sinn. Sie sollte fort!
Zitternd richtete sie sich auf und schwankte, als sie einer Schlafwandlerin gleich Stufe um Stufe die Treppe hinab zur Stube nahm. Der Fremde hatte die Eingangstür nicht hinter sich geschlossen, und der Geruch nach Regen lag in der Luft. Er blickte auf, doch sein durchscheinender Glanz, das Gold seiner Augen und das Geheimnis, das ihn umgab, interessierten sie nicht mehr. Es war der verzweifelte Ausdruck ihres Vaters, der ihr die Tränen in die Augen trieb.
»Vanora! Wieso schläfst du nicht?«
»Sag ihm, dass ich hierbleiben werde.« Es gelang ihr nicht, das Schluchzen zu unterdrücken. »Sag ihm, dass er mich nirgendwohin mitnehmen darf.«
Die Augen ihres Vaters glänzten, und als er nun zu ihr kam und sie hochhob, wirkte sein Lächeln gezwungen. Vanora klammerte sich an ihn, vergrub ihr Gesicht an seiner Schulter. Noch nie hatte sie solch große Angst gehabt. Noch nie hatte sie ihren Vater so verzweifelt gesehen.
»Keine Sorge. Du bleibst bei mir. Keine Sorge.«
Doch den Fremden schienen die Worte ihres Vaters nicht zu beeindrucken: »Ich erwarte das Kind morgen früh.«
Vanora hob den Kopf und starrte durch einen Schleier aus Tränen in die Nacht hinaus. Ein Schauer kroch ihren Rücken hinab, der nichts mit dem Wind zu tun hatte, der noch immer den Regen in die Stube peitschte. Der Fremde war verschwunden, als hätte es ihn nie gegeben.
»Vater?« Sie lehnte sich etwas zurück und sah ihn an. Der Funkenflug in der Schmiede hatte Dutzende heller Narben auf sein Gesicht gezeichnet. Zärtlich strich sie ihm durch das dichte, blonde Haar, das dem ihrigen so sehr glich – ebenso wie seine türkisblauen Augen, in denen nun Tränen glänzten. Sie gab ihm einen tröstenden Kuss auf den Mund. Sein blonder Ziegenbart pikste, doch das hatte sie noch nie gestört. Wenn er nur aufhören wollte zu weinen!
»Vater, wer ist Eliria?«, fragte sie und versuchte ihre Worte belanglos klingen zu lassen, was ihr allerdings nicht besonders gut gelang.
Briac wurde blass, sehr blass. Behutsam stellte er sie wieder auf die Beine. »Du hättest nicht lauschen dürfen, Kleine.« Er drehte sich um, schloss die Türe und verharrte dann einen Moment lang reglos, ehe er sich ihr mit einem tiefen Seufzen zuwandte und in die Hocke ging. »Du weißt, dass ich dich sehr liebhabe.« Er hob sie auf sein Knie und strich ihr das lange, hellblonde Haar zurück, das in ihrem tränennassen Gesicht klebte. »Der Mann, der eben hier war … er kannte deine Mutter. Eliria.«
»Die Frau, die gestorben ist?«
Er musterte sie forschend, dann nickte er. »Ja. Deine Mutter lebt nicht mehr.«
Vanora verstand, aber der Tod der Frau berührte sie nicht. Für sie hatte es immer nur ihren Vater gegeben – und ihren Großvater, als dieser noch am Leben gewesen war. Der Name ihrer Mutter war ihr ebenso gleichgültig wie die Nachricht von ihrem Tod. Kurz irritierte sie dieser Mangel an Traurigkeit. Ihre Mutter war gestorben. Müsste sie nicht irgendetwas fühlen? Den Verlust beweinen? Aber dann schüttelte sie den Kopf. Bis vor wenigen Augenblicken hatte sie keine Mutter gehabt, und wie die Dinge standen, würde sich daran auch niemals etwas ändern. Eliria war für sie nur ein Name, mehr nicht. Sie wusste nicht, was sie vermissen sollte, und deshalb war es, so fand sie, vermutlich auch nicht weiter schlimm, dass sie nun nicht traurig war. Nachdenklich ließ sie ihren Blick durch das Zimmer und zu der geschlossenen Haustür wandern, durch die der Fremde wie ein Geist verschwunden war. Sofort griff die Kälte wieder mit langen Klauen nach ihrem Herzen. »Wieso war dieser Mann hier, Vater? Wieso will er mich mitnehmen – und wohin?«
Energisch schüttelte er den Kopf, als wolle er damit nicht nur ihre Ängste, sondern auch seine eigenen Geister vertreiben. »Er wird dich nicht mitnehmen, Kleine. Deine Mutter war eine … sehr hochgestellte Frau. Sie wollte dir eine gute Ausbildung ermöglichen, und deswegen ist dieser Mann heute zu uns gekommen.«
Vanora verstand kein Wort. Jede Antwort warf neue Fragen auf. Sie hatte ihren Vater früher hin und wieder nach ihrer Herkunft gefragt, aber er war ihr stets ausgewichen, und so hatte sie irgendwann hingenommen, dass er nicht darüber sprechen wollte. Nun aber war dieser Fremde in ihr Leben getreten, hatte den Damm aus Schweigen gebrochen, und Vanora wollte Antworten. Wieso wurde sie in diesem Dorf wie eine Aussätzige behandelt? Wieso wollte niemand etwas mit ihr zu tun haben? Schließlich war sie hier nicht das einzige Kind, das ohne Mutter aufwuchs. Andere Frauen waren im Kindbett gestorben oder am Fieber. Lag es daran, dass ihre Mutter … wie hatte ihr Vater es genannt? … eine sehr hochgestellte Frau gewesen war? Hatte sie einst mit ihnen hier in dieser Kate gelebt und war dann fortgegangen? Vielleicht nach Vinelba, der nächstgelegenen Stadt, in der auch die anderen Grafen und Barone lebten? Aber weshalb war sie dann nie gekommen, um sie und ihren Vater zu besuchen? Bis zur Stadt war es mit einer der edlen Kutschen, die manchmal auf der großen Straße vorbeifuhren, zwar kein Katzensprung, aber auch nicht unendlich weit.
Vanora löste sich von ihrem Vater und setzte sich vor ihm auf den Boden. Mit an die Brust gezogenen Beinen sah sie zu ihm auf. »Diese … Eliria … Wieso ist sie weggegangen?«, fragte sie zum ersten Mal in ihrem Leben und fürchtete sich gleichzeitig vor der Antwort.
Briac atmete tief aus, strich sich wieder mit der Hand über die Augen. »Du musst wissen, Kleine, Eliria war mehr als nur Gräfin oder die Tochter eines Barons. Sie war so eine Art Prinzessin.«
»Eine Prinzessin?«
»Ja, aber in ihrem Heimatland war sie nicht sicher. Dort herrscht ihre Tante.«
»Das verstehe ich nicht.«
»In diesem Reich geschehen Dinge, die uns fremd sind.« Briac sah ihr in die Augen, und doch sah er sie nicht an. Er war irgendwo weit weg. »Kämpfe um Macht und Land«, murmelte er. »So viele Lügen und Intrigen. Nein, Kleine. Wir können das nicht verstehen. Das Einzige, das du wissen musst, ist, dass deine Mutter dich nicht in dieses Land mitgenommen hat, weil sie dich beschützen wollte.«
»Aber wieso ist sie dann nicht einfach hiergeblieben? Wieso ist sie zurückgegangen in dieses andere Land?«
»Sie hatte Angst um uns, um dich. Sie war eine Prinzessin und deswegen sehr wertvoll für diejenigen, die um die Herrschaft kämpfen. Sie wollte nicht, dass irgendjemand weiß, dass du … Sie wollte dich retten.«
Vanora verstand noch immer nicht. Sie war die Tochter des Hufschmieds, keine Prinzessin. Erneut huschte ihr Blick zu der nunmehr geschlossenen Tür. »Und dieser Mann? Wo kommt er her? Was wollte er?«
Briac erhob sich, und wie einem Impuls folgend schob er den Riegel vor. »Sein Name ist Glendorfil. Du musst nicht so schauen. Er heißt wirklich so.«
»Dieses Land muss sehr weit weg sein.«
»Das ist es auch.« Briac lehnte sich gegen den Türrahmen. »Jedenfalls stand Glendorfil auf der Seite deiner Mutter. Und jetzt möchte er nach dir sehen. Er wird dich ab morgen unterrichten.«
»Was?!« Vanora sprang auf. »Ich will nicht, Vater! Dieser Mann ist mir unheimlich.«
Briacs Lächeln wirkte gequält. »Ach, komm schon, Kleine. Seit wann bist du denn so ängstlich? Er wird dir nichts tun. Er war ein Freund deiner Mutter.«
»Wenn er ein Freund ist, wieso hast du ihn dann so angeschrien?«
Briac öffnete den Mund, sagte jedoch nichts. Er schob die Stühle um den Tisch zurecht und deutete dann die Treppe hinauf. »Ab ins Bett jetzt. Morgen liegt ein anstrengender Tag vor dir.«
»Aber ich …«
»Keine Widerrede. Du gehst morgen zu Glendorfil, und du wirst dich benehmen, hast du verstanden?«
Vanora hob den Kopf und sah ihn fassungslos an. Das konnte er doch nicht so meinen! Er hatte den Mann doch selbst nicht gemocht! Wie konnte er da …? Aber ihr Vater tat, als sei die Angelegenheit erledigt und alles gesagt. Schließlich stapfte sie an ihm vorbei, lief laut polternd die Treppe nach oben, knallte die Tür hinter sich zu und warf sich auf das Strohlager.
In dieser Nacht konnte sie kaum schlafen, und wenn sie es doch tat, träumte sie widersinniges Zeug. Sie sah einen dunklen Wald, mit Bäumen so hoch, dass sie bis in den Himmel reichten, und Stämmen so dick, dass sie wohl nicht einmal zehn Männer mit ausgestreckten Armen umfassen könnten. Dichte, graue Nebelschleier wanden sich zwischen den schwarzen Säulen hindurch und nahmen ihr die Sicht. In einem anderen Traum war sie von weißem Licht umgeben. Sie wusste nicht, wo oben oder unten war, schwebte in der Unendlichkeit. In den vielen und langen Wachphasen ging es ihr auch nicht besser. Die wilden und zusammenhanglosen Bilder, die sich in ihren Kopf schlichen, verwirrten sie und waren, so dachte sie, gewiss ein Nachhall der Dinge, die sie am Abend zuvor erfahren hatte.
Als sich am Morgen die ersten Sonnenstrahlen an dem dicken Vorhangstoff vorbei in ihr Zimmer stahlen, wusste sie nicht zu sagen, was überwog: die Erleichterung über das Ende dieser endlos langen Nacht oder die Furcht vor dem, was der Tag bringen würde.
Ihr Vater war an diesem Morgen besonders wortkarg und holte sie früher als sonst aus ihrer Kammer. Wie so oft, wenn er früh in der Schmiede arbeitete, war sie beim Frühstück allein, aber heute schien es Vanora so, als würde Briac vor ihr fliehen. Sie würgte den geschmacklosen Getreidebrei hinunter, schlüpfte in eines ihrer verhassten Kleider, schrubbte ihr Gesicht an der Tränke mit Wasser ab und strich ein paarmal mit den Fingern durch ihre Haare. Dann ging sie zu ihrem Vater in die Schmiede. Er wich ihrem Blick noch immer aus, erklärte ihr, wohin sie gehen musste, und erstickte ihren Protest früher und schärfer, als sie es gewohnt war. Also nickte sie nur knapp, warf die Tür hinter sich ins Schloss und stapfte kurz darauf wütend durch das hohe Gras den Hügel hinauf. Mit einem Ast schlug sie auf die purpur blühenden Disteln ein, die ihr die Beine zerstachen, und jeden Kopf, der fiel, kommentierte sie mit einem Fluch. In ihrer Phantasie waren es Drachen, die sie mit ihrem Schwert bezwang, einen nach dem anderen.
»Du darfst da nicht hinaufgehen! Das ist verboten!«
Vanora hielt mitten im Schwung ihres Schwertstreiches inne und drehte sich übertrieben seufzend zu den anderen Kindern um. Sie mochten sie nicht und hatten selten ein gutes Wort für sie. »Dann geht schnell zurück, bevor eure Mamis euch ausschimpfen«, blaffte sie und streckte der Bande ihren Ast entgegen. Graem, der Anführer der Raufbolde und zwei Sommer älter, als sie selbst es war, lachte lauthals, und seine Anhänger stimmten artig ein. Dann deutete Graem mit seinem klobigen Holzschwert in Richtung des Hügels: »Wer da hinaufgeht, kommt nicht mehr zurück.«
Vanora musterte ihn aufmerksam. Seine Waffe war nicht beeindruckender als ihr Ast, und in seinen Augen glomm eine Mischung aus Furcht und Trotz. Er würde sie nicht gehen lassen, ihr aber auch nicht sehr lange folgen, wenn es ihr gelänge, ihm zu entwischen. Vanora lächelte. Sie hatte die Bande oft genug dabei beobachtet, wie sie mit ihren selbst gebastelten Schwertern gegen Bäume, Häuser oder aufeinander eingedroschen hatten, und sie wusste, dass sie schneller war.
»Wenn ihr euch fürchtet, müsst ihr ja nicht weitergehen.« Sie drehte sich um, doch wie erwartet packte Graem ihren Arm. Es war ein Reflex, der sie im selben Moment, in dem sie zu ihm herumgerissen wurde, mit dem Arm ausholen ließ. Mit aller Kraft schlug sie den Ast gegen seine Schläfe und verlagerte sofort ihr Gewicht, um ihm gegen das Schienbein zu treten. Graem fluchte, ließ sie aber los, so dass sie ihm noch mit der freien Hand gegen die Schulter boxen konnte. Sie war immer schon schnell gewesen, und so war es ihr ein Leichtes, vor ihm zurückzuweichen, sich umzudrehen und davonzulaufen.
Sie wusste, dass die Bande zu ängstlich sein würde, um ihr zu folgen, und so stürmte sie, ohne zurückzublicken, weiter, bis die Umrisse der alten, verwahrlosten Hütte auftauchten, die die Schäfer schon vor langer Zeit verlassen hatten. Hier sollte sie warten, hatte ihr Vater ihr gesagt. Sie war schon oft hier gewesen, heimlich, um sich zu den Steilklippen zu schleichen und die tosende Brandung zu sehen, die sich an den scharfkantigen Felsen brach. Das Haus war ihr nicht fremd, und doch ging etwas Gespenstisches von ihm aus. Das Holz war modrig und stellenweise mit Moos bewachsen, das Strohdach verschimmelt. Ohne es zu bemerken, wurde sie immer langsamer, doch dann straffte sie sich. Ihr Vater hätte sie wohl kaum hierher geschickt, wenn ihr hier eine Gefahr drohen würde. Und deshalb gab es auch keinen Grund zur Furcht – auch dann nicht, wenn hier der unheimliche Mann mit den Goldaugen auf sie wartete.
Wenige Meter vor dem Häuschen blieb sie stehen und lauschte. Außer den Geräuschen des nahen Waldes war es still. Vielleicht hatte sich ihr Vater geirrt? War da nicht doch etwas? Sie fühlte sich beobachtet und inspizierte aufmerksam die schwarzen Fensterhöhlen, doch dort war nichts als Dunkelheit. Da war niemand. Sie hatte keine Angst. Keiner der Helden aus ihren Geschichten fürchtete sich beim Betreten einer Drachenhöhle. Ihre Finger schlossen sich fester um den Ast in ihrer Hand.
Leise klopfte sie an die Tür. Es war kaum zu hören – wie auch, wo sie das Holz so gut wie nicht berührt hatte. Dennoch antwortete ihr die Stimme des Fremden wie ein Flüstern des Windes in ihrem Ohr: »Komm nur herein, Mädchen.«
Vanora nahm den Türknauf in die Hand und atmete tief durch. Sie hatte keine Angst. Sie hatte niemals Angst. Energisch stieß sie die Tür auf und machte einen entschlossenen Schritt in die Dunkelheit.
Zunächst erkannte sie die Umrisse eines Tisches, an welchem zwei Stühle standen. Erst als sich ihre Augen allmählich an das Zwielicht gewöhnt hatten, bemerkte sie die hochgewachsene, schlanke Gestalt, die fast mit den Schatten zu verschmelzen schien.
»Ich freue mich, dass du gekommen bist.« Glendorfil ging einen Schritt auf sie zu, trat in den von Staubwirbeln durchzogenen Lichtstreifen, der durch die offenstehende Tür drang.
Vanora starrte ihn an, die Antwort blieb ihr im Halse stecken, und den Mund wieder zu schließen, vergaß sie ganz. Es war schwer, selbstbewusst zu wirken, während der schönste Mann der Welt zu einem hinabsah. Er sah unwirklich aus, nicht wie ein Mensch. Seine Haut wirkte wie weißer, geschliffener Marmor, die scharfen Gesichtszüge wie eingemeißelt. Ein Strom pechschwarzer, seidiger Haare floss über seine Schultern bis zur Brust hinab und ließ sein schmales Gesicht nur noch heller strahlen. Unter dem Hut mit der breiten, goldverzierten Krempe glosten seine Goldaugen und hielten sie gefangen.
»Setz dich.«
Der Mann, der, wie sie von ihrem Vater wusste, Glendorfil hieß, deutete mit einem Lächeln in die Richtung, in der sie vorhin den Tisch mit den Stühlen gesehen hatte. »Setz dich nur, Vanora.« Jedes seiner Worte klang, als würde es von einem unsichtbaren Glockenspiel begleitet. Noch immer konnte sie den Blick nicht von ihm wenden. Fasziniert betrachtete sie eine kleine, hauchdünne Einkerbung an seiner linken Wange. Zunächst hatte sie sie für ein Grübchen gehalten, doch bei genauerer Betrachtung erkannte sie, dass es eine Narbe war.
Glendorfil, der ihren Blick wohl bemerkt hatte, zog mit dem Finger den Verlauf der weiß verblassten Linie nach und zwinkerte ihr zu: »Eine alte Kriegsverletzung.«
Vanora kniff die Augen zusammen. Eine alte Kriegsverletzung? Wie alt könnte diese Verletzung denn schon sein? Ihr Vater hatte noch nicht einmal dreißig Sommer erlebt, und dieser Mann war um etliche Jahre jünger als er. Argwöhnisch musterte sie den Fremden und verharrte auf dem Blick seiner tiefgründigen, weisen Augen, die wirkten, als hätten sie Jahrhunderte vorüberziehen sehen. Womöglich war er doch älter, als er aussah?
Glendorfil deutete erneut in Richtung des Tisches, und dieses Mal erinnerte sie sich an ihre Erziehung, sank in einen Knicks und nahm schließlich Platz. Der Fremde setzte sich ihr gegenüber: »Ich hoffe, ich habe dir gestern keine Angst gemacht. Falls doch, möchte ich mich bei dir entschuldigen.«
Vanora schob das Kinn vor und richtete sich im Stuhl auf. »Ich bin nicht ängstlich.« Sie ballte die Hände zu Fäusten, um das Zittern zu verbergen.
Glendorfil lächelte noch immer und beugte sich etwas weiter vor. Vanora runzelte die Stirn. Es war merkwürdig. Der Geruch des feuchten, modrigen Holzes lag in der Luft, doch gleichzeitig ging von dem Mann ein schwacher, unglaublich frischer Duft aus, so klar wie die Luft nach einem Gewitter, wie frischer Schnee oder das eisige Meer.
Vanora straffte sich und lächelte zurück. »Mein Vater sagt, Ihr wart ein Freund meiner Mutter.«
»So könnte man sagen, ja. Was hat dir dein Vater denn noch alles erzählt?«
Aufmerksam forschte sie in seinen Goldaugen nach einem Hinweis, einer Gefühlsregung, irgendetwas, das ihr geholfen hätte, zu erkennen, wie der Fremde zu ihrer Mutter gestanden hatte. Vermisste er sie? Hatte er sie geliebt? Und wie mochte er zu ihrem Vater stehen? »Papa spricht nicht über sie«, sagte sie schließlich.
Glendorfil nickte. Sein Blick fiel auf ihre Hände, die auf der rauen, zersplitterten Tischplatte lagen. »Woher hast du diese Narben?«
Blitzschnell ließ Vanora ihre Hände unter dem Tisch verschwinden. »Ist in der Schmiede passiert. Funken.«
Wieder nickte Glendorfil, und Vanora spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. Ob er ihre Lüge durchschaut hatte? Die hellen Linien, die sich über ihre Handinnen- und -außenflächen zogen, waren kaum noch zu sehen. Das Feuer hatte sie kaum verletzt. Eigentlich hätten sie im Zwielicht gänzlich unsichtbar sein müssen. Offenbar hatte Glendorfil gute Augen. Genau wie sie.
»In der Schmiede also«, wiederholte Glendorfil schließlich leise.
»Ja, mein Vater ist Hufschmied. Früher war er Waffenschmied. Mein Großvater sagte, dass Vater die besten Schwerter hergestellt hat. Einmal hat er sogar für den Fürsten von Vinelba eines gemacht.«
»Wirklich? Für den Fürsten?«
»Ja.« Vanora vergaß die Beklommenheit, legte automatisch die Hände wieder zurück auf den Tisch und rutschte näher. »Von überall in der Welt wollten die Leute seine Schwerter haben. Er war oft in Vinelba in der Burg. Mein Großvater hat gesagt, dass er dort meine Mutter kennengelernt hat. Ist das wahr? Mein Großvater hat auch gesagt, dass Vater den König getroffen hat. Alle Ritter wollten eines von seinen Schwertern haben. Hat meine Mutter in Vinelba gewohnt? Mein Großvater hat gesagt, dass sie wunderschön war und dass mein Vater früher auch einmal schön gewesen ist und lustig und fröhlich. Seine Schwerter …«
»Aber jetzt ist dein Vater Hufschmied, nicht wahr?«
Vanora grub die Fingernägel in die Kerben der Tischplatte. »Er kann immer noch Schwerter machen«, sagte sie leise und doch bestimmt.
»Wieso tut er es dann nicht?«
»Er … Mein Großvater hat gesagt … er … er konnte nicht mehr so viel reisen. Er wollte mit den Noblen nichts mehr zu tun haben. Er hatte … mich.«
»Ja, fürwahr.« Glendorfil erhob sich und ging auf die Truhe zu. Mit dem Rücken zu ihr blieb er stehen und blickte geradeaus zur Wand. »Er war früher anders?«, fragte er nach einer Weile des Schweigens, ohne sich jedoch zu ihr umzudrehen. »Dein Vater, er war nicht immer so …«
»Traurig?«
Glendorfil drehte sich zu ihr um. Sie konnte sein Gesicht nicht sehen, und doch spürte sie auch an ihm eine gewisse Traurigkeit, die sie ungewöhnlich intensiv fühlen konnte. So als wäre sie … ein Teil von ihm. Ein Schauer lief ihr den Rücken hinab, doch dann fing sie sich wieder. Das war Unsinn. Es war nur seine Stimme, die so anders war und automatisch eine melancholische Stimmung hervorrief.
»Und dein Großvater kannte deine Mutter ebenfalls?«
»Ja. Mein Großvater war auch Waffenschmied, obwohl er der Sohn eines Gelehrten von Vinelba war. Er hat meinem Vater alles beigebracht. Graham sagt, ich sehe aus wie er.«
»Tatsächlich? Dann muss dein Großvater sehr hübsch gewesen sein.«
Eine leise Verlegenheit befiel sie, doch kurz darauf spülte das Misstrauen sie fort. »War er nicht. Woher wisst Ihr, dass er tot ist?«
Glendorfil wandte sich wieder ab und nahm etwas aus der Truhe. »Menschen sterben«, sagte er, als er sich wieder zu ihr umdrehte. »Früher oder später.«
Vanora starrte in das von Schatten verhüllte Gesicht. »Er war nicht so alt«, sagte sie. »Er starb im Winter vor zwei Jahren am Fieber.«
»Richtig.« Er legte einen Haufen schwarzer Leintücher auf den Tisch. »Aber genug davon. Lass uns mit dem Unterricht beginnen.«
Sie seufzte. »Aber ich kann schon lesen und schreiben. Großvater hat es mir beigebracht.«
»Dann ist es ja gut, dass du bei mir anderes lernst.« Mit einer blitzschnellen Bewegung schlug er die Tücher auseinander.
Vanora fuhr zurück, schnappte instinktiv nach Luft und wäre fast mit dem Stuhl hintenübergekippt.
»Du tust ja so, als wäre darin eine Schlange.«
Mit großen Augen starrte sie auf Köcher, Pfeile und Bogen. »Was soll ich damit?«
»Üben.« Glendorfil lächelte und legte nun auch noch ein prachtvolles, mit Edelsteinen verziertes Schwert frei. »Und die Beste werden.«
Vanora sah ihn fassungslos an. »Einfache Leute dürfen keine Waffen benutzen – und Frauen dürfen es erst recht nicht.«
»Dort, wo ich herkomme, schon.« Glendorfil nahm ihr gegenüber Platz. »Sag, ist dir jemals aufgefallen, dass in deiner Gegenwart vermehrt Dinge geschehen, die du nicht erklären kannst? Gab es hier bereits besonders starke Stürme? Überschwemmungen? Brände?«
Vanora zuckte zusammen. Sofort erschienen in ihrem Kopf: der brennende Ziegenstall im Hinterhof. Die Blumen, die plötzlich zu Asche verwandelt aus ihrer Hand rieselten. Das Holzschwert, das zersplitterte, als wäre ein alles versengender Blitz hindurchgefahren. Doch dies waren bei weitem nicht die schlimmsten Erinnerungen. Da waren jene Momente, die sie nicht bewusst erlebt hatte. Die vielen Male, als ihr die Sinne geschwunden waren. Als sie nicht mehr wusste, was sie tat, und danach in die entsetzten Gesichter der Leute aus dem Dorf blickte – und in das besorgte Gesicht ihres Vaters. Die Narben an ihrer Hand begannen zu jucken. Vanora strich mit den Fingern darüber, sah auf und hielt Glendorfils bohrendem Blick stand. »Nein«, antwortete sie. Sie musste sich darauf konzentrieren, ruhig zu atmen und das Glühen ihrer Wangen zu ignorieren. Nur ihr Vater wusste von den seltsamen Dingen, die ihr geschahen. Und er hatte ihr streng verboten, irgendjemandem davon zu erzählen. Manche Menschen waren nun einmal so wie sie, sagte er, aber es wäre besser, das geheim zu halten.
»Nun gut.« Glendorfil erhob sich. »Wie du meinst. Dann lass uns keine weitere Zeit verschwenden.« Und mit diesen Worten ging er an ihr vorbei und zur Tür hinaus.
Ohne zu überlegen, griff Vanora nach Bogen und Pfeilen und folgte ihm. »Habt Ihr deshalb mit meinem Vater gestritten? Weil Ihr mir beibringen wollt, wie man damit umgeht? Weil …« Sie verstummte. Mit weit aufgerissenen Augen sah sie an dem Mann vorbei und auf ein Tier, das dort seelenruhig auf der Wiese graste. Nicht einmal die prächtigen Schlachtrösser der Ritter, die sie einst gemeinsam mit ihrem Großvater in Vinelba gesehen hatte, waren mit diesem Tier zu vergleichen. Das Fell war viel zu schwarz und glänzte wie in Öl gebadet, und die dichte, schimmernde Mähne reichte bis weit unter den muskulösen Hals. Noch nie hatte sie etwas so Wunderschönes gesehen. Langsam näherte sie sich, blieb jedoch an Glendorfils Seite. Das Pferd hob den Kopf, streckte ihnen aufmerksam die Ohren entgegen. Was war das nur für ein Land, aus dem Glendorfil kam, wenn es dort solche Pferde gab?
»Vanora.« Glendorfil streichelte über die Stirn des Pferdes, das ihm zärtlich gegen die Brust stupste. »Ich möchte dir meinen treuen Freund Glitnir vorstellen.«
Sie räusperte sich. »Er ist wundervoll«, und empfand zugleich schmerzlich, dass dieses Wort dem Pferd nicht gerecht wurde.
»Ja, das ist er.« Erneut lächelte Glendorfil auf jene schöne und zugleich beunruhigende Weise, die ihm eigen war, und tätschelte Glitnirs Hals. »Dann freut es dich doch bestimmt, dass du jetzt auf ihm reiten wirst.«
»Was?« Sie wich einen Schritt zurück. »Nein, das geht nicht. Er ist so groß.«
»Er wird gut auf dich aufpassen. Und ich bin ja auch noch da.«
Sie schüttelte den Kopf. Sie wusste weder, was sie von Glendorfil halten, noch, wie sie das Tier einschätzen sollte. Doch ihr selbsternannter Lehrmeister nahm nur die Zügel in die Hand und hielt sie ihr hin. »Wenn du Angst hast, können wir auch zu Fuß gehen.«
»Ich habe keine Angst«, erklärte sie, reckte das Kinn vor und setzte sich mit festen Schritten in Bewegung.
Er zwinkerte ihr zu – eine seltsam menschliche Geste in diesem so wenig menschlichen Gesicht. »Das dachte ich mir.«
Und noch ehe sie richtig begriff, wie ihr geschah, packte Glendorfil sie, hob sie mühelos auf das Pferd und saß im nächsten Moment selbst hinter ihr im Sattel.
Ein kräftiger Windstoß fuhr ihr ins Gesicht, wehte ihr Haar zurück und zerrte an ihrem Kleid. Die Welt um sie herum flog an ihr vorbei und verschwamm zu einem blaugrünen Schemen. So leicht, als würde er schweben, stürmte der Rappe über die Hügel auf den hellblauen Horizont zu. Ihre Hände klammerten sich an den Bogen, und sie spürte Glendorfils Arm, mit dem er sie an seine Brust drückte. So musste sich ein Vogel fühlen, der frei und schwerelos über das Land flog – dem gewaltigen Donnern der Wellen zu, der lauter war als das Gewitter der vergangenen Nacht.
Sie benötigten nur wenige Minuten, um die Steilklippen zu erreichen. Glitnir hielt inne, und Vanora atmete tief die kühle Seeluft ein. Die anderen Dorfbewohner mieden diesen Ort, aber Vanora liebte die gigantischen Felsen, die senkrecht ins Meer fielen, und hatte sich ihnen zeit ihres Lebens verbunden gefühlt. Dass – wie die anderen behaupteten – das Böse in diesen Klippen wohnte, glaubte sie nicht. Wie sollte solch ein traumhafter Ort böse sein?
Glendorfil schwang sich aus dem Sattel, hob sie vom Pferd und sah sich um. Wonach er Ausschau hielt, wusste sie nicht. Hier gab es nichts als die grüne Ewigkeit und den Abgrund am Ende der ewig langen Küstenlinie.
»Siehst du den Felsen, dort, neben dem Apfelbaum?«
Vanora kniff die Augen zusammen, folgte seinem Blick und schüttelte schließlich den Kopf.
»Streng dich an.«
»Aber ich sehe dort keinen Felsen und auch keinen Apfelbaum.«
Glendorfil sah zu ihr hinab, und in seinem Blick lag mit einem Mal eine Kälte, die ihr die Luft aus den Lungen zu pressen schien. Sie schauderte, als der Blick seiner goldenen Augen den ihrigen gefangen hielt. Und so versuchte sie es noch einmal, konzentrierte sich auf die gewellte Linie, die die grünen Hügel vom blauen Horizont trennte. Das Bild wurde immer schmaler, die Ränder zogen sich nach innen, immer stärker schränkte sich ihr Blickfeld ein. Sie nahm nicht mehr wahr, was seitlich von ihr geschah, und ihr Blick flog wie durch einen Tunnel über die Wiese – und da sah sie ihn. Den langen, spitz zulaufenden Felsen, der unweit eines weißblühenden Apfelbaums aus dem Boden ragte.
Vanora bemerkte kaum, dass Glendorfil ihr den Köcher mit den Pfeilen umlegte und den Bogen gegen die Brust drückte. »Zieh einen Pfeil.«
Ohne lange nachzudenken, hob sie die Hand, griff über die Schulter nach hinten, tastete nach den gefiederten Enden der Pfeile und zog einen davon heraus.
»Dreh dich etwas zur Seite, diesen Fuß ein kleines Stück zurück, genau so. Steh aufrecht, Kopf hoch.«
Vanora löste den Blick vom Felsen, sah zu Glendorfil auf und erstarrte. Es war, als wäre ein Schleier von ihren Augen gefallen und als könnte sie zum ersten Mal klar sehen. Sie erkannte jedes Detail – Dinge, die ihr früher niemals aufgefallen waren. So sah sie auch, dass Glendorfils Haut tatsächlich reinweiß war, ohne die kleinste Unreinheit, ohne Bartstoppeln oder Unebenheiten. Seine Augen funkelten wie Edelsteine, wirkten genauso wie seine Haut – als wären sie aus Stein; leblos, kalt und doch atemberaubend schön.
Sie wusste nicht, ob sie weinen sollte, weil so wenig Leben in dieser Schönheit zu liegen schien; ob sie schreien und fortlaufen sollte vor Furcht oder ob sie vor diesem Fremden, der nun ihr Lehrer war, niederknien sollte, um ihm dafür zu danken, was er ihr gegeben hatte. Sie fühlte sich vollkommen und zugleich entzweit, lebendig und erstarrt – und zutiefst verunsichert. Ein schneller Blick zu dem Apfelbaum in der Ferne zeigte ihr, dass sie diesen noch ebenso klar erkennen konnte wie zuvor. »Was …«, begann sie, aber Glendorfil hob nur seinen Langbogen, der sie nahezu überragte, und zeigte ihr, wie sie ihn richtig halten musste. »Dreh den Ellbogen etwas nach außen. Die Finger nicht so verkrampft, halt ihn ganz locker, Schultern nach unten. Der Arm muss ausgestreckt sein. Zieh die Sehne zurück, ja, richtig. Konzentrier dich auf den Felsen. Die Sehne noch weiter zurück, leg sie am Kinn an.«
Vanora atmete ganz ruhig, sog jedes seiner Worte auf, befolgte die Anweisungen, so genau sie nur konnte. Dies war genau das, was sie immer schon gewollt hatte. Nicht kochen, die Stube fegen oder bei Brietta nähen lernen. Hier zu sein, an seiner Seite, den Bogen in Händen und den Finger an der Sehne – all das fühlte sich richtig an.
Ein leises Kribbeln strömte durch ihre Adern, breitete sich aus, erreichte die Hände, die den Bogen hielten. Ihre Sicht wurde noch schärfer, die Konturen des Felsens immer deutlicher.
»Ruhig einatmen. Halt den Atem an … Lass los.«
Der Pfeil zischte von der Sehne, der Bogen machte einen Satz nach vorn und fiel ihr beinahe aus der Hand. Mit weit aufgerissenen Augen verfolgte sie den Flug des Pfeiles. Er würde nicht treffen, das konnte sie bereits sehen. Schon wollte sie enttäuscht den Blick abwenden, als sie den roten Schweif sah, den der Pfeil hinter sich herzog. Kurz darauf ertönte ein lauter Knall, der hübsche Apfelbaum ging in Flammen auf und brannte lichterloh. Vanora schnappte nach Luft. Das war nicht sie gewesen. Nicht schon wieder. Ihre Hände begannen zu zittern. Mit aller Kraft klammerte sie sich an den Bogen und starrte zu dem Feuer.
»Beeindruckend.«
Glendorfils Stimme riss sie aus ihrer Starre, und fieberhaft suchte sie nach einer Erklärung, nach irgendetwas, das sie ihm erzählen könnte – etwas, das er glauben würde. Sie wusste, dass sie jetzt in Gefahr war. Ihr Vater hatte ihr immer wieder eingeschärft, dass sie in großer Gefahr schwebte, wenn jemand Zeuge dessen wurde, was sie vermochte. Doch sosehr sie sich auch bemühte, ihr wollte einfach nichts einfallen. Sie zitterte, klammerte sich an den Bogen und schwieg.
Glendorfil beugte sich zu ihr hinab und legte die Hand auf ihre Schulter. »Ist so etwas schon einmal passiert?«, fragte er. Seine Stimme klang sanft. Täuschte sie sich, oder schwang dort sogar eine Spur Zufriedenheit mit – oder gar Stolz?
Vorsichtig blickte sie zu ihm auf und schüttelte den Kopf, doch als das Lächeln in seinen Zügen jener Kälte wich, die sie bereits zuvor erschreckt und eingeschüchtert hatte, verwandelte sich ihr Kopfschütteln in ein zaghaftes Nicken.
»Gut«, sagte er. »Weißt du auch, wieso du das kannst?«
Wieder schüttelte sie den Kopf, brachte dann aber doch eine Antwort zustande. »Mein Vater sagt, ich habe einen starken Geist. Manche Menschen können … sie können sich die Kräfte der Natur zu eigen machen.«
»Nun, dein Vater scheint sehr klug zu sein. Soll ich dir verraten, was man sich in meinem Land über Menschen mit solchen Kräften erzählt?«
Vanora nickte. Ihr Herz schlug noch immer viel zu laut gegen ihre Rippen. Auch wenn sie sich eher die Zunge abgebissen als es zugegeben hätte: Diese ganze Situation war zu viel für sie.
»Also gut. Es heißt, dass solche Menschen von Elfen abstammen. Irgendwann, auch wenn es bereits sehr weit zurückliegt, gab es wohl einen Elfen unter deinen Vorfahren.«
»Elfen?«, hauchte sie. »Ich stamme von Elfen ab?« Das war so absonderlich und zugleich aber auch aufregend, dass ihr ganzer Körper zu prickeln begann. Es war lange her, dass in dieser Gegend Elfen gesehen worden waren, die Bündnisse mit den Menschen lagen schon lange zurück. Sie waren einfach zu unterschiedlich, hatte ihr Großvater gesagt, Menschen und Elfen, und niemals hatte der gegenseitige Argwohn überwunden werden können. Heute redete kaum noch jemand von diesen alten Zeiten, und besonders die abergläubischen Bewohner ihres Dorfes sprachen das Wort »Elfen« stets nur flüsternd aus, da sie fürchteten, Böses damit heraufzubeschwören. In den Städten mochten sich die Leute wohl noch eher an die hochgewachsenen Gestalten mit den spitzen Ohren erinnern, doch für Vanora waren sie bisher nur Figuren aus Großvaters Geschichten gewesen.
Die Kälte war nun endgültig aus Glendorfils Goldaugen gewichen. »Wer weiß?«, meinte er lächelnd. »So lauten die Geschichten in meinem Land. Es kann natürlich schon sehr weit zurückliegen.« Er machte mit seiner Hand eine weit ausholende Geste. »Die Natur ist von Magie durchdrungen. Menschen, die Elfenblut in sich haben, können diese Magie in sich aufnehmen.«
»So wie richtige Elfen?«
»Nein, Vanora. Elfen stehen der Natur sehr nah. Sie sind selbst magische Wesen, vereinen die Elemente in sich, auch wenn jeder Elf nur einem Element zugehörig ist. Sie müssen keine Kraft aus ihrer Umwelt schöpfen. Aber ein Mensch kann nur magische Kräfte entfalten, wenn er sie der Natur entnimmt.«
»Also habe ich der Natur etwas … weggenommen?«
»Bislang hast du das, ja.« Er nahm ihre Hand in seine. »Dennoch trägst du die Magie bereits in dir, Vanora. Und du verstärkst sie durch die Energie, die überall um dich herum existiert, weil du nicht mit diesen Kräften umgehen kannst. Das ist sehr gefährlich. Es kann zu viel werden.« Glendorfil kniete sich vor sie hin und seine Augen waren nun auf der gleichen Höhe mit den ihrigen. »Ich kann dir helfen, diese Kraft zu kontrollieren. Damit du über sie verfügst und sie nicht länger über dich verfügt.«
Vanora kniff die Augen zusammen und sah ihn forschend an. »Das könnt Ihr?«, flüsterte sie und ließ sich ins Gras sinken.
»Ich kann dir bei vielem helfen.«
Gedankenverloren hob sie die Hand und grub sie unter ihr Haar. »Vielleicht sind meine Ohren deshalb so spitz«, überlegte sie laut, »weil ich Elfenblut in mir habe.«
»Zeig sie mir.« Glendorfil strich ihr dichtes Haar zurück. Sie trug es immer offen, um die leicht spitz zulaufenden oberen Enden der Ohrmuscheln zu verbergen.
»Nein, nein.« Lächelnd schüttelte er den Kopf. »Elfenohren sehen ganz anders aus. Deine sind viel zu rund. Vielleicht hat dich dein Vater zu oft daran gezogen.«
»Wie sehen denn Eure Ohren aus?«, platzte es aus ihr heraus, doch Glendorfil richtete sich blitzschnell auf. »Sei nicht unhöflich, Mädchen. Man fragt einen Noblen nicht nach seinen Ohren.«
Vanora musterte sein perfektes Gesicht, das nichts Menschliches an sich hatte, und die Stelle, an der sein Hut die Ohren verbarg. »Seid … seid Ihr ein Elf?«, flüsterte sie.
Glendorfil lachte und setzte sich ihr gegenüber in das knöchelhohe Gras. »Wie kommst du denn auf so etwas?«
»Weil, also … Ihr seht so aus wie ein Elf.«
»Wie viele Elfen hast du denn bereits gesehen?«
Vanora sah verlegen zu Boden. Ihre Wangen glühten. »Keinen. Aber … Ihr seid so schön. Niemand sieht so aus wie Ihr.«
»Und du hast schon so viele Menschen in deinem jungen Leben getroffen, um beurteilen zu können, dass niemand von ihnen mir ähnlich sieht? Wie weit hast du dich denn schon von deinem Dorf entfernt? Weiter als bis nach Vinelba?«
»Nein«, gab sie zu und wäre am liebsten im Erdboden versunken.
»Wie willst du dann wissen, wie die Menschen in entfernten Ländern aussehen?«
»Ich weiß es nicht.« Sie konnte kaum noch sprechen. Es lag nichts Böses oder Hohn in seiner Stimme, und doch schüchterte er sie immer noch ein.
»In meinem Land begegnet man noch Elfen. Vielleicht hast du ja recht, vielleicht trage auch ich Elfenblut in mir.« Er beugte sich etwas näher zu ihr. »Möchtest du die Sprache der Elfen lernen?«
Vanora blickte auf und vergaß ihre Scheu. »Ihr sprecht ihre Sprache?«
»Natürlich. So wie alle noblen Herren. Auch die Noblen dieses deines Landes sprechen sie.«
»Ja.«
»Ja, das ist auch hier so?«, fragte er belustigt. »Oder ›ja‹, du möchtest die Sprache lernen?«
»Beides!«, rief sie und wäre ihm mit einem Mal am liebsten um den Hals gefallen. Es war alles so unwirklich, als befände sie sich in einem Traum. Ein wundervoller und zugleich unheimlicher Traum. Mal fürchtete sie sich, mal war sie überglücklich, und im Grunde verstand sie, wie sie sich in einem kleinen Winkel ihres Herzens eingestand, noch immer gar nichts von dem, was ihr geschah. Unruhig rutschte sie hin und her. Dieser Fremde war ihr unheimlich, ja, und manchmal machte er ihr Angst. Sie wusste rein gar nichts von ihm und dennoch war er ihr auf sonderbare Art vertraut. Und er bot ihr ein Leben, von dem sie stets geträumt hatte: das Leben einer Kriegerin! Sie würde all die Abenteuer erleben, von denen ihr Großvater erzählt hatte. Sie würde richtig kämpfen und Drachen besiegen. Niemand würde sie besiegen können. Und Glendorfil war der Schlüssel zu diesem Paradies. Sie wusste nicht, wohin der Weg, den er ihr wies, sie führen würde, aber sie spürte, dass sie aufbrechen wollte. Losgehen. Nachsehen, was hinter dem nächsten Hügel lag. Zurückkehren oder innehalten konnte sie ja immer noch.
»Soll ich noch einmal auf den Felsen schießen?«, fragte sie und hob ihre Hand, um einen neuen Pfeil hervorzuziehen, doch Glendorfil hielt sie zurück: »Nicht so ungeduldig. Zuerst widmen wir uns deinem flammenden Problem, bevor wir weitere unschuldige Bäume vernichten.« Er zwinkerte ihr zu, doch Vanora spürte, dass es kein Scherz gewesen war. Die Art, in der er die unschuldigen Bäume betonte, war, als hätte sie tatsächlich jemanden getötet. Noch ehe sie ihn danach fragen konnte, unterbrach er ihre Gedanken: »Komm näher«, sagte er und Vanora rutschte ein Stück auf ihn zu, so dass sie ihm nun genau gegenüber saß. »Konzentrier dich.«
Die Strahlen der Sonne waren mittlerweile kräftiger und wärmten ihr Gesicht, doch die kalte Luft, die vom Meer her wehte, brachte zugleich lindernde Kühle. Das regelmäßige Rauschen und Donnern des Meeres war die Begleitmusik zu Glendorfils wohlklingender Stimme. Das Meer, der Wind, das Wiegen des langen Grases, das Licht der Sonne, alles verband sich zu einem harmonischen Lied. Sie konnte es hören, es riechen, auf ihrer Haut spüren und selbst auf ihren Lippen schmecken. Sie wurde ruhig, eins mit der Welt um sie herum, und war zugleich hellwach und aufmerksam. Es fühlte sich sonderbar an – fast wie etwas Magisches.
»Ich wünschte, ich wäre eine richtige Elfe.«
Der Holzlöffel ihres Vaters fiel auf den Teller, und Briac sah von seinem Getreidebrei auf. Der grimmige Gesichtsausdruck, den er seit ihrer Rückkehr von den Steilklippen trug, wurde jetzt sogar noch finsterer. Es entstand die vertraute senkrechte Falte zwischen seinen Augenbrauen, die Vanora nur zu gut kannte.
»Wie kommst du denn auf so etwas?«
»Der Herr Glendorfil hat mir heute viel über Elfen erzählt. Wusstest du, dass es zwei verschiedene Elfenvölker gibt? Die Licht- und die Dunkelelfen?«
»Hab schon mal davon gehört«, knurrte Briac und löffelte missmutig weiter.
Doch Vanora ließ sich die Laune nicht verderben. Dies war der schönste Tag ihres Lebens gewesen – fort aus dem Dorf, in dem niemand sie leiden konnte, und fort von den Menschen, die sie stets ansahen, als wäre sie eine Missgeburt. Heute hatte sie so vieles gelernt, hatte wundervollen Geschichten gelauscht und Kräfte in sich selbst, aber auch in der Natur entdeckt, von denen sie niemals gedacht hätte, dass sie existierten.
»Der Herr Glendorfil sagt, dass ich vielleicht von Elfen abstamme und deswegen … Vater, geht es dir gut?«
Briac hustete und würgte. Vanora reichte ihm schnell den Becher mit dem Wasser, das ihr Vater sofort gierig trank. Nur langsam nahm sein Gesicht wieder eine normale Farbe an.
»Es geht mir gut«, krächzte er, obwohl er nicht so aussah. »Was hat er dir noch gleich gesagt, der … Herr Glendorfil?«
Vanora zögerte und musterte ihren Vater, der sie mit angespanntem Kiefer ansah. »Mir ist etwas passiert«, begann sie schließlich leise. »Mit Feuer. Aber keine Sorge, der Herr Glendorfil war nicht böse. Er hat gesagt, dass es eine Gabe ist und dass ich lernen kann, sie zu benutzen. Er hat gesagt, dass dort, wo er herkommt, viele so eine Gabe haben und dass vielleicht ein Elf unter meinen Vorfahren war.«
Briac wurde immer blasser. Wie um Halt zu suchen, griff er erneut nach seinem Löffel, doch seine Hände zitterten. »Das hat er also gesagt?«
»Ja. Und dass überall – also im Boden, im Wasser, in der Luft – Magie ist. Er hat mir gezeigt, dass mir die Energie der Natur helfen kann, ohne dass ich ihr etwas wegnehme. Ein Geben und Nehmen. Man darf der Natur nämlich nichts wegnehmen, ohne ihr wieder etwas zu geben.« Sie grinste. Das mit der Energie war ganz schön kompliziert gewesen, wie sie fand, und sie war stolz auf sich, dass sie alles Erlernte so gut behalten hatte und wiedergeben konnte.
»Es scheint dir nicht mehr so viel auszumachen, dass er dich unterrichtet«, stellte ihr Vater fest.
»Nein, es ist toll!« Vanora strahlte über das ganze Gesicht. Vor Aufregung hatte sie noch keinen Bissen gegessen. »Er erzählt mir Geschichten von Elfen, und er sagt, dass dort, wo er herkommt, ganz viele Elfen leben. Stell dir das mal vor! In Vinelba waren ja schon lange keine mehr. Und er sagt, dass Elfen …«
»Ja? Was sagt er denn über die tollen Elfen? Sagt er dir, dass Elfen wunderschön sind? So schön, dass sie einem den Verstand vernebeln? Sag, Kind, was erzählt er dir? Erzählt er dir, wie schnell sie sind? Wie gut sie sehen können oder dass sie in allem besser sind als Menschen? Wieso wünschst du dir, eine Elfe zu sein? Sag schon – was erzählt der Herr Glendorfil?« Die Fragen kamen wie eine Pfeilsalve, und Vanora duckte sich immer tiefer auf ihrem Schemel. Ihre Hochstimmung war verschwunden. »Nein«, sagte sie und schluckte tapfer gegen das Schluchzen an, das ihr die Kehle hinaufkroch. »Er sprach über Magie und über die Liebe einer Elfenkönigin, die das Elfenreich teilte und damit einen Krieg verursachte.«
»Liebe.« Ihr Vater spuckte das Wort aus, als wäre es ein Fluch. »Er hat wohl vergessen, zu erwähnen, wie dieses Märchen der Liebe ausging.«
»Das kannst du gar nicht wissen.« Ihre Antwort kam patzig, und im Grunde wusste sie, dass sie den Vater verletzte, aber der Zorn war stärker. Warum konnte er sich nicht einfach mit ihr freuen? Der Fremde hatte ihm doch gar nichts getan. Sie, seine Tochter, war noch immer hier. Und sie wollte ihr Glück mit ihm teilen. Da musste er doch nicht … Aber weiter kam sie nicht, denn Briacs Augen blitzten nun vor Zorn so hell wie die Glut des Schmiedefeuers: »Ach nein? Das weiß ich also nicht? Du würdest dich wundern, was ich alles weiß. Die Elfenkönigin hat ihre Schwester verraten. Sie hat sie aus Liebe zu einem Ritter verlassen und so das ganze Land ins Unglück gestürzt. Es gab nicht immer Licht- und Dunkelelfen, Vanora. Früher waren sie alle eins. Aber diese Königin hat dein wunderbares Elfenreich – dieses Elvion – durch einen Zauber geteilt. Und der Ritter? Der hat sie zum Dank dafür getötet! Dann hat er sich selbst zum König des abgetrennten Reiches gemacht, zum König der Dunkelelfen. Was wissen Elfen schon von Liebe, Vanora? Vermutlich hat dir dein lieber Herr Glendorfil nicht erzählt, dass Elfen nicht lieben können, nicht wahr? Nach außen hin sind sie atemberaubend schön, aber in ihrem Inneren sind sie leer. Hässliche, dunkle Seelen und eiskalte Herzen. So sind die Elfen, mein Kind. Und glaub mir: Ich weiß das sehr genau.«
»Das ist nicht wahr!« Vanora kämpfte gegen Tränen und Zorn. Wie konnte ihr Vater solche gemeinen Dinge sagen? Gar nichts verstand er, gar nichts. Er kannte ja noch nicht einmal einen Elfen! Und diese Geschichte über die beiden Elfenköniginnen hatte er bestimmt aus seiner Zeit in Vinelba und sie dort beim Adel am Hof gehört. Aber Glendorfil hatte schon viele Elfen getroffen. Er sprach ja sogar deren Sprache!
»Du weißt gar nichts«, flüsterte sie und würgte den ekelhaften Brei hinunter, in den bereits Tränen getropft waren.
Ihr Vater antwortete nicht, und auch sie löffelte schweigend ihren Teller leer. Erst als sie aufstand und auf die Treppe zuging, hielt ihr Vater sie auf. »Du gehst sofort schlafen«, knurrte er und tauchte die Schalen in die Wasserschüssel. »Morgen musst du sehr früh aufstehen.«
Vanora hielt inne und lächelte. »Dann darf ich morgen wieder hingehen?«
Er sah sie noch immer nicht an und starrte stattdessen auf das Geschirr in seinen Händen. »Natürlich gehst du morgen wieder hin. Du gehst jeden Tag zu ihm.«
Vanora verstand nicht, was ihn umtrieb. Weshalb schickte er sie zu Glendorfil und ließ zugleich kein gutes Haar an ihm? »In ein paar Tagen ist er fort, Papa«, sagte sie schließlich. »Bei Vollmond verlässt er uns. Aber nicht lange, dann kommt er wieder.«
»Natürlich«, knurrte Briac, den Kopf weiterhin gesenkt. »Er kommt immer wieder.«
Vanora seufzte. Ihr Vater war schon immer ein Griesgram gewesen. Sie war es gewohnt. Es machte sie traurig um seinetwillen, aber es verletzte sie nicht. Er stand zu seinen Entscheidungen, er liebte sie, und er ließ sie ziehen. Morgen würde sie einmal mehr dem Dorf und seinen Bewohnern den Rücken kehren und die Welt bei den Steilklippen erkunden – auf jene gänzlich neue, magische Art, die Glendorfil ihr eröffnet hatte. Und das allein zählte.
Alkariel
Als Alkariel in das grelle Licht der Fackel blickte, kam die Erinnerung so unerwartet und heftig, dass sie eher einer Vision glich und ihren Körper ins Taumeln brachte. Ihr Geist war jedoch längst weit weg und befand sich wieder auf dem Balkon ihres Gemachs im Palast von Ueden: Ein greller Blitz erhellte die Nacht und blendete sie mehrere Sekunden lang. Mit Faszination und panischem Schrecken zugleich beobachtete sie die weißglühende Wand, welche sich in der Ferne dem Himmel entgegenstreckte. Die Mauern des Palastes zitterten, die Luft vibrierte durch die gewaltige Energie. Elvions Banner – das Sternbild des Einhorns, welches sich vor einem dunkelblauen Firmament abzeichnete – zerriss in zwei Hälften. Magie knisterte in der Luft, griff nach ihrem Geist, ihrer Seele.