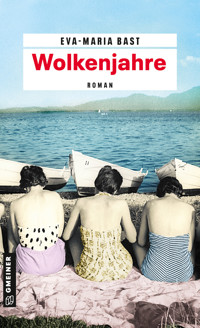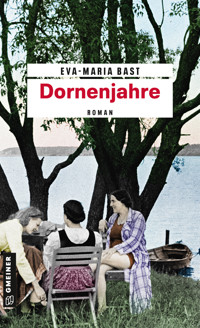10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Juwelier-Saga
- Sprache: Deutsch
Die schillernde Fortsetzung der großen Familiensaga um die Schmuckdynastie Cartier.
Mit dem Aufstieg zum kaiserlichen Hoflieferanten hat sich für die Familie Cartier ein Traum erfüllt. Mit der nächsten Generation entwickelt sich das Unternehmen stetig weiter. Tochter Camille fädelt erfolgreich eine Kooperation mit dem Modeschöpfer Charles Frederick Worth ein. Seine reichen Kunden zeigen sich begeistert von den Schmuckkreationen aus dem Hause Cartier. Derweil plant Sohn Alfred eine Erweiterung des Sortiments und setzt auf Uhren. Gelingt es ihm, aus dem Alltagsgegenstand einzigartige Schmuckstücke zu machen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Die Geschwister Alfred und Camille führen das Unternehmen der Familie Cartier erfolgreich durch schwere wirtschaftliche Zeiten. Auch Camilles Tochter Marie hat die Leidenschaft für Schmuck und das Zeichentalent der Mutter geerbt. Das kreative Arbeiten hilft ihr, über die Schicksalsschläge hinwegzukommen, die die Familie erleiden muss. Als die Weltausstellung und der Bau des Eiffelturms die Gesellschaft beschäftigen, hat sie eine großartige Idee: Marie entwirft eine eigene Kollektion zur Ausstellung, bei der der Eiffelturm im Zentrum steht. Die Reaktionen sind begeistert, doch genügt das, um dem Traditionsunternehmen den Weg in die Zukunft zu ebnen?
Über Eva-Maria Bast
Eva-Maria Bast ist Journalistin und Autorin mehrerer Sachbücher, Krimis und zeitgeschichtlicher Romane. Für ihre journalistische Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Als eine Hälfte des Autorenduos Charlotte Jacobi schrieb sie u. a. den Spiegel-Bestseller »Die Douglas-Schwestern«. Die Autorin lebt am Bodensee.
Im Aufbau Taschenbuch sind von ihr bisher die Bände der Saga »Die Frauen der Backmanufaktur«, der Roman »Die Frauen von Notre Dame« sowie der erste Band der Juwelier-Saga »Antoinette und das Funkeln der Edelsteine« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Eva-Maria Bast
Der Schmuckpalast – Camille und der Glanz von Gold
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Teil 1 — 1873–1874
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Teil 2 — 1877–1881
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Teil 3 — 1886–1889
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Epilog
Danksagung
Spuren der Realität
Literatur und Quellen
Impressum
Buchtipps, die Ihnen ebenfalls gefallen könnten!
Prolog
Laut quietschend fuhr der Zug in die große Bahnhofshalle der Londoner Paddington Station ein. Alfred Cartier erhob sich, setzte seinen Hut auf und strich seinen Mantel glatt, um dann die beiden Koffer, die er die ganze Fahrt über nicht aus den Augen gelassen hatte, aus dem Gepäcknetz zu heben. In dem kleineren der beiden befanden sich die Juwelen, die er im Auftrag seines Vaters in London verkaufen wollte. Der Schaffner öffnete von draußen die Tür, und Alfred stieg über den metallenen Tritt auf den belebten Bahnsteig. Sog tief die Luft ein – schließlich atmete er zum ersten Mal Londoner Luft – und stieß sie schnell wieder aus. Hustete. London, musste Alfred feststellen, roch nicht unbedingt gut, was, wie er der Stadt zugutehalten musste, allerdings auch daran lag, dass er den Dampf der Lokomotive inhaliert hatte und obendrein am Bahnsteig Bauarbeiten stattfanden. Es roch nach Ruß und Kohle, ganz so wie vorhin, als er mit dem Zug durch einen dunklen, dampf- und rauchgefüllten Tunnel gebraust war.
»Sir!« Ein Junge stürzte auf ihn zu. »Sir, ich nehme Ihre Koffer und bringe sie zur Droschke.« Aufgeregt zeigte er hinter sich, und Alfred stellte angenehm überrascht fest, dass zwischen seinem und dem Nachbargleis eine ganze Reihe von Droschken bereitstanden.
Dann musterte er den Burschen. Seine Wangen waren zwar rund, wodurch er auf den ersten Blick wohlgenährt wirkte, doch bei näherem Hinsehen entpuppte sich das als Irrtum: Die Haut unter seiner Kappe war blass und fahl, unter seinen Augen lagen tiefe Schatten, seine Hose war löchrig und seine Schuhe schienen nur noch aus Lederfetzen zu bestehen. Der Knabe dauerte ihn.
»Gut«, sagte Alfred daher und nickte zustimmend. »Aber du nimmst nur den einen Koffer, den großen. Den anderen trage ich selbst.«
»Aber …«, setzte der Knabe an, doch Alfred fiel ihm ins Wort. »Ich bezahle dich trotzdem für beide Koffer. Du machst ein gutes Geschäft, Junge, und solltest nicht lange zögern. Ich glaube, du hast jede Menge Konkurrenz.« Mit dem Kinn deutete er zu den anderen Jungen, die sich auf dem Bahnsteig drängten, offenbar begierig, sich ein paar Penny zu verdienen.
»Gut, Sir, danke Sir«, strahlte der Junge, griff nach dem Koffer und steuerte auf eine der Droschken zu. Der Kutscher, ein brummiger Alter, quälte sich mit unfassbar langsamen Bewegungen von seinem Kutschbock, verlud den Koffer und wollte auch nach dem kleineren greifen, doch wieder wehrte Alfred ab. »Nein«, sagte er. »Den nehme ich mit in die Droschke.«
Mit einem Knurren und einem Achselzucken kletterte der Alte wieder auf seinen Kutschbock. Alfred entlohnte den Knaben großzügig, der sich daraufhin strahlend trollte, dann rief er dem Kutscher die Adresse zu, an der sein Vater ihn eingebucht hatte: dem Hotel Langham in der Regent Street im Stadtteil Marylebone.
Er hatte kaum die Tür geschlossen, als der Kutscher auch schon mit einem Ruck anfuhr und die Droschke in den dichten Stadtverkehr lenkte.
»Und ich habe immer gedacht, in Paris’ Straßen gehe es wild zu«, murmelte Alfred eingeschüchtert, als er aus dem Fenster blickte. Irritierend war vor allem, dass hier alles verkehrt herum war. Aber es herrschte auch ein unglaubliches, scheinbar völliges Durcheinander aus Händlern mit Handkarren, Kutschen und Fußgängern. Schon nach wenigen Minuten war Alfred schweißgebadet und dachte, dass er vielleicht doch besser diese neumodische Erfindung hätte ausprobieren sollen, von der sein Vater Louis-François Cartier ihm in Vorbereitung auf die Reise erzählt hatte: In sechzig Meter Tiefe rauschte eine Bahn durch den Londoner Untergrund. Alfred fand diese Vorstellung allerdings eher beunruhigend und hatte sich deshalb entschieden, den Weg an der Oberfläche zu wählen. Dass es hier mindestens ebenso turbulent zugehen würde, hatte er nicht geahnt. Aber er hätte es ahnen müssen: Der Vater, der die britische Hauptstadt auf seinen Handelsreisen schon sehr häufig besucht hatte, hatte ihm schließlich davon erzählt.
Sie bogen in eine Straße ein, in der der Verkehr zu Alfreds Erleichterung etwas ruhiger dahinfloss. Nun hatte er Muße, sich auf die Stadt und auf die Menschen zu konzentrieren und ließ seine Blicke schweifen. Knaben kamen vorbei, die dem Kofferträger am Bahnhof zum Verwechseln ähnlich sahen, sie waren offenbar mit Botengängen beschäftigt, mit denen sie sich den einen oder anderen Penny zu verdienen hofften. Herren in grauen Anzügen und mit eleganten Bowler-Hüten eilten vorüber, die wohl auf dem Weg in ihre Büros waren. Aus dem Souterrain eines Feinkostgeschäfts, in dessen Schaufenster Reklameschilder für EGG&MILK, R. White’s SodaWater und R. White’s Lemonade warben, linste ein Mann heraus. Bei näherem Hinsehen erkannte Alfred, dass dieser auf einem Tuch vor sich auf der Straße Schuhe präsentierte. Wohl ein Schumacher, der auf einer winzigen Arbeitsfläche halb unter Tage seiner Arbeit nachging.
Je näher sie der Regent Street kamen, desto eleganter wurde die Gegend, und kurz darauf hielt die Droschke vor dem Langham-Hotel, in dem Alfred während seines Aufenthalts residieren würde. Beeindruckt sah er an der mächtigen Sandsteinfassade empor, als auch schon ein Page herbeieilte, um ihm mit dem Gepäck behilflich zu sein. Alfred trat durch die große Flügeltür und bemerkte, dass die Anspannung und die Reisestrapazen langsam von ihm abfielen. Die kühle Eleganz dieses Hotels wirkte augenblicklich entspannend!
Der Concierge begrüßte ihn wie einen lang verloren geglaubten Freund – ohne dabei jedoch seine professionelle Zurückhaltung zu verlieren, was Alfred ausgesprochen beeindruckend fand.
»Willkommen im Langham«, sagte der Mann, er mochte Mitte zwanzig sein, und deutete eine Verbeugung an. »Wir freuen uns immer ganz besonders, einen Gast aus Frankreich bei uns begrüßen zu dürfen.«
»Oh!«, machte Alfred überrascht. »Weshalb das?«
»Nun«, erwiderte der Mann, und sein Strahlen vertiefte sich noch etwas, »vor nicht allzu langer Zeit logierte Ihr Kaiser, Napoleon III., ebenfalls bei uns. Ich hatte die große Ehre, ihm persönlich zu begegnen. Ein äußerst beeindruckender Mann.«
Er ist nicht mehr unser Kaiser, dachte Alfred und wunderte sich. Hatte der junge Mann das etwa nicht mitbekommen? Oder hatte er sich lediglich unpräzise ausgedrückt? Vermutlich eher Letzteres, dachte Alfred, denn es gehörte mit Sicherheit zu den Aufgaben des Concierge, über derartige politische Umbrüche informiert zu sein! Der Concierge schlug indes mit einem Blick auf die Uhr vor: »Wenn es Ihnen recht ist, Sir, lasse ich das Gepäck auf Ihr Zimmer bringen und lade Sie auf einen Nachmittagstee auf Kosten des Hauses ein?«
Alfred bemühte sich, nicht das Gesicht zu verziehen. Ein kräftiger Kaffee wäre ihm lieber gewesen. Doch er wusste von seinem Vater von der Sitte des britischen Nachmittagstees – und dass man gut daran tat, diesen niemals abzulehnen.
Der Concierge fuhr freundlich fort: »Wir sind sehr stolz darauf, dass die Tradition, um fünf Uhr nachmittags Tee, Gurkensandwiches und Gebäck zu servieren, 1865 in unserem Hause begründet wurde.«
»Dann«, sagte Alfred und lächelte ihm zu, »nehme ich dankend an. Ich würde es allerdings bevorzugen, mich zunächst ein wenig frisch zu machen.«
»Selbstverständlich«, stimmte der Concierge zu. »Ich begleite Sie zu unseren hydraulischen Aufzügen. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben: Wir sind das erste Haus in England, das über diese Aufzüge verfügt.«
Alfred nickte beeindruckt. Sein Vater hatte sich nicht lumpen lassen, als er dieses Hotel gebucht hatte. Es verfügte über hundert Toiletten und sechsunddreißig Badezimmer – Louis-François Cartier hatte für seinen Sohn sogar ein Zimmer mit Badezimmer reservieren lassen, was aber vor allem daran lag, dass diese gehobenen Zimmer auch über einen Tresor verfügten – und einen solchen brauchte Alfred für die mitgebrachten Juwelen.
Minuten später ließ der junge Franzose sich glücklich seufzend auf einem ausladenden Ohrensessel nieder, der unter einem großen Fenster stand und einen hervorragenden Blick auf den Regent’s Park eröffnete. Er liebte Parks! Als er noch ein kleiner Junge gewesen war, war seine Mutter Antoinette mit ihm und seiner kleinen Schwester Camille täglich in diese grünen Oasen entflohen, vor allem, als sie noch bei seinen Großeltern im engen Marais gewohnt hatten. Alfred hatte sich oft furchtbar vor all dem Dreck und all dem Gestank in der Stadt geekelt und war seiner Mutter sehr dankbar für die Ausflüge gewesen. Doch inzwischen hatte Paris ein vollkommen anderes Gesicht bekommen: In den letzten Jahren, ach was, in den letzten Jahrzehnten, hatte der Präfekt Haussmann im Auftrag Napoleon III. Paris buchstäblich zerschlagen und neu wieder aufgebaut. Wie schön und prachtvoll die Stadt geworden war! Bis die Preußen gekommen waren und Paris belagert hatten. Und als sie wieder abgezogen waren, hatte ein blutiger Bürgerkrieg zwischen den Royalisten und den Kommunarden seiner Stadt den Rest gegeben.
Alfred wurde das Herz schwer, als er an die zurückliegenden Jahre dachte. Harte und bittere Jahre waren das gewesen, Jahre voller Angst und Schrecken, voller Hunger und Not. Nun, sie waren zum Glück vorüber und Paris erwachte langsam wieder zum Leben – allerdings würde es sicherlich noch eine ganze Weile dauern, bis die Stadt wieder zu ihrer alten Blüte zurückfand. Wenn das überhaupt irgendwann der Fall sein würde! Frankreich war kein Kaiserreich mehr, sondern eine Republik.
Er musste wieder an den Concierge denken, der vorhin voller Stolz davon berichtet hatte, dass der französische Kaiser hier gewesen sei. Doch wenn er noch Kaiser gewesen wäre, dachte Alfred, dann wäre er, Alfred, nun vermutlich nicht hier. Dann würde das Kaiserreich Paris in voller Blüte erstrahlen lassen, die Menschen würden in die Geschäfte strömen und ihnen die Juwelen nur so aus der Hand reißen. So aber war der Adel aus der Stadt geflohen, und ohnehin hatten die Menschen kein Geld mehr für Schmuck und Juwelen, sie kämpften häufig ums nackte Überleben.
Mit einem Seufzen wandte sich Alfred vom Fenster ab. Zum Träumen blieb jetzt keine Zeit. Und dafür, sich in finsteren Gedanken zu verlieren, erst recht nicht. Er hatte viel zu tun. Sein Vater hatte ihn nach London geschickt in der Hoffnung, dass die Menschen hier eher Sinn für Schmuck und Kostbarkeiten hatten als die kriegsgebeutelten Pariser. Er ging zur Kofferablage, nahm das kleinere der beiden Gepäckstücke, legte es aufs Bett und klappte es auf. Entnahm eines der samtenen Schmuckkästchen und öffnete es. Sogleich begann sein Herz höher zu schlagen. Was für ein wundervolles Funkeln! Dieser Zauber, der von den Schmuckstücken ausging, die sein Vater geschaffen hatte, hatte Alfred schon als Junge sehr in seinen Bann gezogen. Und die Faszination war mit jedem Jahr gestiegen, hatte sich gesteigert, je mehr er über die Kostbarkeiten erfuhr und je besser seine Fähigkeiten wurden, einem Stein durch seine Fassung noch mehr Ausdruck zu verleihen.
Der Juwelierssohn entnahm dem Koffer Etui um Etui und stapelte sie sorgsam im Tresor. Dann schloss er ab und ging hinunter, um seinen Fünf-Uhr-Tee einzunehmen.
*
Patron Louis-François Cartier hatte Alfred mit einer ganzen Liste auf die Reise geschickt, in der er genaue Anweisungen erteilte, welche Kunden sein Sohn in London aufsuchen sollte. Für den zweifelsohne wichtigsten Klienten musste Alfred London kurzfristig verlassen und in die West Midlands reisen. Hier residierte Graf Dudley, der als ausgewiesener Edelsteinexperte galt. Es war eine enorme Ehre, dass Dudley den zwar sehr erfolgreichen, aber definitiv nicht in der ersten Liga spielenden Cartier auf sein Anwesen bat, in dem er mit seiner aufsehenerregenden, dreißig Jahre jüngeren Ehefrau residierte.
Als die Kutsche auf den Landsitz zusteuerte, verschlug es Alfred beinah den Atem. Das war ein Palast, dem sogar eine Kirche angegliedert war!
Gleich zwei Diener erwarteten seine Ankunft, man bat ihn ehrerbietig hinein und gleich darauf stand er in der größten Halle, die er je zuvor betreten hatte.
»Sir«, sagte der Diener, der ihn hineinbegleitet hatte. »Bitte folgen Sie mir. Lady Dudley erwartet Sie im Garten.«
Der Garten erwies sich als riesige Anlage, die sich terrassenförmig bis zu einem gigantischen Springbrunnen ergoss und sich von dort aus scheinbar meilenweit in die Unendlichkeit erstreckte.
Alfred war sprachlos vor Begeisterung und geradezu hingerissen, als sein Blick auf die Frau fiel, die auf einem zierlichen Korbstuhl auf der ausladenden Terrasse saß und ein Buch in der Hand hielt. Sie las allerdings nicht darin, sondern hatte es in den Schoß sinken lassen und blickte verträumt in die Ferne.
Alfred starrte sie an. Er hatte von Lady Dudleys spektakulärer Schönheit gehört – aber damit hatte er nicht gerechnet! Diese Frau war nahezu überirdisch schön!
Sie hatte sie nicht kommen hören und fuhr leicht zusammen, als der Diener zu ihr trat und sie leise ansprach. »Mylady?«
»James!«, erkannte sie ihn, und dann fiel ihr Blick auf Alfred. Er war derart intensiv, dass er rasch und verlegen zur Seite blickte, bevor er sich seiner guten Manieren besann, zu ihr eilte und ihr die Hand küsste.
»Mylady!«, er musste sich Mühe geben, nicht zu stammeln. »Es ist mir eine große Freude und Ehre. Und ich soll die besten Wünsche meines Vaters überbringen.«
»Wie überaus freundlich«, erwiderte Lady Dudley. »Bitte übermitteln Sie Ihrem Herrn Vater ebenfalls die besten Wünsche.«
»Das will ich gerne tun«, versicherte Alfred, während Lady Dudley auf den Korbsessel deutete, der dem ihren gegenüberstand. »Bitte«, sagte sie. »Nehmen Sie Platz. Oder nein, lassen Sie uns nach dort hinten gehen«, sie zeigte auf einen großen Tisch, in dessen Mitte ein riesiges Blumenbouquet thronte. »Dort können Sie Ihre Kollektion besser präsentieren.«
Sie erhob sich und schwebte – anders ließ es sich nicht bezeichnen – in Richtung des Tisches davon. Ein Diener stürzte sogleich herbei, um ihr den Stuhl zurechtzurücken.
Als Alfred und sie einander gegenübersaßen, wandte sie sich zu dem Diener um. »Servieren Sie uns den Fünf-Uhr-Tee.«
Schon wieder der Fünf-Uhr-Tee!, dachte Alfred, der allerdings zugeben musste, dass ihm dieser im Hotel ausnehmend gut geschmeckt hatte.
»Ein reizendes Anwesen haben Sie hier«, bemerkte Alfred, um die Konversation wieder aufzunehmen.
»O ja, es ist ganz nett«, erwiderte Lady Dudley. »Das ursprüngliche Anwesen hat John Nash errichtet, der auch die Regent Street anlegen ließ. Die Familie meines Mannes hat es noch etwas erweitern und umbauen lassen.«
»Wirklich beeindruckend«, bekräftigte Alfred, als auch schon die Diener herbeischwebten. Mit riesigen Tabletts und Etageren aus purem Silber servierten sie einen Fünf-Uhr-Tee, der jenem, den Alfred in seinem Hotel eingenommen hatte, bei Weitem übertraf.
Lady Dudley griff nach einem Gurkensandwich und aß ganz undamenhaft und mit großem Appetit, was Alfred hinreißend fand.
»Bitte«, sagte Lady Dudley zwischen zwei Bissen und deutete auf die Sandwiches. »Die müssen Sie probieren. So etwas Gutes haben Sie noch nicht gegessen.«
Alfred hatte bisher zwar keinen Gefallen an der englischen Küche gefunden, griff aber dennoch zu und biss vorsichtig in das Gurkensandwich. Er war überrascht. »Es ist wirklich ganz hervorragend«, bestätigte er.
Lady Dudley strahlte. »Nicht wahr? Warten Sie erst einmal ab, bis Sie die Scones mit Clotted Cream und Marmelade probiert haben.«
Sie war hinreißend, dachte Alfred. Lady Dudley war mit jedem Zoll eine Dame. Aber zugleich war sie erfrischend natürlich, als stecke in ihr noch das liebenswerte kleine Mädchen, das sie einmal gewesen war. Sie hatte ihr Mahl beendet, sah ihn mit leuchtenden Augen an und bat ihn, ihr nun den mitgebrachten Schmuck zu präsentieren.
Flüchtig fragte sich Alfred, weshalb ihr Gatte bei dem Termin nicht zugegen war, immerhin war er es, der als ausgewiesener Edelsteinexperte galt, doch er wagte nicht zu fragen. Vermutlich würde Lord Dudley später zu ihnen stoßen.
»Sehr gerne, Mylady«, antwortete er seiner außergewöhnlichen Klientin und begann, den Schmuck auf dem Tisch auszubreiten. Funkelnde Diademe, betörende Ohrgehänge und ganze Kollektionen aus Saphiren, Smaragden und Rubinen. Glücklich betrachtete Alfred die Kunstwerke. Jedes Mal, wenn er ein Schmuckstück sah, das aus ihrem Hause stammte, überkam ihn ein nahezu berauschendes Gefühl der Begeisterung, und er hätte jubeln mögen vor Glück. Vor allem die Steine waren es, die wieder und wieder dieses Gefühl in ihm hervorriefen. Diese Tiefe, dieses Funkeln, das erst durch den Schliff richtig zum Vorschein gelangte. Und dann die zarten Fassungen, mit denen die Goldschmiede es vermochten, die Steine in den für sie passenden Rahmen zu bringen …
»Wie Sie sehen«, richtete Alfred nun sein Wort an Lady Dudley, »habe ich mir erlaubt, Ihnen eine große Auswahl unserer aktuellen Kollektion mitzubringen.«
Lady Dudley hatte sich erhoben und betrachtete die Schmuckstücke aufmerksam, jedoch ohne etwas zu sagen. Alfred wurde nervös. Hoffentlich würde der Schmuck nicht in den Augen dieser Dame durchfallen. Das wäre eine Katastrophe für ihren Ruf, denn Lady Dudleys Wort war meinungsbildend. Wenn ihr Cartiers Schmuck nicht zusagte, dann würden sie in London keinen Fuß auf den Boden bekommen und schlimmer noch: Es würde sich bis nach Paris herumsprechen.
»Sie ist zauberhaft«, sagte Lady Dudley da an seiner Seite.
»Wie?« Alfred fuhr herum und starrte sie an. Im nächsten Moment hatte er sich jedoch wieder im Griff. »Verzeihen Sie, Mylady, ich war in Gedanken.«
Sie schüttelte tadelnd den Kopf, aber ein Lächeln begleitete diese Geste.
»Ich sagte, dass Ihre Kollektion ganz zauberhaft ist. Und dieses Smaragd-Collier ist außerordentlich.« Sie deutete auf den Tisch. »Aber ob es mich kleidet?«
»Es gibt sicherlich nichts, was Sie nicht kleidet, Mylady«, beeilte sich Alfred zu versichern, »aber dieses Collier dürfte Ihnen besonders gut zu Gesicht stehen. Es betont, wenn ich das so sagen darf, die Farbe Ihrer Augen.«
Lady Dudley nickte. »Das war auch mein Gedanke«, bekräftigte sie. »Ich müsste es anlegen.«
Sie wandte den Kopf, sah ihm direkt in die Augen und fragte: »Wären Sie so freundlich?«
Alfred schluckte. Ihre Frage war absolut ungehörig, mehr als das, sie war skandalös! Aber er konnte ihr diesen Wunsch, vielmehr war es eine Aufforderung, sicherlich auch nicht abschlagen, ohne extrem unhöflich zu sein. Seine Gedanken überschlugen sich. Was, wenn die starr geradeaus blickenden Diener Lady Dudleys Gatten Bericht erstatteten? Möglicherweise wäre Lord Dudley derart empört, dass er nicht nur keine Juwelen mehr bei Cartier kaufen, sondern sie auch noch überall schlechtmachen würde, und …
»Sir?« Lady Dudley klang irritiert. »Werden Sie mir das Collier nun anlegen, oder ist Ihnen die Vorstellung, meinen Hals zu berühren, derart zuwider?«
»Na… natürlich nicht«, brachte Alfred hervor. »Bitte entschuldigen Sie, Mylady, ich überlegte nur … die Schicklichkeit …«
»Ach, pfeifen Sie auf die Schicklichkeit«, rief Lady Dudley und sandte Alfred erneut einen intensiven Blick.
Dem er auswich, während er ihr nun mit zitternden Fingern das Collier anlegte.
Teil 1
1873–1874
Kapitel 1
Herbst 1873
»Alfred! Mein Junge! Da bist du ja wieder! Und ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz ich auf dich bin.«
Louis-François Cartier zog seinen Sohn im Ausstellungsraum seines Juweliergeschäftes am Boulevard des Italiens in seine Arme und klopfte ihm kräftig auf den Rücken. Alfred, der gerade erst aus London zurückgekehrt war und vom Bahnhof aus eine Kutsche genommen hatte, war etwas verlegen: Derart öffentliche Liebesbekundungen waren bei den Cartiers nicht an der Tagesordnung. Doch der alte Cartier konnte sich vor lauter Begeisterung gar nicht halten.
»Gestern erreichte mich ein Brief von Lord Dudley«, teilte er seinem Sohn mit. »Er hat regelrecht von dir und deinen Kenntnissen geschwärmt und mir versichert, du hättest ganz England in Aufruhr versetzt. Kein Wunder, du hast wirklich ein außergewöhnliches Gespür für Edelsteine. Seine Gemahlin soll wohl auch mehr als begeistert von dir gewesen sein und erklärt haben, dass sie dich überallhin weiterempfehlen wird.«
Bei diesen Worten seines Vaters errötete Alfred etwas. Er war noch einige Tage bei den Dudleys zu Gast gewesen, und auch wenn Lady Dudley nie etwas Verwerfliches getan hatte, so hatte sie ihm mit Blicken und Worten doch mehr als deutlich gemacht, dass er ihr gefiel – was Alfred angesichts ihres dreißig Jahre älteren Ehemanns nur zu verständlich fand. Natürlich war es undenkbar gewesen, sich in irgendeiner Weise näherzukommen, doch je mehr Zeit sie miteinander verbracht hatten, desto mehr hatte Alfred festgestellt, dass sie den gleichen Humor teilten, sich für die gleichen Dinge interessierten – und als sie sich schließlich schweren Herzens voneinander verabschiedet hatten, da hatte Lady Dudley gesagt, sie hoffe, dass sie Freunde bleiben, einander schreiben und sich eines Tages wiedersehen würden.
»Ich höre, Lord und Lady Dudley haben dich sogar mit in den Hurlingham Club zu einem Ballonrennen genommen«, sagte Louis-François da in seine Gedanken hinein.
»Richtig, Vater«, bestätigte Alfred. »Durch die freundlichen Empfehlungen der Dudleys erhielt ich unzählige Einladungen – das ist auch der Grund, weshalb ich all unseren Schmuck bereits verkauft habe und früher zurückgekehrt bin als geplant.«
»Ich bin sehr stolz auf dich«, wiederholte Louis-François. »Gehen wir einen Moment in mein Kontor. Wir haben Wichtiges zu besprechen.«
»Nun lass ihn doch erst einmal ankommen«, protestierte da eine Stimme in Alfreds Rücken. Er wandte sich um. »Camille!« Freudestrahlend schloss er seine Schwester in die Arme. »Ich habe dich so vermisst.«
»Ohne dich war es hier auch ganz schön einsam«, beteuerte Camille. »Ich musste ständig ganz allein auf unserer Empore sitzen und trübsinnig vor mich hinstarren.«
Sie deutete nach oben, wo sich, direkt über dem Eingang, ein kleiner Innenbalkon befand, der durch ein winziges, rundes Fenster einen hervorragenden Blick auf den belebten Boulevard und gleichermaßen, zur anderen Seite hin, die beste Aussicht auf den Ausstellungsraum bot. Von jeher hatten sich die Geschwister häufig auf die Empore zurückgezogen und sich dort ihre Sorgen und Geheimnisse anvertraut. Vielleicht, dachte Alfred, würde er seiner Schwester dort oben auch seine Schwärmerei für Lady Dudley gestehen. Laut sagte er lachend: »Als ob du auch nur eine Sekunde Zeit hättest, einsam auf unserer Empore zu hocken und vor dich hinzustarren.«
»Du hast recht«, gestand sie. »Ich hatte wirklich keine Sekunde Zeit.«
Camille war im Januar 1872 zum zweiten Mal Mutter geworden, und sie kümmerte sich um ihre kleine Tochter Jeanne ebenso aufopferunsgvoll wie um die fünfjährige Marie. Sie war aber auch eine nicht minder leidenschaftliche Künstlerin: Camille hatte von ihrer Mutter Antoniette die große Leidenschaft und Begabung für das Zeichnen geerbt. Nachdem sich ihre Mutter nach und nach aus dem Unternehmen zurückgezogen hatte, war es nun Camille, die die Zeichnungen für die Schmuckkollektionen im Hause Cartier zu Papier brachte. Kurz vor und kurz nach der Niederkunft hatte sie natürlich pausiert, aber bereits drei Monate nach Jeannes Geburt war die fröhliche und lebenslustige junge Frau, die vor Ideen stets nur so sprudelte, wieder in ihr Atelier zurückgekehrt. Das ging auch deshalb so gut, weil sich sowohl das Atelier als auch die Wohnung der Familie in einem Haus befand: Camille lebte mit ihrem Ehemann, dem zwölf Jahre älteren Prosper, der im Unternehmen für die Buchhaltung, die Schaufenstergestaltung und die Werbung verantwortlich war, und den beiden gemeinsamen Kindern in der Wohnung über dem Ausstellungsraum. An den Vormittagen wurden die kleinen Mädchen entweder von ihrem Kindermädchen Louise betreut, oder Camille nahm sie mit ins Atelier.
»Wo wir gerade von Zeit sprechen«, ließ sich da wieder Patriarch Louis-François vernehmen, »die Arbeiter werden bald in die Mittagspause gehen, und ich denke, auch für uns wird es Zeit. Unsere kleine Unterredung im Kontor müssen wir wohl aufschieben oder auf das Mittagessen verschieben, das jetzt gleich serviert wird.«
»Da bin ich ja genau richtig gekommen«, freute sich Alfred. Sein Vater hob scherzhaft den Finger. »Ich unterstelle, du hast die Zugverbindungen mit Absicht so gelegt, dass du pünktlich zum Mittagessen eintriffst.«
Alfred lachte. »Ich gestehe«, sagte er. »Denn so schön England auch sein mag: An das Essen dort kann ich mich nicht gewöhnen.«
*
Am mittäglichen Familienessen nahmen stets Louis-François Cartier und seine Gattin Antoinette, Camille und Prosper sowie Alfred teil. Die Kinder der Lecomtes speisten mit dem Mädchen nebenan.
Nachdem auch Antoinette und Prosper Alfred begeistert begrüßt und sie anschließend ihr Mahl genossen hatten, setzte Louis-François beim Nachtisch eine ernste und feierliche Miene auf und sah seinen Sohn an. »Alfred«, sagte er. »Deine Reise nach London war deine Feuerprobe, die du mit Bravour bestanden hast. Es ist nun an der Zeit, das Unternehmen an dich zu übergeben.«
Diese Ankündigung war für keinen am Tisch eine Überraschung. Es hatte schon immer festgestanden, dass Alfred irgendwann in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Dass Louis-François den Zeitpunkt nun, wo der Zweiunddreißigjährige aus London zurückgekehrt war, für ideal hielt, lag im Grunde auf der Hand.
Daher nickte Alfred und sagte: »Ich danke dir sehr für dein Vertrauen, Vater. Und ich versichere dir: Ich werde dich nicht enttäuschen.«
»Davon gehe ich aus«, erwiderte Louis-François. »Dann schlage ich vor, wir gehen gleich nach dem Essen in mein Kontor, um über den Kaufpreis zu beraten.«
Sie hatten sich schon lange darauf geeinigt, dass Alfred das Geschäft nicht umsonst erhalten würde. Und er fand das vollkommen richtig, schließlich hatte sein Vater sich alles selbst aufbauen müssen und Alfred teilte dessen Überzeugung, dass man es nur durch Fleiß und unermüdliche Anstrengung zu etwas bringen konnte. Es gab so viele Unternehmen, die in der zweiten oder spätestens in der dritten Generation kaputtgingen, weil ihre Erben nicht gelernt hatten, wirklich zu arbeiten. Und Alfred wollte das Unternehmen auch nicht einfach nur geschenkt bekommen. Er wollte beweisen, dass er in der Lage war, hart zu arbeiten, und er wollte beweisen, dass er mit Geld umgehen und sich für seine Ziele einsetzen konnte. Deshalb hatte er in den letzten Jahren jeden Sous gespart. Und jetzt eine ordentliche Summe beisammen, um seinem Vater das Unternehmen abzukaufen. Das war für ihn auch eine Frage der Ehre: Schließlich wollte er, dass sein Vater, der sein Lebtag lang hart gearbeitet hatte, es sich in seinem letzten Lebensabschnitt richtig gut gehen lassen konnte. Und das wäre nicht möglich, wenn er ihm, Alfred, sein ganzes Vermögen schenken würde!
Vater und Sohn Cartier hatten sich nach dem Mittagessen direkt in Louis-François’ Kontor zurückgezogen, das Alfred nach der Geschäftsübergabe übernehmen würde. Alfred spürte sein Herz hart gegen seine Brust schlagen. Endlich war es soweit! Endlich kam er zum Zug! Zwar würde er sich in den nächsten Jahren nicht allzu viele Neuerungen erlauben können – einfach deshalb, weil er streng haushalten musste und auch aufgrund der Ratenzahlungen für seinen Vater kein neues Personal einstellen konnte, aber es wäre sein eigenes Geschäft. Wie gut sich das anfühlte! Gleichzeitig spürte er enorme Verantwortung: Er würde das Familienerbe übernehmen!
Vater und Sohn hatten Platz genommen, auch Prosper, der im Hause Cartier für Zahlen und Verträge zuständig war, wohnte dem Gespräch bei.
Sie einigten sich auf eine Kaufsumme von hundertdreiundvierzigtausend Francs. Das war eine Stange Geld, aber Alfred war wild entschlossen, die Summe zu bezahlen – durch einen Kredit bei der Bank und durch die Rücklagen, die er in den letzten zehn Jahren angespart hatte. Sein Vater ließ ihm Zeit: Laut Vertrag war der Betrag in zehn Monatsraten zu entrichten. Und außerdem: In der Kaufsumme inbegriffen war auch der gesamte Schmuck! Ein Ausstellungsraum voller Ringe, Ohrringe, Colliers und natürlich auch silbernen Teeservicen wie Kaiserin Eugénie seinerzeit eines erworben hatte. Den Ausgaben stand also jede Menge wertvolle Ware gegenüber, die in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich veräußert werden würde. Im Vertrag gliederten die Cartiers die einzelnen Bereiche des Unternehmens genau auf: Der Schmuck machte zwei Drittel des Kaufpreises aus, für die Einrichtung des Geschäftes, den Kundenstamm und das Unternehmen selbst inklusive des Königlichen Patents, das Louis-François von Prinzessin Mathilde verliehen worden war, berechnete er seinem Sohn lediglich fünfzigtausend Francs.
»Zwei Bedingungen habe ich aber noch«, sagte der Patriarch, nachdem sie sich auf die Kaufsumme geeinigt und diese aufgeschlüsselt hatten.
»Ja?«
»Du weißt ja: Vor vielen Jahren ist uns einmal fast die Werkstatt abgebrannt, weil im darunterliegenden Restaurant eine Gasleitung explodiert war.«
»Ich weiß«, erwiderte Alfred. Sein Vater sprach nicht gern über dieses Thema, aber seine Mutter hatte ihre Kinder schon früh aufgeklärt, weshalb ihr Vater so schreckliche Angst vor Feuer hatte. Er wurde stets ganz nervös, wenn jemand eine Kerze anzündete, er arbeitete in der Werkstatt nicht gern an der Flamme und jeden Abend ging er zweimal durchs Haus, um sich zu vergewissern, dass auch kein offenes Feuer übersehen worden war. Kein Wunder: Louis-François Cartier hatte damals zusehen müssen, wie der Boden vor ihm regelrecht in sich zusammenstürzte.
»Und deshalb«, sagte Louis-François nun, »möchte ich vertraglich zugesichert haben, dass du alle notwendigen Versicherungen gegen Feuerschäden aufrechterhältst.«
»Natürlich«, sagte Alfred sofort. »Das hätte ich ohnehin getan, auch ohne einen entsprechenden Passus im Vertrag. Aber wir können das sehr gerne aufnehmen.«
Louis-François nickte, und die Erleichterung war ihm deutlich anzumerken. Alfred dachte gerührt, wie schwer es seinem Vater immer noch fiel, dieses Thema überhaupt anzusprechen.
»Und da wäre noch etwas, Alfred«, sagte Louis-François nun. »Noch etwas, was mir sehr wichtig ist und was ich ebenfalls gern in unserem Vertrag festhalten würde.«
»Was denn?«, fragte Alfred gespannt.
Louis-François beugte sich über die mächtige Tischplatte nach vorne, wohl, um seinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen, und sagte: »Das Geschäft darf nicht verkauft oder verpachtet werden.«
»Natürlich nicht, Vater!« rief Alfred verblüfft. »Das Geschäft ist mein Leben. Dein Vermächtnis. Wieso sollte ich es verkaufen oder verpachten, wo ich doch die letzten zehn Jahre jeden Sous gespart habe, um es zu bekommen?«
Louis-François hob beschwichtigend die Hand.
»Ich weiß, mein Sohn, ich weiß«, sagte er. »Aber aus meiner eigenen Geschichte weiß ich, dass es immer mal schwere Zeiten gibt. Ich war einmal kurz davor, mein Geschäft wieder zu schließen, nur ein Jahr, nachdem ich es übernommen hatte. Aber in solchen Zeiten muss man durchhalten, Alfred. Ich hatte auch jemanden, der mir das gesagt hat, sonst gäbe es vielleicht das Unternehmen nicht mehr. Und deshalb«, sagte er, »deshalb möchte ich, dass der Umstand, dass das Geschäft nicht verkauft oder verpachtet werden darf, in den Vertrag aufgenommen wird.«
Alfred schluckte. Vertraute der Vater ihm etwa nicht? Verletzt sah er ihn an, und Louis-François schien seine Gedanken zu erraten. Beschwichtigend legte er eine Hand auf die seines Sohnes.
»Du musst hier die Ebenen trennen, Alfred«, sagte er. »Ich als dein Vater vertraue dir vollkommen. Ich weiß, dass du das Geschäft niemals verkaufen würdest. Aber jetzt, in diesem Moment, sind wir nicht Vater und Sohn, sondern wir sind Geschäftsleute. Ein Familienunternehmen funktioniert nur, wenn man diese Ebenen klar trennt.«
Alfred nickte langsam. »Ich verstehe dich, Vater«, sagte er. »Wirklich. Und du hast recht. Ich habe nichts dagegen, wenn wir diese Klausel in den Vertrag aufnehmen.«
»Wenn ich dazu auch noch eine Bemerkung machen dürfte«, ließ sich Prosper vernehmen, der die meiste Zeit über schweigend neben Alfred gesessen hatte.
Die beiden Männer wandten sich ihm zu. »Bitte, Prosper«, sagte Louis-François. »Du weißt, wie viel wir auf deine Meinung geben«, ermutigte er seinen Schwiegersohn, und auch Alfred nickte auffordernd.
»Ich bin kein Advokat und daher weiß ich nicht, ob ich vielleicht falschliege.« Er zögerte.
»Prosper«, kam es von Alfred, »du magst kein Advokat sein, aber du kennst dich mit derlei Dingen doch am besten aus. Bitte teile uns deine Gedanken mit.«
»Nun«, sagte Prosper, »ich bin mir nicht ganz sicher, ob ein solcher Passus rechtsgültig wäre.«
»Warum denn nicht?«, begehrte Louis-François auf. »Ich kann doch die Bedingungen für den Verkauf meines Geschäfts selbst bestimmen?«
»Leider nicht«, korrigierte Prosper mutig. »Das gilt nur innerhalb des geltenden Gesetzes.«
Louis-François’ Kopf lief rot an. »Ich habe mich noch nie außerhalb des Gesetzes bewegt!«, schnaubte er.
Alfred lächelte seinem Schwager ermutigend zu. Doch er wusste, dass dieser eigentlich keinen Beistand brauchte. Prosper schätzte seinen Schwiegervater sehr, und er war ein ausgesprochen selbstbewusster Mann, den auch ein erzürnter Louis-François Cartier nicht so leicht aus der Fassung bringen konnte.
»Und damit du das auch jetzt nicht tust, bringe ich meinen Einwand«, sagte Prosper ruhig. »Zumal ich vollkommen verstehen kann, dass man da nicht von selbst drauf kommt. Es ist ja dein Eigentum, mit dem du tun und lassen kannst, was du willst.«
»Eben«, schnaubte Louis-François. »Was also ist das Problem?«
»Nach meinem Ermessen kannst du so lange über dein Eigentum bestimmen, wie es dein Eigentum ist. Und das ist so lange der Fall, bis die Summe abbezahlt ist. Danach ist es das Eigentum deines Sohnes, und du hast kein Recht mehr, hier Einschränkungen zu machen.«
»Ich muss zugeben, das leuchtet ein«, murmelte Louis-François. »Was schlägst du also vor?«
»Eine Klausel, dass das Geschäft so lange nicht verpachtet oder veräußert werden darf, bis die ganze Summe abbezahlt ist.«
»Ja«, stimmte Louis-François sofort zu, offenbar erleichtert, dass sich hier so schnell eine Lösung auftat. »Ja, das ist ein annehmbarer Vorschlag.« Mit einem spitzbübischen Lächeln fügte er hinzu: »Ich schlage vor, dass du mir die ganze Kaufsumme dann einfach nie gibst, dann habe ich immer ein Mitspracherecht. Sagen wir …«, er überlegte, »sagen wir, zehn Francs bleibst du mir dein Lebtag schuldig?«
»Einverstanden«, lachte Alfred, der mit einem Mal ein unglaubliches Glücksgefühl in sich aufsteigen fühlte. Bald würde das Unternehmen wirklich ganz ihm gehören! Er wandte sich an Prosper. »Darf ich dich in ein Gasthaus einladen, werter Schwager? Ich bin jetzt um zehn Francs reicher.«
»Das ist ein Wort«, freute sich Prosper. »Gehen wir.«
Kapitel 2
»Vater«, flüsterte Camille, »darf ich fragen, weshalb du die arme Alice Griffeuille die ganze Zeit so anstarrst?«
Die Familie Cartier war zu einem Diner bei Juwelier Théodule Bourdier geladen, an dem auch dessen Schwägerin Alice Griffeuille teilnahm. Bourdier war sehr erfolgreich in seinem Fach und hatte Cartier, obgleich er deutlich später sein Geschäft eröffnet hatte, längst überflügelt, was Louis-François stets ein wenig wurmte, wenn er ihm begegnete. Doch heute hatte er andere Sorgen. Besser gesagt: Er hatte eine Idee. Wenn er Bourdier seinen Erfolg auch etwas neidete, so ließ es sich nicht von der Hand weisen, dass die Juweliere in Paris einander nach wie vor unterstützten. Und diese Unterstützung könnte er sich auch noch auf andere Weise zueigen machen.
»Vater!«, drängte Camille. »Ich möchte wissen, weshalb du die arme Alice Griffeuille so anstarrst.«
»Tue ich das?«, gab sich Louis-François überrascht.
»Ja, das tust du«, flüsterte Camille streng. »Und ich glaube auch zu wissen, warum du das tust.«
Louis-François nahm einen Schluck Wein und grinste sein spitzbübisches Grinsen. »So?«, raunte er seiner Tochter zu. »Und warum tue ich das? Deiner Meinung nach?«
»Weil du der Ansicht bist, dass Alfred unter die Haube muss. Und weil du dir überlegt hast, dass es nicht schlecht wäre, mit dem großen Juwelier Bourdier verschwägert zu sein.«
»Ich gestehe es frank und frei.« Gut gelaunt schnitt sich Louis-François ein Stück Fleisch ab und schob es sich in den Mund. Als er heruntergeschluckt hatte, fuhr er fort: »Eine bessere Partie kann man sich nicht wünschen. Zumal die Witwe Griffeuille ihre Töchter mit großzügigen Mitgiften ausstattet, wie man hört. Und eine solche Finanzspritze könnte Alfred zum Start gut gebrauchen.«
»Vater!«, schalt Camille. »Du weißt, wie wenig ich von der Unsitte halte, Paare aus finanziellen und gesellschaftlichen Gründen zu verheiraten.«
»Und du weißt, dass ich deine Meinung im Grunde teile«, brummte der alte Cartier friedfertig. »Schließlich habe ich deine Mutter auch aus Liebe geheiratet.« Er warf seiner Gattin, die schräg gegenübersaß und in ein Gespräch vertieft war, einen zärtlichen Blick zu. Sie schien ihn zu spüren, sah auf und erwiderte ihn. Wieder einmal dachte Camille, wie schön es war zu sehen, wie gut ihre Eltern sich verstanden. »Siehst du?«, nahm sie den Gesprächsfaden wieder auf. »Du und Mutter, ihr seid so glücklich. Stell dir vor, dein Vater hätte dich mit einer Frau verheiratet, die du nicht liebst. Der Mitgift wegen.«
»Eine schreckliche Vorstellung!«, pflichtete Louis-François seiner Tochter bei. »Und du wirst wissen, dass ich so nicht bin und auch von euch keine Heirat gegen euren Willen erwarte. Schließlich hast du deinen Prosper ja ebenfalls aus Liebe geheiratet.«
»Ja«, sagte Camille und warf nun ihrerseits ihrem Ehegatten, der neben seiner Schwiegermutter auf der anderen Tischseite saß und mit einer jungen Frau plauderte, die Camille nicht kannte, einen liebevollen Blick zu. »Umso weniger verstehe ich, warum du den armen Alfred mit Alice Griffeuille verkuppeln willst.«
Sie betrachtete die ein wenig scheu wirkende Frau, die ihr gegenübersaß, unter gesenkten Lidern. Alice Griffeuille war durch und durch unauffällig, aber, wenn man sie näher betrachtete, hübsch anzusehen. Ihr ovales Gesicht wies zwar keine klassisch-schönen Züge auf, aber Alice wirkte durchaus freundlich – und traurig. Camille vermutete, dass sie noch immer um ihren verstorbenen Vater trauerte.
Die junge Frau schien ihren Blick zu bemerken und hob den Kopf.
Camille lächelte ihr zu. Alice lächelte zurück.
Als die Gäste sich nach dem Dinner in lockeren Grüppchen bei Cocktails im prachtvollen Salon von Théodule Boudier zusammenfanden, beobachtete Camille, dass sich ihr Vater der Witwe Griffeuille näherte und mit ihr ein Gespräch begann. Den Mienen der beiden zufolge hatte die Unterhaltung einen bedeutsamen Inhalt. Camille war empört. Schmiedete Louis-François mit Alices Mutter etwa tatsächlich bereits Heiratspläne? Ohne zuvor mit seinem Sohn gesprochen zu haben? Dieser jedenfalls schien Alices Anwesenheit nicht einmal bemerkt zu haben. Er stand in einer Ecke, hielt ein Cocktailglas in der Hand und unterhielt sich angeregt mit einem jungen Herrn, den Camille nicht kannte, während Alice mal mit diesem, mal mit jenem plauderte und dabei den Eindruck machte, als sei jedes Gespräch für sie eine furchtbare Qual. Immer wieder schielte sie haltsuchend nach ihrer Mutter oder zu ihrer älteren Schwester Marie, der Gastgeberin, die sie aber beide nicht beachteten. Kurz entschlossen trat Camille auf die junge Frau zu, als diese für einen Augenblick allein war.
»Mademoiselle«, sagte sie. »Würden Sie mich retten?«
Alice blickte so verdutzt drein, dass Camille sich ein Lachen verkneifen musste. »Ich? Sie retten?«
»Wissen Sie«, log Camille, »ich bin von Natur aus etwas schüchtern. Es fällt mir schwer, mich mit Menschen zu unterhalten, die ich nicht kenne.«
»O ja!«, Alices Miene hellte sich auf. »Das kenne ich nur zu gut. Ich weiß immer nicht so recht, was ich sagen soll.«
»Ganz genau so ergeht es mir auch«, sagte Camille lächelnd. »Aber wenn wir beide uns nun miteinander unterhalten, dann kommt kein anderer auf die Idee, uns anzusprechen, zumindest hoffe ich das.«
Alice kicherte leise, ein Geräusch, das Camille überraschte, weil es so gar nicht zu dieser ernsten und unsicheren jungen Frau passen wollte. Verschwörerisch blinzelte sie Camille zu. »Ich werde den ganzen Abend nicht mehr von Ihrer Seite weichen, Madame.«
Camille hatte tatsächlich den ganzen Abend über in Gesellschaft von Alice Griffeuille verbracht, und je länger sie sich miteinander unterhielten, desto mehr war die junge Frau aufgetaut, und Camille hatte festgestellt, was für ein charmantes und interessantes Wesen sich hinter der schüchternen Fassade verbarg. Aus dem Augenwinkel hatte sie aber auch beobachtet, dass Louis-François sich fast den ganzen Abend über mit der Witwe Griffeuille unterhalten hatte, und als sie spätabends in der Kutsche saßen, die sie nach Hause bringen sollte, warf sie ihrem Vater strafend-fragende Blicke zu, denen dieser jedoch gekonnt auswich. Da ihre Eltern sie zu Hause absetzten und anschließend weiterfuhren, hatte sie keine Gelegenheit mehr, nachzufragen. Aber als Louis-François am nächsten Morgen das Geschäft betrat – noch hatte er ja nicht offiziell an Alfred übergeben, daher kam er nach wie vor jeden Tag und machte seine Runde durch den Ausstellungsraum und die Werkstatt, bevor er ins Kontor ging – suchte sie ihn in seinem Büro auf. Klopfte, trat ein und setzte sich.
Verwundert und auch etwas unwillig sah Louis-François sie an. Er mochte keine unangekündigten Besuche, doch es hatte stets die Regel gegolten, dass er für seine Kinder immer zu sprechen war, wenn die etwas auf dem Herzen hatten. »Ja?«, fragte er, »wie kann ich dir helfen, mein Kind?«
»Du weißt genau, warum ich hier bin«, sagte Camille bestimmt. »Du hast gestern Abend lange mit der Witwe Griffeuille gesprochen. Hast du deinen Sohn verschachert?«
Das Gesicht ihres Vaters lief feuerrot an vor Zorn. Es gab wenig, was Louis-François Wut mehr entfachte, als wenn er sich respektlos behandelt fühlte. Da Camille in der Regel immer sehr direkt sagte, was sie dachte und mindestens ebenso stur war wie ihr Vater, waren die beiden schon oft aneinandergeraten. Zumal Camille, wenn sie sich ärgerte, ihre Worte nicht gerade mit Bedacht wählte.